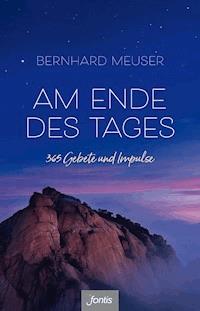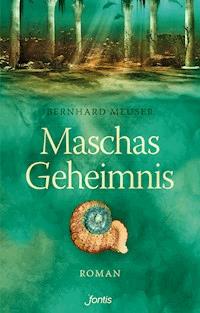Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Autor schreibt: "Beten, sagen viele Menschen, ist das Letzte. Sie haben recht: Beten ist das letzte Abenteuer, die letzte Reise in das unentdeckte Land – unser eigenes Herz. Beten ist etwas zutiefst Natürliches, Befreiendes, Sinnstiftendes, ein tiefes seelisches Einschwingen mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält und wofür wir den Namen Gottes haben." Dieses Buch ist gefährlich. Mit seiner lebendigen und authentischen Sprache schlägt es den Leser in den Bann. Man merkt, dass hier einer ernst macht mit dem Glauben. Fröhlichen Ernst. Man kann diesen Autor nicht beobachten. Man muss ihm folgen. Und das hat Folgen, die man erst wahrnimmt, wenn man sich auf den Knien wiederfindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beten. – Eine Sehnsucht
Bernhard Meuser
Beten.
– Eine Sehnsucht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Die Bibelstellen wurden in der Regel folgender Übersetzung entnommen:
«Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift» © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart.
© 2015 Fontis – Brunnen Basel Umschlag: spoon design, Olaf Johannson, Langgöns Umschlagfoto: Victor Tongdee/Shutterstock.com E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-730-2
Inhalt
Einführung
1 Das Vertrackte an der Frömmigkeit
Sonnenaufgang in den Abruzzen
2 Kleine, subjektive Feldforschung
Einmal um die halbe Welt
3 Über die Quellen des Betens
Schreie der Not und Rufe der Sehnsucht
4 Über Sprache und universale Verständigung
Eine Geigerin, die vom Mond träumt
5 Von den Fussspuren Jesu
Er ist Gott und sieht mir ähnlich
6 Von der Geistesgegenwart
Die Abgründe werden bewohnbar sein
7 Über die Vielfalt der Gebete
Das Gestammel des heiligen Narren
8 Über Beten und Hingabe
Der Tod der schönen Agata Mroz
9 Das Netzwerk der Beziehung
Sein Leben in meinem Leben
10 Über Weltveränderung
Die Botschaft der Chipstüten am Strand
11 Über psychische und sonstige Sanierung
Sorge dich nicht, bete!
12 Von der Anbetung
Kein Luxus, sondern Priorität
Deine Sehnsucht ist dein Gebet … Wenn du nicht aufhören willst zu beten, dann höre nicht auf dich zu sehnen. Ist deine Sehnsucht beständig? Dann ist auch der Schrei deines Gebets beständig. Du wirst nur dann schweigen,
Einführung
Nicht einmal ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer starb ein Mann, den jeder in der DDR kannte: Horst Sindermann. Kurz vor seinem Tod legte das ehemalige SEDPolitbüromitglied ein merkwürdiges Bekenntnis zu den eigentlichen Ursachen der geschichtlichen Wende zwischen Ost und West ab. Sindermann sagte: »Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete.«
Viele halten Beten für eine die Härten des Lebens abfedernde Maßnahme. Sie glauben – wenn sie denn Gebeten irgendeinen Nutzen zuschreiben – an die Kraft der Selbsterschütterung, der Selbstberuhigung, der Selbstmotivation. Ich halte das für Kitsch. Mich fröstelt, wenn mir Leute etwas von Autosuggestion durch Gebet erzählen und fließende Übergänge zwischen Positiv-Denken und Gebet herstellen. Ich will das Leben nackt haben, ungeschminkt, so, wie es eben ist. Auf süßliche Verpackung und erbaulichen Selbstbetrug kann ich verzichten. Wäre Religion das und dienten Gebete nur dazu, die Wirklichkeit zu verstellen, uns über sie hinwegzulügen – ich würde betende Menschen mit Ironie überziehen, würde Religion bekämpfen und wäre an der Seite derer, die an ihrer Zersetzung arbeiten.
Ich halte das Gebet für etwas Großes. Ich glaube, dass man mit Gebeten seine persönliche Umwelt und seine eigene Verfassung verändern kann, selbst in scheinbar aussichtsloser Lage. Ich stimme Alexis Carrel zu, der 1912 den Nobelpreis für Medizin erhielt, damals, als er noch keinen Glauben hatte. Später sagte er Sätze wie »Das Gebet ist die stärkste Form von Energie, die man erzeugen kann, so real wie die Schwerkraft«. Alexis Carrel musste einen weiten Weg zurücklegen, bis hin zu solchen Aussagen. Bewusst hatte man ihn, den berühmten Chirurgen, großen Rationalisten und Atheisten, als Gutachter beim Fall einer unerklärlichen Heilung in Lourdes hinzugezogen. Danach gab er zu Protokoll: »Niemals werde ich das erschütternde Erlebnis vergessen, als ich sah, wie ein großes, krebsartiges Gewächs an der Hand eines Arbeiters vor meinen Augen bis auf eine kleine Narbe zusammenschrumpfte. Verstehen kann ich es nicht, aber ich kann nicht bezweifeln, was ich mit eigenen Augen gesehen habe.« Ich bin überzeugt, dass Carrel nicht einer plötzlich grassierenden Irrationalismus-Welle erlag. Ich stimme ihm zu, solche Dinge gibt es. Sie haben mit dem Gebet zu tun, und es ist empirische Ignoranz, wenn Intellektuelle seit 300 Jahren das Drei-Affen-Spiel betreiben: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Und natürlich stimme ich auch Herrn Sindermann darin zu, dass man durch Gebet in die Geschichte eingreifen kann. Ich glaube, dass der Dichter Reinhold Schneider recht hatte, als von 1936 an die prophetischen Zeilen von Hand zu Hand gingen: »Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten.« Sie hätten das Verhängnis aufhalten können, wären es mehr gewesen. Aber der Glaube an die dämonischen Kräfte von Blut und Boden war stärker: »Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen.« Ich bin dafür, dass möglichst viele Leute die Aussage Jesu experimentell überprüfen: »Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten« (Mt 7,7–11). Ich stehe hinter diesen Sätzen, glaube sie durch Lebenserfahrung und Gebetserfahrung bestätigen zu dürfen. C. S. Lewis hat es auf eine vielleicht schockierende Formel gebracht: Leuten, die Jesus folgten, sagte er, stünden zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um Ereignisse hervorzurufen: »Arbeit und Gebet«. Zu Recht nennt er nicht Lottospielen. Dass man durch Lottospielen meist nur dann zu einem kleinen Vermögen kommt, wenn man vorher ein großes hatte, ist bekannt. Durch Arbeit zu etwas zu kommen – das erscheint plausibel. Aber durch Beten? Darüber wird zu sprechen sein.
Beten ist also für mich durchaus kein Herabschnurren überkommener Zauberformeln zur magischen Beschwörung himmlischer Mächte. Beten ist so menschlich wie Atmen, Essen, Lieben. Aber es ist viel mehr! Es steht die Behauptung: Beten ist der schnellste Weg ins Herz des Universums. Gründe für diese Behauptung beizubringen, den Ideologieverdacht, unter dem Beten notwendigerweise steht, zu entkräften – dazu dient dieses kleine Buch.
Dorthin, ins Herz des Universums, gibt es einen Weg – es ist wichtig, ihn zu finden und sich entschlossen nach dorthin auf den Weg zu machen. Ich glaube denen nicht, die das Universum für eine weg-, plan- und sinnlose Veranstaltung halten – ein Etwas ohne Ursprung, Mitte und Ziel. Dazu habe ich nicht genug Glauben. »Ich glaube«, sagte Dietrich Bonhoeffer, »dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.«
Ich halte mich an die Überzeugung meiner Mütter und Väter, Vormütter und Vorväter, zudem an die Überzeugung fast aller Hochkulturen der Erde. Sie besagt: Hinter dem, was ist, wartet ein Gesicht. Ich glaube auch denen nicht, die sagen: Da ist vielleicht jemand, aber er ist nicht zu sprechen. Dass der, der die Welt gemacht hat und sie sekündlich im Sein erhält, dümmer und herzloser sein sollte als seine Erfindungen, ist eine in sich widersinnige Annahme. Zudem fühle ich mich täglich angesprochen von IHM. Er regt sich an der Quelle meiner Handlungen und Unterlassungen. Ich fühle, dass er da ist, wenn ich seinen Impulsen folge, und dass er da ist, wenn ich seinen Willen ignoriere – in irritierend gleichbleibender Liebe. Ich kenne Menschen, die so unerwartet und präzise »von oben« angesprochen wurden, dass ihr Leben vom Kopf auf die Füße gestellt wurde.
Darum sage ich: Beten ist etwas zutiefst Natürliches, Befreiendes, Sinnstiftendes, ein tiefes seelisches Einschwingen mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält und wofür wir den Namen Gott haben. Beten ist überdies die tiefste Verbindung zwischen Menschen, denn indem ich für einen anderen Menschen bete, bin ich ihm näher, als wenn ich Sex mit ihm hätte. Dass wir im Gebet aneinander denken (und uns so im Leben halten), ist der schönste Freundschaftsdienst, den wir einander erweisen können.
Ich habe noch mehr erfahren: Beten reinigt und macht glücklich. Beten ermöglicht den Widerstand gegen Versuchungen. Beten stärkt in der Schwachheit; es ermutigt gründlicher als alle Tschaka-Du-schaffst-es-Schreie und aller Positiv-Denken-Psycho-Zauber. Aus den Höllen der KGB- und Gestapo-Gefängnisse wissen wir, woher letzte Entschlossenheit und wahre Kraft kommen: aus dem Gebet. Aus eigener Erfahrung bezeuge ich: Beten nimmt die Angst, verdoppelt die Kräfte, gibt den längeren Atem bei der Arbeit an Projekten. Ich wittere Morgenluft, wenn ich ein paar Sätze von Mutter Teresa lese, meiner Lieblingsheiligen, die übrigens einen messerscharfen Intellekt und eine präzise Wahrnehmung für die »Gestalt« geistiger Dinge hatte: »Ich glaube, es gibt niemanden, der Gott so nötig hat wie ich. Ich fühle mich so nutzlos und schwach. Weil ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, verlasse ich mich auf ihn, 24 Stunden am Tag. Mein Geheimnis ist einfach: Ich bete. Ich liebe das Beten. Der Drang zu beten ist immer in mir. Das Gebet erweitert das Herz, bis es bereit ist, Gottes Geschenk seiner selbst zu empfangen. Wir wollen so gerne richtig beten, aber dann scheitern wir. Wenn du besser beten willst, bete mehr. Wenn wir fähig sein wollen zu lieben, müssen wir beten.«
Man muss partout kein Engel von Kalkutta und kein Heiliger sein, um sich in das Gebet zu verlieben und zu versuchen, es immer besser in sein Leben zu integrieren. Manchmal braucht man es einfach. Mitten am Tag. Mitten in seinen Sünden, seiner Verwirrung, seinem Nicht-mehr-Weiterwissen. »Ohne zu beten«, sagte Mahatma Gandhi, »wäre ich schon längst wahnsinnig geworden.« In dieser Linie liegt es, wenn ich bekenne, dass ich unter keinen Umständen den Eindruck erwecken möchte, beim Autor handle es sich um einen Meister des Gebetes. Dieses Bekenntnis ist nicht der Koketterie und auch nicht der Tatsache geschuldet, dass sich nicht einmal Teresa von Avila als Meisterin des Gebets hätte apostrophieren lassen. Ich bete einfach, weil ich es manchmal nötig habe wie ein Ertrinkender das Wasser, bete gut oder schlecht, mit Gefühlen, ohne Gefühle, ob es regnet oder schneit. Manchmal mehr, manchmal weniger. Eines Tages vielleicht so viel wie meine wunderbare Großmutter, die, herzkrank, dreißig Jahre im Bett lag und kein Fernsehen brauchte. Sie strahlte – mit einem verachteten Gerät in der Hand: dem Rosenkranz.
Mit anderen Worten: Ich kann nichts mehr anfangen mit Vorstellungen, die Beten für langweilig, ineffizient, unmodern oder wissenschaftlich überholt halten. Ich sehe die Effekte bei Menschen, die (oft nach kuriosen Umwegen) zu wirklichem Beten gefunden haben. Ich empfinde sie als tief, klar, voller Liebe, gesegnet mit Kraft. Es geht eine starke Anziehung von ihnen aus. Ich möchte daher eine Lanze für das Beten brechen. Ich möchte auch Ihnen Lust auf Beten machen. Tun Sie’s und lassen Sie sich auslachen. Es war schon immer etwas strapaziös, einen besonderen Geschmack zu haben.
Ich biete Ihnen einen Text, der sich auf ein Stück eigene Geschichte beruft, seine Sicherheit aber aus tieferen Quellen schöpft. Ich berufe mich auf die Heilige Schrift, auf Jesus, den ich für den einzigen wirklichen Experten des Betens halte, sodann auf die, die ihm am nächsten standen (und in Ewigkeit stehen), seine Nachfolger: Teresa von Avila, ihre zauberhafte kleine Schwester Therese von Lisieux, der Pfarrer von Ars, der moderne Wüstenmann Charles de Foucauld, Frère Roger Schutz aus Taizé, Mutter Teresa – sie kommen häufig zu Wort. Sie haben einen uneinholbaren Vorsprung an Nähe zu Jesus. Ich liebe es, ihre brennenden Worte zu lesen. Auch Sie werden sie lieben, wenn Sie wirklich beten und in die Nähe Gottes kommen wollen.
Hören Sie auf mit meditativen Schnupperkursen, in denen Ihnen Gurus seelische Kicks und manipulative Tricks für die Beherrschung der Kräfte des Universums versprechen! Wenn es Gott gibt – glauben Sie dann wirklich, Sie könnten ihn mit Hilfe der Methode von Sri Swami Sivananda fernsteuern? Das ist erstens lachhaft, zweitens Blasphemie (= Gotteslästerung), und drittens geht es von Ihrer Zeit ab. Treten Sie lieber in ein unaufhörliches Gespräch mit dem ein, der Sie aus Liebe gemacht hat, der Sie voll Liebe anschaut und auf nichts sehnlicher wartet, als dass Sie seine Nähe und Freundschaft suchen.
1. Das Vertrackte an der Frömmigkeit
Sonnenaufgang in den Abruzzen
Es war ein wunderschöner Sommermorgen in den Abruzzen, als ich infiziert wurde. Infiziert von diesem merkwürdigen Bazillus der Frömmigkeit. Am Vorabend hatten wir mit Freunden gefeiert. Nun war ich früh auf den Beinen. Der Tag versprach herrlich zu werden. Im Osten, dort, wo das offene Meer sein mochte, war vor vielleicht einer Stunde die Sonne aufgegangen. Ich saß auf einer Bank vor dem Haus, freute mich, wie warm es hier in diesen südlichen Gefilden war, blickte durch einen Rosenbogen hinaus auf die grünen Hügel, die der Nebel der Nacht noch sanft umkleidete, und gab mich der erwachenden Geräuschkulisse hin. Die Welt konnte so bleiben; sie war vollkommen okay. Zumindest fühlte sie sich gerade so an. In Wahrheit hatte ich zu dieser Zeit jede Menge Probleme und war weder mit mir noch mit der Welt im Reinen. Im Grunde war der Morgen nur eine Insel in einem mich restlos fordernden Getriebe; mein Morgenglück in den Abruzzen erkaufte ich mit Vergessen. In anderthalb Tagen, am Montag, würde mich die Realität schon wieder einholen: das Elend des Alltags, die Querelen, der Druck, die Angst.
Ich hörte Schritte. Ein Freund, mit dem ich am Vorabend ausgiebig die Vorzüge italienischer Weine und Kochkünste ausgelotet hatte, gesellte sich zu mir – auch so ein Frühaufsteher. Journalist bei einer großen deutschen Wochenzeitung, hatte er, wo er ging und stand, seine Kamera bei sich. Nun fing er von der gemeinsamen Bank aus den unwirklichen Paradieseszauber der Szenerie ein: »Schau dir den Rosenbogen an! Vor dieser Kulisse! Ist das nicht der Himmel?« Klick, das war festgehalten. »Vielleicht«, meinte ich, »vielleicht aber auch nur das Beiprogramm für ziemlich viel Mist hier auf der Erde …«
Mein Freund sah mich von der Seite an: »Probleme?« – »Wie man’s nimmt.« Ich erzählte etwas von den Kindern, der Firma, dem schmalen Korridor persönlicher Ambitionen. Auch mein Freund schüttete sein Herz aus. Wir sprachen über die ups and downs im Leben, bis ihm der Kragen platzte. »Ha, was reden wir da für ein Zeug! Schau dich um – die Welt ist so unglaublich schön!« Das musste er mir nicht sagen; ich sah das auch, aber meine Seele versuchte sich schon wieder in vorauseilendem Gehorsam mit dem Alltag zu arrangieren: »Das ist ja alles schön und gut. Bloß kriegen wir das Schöne, den Frieden, immer nur in kleinen Dosen, nicht wahr? Rhythmische Ausschläge auf dem mittleren Pegel der Tristesse …« Keine Antwort.
»Betest du eigentlich?«, fragte mein Freund unvermittelt, während er mit der Kamera schon wieder ein neues Motiv ins Visier nahm. Keine besonders angesagte Frage unter Männern! Sie traf mich gewissermaßen aus heiterem Himmel. Ich redete nicht gerne über Religion. Irgendwelche Bekundungen von Frömmigkeit öffentlich zu machen bereitete mir Unbehagen. Ich hatte das Gefühl, das müsse allen halbwegs verständigen Menschen so gehen. Im Gymnasium hatten wir nicht nur die Klassiker gelesen; ein origineller Lehrer hatte uns auch mit dem witzig gescheiten Wilhelm Busch vertraut gemacht. Wir Schüler kannten ihn eher von Max und Moritz. Unser Lehrer klärte uns nicht nur darüber auf, dass wir es mit dem ersten Cartoonisten der Welt, zudem einem spitzzüngigen Literaten zu tun hatten. Buschs »fromme Helene« imprägnierte uns gegen jede Form von Doppelmoral. Also lieber die hohen Ideale verstecken, statt eines Tages hohler Prätention überführt zu werden. Es gab da so einige Codewörter, die aus Gründen geistiger Hygiene verboten waren: Nimm nie das Wort Gott in den Mund! Streiche das Wort fromm aus deinem Wortschatz! Sprich nicht über Beten! Rede nicht von Segen, nicht von Gnade und nicht von Vorsehung. Schon die bloße Begrifflichkeit exkommunizierte vom intellektuellen Diskurs. Irgendein gesellschaftliches Über-Ich sagte den Leuten meiner Generation, man bekäme schwitzige Hände davon.
»Ja«, meinte ich zögerlich, »ich bete schon, aber ich rede nicht gern darüber.« – »Klingt nicht sehr überzeugend«, blieb mein Freund am Ball. »Wie betest du?«, wollte er wissen. Ich murmelte ein »Irgendwie«, stotterte was von Morgen, Abend und bei Tisch. Weder mich noch meinen Gesprächspartner beeindruckte das sonderlich. »Du solltest damit anfangen«, sagte mein Freund. Dann hielt er mir einen kleinen Vortrag, in dem er mir kurzerhand und ungefragt eine Art Grundkurs Beten vermittelte, wobei er nebenbei und in drastischer Manier noch das Roadmovie seines Lebens einflocht, eine exzessive Geschichte mit deutlichen Barbiturat- und Sexanteilen sowie überraschenden Wendungen: »Mir stand die Scheiße bis zum Hals …« Eines Tages habe er zu beten angefangen, aber richtig – als »zeitfressende Priorität«, mit Hingabe. »Die halbe Stunde am Morgen kriegst du mit Zinsen und Zinseszinsen am Tag zurück!« Kurz gesagt: Ich bekam eine umfassende Rezeptur verpasst. So und so solle ich es machen, »von jetzt an jeden Tag, den der liebe Gott gemacht hat. Du wirst sehen, dein ganzes Leben wird sich verändern!« Ein großes Wort, gelassen ausgesprochen! Zum Abschied drückte er mir einen Rosenkranz in die Hand. Den brauchte ich nun nicht. Er musste meine Skepsis spüren. »Hör mal, dieses Gerät ist ein paar hundert Jahre alt. Die Dominikaner haben ihn propagiert, das waren keine Idioten. Da kannst du dich dran voranhangeln, Perle um Perle … na, und schau dir diesen Rosenbogen an!« Der Rosenbogen in der Morgensonne – er war in der Tat wunderschön. Mir kam das alles sehr italienisch, um nicht zu sagen spanisch vor.
Freunde haben einen Vertrauensvorschuss verdient. Ich ließ mich also auf die Geschichte ein – und ich kann heute sagen: Es war der beste Rat, den ich in meinem ganzen Leben empfangen habe. Die Verheißung meines Freundes beamte mich keineswegs schlagartig in eine neue, nun rosa illuminierte Welt. Es geschahen keine äußeren Wunder. Meine Probleme wurden nicht kleiner. Und doch gingen mir in verschiedener Hinsicht die Lichter auf; es ergaben sich neue Perspektiven; es kam ein Grundklang gelassener Zuversicht, ja so etwas wie Freude in mein Leben. Ich kam aus der Sackgasse des Selbstmitleids heraus, begann das Leben wieder zu lieben, es als Geschenk zu begreifen. Eine neue Intensität, eine Wachheit und Entschlossenheit erfassten mich, die ich vorher so nicht kannte. Plötzlich konnte ich ein gewaltiges Arbeitspensum bewältigen, ohne die subjektive Empfindung von Mühe und Stress, und das, obwohl ich faktisch weniger Zeit hatte. Denn ich betete ja – vielmehr: Ich schnitt Zeit aus meiner Agenda heraus. Beten wollte ich das am Anfang nicht nennen. Das hatte mir mein Freund ans Herz gelegt: »Ob du am Anfang etwas dabei empfindest, ob du dir von außen zuschaust oder Schäfchen zählst – es ist nahezu vollkommen egal. Hauptsache, du tust eine halbe Stunde nichts anderes, als dich dem lieben Gott hinzuhalten! Denk immer an den alten Vater Bernanos, den vom Tagebuch eines Landpfarrers: ›Schon der Wunsch zu beten ist ein Gebet!‹« Mir war das nicht recht plausibel erschienen. Aber mein Freund ließ keinen Widerspruch zu: »Ich stand mal mit meinen halbwüchsigen Kindern im Tiroler Villnösstal vor den Geißlerspitzen. 700 Höhenmeter waren zu bewältigen. Sie rebellierten, maulten: ›Was bringt denn das, da hinaufzulatschen?‹ Ich blieb hart: ›Das seht ihr, wenn ihr oben seid!‹ Oben war es phantastisch. Die Kinder erzählen heute noch davon. So ist das auch mit dem Beten.« – »Also einfach starten, ohne Rücksicht auf die subjektiven Rahmenbedingungen?« – »Ja, ob es regnet oder schneit, ob du im Lotto gewonnen hast oder dir die Hütte abgebrannt ist: Tu es! Jeden Tag! Nicht aus Gesetzlichkeit heraus! In völliger Treue zu dir selbst.«
Ich folgte also dem Rat des Freundes. Kam mir komisch dabei vor. Kreiste um mich. Sah mir zu. Suchte nach bestimmten Gefühlen, wollte etwas spüren. Spürte nichts. War permanent von der Idee geplagt, ich führe Selbstgespräche. Mein Freund hatte mich über all diese Phänomene aufgeklärt. Das müsse so, könne gar nicht anders sein – eine Phase auf dem Weg, eine Art Vorstufe. »Aber die Gefühle …«, rief ich meinen Freund nach einer gewissen Zeit an, protestierend: »Du sagst, es sei nicht wichtig, ob man etwas dabei empfindet? Aber Religion ist doch Gefühl!« – »Schmink dir das ab, mit den Gefühlen, die hat der olle Schleiermacher unter die Religion gemischt«, blaffte er zurück, »Gefühle sind für Mädchen. Da sind wir gleich bei den Esoterikern, die nach Pneuma schnuppern und ein halbwegs anständiges Sommerlüftchen für das Wehen des Heiligen Geistes halten! Nein, mein Freund, lies lieber Newman!« Paul Newman? Nein, John Henry Newman.
Heute bin ich selbst davon überzeugt: Der Theologe Friedrich Daniel Schleiermacher (1768–1834) hat dem christlichen Glauben keinen Gefallen getan, als er Religion mit dem »Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit« von etwas Höherem definierte und mit »Sinn und Geschmack für das Unendliche« umschrieb. Sofort sind wir in wolkigen Regionen unverbindlicher Erbaulichkeit. Schöne Gefühle zu haben macht fröhlich. Sie kosten ja auch nichts. Und sie sind nichts wert. Bei der erstbesten Krise lösen sie sich in nichts auf wie Tau in der Mittagshitze.
Der englische Philosoph und spätere Kardinal John Henry Newman (1801–1890) hat immer gegen »Religion als Gefühl« gekämpft, von Glaubenstatsachen gesprochen und auf die nüchternen Gründe hingewiesen, die Menschen veranlassen könnten, alles auf die eine Karte Gott zu setzen. Wenige Jahre nach dem Tod Schleiermachers, nämlich 1843, wies Newman in einer Rede an der Universität Oxford auf folgende Struktur hin, die für ihn das typisch Christliche ausmachte: »Als ein römischer Stoiker Selbstmord beging, klagte er, er habe die Tugend angebetet, um am Ende zu finden, dass sie doch nur ein leerer Name sei. Es ist ja auch heute noch die Art der Welt, das religiöse Prinzip als Eigenheit des Temperamentes, als Schwäche, Begeisterung, verfeinertes Gefühl oder (je nachdem) als Zeichen eines furchtsamen und engen oder eines hitzigen oder eines hochbegabten Geistes zu betrachten. Hier kommt uns nun die Offenbarung mit einfachen und deutlichen Tatsachen und Handlungen entgegen, nicht mit mühsamen Folgerungen aus gegebenen Erscheinungen, nicht mit verallgemeinerten Gesetzen oder metaphysischen Aufstellungen, sondern mit Jesus und der Auferstehung: ›Wenn Christus nicht auferstanden ist‹, so bekennt sie klar, ›dann ist unsere Predigt unnütz und eitel euer Glaube.‹«
Auch Beten basiert nicht auf Gefühlen (die man erst einmal haben muss); Beten – das weiß ich heute – ist vielmehr etwas vom Nüchternsten, das ich kenne. Wer beten will, darf gerade nicht wegdämmern, sich einlullen lassen, am besten noch mit Meditationsmusik im Hintergrund. Beim Beten muss man knochennüchtern und hellwach sein – wie ein Innenverteidiger bei einem Konterangriff. Wer betet, rechnet mit Gott als einer wirksamen Tatsache, wenn man so uneigentlich, so sachlich sprechen darf. Wer betet, vertraut sich Gott an und geht (hoffentlich ohne Angst) in die Gefahr. Wer Gott bittet, verlässt sich »in echt« auf Gottes Fügungen. So zeigt sich der Tatsachencharakter des Betens oft nicht beim Beten selbst (das für den Zuschauer vieldeutig ist), freilich an seinen Früchten. Es zeigt sich, ob einer den Himmel ernst nimmt, wenn man sieht, wie er lebt. Der Münsteraner Bischof Reinhard Lettmann berichtet von einer denkwürdigen Begegnung mit einer sterbenden Frau; es war zu der Zeit, als Lettmann noch Kaplan war. Die Dame konfrontierte den jungen Priester mit der Frage: »Glauben Sie denn an ein Fortleben nach dem Tod?« Lettmanns Antwort aus dem Augenblick heraus war ebenso handfest wie genial: »Wenn ich daran nicht glaubte, würde ich gewiss kein eheloses Leben führen.« Es heißt, die Frau sei gut und in innerem Frieden gestorben.
Er hatte recht: Wer an seinen Gefühlen hängt, bleibt bei sich und seinen Emotionen; er checkt nur permanent seine seelische Wohlfühltemperatur. Ich schenkte mir die Erwartung auf ein drogenanaloges Feeling, was die einfachste Übung nicht war. Irgendwie ging etwas weiter. Eines Tages kam ich von mir los, spürte, dass mir von der Seite Gottes »etwas« entgegenkam, etwas, das ich nicht selbst machte, mir nicht ausgedacht hatte, nicht steuern konnte, für das ich keinen Namen hatte und keine Beschreibung, außer dass es das Nicht-von-mir-Kommende war. Für den 1990 verstorbenen jüdischen Philosophen Emmanuel Levinas fällt Gott »im Antlitz des Anderen« in das Denken ein. Karl Barth, der reformierte Schweizer Theologe, hat von Gott mit Vorliebe als von dem »ganz Anderen« gesprochen. Im Alten Testament gab es das Gebot, den Namen Gottes nicht auszusprechen. Das Judentum behalf sich mit dem sogenannten Tetragramm und bezeichnete Gott mit JHWH. Es ist dieses Geheimnis, das sich im Beten jedes Menschen ereignet, der ernsthaft damit beginnt: Es geht eine Wirklichkeit auf, für die wir keine Worte haben. Anders gesagt: Hätten wir Worte dafür, könnten wir »es« auf den Begriff bringen, wäre »es« nicht, was es ist.