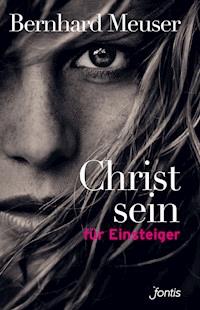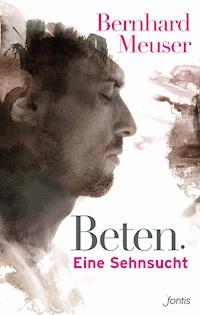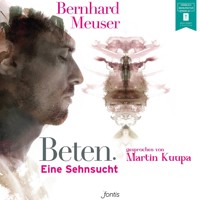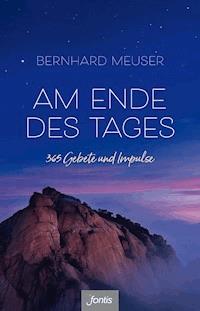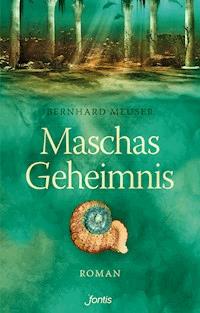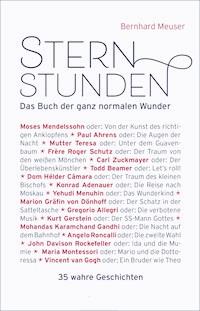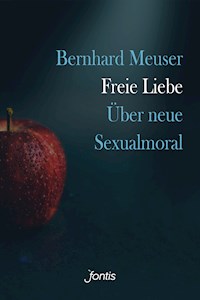
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit der weltweiten Corona-Krise scheint ein Zeitalter an sein Ende gekommen zu sein, dessen Signatur der Individualismus war. In der kollektiven Bedrohung entdecken wir wieder, wie kostbar Menschen sind, die Verantwortung übernehmen, verlässlich in der Nähe sind und selbstlose Zuwendung schenken. Anders gesagt: Wir haben «Liebe» neu entdeckt, und nicht nur die Liebe, sondern auch all die kleinen Bausteine, die gutes Leben ausmachen. Früher hatte man für die flankierenden Maßnahmen guten Lebens das Wort «Moral». Plötzlich sehen wir, dass es uns an ethischen Tools für ein gutes Miteinander fehlt. Auf der Suche nach dem größtmöglichen persönlichen Glück des Einzelnen geriet die Welt der Liebe aus den Fugen. Sie funktioniert nicht, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Mitten in der weltweiten anthropologischen Krise leisten es sich die beiden großen Kirchen, zur menschenwürdigen Gestaltung von Leben, Liebe und Sexualität zu schweigen, als hätten sie dazu nichts zu sagen. Aber was sind die Koordinaten für gutes Leben, gute Liebe und guten Sex? Es ist Zeit, auf eine neue, tiefe und gründliche Weise über diesen vitalen Dreiklang nachzudenken - und es dennoch anhand eines Sonderfalls zu tun: des tiefen Absturzes der Katholischen Kirche. Der Missbrauch und seine Bewältigung ist ein Lehrstück für alle, denen an einer menschenwürdigen Gestaltung unserer geschlechtlichen Beziehungen gelegen ist. Bernhard Meuser, Publizist und Verleger, war früher Leiter des Pattloch Verlags, danach Initiant und Mitautor des «YOUCAT». Meuser hat in seiner Jugend selbst den Missbrauch durch einen homosexuellen Priester erlebt. Schockiert über die halbherzigen Aufarbeitungsstrategien seiner Kirche, entschloss er sich zu einer deutlichen Entgegnung. Dabei blieb er nicht bei Kirchenkritik stehen, sondern musste radikal nachdenken, um zu den Wurzeln von Liebe und gutem Leben durchzudringen. Leserstimme: «Ein messerscharfes, furchtloses Buch, an dem sich die Geister scheiden werden. Glänzend geschrieben, nie langweilig, oft genug schonungslos provokant, wird man hineingesogen in einen großen Dialog über das, was gutes Leben ausmacht. Lange hat niemand mehr so klar und bestimmt von der Liebe, der Lust und der Freiheit gesprochen. Wenn das christliche Moral ist, dann wünsche ich "Freie Liebe" in die Hand jedes evangelischen und katholischen Christen.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Meuser Freie Liebe
Bernhard Meuser
Freie Liebe
Über neue Sexualmoral
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2020 by Fontis-Verlag Basel
Die Bibelstellen wurden in aller Regel folgender Übersetzung entnommen: «Revidierte Einheitsübersetzung», 2016 (in wenigen Fällen hat der Autor auch selbst übersetzt)
Umschlag: René Graf, Fontis-Verlag Bild: pexels.com / Ashutosh Sonwani E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-670-1
Inhalt
Teil I: Alle wollen nur das Eine
Einführung
1 | Sex ja, Moral lieber nicht
2 | Wo finde ich, was gutes Leben ausmacht?
3 | Für eine Ökologie des Menschen
4 | Judith Butler meets Thomas von Aquin
5 | Der Kästner-Check – oder: Sex im Ranking der Werte
6 | Zivilmoral, oder: Was alle tun, weil es alle tun
7 | Die Sexuelle Revolution und ihr geheimer Treiber
8 | Christsein als Option
Teil II: Die Kirche und ihr Sexproblem
9 | Eine Ménage-à-trois …
10 | Die Missbrauchskrise und ihre Bewältigung
11 | Die Allianz der Verschweigung
12 | Ein Vater darf alles sein, nur nicht geil auf sein Kind
13 | Allein oder mit andern – oder: Wessen Problem ist der Missbrauch?
14 | Einwände gegen die Matrix einer neuen Sexualmoral
15 | Hast du nicht andern Segen? – Homosexualität in der Bibel
Teil III: Gutes Leben! – Gute Liebe! – Guter Sex!
16 | Sex von gestern – oder: Ein kurzer Blick auf die alte Moral
17 | Der Schlag ins Gesicht der Moderne
18 | Über die Spielarten der Liebe
19 | Die meisten Sünden gegen das Sechste Gebot …
20 | Der Mann, der aus der Kinderladenszene ausstieg
21 | Abschied vom Pippilotta-Prinzip
22 | Eine andere Geschichte von den verlorenen Söhnen und Töchtern
23 | Liebe Bischöfe – ein Brief zuletzt …
Danksagung
Anmerkungen
«Wenn alles das, wasDas ist gut sagt, abgetakelt worden ist, bleibt noch immer das, was Ich will sagt.»
C.S. Lewis The Abolition of Man
«Man had saved his good as Crusoe saved his goods: he had saved them from a wreck.»
Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxy
«Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten!»
Der Prophet Joel
Teil I
Alle wollen nur das Eine
Einführung
Alle wollen nur das Eine. Nämlich Sex. Ich will das. Sie, liebe Leser, wollen das. Ich nehme es zumindest an. Es ist vollkommen natürlich, sich nach Liebe und gutem Sex zu sehnen. Auch Christen sind keine asexuellen Wesen. Nicht einmal Pfarrerinnen sind das – wie man bei Ellen und Stefanie Radtke, zwei jungen Pastorinnen im niedersächsischen Dörfchen Eime, sieht. Das lesbische Paar betreibt den YouTube-Channel «Anders Amen», der vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen produziert wird. Ihr Anders-Amen-Trailer1 hat «richtig Wums», wie die beiden wohl sagen würden: Die Kamera-Drohne fährt auf ein Doppelfenster in der Kirchturmspitze zu, aus dem sich die beiden in Talar und Bäffchen gehüllten Pastorinnen herauslehnen, um sich in einem satten Zungenkuss zu vereinen. Im Zoom entfernt sich die Kamera aus der Naheinstellung von der Liebe. Das Dörfchen mit dem Kirchturm lacht in der Sonne. «Noch Fragen?»
Obwohl derlei für die meisten Evangelischen Landeskirchen nun schon Alltag ist, provoziert der Hingucker. Während die einen die beiden Pfarrerinnen couragiert finden, sich allenfalls sagen: «Nun gib dir schon einen Ruck. Das ist normal. Die Kirche muss ein bisschen mit der Zeit gehen», empfinden andere die Aktion als abgeschmackt oder nehmen den eklatanten Widerspruch zur biblischen Botschaft wahr. Hatte nicht auch Luther gelehrt, das gleichgeschlechtliche Begehren sei «gegen die Natur», eine ohne Zweifel «ex Satana» herrührende «perversitas»2?
Mit gemischten Gefühlen schauen katholische Christen auf Ellen und Steffi. Werden sich demnächst auch Ordensbrüder aus dem Kirchturmfenster beugen?
Beide großen christlichen Konfessionen kämpfen in Westeuropa gerade um ihr nacktes Überleben. Es ist nur zu verständlich, dass die letzten Christen zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen, um wenigstens den Kern ihrer Botschaft plausibel zu machen und damit über die Zeit zu retten. Eine beliebte Strategie ist jeweils die Verbilligung des Angebots, namentlich die Ent-Ethisierung des Evangeliums. In der Ethik geht es um gutes Handeln. Hier stoßen die Dinge hart an hart aufeinander; in der Ethik muss man sich entscheiden. Wie, wenn es ein Christentum gäbe, in dem mehr oder weniger alles erlaubt ist?
In Teilen der Evangelischen Kirche scheint man nicht weit von dieser Vision entfernt zu sein. Wenn man den Müll trennt, für den Frieden ist und sich klimaneutral verhält, kann man nicht mehr viel falsch machen. Manche evangelischen Christen, denen das zu schlicht gedacht ist, schielen mit Wehmut auf die Katholische Kirche, weil sie meinen, wenigstens in Sachen Liebe sei dort die Welt theoretisch noch in Ordnung. Nimmt die Katholische Kirche nicht tatsächlich zu Lebensschutz, Scheidung, außerehelichem Sex, Homosexualität usw. eine klare Haltung ein?
Sie täuschen sich. Auch in der Katholischen Kirche geht es gerade wild zur Sache. Seit Jahren schon steht der sogenannte Zölibat3 unter kritischer Beobachtung. Gegen viel Widerstand hat Papst Franziskus diese Lebensweise, die sich an der Lebensform Jesu orientiert, für seine Priester weiterverordnet.
Ja, geht denn das? Ohne Sex leben?
Genau genommen müssen viele Menschen «zölibatär» leben. Einige, weil sie keinen Partner finden, der zu ihnen passt; andere, weil sie sexuelle Neigungen haben, die Sex nur zum Preis eines Verbrechens4 oder zum Preis der Selbstzerstörung5 möglich machen würden. Natürlich brauchen auch katholische Priester, Mönche, Nonnen, der Papst und alle Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Sex haben können, das sichere Gefühl, dass sie nicht zu kurz kommen. In Teilen der Christenheit mindestens hat sich der Glaube gehalten, dass die eigentliche Erfüllung erst noch kommt – in der Liebe aller Lieben: in der Vereinigung mit Gott. Man kann deshalb, wenn man dazu berufen ist, ein bisschen warten – «um des Himmelreiches willen» (Mt 19,12), oder weil sich hier auf der Erde keine Gelegenheit dazu bietet. Nichtchristen werden das möglicherweise für eine ziemlich spinnerte Idee halten. Aber sie ist immerhin von Jesus.
Während weite Teile der Evangelischen Kirche also ihren Frieden mit dem Thema Sexualmoral gemacht haben – einfach, indem es sie faktisch nicht mehr gibt –, scheint das mit Liebe und Sexualität in der Katholischen Kirche gerade nicht besonders gut zu funktionieren. Spektakulärer, als es im Missbrauchsskandal geschehen ist, kann man nicht auf die Nase fallen. Die Superheroes haben sich bis auf die Knochen blamiert. Hat die Katholische Kirche nicht so getan, als habe sie von Gott persönlich das Mandat, die Unmoral der Welt aufzustöbern und zu geißeln? Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche sind geschockt, dass ausgerechnet Priester in nicht unerheblicher Zahl als Vergewaltiger entlarvt wurden. Waren das nicht die gleichen Leute, die der bösen Welt vor kurzem noch «Moral» gepredigt haben? Es wäre zynisch zu sagen: Na, endlich sind sie Menschen!
Durch ein Verbrechen wird man aber nicht menschlich; im Gegenteil: Man verabschiedet sich teilweise oder endgültig aus dem humanen Miteinander. Liegt es am Zölibat? War die Moral dieser Leute in Wahrheit Doppelmoral – nichts als schlecht verkappter Moralismus? «Die Moralisten», sagt Gottfried Hutter von solchen innerhalb und außerhalb der Christenheit, «sind ja bekannt für ihre moralischen Verurteilungen, die sie – wie könnte es anders sein – gewissermaßen aus Rache für die Unannehmlichkeiten der Selbstbeschränkung, die ihnen die Moral auferlegt, denen überbraten, die sich den Zwang der Moral nicht antun.»6
Schon Jesus warnte vor Moralpredigern – und es gibt keinen Grund, die Kritik an einer gewissen Sorte von Schriftgelehrten nicht auf heute zu übertragen: «Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten; denn sie reden nur, tun es aber nicht» (Mt 23,3).
Ich finde, es ist jetzt eine gute Zeit, sich generell über Liebe, Sexualität und Moral zu unterhalten – und es in der Folge auch anhand eines Sonderfalls zu tun: des tiefen Absturzes der Katholischen Kirche7. Wo wird denn Sex und Liebe sonst noch reflektiert als dort, wo es Skandal macht? Seit einer Reihe von Jahren leben wir als Gesamtgesellschaft beziehungstechnisch in explizitem Kontrast zu allen unseren Vorgängergenerationen, ohne uns des tiefen Einschnittes wirklich bewusst zu werden. Dank der Erfindung chemischer und technischer Methoden der Empfängnisverhütung haben wir die Sexualität von der Weitergabe des Lebens entkoppelt und bewegen uns unter der geheimen Prämisse, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Die Idee von Sex als Selbstzweck hat dafür gesorgt, dass homosexuelle Lust neu in Betracht kam, dass außerehelicher Sex der Normalfall wurde, und man lernte, geschlechtliche Begegnungen als einen Wohlfühlmodus und eine Art körperlicher Form von Nähe und Freundschaft zu verstehen.
Nur die Katholische Kirche zog offiziell nicht mit. Doch nun ist ihre wie eine Klippe ins Meer ragende Sturheit, Sexualität ausschließlich in der Ehe zu beheimaten und sonst nirgends, nachhaltig erschüttert worden. Ausgerechnet die Prediger der reinen Lehre wurden enttarnt. Ja, Priester haben Sex, zudem noch homosexuellen Sex, zudem noch Sex mit Schutzbefohlenen. Eine bessere Widerlegung frommer Rede könnte sich selbst der Teufel nicht ausdenken.
Nun muss man die Dinge fein säuberlich auseinanderhalten. Die Notwendigkeit einer an die Wurzeln gehenden Auflösung der Doppelmoral ist das eine. Die Besinnung auf den Sinn von Sex und Liebe das andere. Denn es ist ja nicht so, als gäbe es nur innerhalb der Katholischen Kirche Missbrauch, Gewaltverbrechen und Beziehungschaos. Man darf an #Me Too erinnern; man kann sich auch die Zahlen zu innerfamiliären Sexkatastrophen oder zu den immer häufigeren Fällen von Missbrauch in Bildungseinrichtungen, Sportvereinen etc. anschauen, die hier nicht zum x-ten Mal wiedergegeben werden müssen.
Zunächst aber hat die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, wie und wohin die moralische Instanz Katholische Kirche umzukehren gedenkt. Ihre Reinigung vom Verbrechen des Missbrauchs und seiner anhaltenden Beförderung kann nicht vorrangig darin bestehen, dass man die noch immer gefüllte Schatulle aufmacht und Opfer «abfindet» (sic!). Sie kann nur geschehen, indem man alle Beteiligten – die Täter, ihre Komplizen, Vertuscher, Verteidiger und Verharmloser, genau anschaut. Wenn man nicht weiß, wer da aus welchen Gründen wie handelt, wird man die Strukturen des Bösen nicht ausmerzen.
Das vorliegende Buch zieht seine für alle Christen relevanten Lehren im Wesentlichen aus einem katholischen Lehrstück: dem seltsamen Umgang mit Missbrauch in den Reihen eigener Amtsträger.
Missbrauch in der Evangelischen Kirche steht noch im Windschatten der katholischen Pleite; die Verantwortlichen aber wissen, dass sie keineswegs aus dem Schneider sind. Das Missbrauchsszenario, das die Evangelische Kirche belastet, unterscheidet sich in mancher Hinsicht von der Katholischen Kirche. In der Katholischen Kirche sind es vor allem von Männern ausgehende gleichgeschlechtliche Übergriffe, die kaum einmal einen ideologischen Hintergrund haben, während Missbrauch in der Evangelischen Kirche ebenfalls meist von Männern ausgeht, sich freilich auf beide Geschlechter bezieht und in einem liberalen Umfeld angesiedelt ist, in dem man sich einiges auf «Respekt und Augenhöhe zugutehält» und lange der Auffassung war, dass hier «so etwas angeblich nicht möglich»8 ist.
Jens Brachmann hat in Hinsicht auf die Skandale den klugen Satz gesagt: «Es bedarf eines ganzen Dorfes, um ein Kind zu missbrauchen.»9
Um etwas von der ideologischen Einbettung des Missbrauchs in der Evangelischen Kirche zu verstehen, muss man die Verstrickung der protestantischen Eliten mit der Reformpädagogik untersuchen, wie es beispielhaft Jürgen Oelkers10 in mehreren Publikationen getan hat; man sollte sich mit Namen wie Hellmut Becker (1913–1993), Hartmut von Hentig (*1925), dessen Lebensgefährten Gerold Becker (1936–2010) und Helmut Kentler (1928–2008) auseinandersetzen, die allesamt auch innerhalb der Evangelischen Kirche agierten und dort von maßgeblichem Einfluss waren. Im Bericht von Bischöfin Kirsten Fehrs ist die Rede von «Psychospiele(n) zwecks Selbsterfahrung, Durchkitzeln auf dem Schoß des Pastors, abendliche Feiern der ‹Auserwählten›, verbale Attacken und Demütigungen, bis hin zu Oral- und Geschlechtsverkehr»11.
Während es in der Katholische Kirche mehr um das dumpf weggedrückte Unsägliche geht, muss man in der Evangelischen Kirche wohl verstärkt über die Korruptibilität12 und Ideologieanfälligkeit der Intellektuellen nachdenken. Beflügelt vom Geist der Kritik gefiel man sich in einer neuen, postmythologischen Offenheit für alles. Sie machte blind für eine Tatsache, die man schon bei Sigmund Freud13 hätte studieren können, dass nämlich die Kategorie «Tabu» im evolutiven Repertoire eine tragende Rolle spielt und man lange braucht, um ihre Schutzmacht rational einzuholen. Insofern trifft die Kritik, die der alte Papst Benedikt seiner eigenen Kirche im Umgang mit dem Missbrauch zudachte, eher auf die Evangelische Kirche zu:
«Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ. […] Zur Physiognomie der 68er Revolution gehörte, dass nun auch Pädophilie als erlaubt und als angemessen diagnostiziert wurde.»14
Der Hintergrund des aufzuarbeitenden Elends in beiden Kirchen ist ein Dogma der Moderne und die Unterzeichnung einer Ur-Akte. Das Dogma lautet: Sex ist niemals Sünde. Die Ur-Akte lautet: Wir werden nie wieder etwas Sexuelles in Verbindung mit Sünde bringen. Die Evangelische Kirche hat diese Ur-Akte, die über Anschluss oder Nichtanschluss an die Moderne entscheidet, lange schon unterzeichnet. Die deutsche Katholische Kirche ist gerade im Begriff, dies auch zu tun – scheinbar notgedrungen.
Über die Gründe innerkirchlicher Untaten nachzudenken, wird helfen, eine geläuterte Idee von Sex, Liebe und gutem Leben zu entwickeln – eine Vision, mit der Menschen wirklich leben können. Die unerlässliche Selbstreinigung der Kirche(n) könnte auf diese Weise zum Paradigma15 für eine kritische Sicht auf das werden, was allen Menschen guttut, die nach einer integralen Gestalt von Liebe und Sexualität suchen. Denn mit dem Sex haben ja nicht nur Christen ein Problem. Missbrauch ist zu einer gesamtgesellschaftlichen Normalität geworden, die weiter hinzunehmen schlicht unmoralisch wäre.
Wenn jetzt vorderhand in den Kirchen eine Re-Formation ihres Umgangs mit der Liebe angesagt ist, haben die Katholiken einen Vorteil: Wer aus dem Dreck aufsteht, weiß, wie sich das anfühlt. Danach werden Christen hoffentlich nie wieder besserwisserisch auftreten, sondern mit der nötigen Portion Demut eine Option für gutes Leben anbieten.
Nicht nur Christen haben ja ein Problem mit Liebe und Sex. Im persönlichen Umfeld von meiner Frau und mir sind innerhalb eines einzigen Jahres drei Familien mit Kindern implodiert. Und dreimal ereignete sich das Gleiche: Der Mann verließ Frau und Kinder wegen einer anderen «Liebe». Einerseits können wir froh sein, dass wir im Zeitalter einer nie dagewesenen individuellen Freiheit leben, in der es den «Blockwart» nicht mehr gibt, der aufpasst, dass Sitte und Moral eingehalten werden. Andererseits mehren sich die Opfer der Freiheit: die Verlassenen, Betrogenen, Verwundeten, Enttäuschten. Oft sind es die Frauen. Immer sind es die Kinder, auf deren Seelen die große Freiheit zur Selbstverwirklichung ausgetragen wird.
Ich möchte Sie also zu einer hoffentlich spannenden Reise durch das Land der «Moral» einladen. Damit es nicht zu anstrengend wird, baue ich spielerische Zugänge ein, und wenn wir tatsächlich tiefer in die Philosophie einsteigen – denn das ist nötig –, kommen auch Jürgen Klopp, Woody Allen, Anke Engelke und Miley Cyrus mit wichtigen Beiträgen vor.
Eigentlich mag ich das Wort «Moral» nicht besonders. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, setze ich es gelegentlich in Anführungszeichen. Es klingt wirklich nach Leuten, die sich für etwas Besseres halten und andere Leute nötigen, ihren Vorstellungen von Recht und Anstand zu folgen. Mir gefällt es besser, statt von Moral vom «guten Leben» zu sprechen. «Moral» nenne ich alle flankierenden Maßnahmen, die «gutes Leben» ermöglichen. Und zwar bitte, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist! Denn darum geht es. Eine gute Umweltmoral wäre also beispielsweise praktisches Wissen, das man erworben hat und klugerweise nutzt, um heute so zu leben, dass es morgen kein böses Erwachen gibt. Hätten wir in den 60er Jahren eine gute Umweltmoral gehabt, hätten wir vielleicht erst gar keine Atomkraftwerke gebaut.
Wo wir schon bei Worten sind – auch das Wort «Sexualmoral» ist eigentlich schon im Ansatz daneben. Wir suchen ja nicht nach flankierenden Maßnahmen für guten Sex. Wir suchen nach gutem Leben im Ganzen, worin Sex eine wichtige Rolle spielt. Diese Rolle kann faszinierend konstruktiv, aber genauso gut höchst destruktiv sein. Und das entscheidet sich gerade nicht beim Sex selbst. Spaß im Bett sagt nichts darüber aus, ob der Sex im biografischen Ganzen des Lebens und der Liebe Fluch oder Segen ist. Wir müssten also nach flankierenden Maßnahmen für das Leben und die Liebe suchen und würden besser von einer Moral für die Liebe oder einer Moral für das Leben sprechen.
Und ein letztes Wort, das ich nicht sonderlich mag, das aber in traditionellen Diskursen über Moral immer wieder auftaucht, ist das Wort «Norm». Es kommt vom lateinischen Wort norma, und das bedeutete ursprünglich «Winkelmaß». Und so geometrisch und wenig lebendig kommt es mir auch vor, wenn wir im Bereich der menschlichen Suche nach gutem Leben von «Normen», «normativen Handlungsanweisungen» und «Normalität» sprechen. In der DDR musste man immer die «Norm erfüllen». Dahinter könnte sich ein Missverständnis von Ethik verbergen, als seien wir dann schon gute Menschen, wenn wir die Verkehrs-Regeln kennen und uns peinlich genau daran halten. Wir könnten uns endlos darüber streiten, wer die Regeln aufstellt, wer sie überwacht und wie die bestraft werden, die bei ihrer Übertretung erwischt werden.
Wie kommt man zu gutem Leben? Wie schützt man gutes Leben? Wie bewahrt man Menschen davor, Leben zu zerstören – das eigene und das Leben anderer? Mitten in dieser breiteren Vision geht es auch um das Wilde in uns, unsere Leidenschaft, unsere Vitalität, unsere Triebimpulse. Von diesem energetischen Treibstoff profitieren übrigens alle, auch jene, die Gründe haben, ehelos zu leben.
Übrigens bin ich entschieden für «Freie Liebe» – womit ich freilich nicht Vorfahrt für Ego-Shooter meine. Liebe ohne Freiheit ist Sklaverei. Und Freiheit ohne Liebe ist Betrug. Ich wünsche mir immer mehr Menschen, die das schöne, stolze Projekt freier Liebe verwirklichen. Papst Franziskus hat dieses Projekt einmal mit einer Goldschmiedearbeit verglichen, an der Mann und Frau gemeinsam arbeiten, indem sie alles Mögliche tun, damit der andere in Freiheit wachsen kann. «Na ja, und so kann ich mir vorstellen», sagt der Papst, «wie dich dann eines Tages auf der Straße im Dorf die Leute ansprechen und sagen: ‹Was für eine schöne, starke Frau! …› – ‹Kein Wunder, bei dem Ehemann!› Und auch zu dir werden sie sagen: ‹Schaut ihn euch an! …› – ‹Kein Wunder, bei der Ehefrau!› Und genau das ist es! Darum geht es: dass wir uns gemeinsam wachsen lassen, der eine den anderen. Und die Kinder haben dann dieses Erbe, einen Vater und eine Mutter gehabt zu haben, die gemeinsam gewachsen sind, indem sie sich gegenseitig geholfen haben, mehr Mann und mehr Frau zu werden!»16
Warum ausgerechnet ich das zum Thema mache? Ich bin schließlich kein Ethiker, kein Moraltheologe. Aber ich habe eine besondere Geschichte mit der Kirche, eine Sexgeschichte. Eine Geschichte, die mich seit fünzig Jahren verfolgt. Eine Geschichte, die mich immer wieder zum Nachdenken über richtige und falsche Liebe, über Sex, Gewalt, Kirche und Freiheit gebracht hat. Ich habe in Einsamkeit darüber gegrübelt, als ich noch nicht davon reden konnte, und mit anderen darüber gesprochen, als mir geholfen worden war, den Mund aufzutun.
Um welche Geschichte geht es?
Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, habe ich den Missbrauch durch einen homosexuellen Priester erlebt. Es hätte nicht viel gefehlt, der Fluch wäre auf mich, das Opfer, übergegangen: Ich hätte ein Täter werden können. Gott sei Dank ist es dazu nicht gekommen. Diese Geschichte hat im Nebeneffekt etwas in mir erzeugt, worunter ich jahrelang litt, das Phänomen, das man heute ‹Homophobie›17 nennt. Das ist eine schlimme Sache; ich bin Wikipedia aber für den Hinweis dankbar, dass sie immerhin «nicht krankhaft abnorm bedingt» ist. Da ich Christ bin, fühle ich mich verpflichtet, nicht bei meinem Groll stehenzubleiben, meine persönliche Geschichte zu überschreiten und objektiv nach Gerechtigkeit zu suchen, will sagen: homosexuellen Menschen gerecht zu werden.
Ich komme in Kapitel 12 ausführlich auf meine persönliche Geschichte zu sprechen.
Als mir der Übergriff passierte – in den frühen 70er Jahren –, ahnte ich nicht, dass es viele sein könnten, denen ein analoges Schicksal beschieden war. Nun bin ich glücklich, dass sich die Katholische Kirche weltweit an die Aufarbeitung des Missbrauchs macht. Das heißt: Ich war glücklich, denn die Art und Weise, wie es geschieht, finde ich erstaunlich. Ich glaube, dass sich die Kirche immer noch in der Phase der Verdrängung befindet und dass sie noch lange nicht an den Wurzeln des Missbrauchs ist. Die Manie, mit der die Kirche früher auf dem Sechsten Gebot herumritt, ist nun der fixen Idee gewichen, man brauche nur eine «neue Sexualmoral» und ein bisschen Anschluss an den schönen neuen Sex in der schönen neuen Welt, und die Sache sei geritzt.
Ich halte das für Selbstbetrug.
Ich denke freilich auch, dass die Katholische Kirche eine «neue Sexualmoral» braucht. Aber ich bin entschieden dafür, dass sie erst einmal ihre Hausaufgaben macht, statt ambitioniert in der Gegend herumzuposen. Hausaufgabe ist:
Lokalisiere den Konflikt. (99 % der katholischen Christen fühlen sich mit einigem Recht nicht daran beteiligt. Ich auch nicht!)
Beschreibe das Verbrechen (Spare dabei unter keinen Umständen das Peinliche und politisch nicht Korrekte aus)!
Zeige a) den Weg auf, wie die Täter zuverlässig von Kindern und Jugendlichen ferngehalten werden; und zeige b) auf, wie verhindert werden soll, dass die nächste Generation von guten Onkels und Jugendfreunden ins Priesteramt kommt. Das darf man von einer Kirche erwarten, die jahrzehntelang zugesehen hat, wie sich Täter nicht auf dem Straßenstrich, sondern in der Sakristei bedienten. Das erwarte ich auch persönlich, und zwar hoch drei, der ich mir in Tagen des Ekels und der Depression etwas geschworen habe: «Das, was dir passiert ist, darf keinem Kind oder Jugendlichen passieren – nicht außerhalb der Kirche und schon dreimal nicht in ihren Mauern.»
Um Leserinnen und Lesern, die keine oder wenige Vorkenntnisse in Philosophie, Ethik und Theologie haben, einen guten Zugang zu ermöglichen, werde ich fremdsprachliche Begriffe erläutern, mich um eine möglichst un-theologische Sprache bemühen und meine Darlegungen mit vielen spannenden Beispielen untermauern. Etwas ungewöhnlich für ein populäres Sachbuch: Ich habe mich für Anmerkungen entschieden, die Sie am Ende des Buches finden: reichlich Stoff für alle, die es genauer wissen oder in die Tiefe gehen möchten.
Kapitel 1
Sex ja, Moral lieber nicht
Für viele Menschen, die von außen auf den Glauben und die Kirche schauen, ist Christsein identisch mit Moral. Stimmt zwar nicht ganz, ist aber so. Moral ist etwas, denken die Leute, worauf man sich besser nicht einlässt, weil man sonst keinen Spaß mehr am Leben hat. Das Erotische, die Verlockungen der Freiheit, das Irrationale der Leidenschaft, der sexuelle Kick, der alltägliche kleine Flirt, die Lust an der Lust – all das scheint Christen grundsätzlich verboten zu sein. Besser, man kommt dieser unmenschlichen Community nicht zu nahe.
Dass Moral etwas Lebensfeindliches, Freudloses, Schädliches sein könnte, hat niemand gründlicher zu Wort gebracht als Friedrich Nietzsche (1844–1900); er bezeichnete «die Moral des Christentums als Kapitalverbrechen am Leben.»18 Nun wuchs Nietzsche unter der Obhut von frommen Frauen und in einem besonders prüden evangelischen Milieu auf. Dennoch sind die negativen Konnotationen, die sowohl dem Christlichen als auch der Moral im Allgemeinen anhängen, im Kern Nietzsches beißender Kritik geschuldet. Nietzsche trug sie mit einigem Recht vor.
Dass viele Leute die Kirche heute als eine regelfixierte, tote Einrichtung betrachten, die kein Mensch mit Spaß, Lebensfreude und Lebendigkeit in Verbindung bringt, kommt nicht von ungefähr. Das traurige, regelfixierte Christsein, das Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert auffiel, ist zwar Geschichte, aber dennoch eine historische Altlast, die in den Köpfen derer, die lange nichts mehr mit einer heutigen Gemeinde zu tun hatten, weiterwirkt.
In der öffentlichen Meinung ist die Kirche zur doppelbödigen Kontrollinstanz, zum Sündendetektor abgesunken. Durch die Bank wird sie als vermintes Gelände wahrgenommen, in der jede Normabweichung vom Justemilieu mit Ausschluss bestraft wird, als sei ein Tattoo schon der Abfall von Gott.
Der Kirche steht eine bedeutende Transformation bevor: Gott hat sie als Glücksvorrichtung vorgesehen und nicht als neurotisch-neurotisierende Heilsmaschine. Die Kirche, die kommt (und kommen muss), wird sich vor der individuellen Freiheitsgeschichte der vielen Einzelnen verneigen, wird denen die Achtung nicht entziehen und denen den Anschluss nicht verweigern, die schwierige eigene Wege gehen. Sie wird aber auch ebenso unprätentiös wie standfest auf die offenbaren Optionen Gottes hinweisen; sie wird das Evangelium über die wilden Köpfe aller halten und in das leuchtende Ganze der Liebe einladen. Sie wird von Jesus (und nicht von abstrakten normativen Kopfgeburten) her «moralisch» sein. Sie wird dafür bekannt sein, dass man mit ihrer Hilfe in eine mitreißende Dynamik der Liebe kommt und einen Weg in die persönliche und soziale Seligkeit findet. Sie wird sich mehr von Freiheit und Glück als von der Sünde her definieren.
Aber sie wird deshalb die Fallen nicht übersehen, in denen das Menschliche verdunkelt, gar verschluckt werden kann.
Nietzsche träumte vom lebendigen, starken, stolzen Menschen. Diesen Traum muss die Kirche teilen und Menschen den Freiraum gewähren, sich zu entwickeln, genährt mit Kräften, die der Mensch aus sich heraus nicht hat – mit Gnade. Nietzsche träumte seinen Traum aber, indem er die Sünde als Realität ignorierte; er hielt sie für ein «jüdisches Gefühl und eine jüdische Erfindung»19. Nietzsche empfahl «Unbekümmertheit um die natürlichen Folgen der Sünde»20; er sah nur die vitale Schönheit und Kraft der gewissenlosen blonden Bestie: «Das Tier muss wieder heraus, muss wieder in die Wildnis zurück; römischer, arabischer, germanischer, japanischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger – in diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich.»21
Nun ist das Tier aus dem Käfig heraus. Der Rahmen individueller Freiheit ist weit gesteckt. Nicht gerade in Arabien, aber in der Anonymität der westlichen Welt darf sich jedefrau und jedermann sexuell weitgehend selbstverwirklichen, wie es ihr/ihm gefällt. Dafür steht das Wörtchen Toleranz22, das gesellschaftlich die Akzeptanz von Werthaltungen garantiert, die man selbst nicht teilt. Im Namen der Freiheit hat sich eine bunte Welt unterschiedlicher sexueller Präferenzen und Lebensstile herausgebildet, und Christen stehen mehr oder weniger ratlos daneben, so sie nicht – von schlechtem Gewissen bedrängt – mitmachen im Spiel der Diversitäten23.
Die Katholische Kirche ist länger schon um freundliche Annäherung bemüht und hat verschiedentlich versucht, eine sexualfreundliche Grundhaltung an den Tag zu legen. So kommentierte Papst Benedikt XVI. im Jahr 2010 seine Enzyklika «Deus caritas est»24 mit den Worten: «Wichtig ist, dass der Mensch die Sexualität als eine positive Gabe begreifen darf. Durch sie nimmt er selbst am Schöpfertum Gottes teil. Es stimmt, dass in der Christenheit immer wieder auch Rigorismen25 eingerissen sind und die Tendenz zur Negativwertung, mit der es zu einer Verbiegung, zu einer Verängstlichung des Menschen kam. Heute ist zu erkennen, dass wir wieder zur eigentlichen christlichen Haltung finden müssen, wie es sie in der Urchristenheit und in den großen Augenblicken der Christenheit gab: die Freude und das Ja zum Leib, das Ja zur Sexualität.»26
Was heißt das aber konkret?
In den Kirchen beider Konfessionen war das Sprechen über Sexualität lange Zeit eine vertrackte Sache, wie übrigens in anderen nichtchristlichen Hochkulturen auch. Um 1900 war es ein echter Tabubruch, als Sigmund Freud begann, Sexualität – und wie sie uns bestimmt – ans Licht zu holen. Es bedurfte Zeit und handfester Skandale, damit auch die Kirchen bei Sigmund Freuds Einsicht ankamen, wonach der Mensch im Allgemeinen und auch der kirchliche Amtsträger «eben ein unermüdlicher Lustsucher»27 sei.
Geht es den Frommen wie weiland der Psychoanalyse? «Was man von uns verlangt», meinte Sigmund Freud 1907, «ist doch nichts Anderes, als dass wir den Sexualtrieb verleugnen. Bekennen wir ihn also.»28 Ironischerweise war Freud, aus der Distanz betrachtet, der Vertreter einer eher pessimistischen Kulturtheorie, betrachtete er doch die Sublimierung29 des Sexualtriebs als Voraussetzung von Kultur. Insofern war er «moralischer» als Wilhelm Reich (1897–1957), der andere große Sexualtheoretiker, der in der «neurotischen» Unterdrückung des Sexualtriebs das Elend und den Niedergang der Welt sah. Wilhelm Reich nun hatte, je älter er wurde, eine Schwäche für das Christentum, insbesondere für den Katholizismus, von dem er sich erhoffte, er werde «seine Haltung zur natürlichen Genitalität revidieren müssen und … lernen, zwischen Pornographie, ‹Wollust› und der natürlichen Umarmung zu unterscheiden.»30
In einem Interview von 1953 bekannte Wilhelm Reich von der christlichen Gedankenwelt: «Ich glaube nicht an diese Dinge. Aber ich verstehe sie gut. Die Christen haben die tiefste Perspektive, die kosmische.»31
Ein Pfarrer meinte vor kurzem im Privatgespräch: «Die Kirche hat versucht, die Welt in ein Kloster zu verwandeln. Die Welt ist aber kein Kloster … und wird nie eines werden!» Die Kirche – gescheitert an der idealistischen Überhöhung von Liebe?
Alle Welt ist auf die Lust gekommen. Und es scheint, als sei auch die Kirche etwas unsanft auf dem Bettvorleger der Biologie gelandet. Sind wir nicht alle nur hormongesteuerte Triebwesen – und manchmal halt auch ethische Zeitbomben? Zwar wissen wir nun hinreichend, dass Sex an sich keine Sünde ist, aber wir wissen auch, in welchem Ausmaß er unser Leben bestimmt, oft gegen die Oberfläche unseres rationalen Wollens und menschlichen Könnens.
Sigmund Freud hat 1917 von der dritten großen Kränkung des Menschen32 gesprochen. Die erste habe darin bestanden, dass der Mensch sich mit Kopernikus nicht mehr als Mittelpunkt der Welt empfunden habe. Die zweite große Kränkung sei es gewesen, dass der Mensch mit Darwin gesehen habe, dass er aus der Tierreihe hervorgegangen sei. Die dritte große Kränkung aber sei es nun, dass die Psychoanalyse ihn mit der prekären Einsicht, konfrontiere, «[…] dass das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus.»
Ist die Stunde gekommen, pragmatischer und weniger idealistisch mit der Sexualität umzugehen? Wie könnte eine «neue Sexualmoral» aussehen? Wer sollte darüber sprechen, wer sind die Beteiligten?
Kapitel 2
Wo finde ich, was gutes Leben ausmacht?
Gläubige Menschen werden vielleicht sagen: «In der Heiligen Schrift – und nur dort.» Rationalisten werden antworten: «In der Vernunft – und nur dort.» Ökologen empfehlen die Natur und das Natürliche. Politiker schlagen vor: «In dem, was die Mehrheit will.» Psychologen sagen: «In dem, was nach der Therapie kommt.»
Die Frage, wie wir an das Gute herankommen und wen wir nach den Maßstäben des Guten fragen sollen, lässt viele Antworten zu. Vor kurzem bin ich einem Theologen begegnet, der offenkundig der Auffassung war, dass «Moral» eine Privatsache sei. Er meinte: «Du glaubst doch nicht wirklich, dass man den Leuten noch sagen sollte, was sie zu tun haben?! Das wissen die schon selber!» Ich war so erstaunt, dass ich nicht spontan darauf reagieren konnte.
Natürlich muss «Moral» durch das Nadelöhr der Subjektivität. Menschen müssen aus sich heraus handeln, müssen mit Herz und Verstand ihr Leben in die Hand nehmen und nicht wie Roboter einem kollektiven Schema folgen. Sonst käme das gute Leben nicht aus der Mitte der Person; es käme über einen außengesteuerten Automatismus zustande, wie in China33, wo es heute schon Kameras gibt, die per Gesichtskennung unkorrektes Verhalten erkennen und auf digitalem Weg Sanktionen einleiten. Dennoch wehrte sich etwas in mir, auch noch die Maßstäbe des Handelns im einzelnen Menschen zu verorten. Das hieße ja auch: in mir. Ich kenne mich. Und bin gewarnt. Es scheint ja gerade das Problem zu sein, dass sich immer mehr Menschen nicht an einer gemeinsamen Idee guten Lebens orientieren, sondern sich wie der Derwisch um die eigene Achse drehen: Ich bin so frei!
Individualismus ist die Signatur unseres Zeitalters: Solange wir noch nicht in China sind, macht jeder sein eigenes Ding, auch (und gerade) in moralischer Hinsicht.
Moral hat aber offenkundig mit einem gemeinsamen Guten oder einem gemeinsamen Weg zum Guten zu tun. Denken Sie an den FC Liverpool! 3:0 hatten die «Reds» im Hinspiel gegen Barcelona verloren, im Rückspiel mussten sie auf zwei der weltbesten Stürmer verzichten, eine hoffnungslose Ausgangslage gegen Messi & Co. Aber Liverpool gab nicht auf und besiegte Barcelona im Rückspiel mit 4:0. Das «Wunder von der Anfield Road» führte dazu, dass man in der internationalen Presse stets das Gleiche las: Die Elf von Jürgen Klopp habe über eine «Bombenmoral» verfügt. Und in der Tat hatten die Jungs einen so gewaltigen Teamspirit, dass sie alle Nachteile und Ausfälle kompensieren konnten und einen strahlenden Sieg einfuhren.
Wenn man von der «Moral» des FC Liverpool spricht, kommt niemand auf die Idee, dass sich die Spieler geflissentlich an die sexuellen Verkehrsregeln halten, obwohl das auch nicht schlecht wäre. «Moral» meint hier eine in allen Spielern tief verankerte Leitidee, die zu sehr schönen Ergebnissen führt und manche Nachteile wettmacht.
Damit haben wir schon zwei wichtige Elemente gesehen, die für eine neue Moral wichtig wären. Moral ist zunächst einmal etwas, das für mehr als einen Menschen verbindlich ist. Eine Moral für nur einen Menschen ist ein Neujahrsvorsatz. Hier aber ist etwas, das mehrere Menschen miteinander verbindet und für etwas Gutes nach vorne reißt.
Dann sehen wir, dass Moral offenkundig mit menschlichen Defiziten zu tun hat. Man braucht sie notwendig, um Schwächen und Nachteile zu kompensieren, sonst gehen die Dinge schief. Auch ein schwächerer Spieler, der sich durch sein persönliches Ethos nahtlos in eine gute allgemeine Moral einfügt, kann zum entscheidenden Faktor werden. Denken Sie an irgendeinen Mittelklassestürmer, der mannschaftsdienlich spielt und sich nicht zu schade ist, Verteidigungsaufgaben zu übernehmen. Moral heißt: für das Ganze und vom Ganzen her zu denken. Weil das so ist, bleibt ein schales Gefühl zurück, wenn man sieht, dass bestimmte Spieler das Niveau vom Platz nicht auf das Leben übertragen können, sei es, dass sie goldbelegte Steaks verzehren, Fans verprügeln, Verträge brechen oder in Hotelzimmern die nächstbeste Frau vergewaltigen. Unsere Hochachtung gilt deshalb Spielern, die sich auf dem Platz wie im Leben Hochachtung verdient haben.
Gibt es das Gute vielleicht nur in relativer Dosis?
Überdies ist der Sieg in einem Fußballspiel etwas nur relativ Gutes – sehr gut für die Gewinner, gar nicht gut für die Verlierer. Heute gibt es eine große Debatte über die Frage, ob es vielleicht ausschließlich «relativ Gutes» gibt – und ob wir alle Dinge nicht vielleicht besser nur noch pragmatisch34 regeln sollten.
In dieser Weise könnte man Erich Kästner (1899–1974) missverstehen. «Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es»35, hatte er in einem berühmten Epigramm verlauten lassen. Wahrscheinlich meinte Kästner das nicht im wörtlichen Sinn. Das Gute muss es nämlich auch unabhängig davon geben, ob es von einem, von vielen, von allen Menschen oder von gar keinem Menschen tatsächlich vollbracht wird. Dass es etwas Gutes ist, wenn man ein Kind nicht schlägt, gilt auch dann, wenn alle ihre Kinder verprügeln. Und dass der Stopp des Klimawandels etwas Gutes ist, auch wenn ihn die gesamte Menschheit nicht auf die Reihe bekommen sollte, ist auch klar. Was Kästner wollte, liegt auf der Hand: Er wollte, dass möglichst viele Menschen sich beispielsweise zu einer prügelfreien Erziehung bekehren oder ihre Fernreisen reduzieren, dass also faktisch (und nicht nur theoretisch) das Gute vollbracht wird bzw. das Böse nicht geschieht. Denn vielfach wissen wir ja durchaus, was das Gute ist (und nicht nur, was gut für uns ist). Es wird aber nicht in die Tat umgesetzt, weil wir zu faul oder zu feige sind, weil wir verdrängen und die Augen verschließen und immer noch eine Ausrede oder eine clevere Weise der Delegation parat haben: Sollen die andern mal!
Es gibt das Gute. Menschsein heißt, es mit Leidenschaft für sich und mit Augenmaß für die anderen anzustreben. Weil das aber schwer ist, gibt es einige flankierende Maßnahmen, damit wir individuell und gemeinsam nicht vom Weg abkommen. Diese flankierenden Maßnahmen, die einen Wert beschützen und das Gute in realistische Reichweite bringen, nennen wir «Moral». Man könnte auch sagen: Moral ist ein Artenschutzprogramm für die gefährdete Gattung Mensch. Moral ist nicht dazu da, Nachbarn zu beobachten, Beachwear zu beurteilen oder Kinder zu dressieren.
Flankenschutz für das Gute
Schauen wir nun auf die Sexualmoral – sie ist ja unser Thema. Was ist das Gute daran, um welche Werte geht es, und was müssen wir auf welche Weise beschützen, damit es nicht vor die Hunde geht?
Vielleicht sollten wir aber zunächst wissen, was Sexualität überhaupt ist. Das Wort gibt es erst seit etwa 1820; ein Botaniker hat es zuerst verwendet, weshalb wir lustiger Weise heute noch von Fort-Pflanzung sprechen. Das lateinische Wort Sexus bedeutet Geschlecht, was Wikipedia zur Definition veranlasst, Sexualität im engeren biologischen Sinn bezeichne «die Gegebenheit von (mindestens) zwei verschiedenen Fortpflanzungstypen (Geschlechtern) von Lebewesen derselben Art, die nur jeweils zusammen mit einem Angehörigen des (bzw. eines) anderen Typus (Geschlechts) zu einer zygotischen Fortpflanzung fähig sind. Hier dient die Sexualität einer Neukombination von Erbinformationen, die aber bei manchen Lebensformen auch durch der Sexualität ähnliche, nicht polare Rekombinationsvorgänge ermöglicht wird.» Mit Zygote, das weiß man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, ist eine befruchtete Eizelle gemeint, die nach der Vereinigung der 23 Chromosomen der weiblichen Eizelle mit dem männlichen Spermium (ebenfalls mit 23 Chromosomen) über einen vollständigen Chromosomensatz verfügt. Man kann auch sagen: Ein Mensch entsteht.
Dies ist ein unerhörter Umschlag in der Qualität. Bei einigem Nachdenken wird man mit dem Wunderbaren konfrontiert, das darin besteht, dass aus dem genetischen Cocktail zweier gegengeschlechtlicher Individuen ein neues Individuum entsteht, das nicht die Summe seiner Teile, sondern etwas völlig Neues, nie Dagewesenes ist. Stein + Stein wird niemals ein Lebewesen; Fleisch + Fleisch bringt niemals Geist hervor, schon gar nicht ein Wesen, das Person ist und «Ich» sagt.
Wir können das nicht erklären und werden es nicht erklären können – es ist nämlich ein Geheimnis und kein Rätsel. Die abendländische Denktradition verwendet für diesen bleibenden Rest an Unerklärlichem den Begriff «Seele» und sagt, sie sei unmittelbar von Gott geschaffen, nicht von den Eltern «hervorgebracht»36. Das klingt in modernen Ohren fremd, aber es will sagen, dass das Menschlichste am Menschen, seine geistige Identität, seine Beseelung37 mit Personalität und Würde, unmittelbar von Gott kommt. Gott sagt «Du» zu einem Wesen, das ein «Ich» ist und zu Gott «Du» sagen kann38.
Die «Seele» eines Menschen kann weder das Produkt einer evolutiven Entwicklung aus der Materie noch das Ergebnis einer genetischen Verbindung von Vater und Mutter sein. Die Redeweise: «Ich habe ihr ein Kind gemacht», ist ebenso unbedacht wie geschmacklos. Was Genetiker konstatieren, verstärkt die Kirche, indem sie das bloß Biologische übersteigt und feststellt: «Von dem Augenblick an, in dem die Eizelle befruchtet wird, beginnt ein neues Leben, welches weder das des Vaters noch das der Mutter ist, sondern das eines neuen menschlichen Wesens, das sich eigenständig entwickelt. Es würde niemals menschlich werden, wenn es das nicht schon von diesem Augenblick an gewesen wäre.»39
So ist das Geheimnis des Lebens etwas, das in seinem Kern schon in einem doppelten Licht erscheint: Einerseits hat der natürliche Aufwand an Sexualität biologisch betrachtet nur ein einziges Ziel und einen einzigen Sinn: den Fortbestand der Spezies homo sapiens40 zu sichern. Andererseits rührt der Mensch im schöpferischsten Moment seiner Existenz an Gott, den Schöpfer; er wird ihm ähnlich41.
Wenn Gott etwas schafft, dann ist es in einem radikalen Sinn «neu». Vorher war es nicht da. Gott spricht, und es ist. Und Gott ist diesem Geschaffenen innerlicher, als es dem Geschaffenen je möglich sein wird, auch nur seiner selbst inne zu sein. Wenn Michelangelo den «David» aus feinstem Carrara-Marmor hervorschält, verändert er etwas schon Seiendes in eine wunderbare, nie dagewesene Form. Aber Michelangelos David weiß nichts von Michelangelo. Michelangelo könnte dement werden und von seinem David nichts mehr wissen. Wenn ein Mann und eine Frau ein Kind zeugen, dann sind sie nicht Schöpfer des Kindes, aber etwas sehr Großes, ja Gott irgendwie Ähnliches: Das Kind, die Frucht ihrer Liebe, wird «Mutter» und «Vater» zu ihnen sagen und lebenslang in unauflöslicher Beziehung zu denen sein, die ihm Leben «schenkten», ohne dass dieses Kind deshalb seinen Hervorbringern auch nur im Geringsten gehören würde. Das zu betonen ist heute sehr wichtig.42
Es hat den Anschein, als verlören wir gerade kollektiv das Gefühl dafür, dass Menschen keine Produkte sind – und ich denke jetzt nicht nur daran, dass man in Japan gerade dabei ist, Menschen und Affen zu kreuzen43; ich denke auch an das vielsagende Wort «Reproduktionsmedizin», das, wie ich finde, in das Wörterbuch des Unmenschen gehört.
Ich erinnere mich gut, wie ich vor einigen Jahren durch die vormalige DDR fuhr und mir ein Hinweisschild ins Auge sprang: TPG Nielebock. TPG stand für Tierproduktionsgenossenschaft. Mir kam das damals schon wie das Realsymbol einer gottlosen Ideologie vor. Leben – tierisches, schon gar menschliches Leben – kann man nicht «produzieren». Wir sind nicht Gott.
Die Biologie nicht überspielen
Bevor wir aber von solchen Dingen sprechen, sollten wir uns noch einmal die biologische, man könnte auch sagen animalische Seite der Sexualität genauer anschauen. Es geht um die menschliche Erfahrung, dass wir psychisch in mancher Hinsicht Getriebene sind. Bestimmte Dinge müssen wir scheinbar unbedingt haben, bevor wir sie rational verstehen und willentlich wollen.
Ohne jetzt auf die seit Sigmund Freud ins Uferlose gehende Triebtheorie näher einzugehen, kann man sagen: Es gibt gewisse Grundbedürfnisse – Leben wollen, satt werden, Sex haben –, denen machtvolle vorrationale Antriebe entsprechen: der Machttrieb, der Selbsterhaltungstrieb, der Sexualtrieb. Wilhelm Reich setzte die Dominanz des Triebhaften besonders hoch an: «Es ist vollkommen logisch, dass der Trieb selbst nicht bewusst sein kann, denn er ist dasjenige, was uns regiert und beherrscht. Wir sind sein Objekt. Denken wir an die Elektrizität. Wir wissen nicht, was und wie sie ist. Wir erkennen sie nur an ihren Äußerungen, am Licht und am elektrischen Schlag …»44
Rein biologisch betrachtet, setzt die Natur alles Mögliche und Trickreiche in Gang für den folgenreichen kleinen Akt, den wir in unserem intellektuellen Hochmut glauben im Griff zu haben. Vom Flirt in der U-Bahn bis «bis dass der Tod uns scheidet» umgibt der Mensch die Vorgänge, die zu einer Zygote führen, mit epischen Geschichten. Es ist der Stoff, aus dem die Dramen und die Komödien sind. Männer werben um Frauen wie um ein Königreich und riskieren dabei Kopf und Kragen. Und Frauen zeigen auf bezaubernde Weise, dass sie es wert sind.
Und es kommt hinzu: Sex sells. Ganze Industrien leben von der Verführung und hoffen, dass der große Strom des Lebens, von dem sie parasitär profitieren, nicht abbricht; und dass in der winzigen Zygote zusammenfindet, was zusammengehört.
In biologischer Perspektive ist Kern, Ursprung und Ziel der menschlichen Geschlechtlichkeit der Erhalt der Gattung. Man muss das extra betonen, denn wenn man vergisst, wozu die Natur die Lust und überhaupt das ganze Triebwerk des Geschlechtlichen braucht, kommt man auf so verwegene Gedanken wie die, Sex wäre eine Art Spaßbeigabe zum Menschsein, ein Extra-Toy zur Grundausstattung, dessen Funktionalität man durch Angebote aus dem Versandhandel noch aufpeppen kann.
Dass Sex, wenn er sich nicht in Formen fremdbestimmter Gewalt ereignet, Spaß macht, weiß jedes Kind. Durch die technische Regulierbarkeit von Empfängnis haben wir aber fast schon verlernt, was für ein überwältigendes Wunder in seinem Inneren verborgen ist: das Geschenk neuen Lebens. Sex ist die lustvolle Erinnerung daran, dass wir nicht aussterben sollen. Durch die Sexualität geht der Strom des Lebens mitten durch unsere partikuläre Existenz hindurch und nimmt uns mit hinein in eine gewaltige Bewegung der Natur. «Niemals, so lange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören» (Gen 8,22). Im selben archaischen Gleichmaß werden Menschen von Vätern und Müttern geboren, sie reifen heran zu Müttern und Vätern, schenken Kindern Leben, die wiederum zu Vätern und Müttern heranreifen, um das uralte Spiel des Lebens in immer neuen Zyklen fortzutragen durch gute und böse Tage, und kämen auch Hungersnöte, Kriege oder Verfolgungen.
Das Leben will, dass das Leben nicht aufhört. «Denk nicht, sondern schau!»45, mahnte Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus. Das Wunder ist größer als seine Begründungen.
Nicht grundlos sind die kostbaren Entfaltungen menschlicher Geschlechtlichkeit umgeben mit den sie umhegenden Schutzmächten von Scham46, Liebe und Gerechtigkeit. Ohne Scham wird das Heilige banal, ohne Liebe wird die Hingabe zum Geschäft, und ohne Gerechtigkeit wird das Wunder der geschlechtlichen Bezogenheit von Männern auf Frauen (und umgekehrt) zum Gegeneinander, zum Herrschaftsverhältnis und zur Machtfrage, so, dass Friedrich Engels 1884 feststellte: «Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das männliche.»47
Hier sind wir an der Wurzel des Feminismus: Frauen hat man ja gerne als «das schwächere Geschlecht» klassifiziert, was Unsinn ist – sie haben ihre eigene Macht: Werden sie von Männern nicht geachtet, geehrt und geschützt, entziehen sie sich. Es versiegt der natürliche Strom des Lebens; Männer mutieren zu Gewalttätern, und Frauen verweigern sich dem Spiel.
Kapitel 3
Für eine Ökologie des Menschen
Es gibt viele Gründe, warum wir den Zusammenhang von Liebe, Sexualität und Fortpflanzung heute auseinandergebrochen und fragmentiert vorfinden – und es ist gut, die Ursachen dafür zu erforschen. Hans Urs von Balthasar (1905–1988) gab vor Jahren einem seiner Bücher den Titel «Das Ganze im Fragment»48, weil er es wichtig fand, dass wir über den Teilen das Ganze nicht aus dem Blick verlieren; glücklicherweise seien wir in der Lage, noch aus den Scherben das heile Gefäß zu rekonstruieren und den «Torso im Geist vom Unversehrten her»49 lesen zu können.
Festzustellen ist: Mitten im ökologischen Zeitalter sind wir so frei, uns von der Natur zu emanzipieren und das gigantische Trieb-Werk, das uns zueinander und in immer neue Individuationen50 des Lebens treibt, zu dekonstruieren und neu zusammenzubasteln – in modo dilettante. Wir trennen männliche Welten von weiblichen Welten, die Lust von der Treue, die Treue von der Liebe, die Liebe vom Kinderkriegen, das Kinderkriegen vom Mutter- und Vatersein und schließlich auch noch politisch die Erziehung vom Elternhaus. Und wundern uns, wenn im öffentlichen Raum Reibung entsteht.
Nicht nur im Politischen begegnet uns der eklatante Verstoß gegen das, was wir mit gutem Recht als natürlich empfinden und darum schützenswert nennen. So alt die Leihmutterschaft kulturgeschichtlich auch ist, so bleibt sie doch das Beispiel eines Verbrechens an Mutter und Kind, auch wenn sich die Gesellschaft in einer Art Rückfall in die Barbarei gerade aufs Neue damit anfreundet, weil sie in der Yellow Press gehypt und in prominenter Besetzung vorgetragen wird.
Ein Elton John darf in die Kamera lächeln und von «seinem» Kind Zachary sagen: «It’s going to be heartbreaking for him to grow up and realize he hasn’t got a mummy. But he’s so happy. I’ve never seen a more contented child.»51 Keiner schreit auf. Auch der so zufriedene kleine Zachary wird eines Tages feststellen, dass er als Sonderanfertigung bestellt, gekauft, bezahlt und nicht natürlich geboren wurde. Natürlich hat Zachary eine Mummy; nur wurde er in einem barbarischen Akt um seine Mutter betrogen. Beschädigt wurde die Menschenwürde von gleich drei Menschen: dem Kind, seiner genetischen Mutter und der Frau, der das Kind, das sie für Geld austrug, vom Herzen gerissen wurde.
Papst Benedikt hat vor dem Deutschen Bundestag eine wegweisende Rede gehalten, in der er die «Natur» des Menschen verteidigte – gegen jene, die sagen: Es gibt keine gemeinsame Natur der Gattung Mensch. Interessanterweise kommt das Wort «Natur» vom lateinischen Wort nasci, was so viel bedeutet wie «geboren werden». Geboren werden müssen wir immerhin noch. Die technisch herstellbare Verwandlung einer Frau in eine künstliche Gebärmutter sollte uns lehren, wohin die Humanität kommt, wenn wir die Fabrizierbarkeit des Möglichen auf den Menschen ausdehnen.
Papst Benedikt meinte: «Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit.»52
Häufig sind die Gegner der Rede von der Vorgegebenheit einer gemeinsamen menschlichen Natur identisch mit solchen, die sonst bei jeder Gelegenheit der Natur das Wort reden und sich einem ökologischen Denkansatz verschrieben haben. Überall wird Arterhaltung betrieben, werden natürliche Lebensräume geschützt, wird dafür geworben, dass der Mensch sich harmonisch in seine Umwelt einfügt. Aber der Mensch selbst – er soll keine Natur haben, kein Habitat, keinen natürlichen Lebensraum, keine spezifischen Lebensbedingungen, in denen er sich optimal entfalten kann?
Das wäre höchst seltsam.
Zerstörte natürliche Zusammenhänge werden leider erst über lange Zeiträume hinweg in ihren Auswirkungen sichtbar. Wie hässlich Skipisten sein können, wussten wir 1975 noch nicht. Wissen wir heute schon, ob die vielfältigen Abschiede von traditionellen «natürlichen» Familienmustern dauerhaftes menschliches Glück bewirken? Oder bezahlen wir die Freiheit, in der Menschen sich heute sexuell und sozial neu erfinden, im Abstand von ein/zwei Generationen mit der Bitterkeit der Vielen, die ausgeschieden wurden aus den Prozessen individueller Optimierung? Wird es am Ende zu einer Erbfolge menschlicher Tragödien kommen, in der Verwundete und Verlassene immer mehr Wunden schlagen und immer neue Akte des Verlassens erzeugen? Im Jahr 2040 werden wir es wissen.
Wer beim Begriff «Natur des Menschen» freilich an Bärenfell, Keule und eine Art Urzustand denkt, ist falsch beraten. Der Mensch ist das einzige Wesen der Schöpfung, das Distanz zu sich und seinen Hervorbringungen hat. Der Mensch hat Geist und Vernunft; er kann denken. Die Natur des Menschen, das Menschengemäße, ist nicht der schiere Naturzustand, in dem die Tiere leben und sich instinktiv zueinander verhalten oder übereinander herfallen. Die «Natur» des Menschen ist die kulturierte Natur, die gehegte, erhobene, aber nicht zerstörte Umwelt – ist also eher der Garten als die Wildnis, eher die Zivilisation als das Chaos. Das Paradies stellen wir uns nicht als ungezähmte Wucherung vor, sondern als einen organischen Zusammenhang der Elemente mit dem Menschen, in dem es einfach gut ist zu sein. Dass der Mensch das Schöne aus seiner Welt gewissermaßen herausholt, ist ihm natürlich. Das Gute ist nicht einfach die «natürliche» Ingredienz einer vom Menschen getrennten materialen Welt. Das natürlich Gute scheint in der Beziehung des Menschen zu allem auf, womit er achtsam und klug umgeht.
Bleiben wir noch einen Moment beim Bild vom Garten. Die sorgsame Hand des Gärtners, der hier etwas beschneidet, dort etwas ausspart, hier etwas Blühendes zur vollen Entfaltung bringt, ist nicht die Zerstörung der Natur des Gartens, sondern gerade seine Entfaltung. Und wenn im Garten der Natur auch noch eine Skulptur ihren Platz findet oder jemand ein Kultsymbol – ein Wegkreuz, eine Bergkapelle – integriert hat, dann werden wir nicht nur von etwas rätselhaft Schönem ergriffen, sondern rühren an eine Kultur, die um ihr Woher und Wohin weiß und auf diese Weise zu sich gekommen ist. Der Ruf nach dem Zurück in eine vorkultische, vorkulturierte Natur ist ein Weg der Illusionen; er führt sowohl in Depression als auch in Barbarei.
Das Nachdenken über das Gute und woran man es messen könnte, begann in der Philosophie des griechischen Altertums – interessanterweise mit einem Vergleich der eigenen Lebensweise mit den unterschiedlichen Sitten der umliegenden Völker, über die man sich nicht einfach erheben oder verächtlich äußern wollte. Stattdessen suchte man nach einem allgemeingültigen Maßstab, wonach man Handlungsweisen bewerten konnte. «Diesen Maßstab nannten sie ‹Physis› – Natur. An diesem Maßstab gemessen war zum Beispiel die Norm der Skythen-Mädchen, sich eine Brust abzuschneiden, schlechter als die entgegengesetzte Norm, dies nicht zu tun.»53 Heute wie damals finden wir diesen Brauch widernatürlich.
An dem berühmten Beispiel kann man eine weitere Unterscheidung entdecken: Es gibt nämlich nicht nur eine Unterscheidung gut/schlecht, sondern auch eine Unterscheidung gut/böse. Die Skythen-Mädchen handelten gewiss nicht böse, obwohl sie etwas objektiv Schlechtes vollbrachten. Sie handelten möglicherweise sogar aus sehr edlen Motiven, als sie sich körperlich verstümmelten. Wenn wir ihren Entschluss, sich die Brust abzuschneiden, trotzdem «schlecht» nennen, so nur in einem außermoralischen Sinn.
Kann man denn immer wissen, was gut und böse ist?
Ist es immer so klar, was gegen die Natur (also natürlicherweise Unrecht) ist, bzw. worauf Menschen ein Natur-Recht54 haben? Immer wieder wird auf die Verschiedenheit der Kulturen und Lebensentwürfe hingewiesen, so dass man den Eindruck gewinnen muss, was hier gut ist, ist in einem anderen Kontext böse. Aber wenn bestimmte Handlungsweisen nicht mehr geächtet werden können, weil wir angeblich nicht wissen können, ob sie böse oder schlecht sind, zerfällt unsere Kultur. Es muss etwa immer absolut böse und absolut schlecht sein, wenn Kinder geschlagen, vernachlässigt, verführt oder als Objekte der Begierde missbraucht werden. Im näheren Kulturvergleich ergibt sich hier auch gar keine wirkliche Differenz. «Wenn wir hören, dass Eltern ein kleines Kind, weil es versehentlich ins Bett gemacht hat, grausam misshandeln, dann urteilen wir nicht, diese Handlung sei eben für die Eltern befriedigend, also ‹gut›, für das Kind dagegen ‹schlecht› gewesen, sondern wir missbilligen ganz einfach das Handeln der Eltern, weil wir es in einem absoluten Sinne schlecht finden, wenn Eltern etwas tun, was für ein Kind schlecht ist. Und wenn wir von einer Kultur hören, wo dies der Brauch ist, dann urteilen wir, die Gesellschaft habe eben einen schlechten Brauch.»55
Ein gutes Argument gegen jene, die sagen, es gäbe keine absoluten Werte; in der einen Kultur sei das eben gut, in der nächsten jenes; alle Werturteile seien durch den kulturellen Kontext bedingt, daher notwendig relativ, bietet die Geschichte vom Umgang Jesu mit der Ehebrecherin in Joh 8. Als Jesus die beschuldigte Frau schützte, folgte er weder der zeitgenössischen Lesart des Gesetzes noch dem kulturellen Mainstream derer, die schon die Steine in der Hand hielten.
Dass es «eine Wirklichkeit jenseits aller Aussagen»56 über sie in den verschiedenen Kulturen, Zeitaltern, Religionen und Philosophien gibt, hat C.S. Lewis in ein uraltes konfuzianisches Wort gefasst: Tao nennt er das schwer fassbar Vorgängige, die Natur, den Weg, die Bahn, «die Art, wie das All sich bewegt, die Weise, wie die Dinge für immer, still und leise in Raum und Zeit auftauchen»57 – objektive Wirklichkeit, auf die hin wir uns verhalten müssen, wobei unsere Haltungen «bezogen auf das Wesen des Alls und auf das, was wir selber sind, wirklich wahr und andere wirklich falsch sind. […] Ich persönlich bin nicht gern mit kleinen Kindern zusammen; sofern ich innerhalb des Tao spreche, anerkenne ich das als einen Mangel in mir – nicht anders, als wenn jemand zugeben muss, dass er unmusikalisch oder farbenblind ist.»58
An anderer Stelle seines Buches nennt C.S. Lewis Tao das, «was andere das Naturgesetz oder die überlieferte Moral oder das Erste Prinzip der Praktischen Vernunft oder die Grundwahrheiten nennen mögen»59, und er verwirft den Gedanken, es handle sich dabei um «ein Wertsystem innerhalb einer Reihe von Wertsystemen. Es ist die einzige Quelle von möglichen Wertsystemen.»60 Treue ist gut. Lüge ist schlecht. Mord ist ein Verbrechen. Das Böse ist böse, das Gute gut.
«Kannst du ein rechtschaffener Mensch sein, wenn du nicht gerecht bist, indem du den Dingen die ihnen gebührende Achtung erweist? Alle Dinge wurden für dich erschaffen, und du wurdest geschaffen, sie ihrem Wert entsprechend zu würdigen»61, sagt der englische Metaphysiker und Poet Thomas Traherne (1636–1674).
Deshalb muss man die pauschale Missachtung eines gemeinsamen Bestandes von ersten Prinzipien und daraus resultierenden flankierenden Maßnahmen zum Schutz guten Lebens – also von Moral – durch die Verlagerung des Moralischen ins rein Subjektive als inhuman und schädlich zurückweisen. Es gibt einen Anspruch der Wirklichkeit an uns, auf die wir gemeinsam antworten müssen. «Gerade bei den menschlichen Grundwerten wie Ehrlichkeit, Recht, Treue, Friedfertigkeit oder Fürsorglichkeit gibt es […] keinen Subjektivismus, keinen Relativismus und keine Beliebigkeit und Anpassung an irgendeinen Zeitgeist. Es darf keine Verdunkelung und Verunsicherung der Evidenz von Werten wie Gleichheit der Menschen, gleiche Würde der Geschlechter und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens geben.»62
Die Falle: der naturalistische Fehlschluss
Ein Denken, das die menschliche Freiheit durch ein Tao, eine vorgängige «Natur», bestimmt sein lässt, ist häufig der Kritik unterzogen worden. Man könne – heißt es – sogenannten naturalistischen Fehlschlüssen nicht entgehen. Ein naturalistischer Fehlschluss ist eine logisch nicht erlaubte Ableitung von Normen aus Tatsachen. In der Tat kommt dieses Argumentationsmuster häufig vor – gerade in der aktuellen Debatte über Homosexualität. Weder geht alleine aus der Tatsache, dass zur Zeugung von Kindern die geschlechtliche Verbindung von Mann und Frau erforderlich ist, notwendig (also quasi durch das Recht der Natur) hervor, dass andere Formen von Geschlechtsverkehr verboten sind. Noch beweist die Tatsache, dass homosexuelles Verhalten auch im Tierreich vorkommt, dass homosexuelle Praxis auch für Menschen ein Naturrecht und eine schöne Option für alle Interessierten ist.
Viele Moraltheologen haben deshalb einer Argumentation aus der Natur der Dinge den Abschied gegeben, so auch der Jesuit Herwig Büchele: «Zum einen gewinnt ein solches Normensystem im gesellschaftlichen Raum einen autoritären macht- und zwangsbestimmten Gesetzescharakter, der nur allzu oft etablierten Mächten zur Rechtfertigung ihrer Herrschaft dient. Zum anderen ermöglicht dieses System einer ‹toten Einheit› nur die Reproduktion des Gewesenen, des Gleichbleibenden, worin kein Platz für Kreativität, Überraschung und Neues ist. Wandlung von Mensch und Gesellschaftsstruktur in ein Neuwerden erhält keine Chance.»63
Gewiss ist mit dem Naturrecht in der Vergangenheit schlimm gesündigt worden – so wie es Büchele benennt. Man sollte schon erinnern, dass auch Sklavenhaltergesellschaften naturrechtlich begründet wurden. So groß wie diese Gefahr ist aber auch die andere – die der Verabschiedung vom Tao und der Auslieferung des Ethischen an subjektive Willkür und die instrumentelle Vernunft in den Händen derer, die wissen, was gut ist für den Menschen und was nicht.
Und überhaupt: Woher wissen wir denn, dass es in den geschaffenen Dingen nicht ein von Gott Gewolltes gibt, dem gerecht zu werden menschlich ist, weil es mein ureigenes Gutes ist, das ich nicht hätte besser erfinden können? Was wäre denn über Schöpfung und mein eigenes kreatürliches Dasein noch zu sagen, wenn wir darin nicht die Handschrift Gottes erkennen könnten? Freilich muss man sich von einem Naturbegriff der «toten Einheit» verabschieden. «Das Paradigma von Sein», sagt Robert Spaemann, «ist […] für den Menschen Existieren, d. h. das Leben von Lebewesen und nicht das Herumliegen von Leichen.»64
Der Mensch ist ein lebendiges Wesen, das Geschichte hat und mit Vernunft und Willen auf das Gute – sein Glück – aus ist. Die Begegnung mit der Natur ist nicht die Wahrnehmung eines von Sachen ausgehenden Diktats, sondern ein Akt der vernünftigen Aneignung. Die Vernunft ist nicht das Andere von Natur; sie ist selbst natürlich und gehört daher in das Naturrecht hinein. So kann Joseph Ratzinger vom Sein des Menschen legitimerweise sagen, dass es «selbst Werte und Normen in sich trägt, die zu finden, aber nicht zu erfinden sind.»65
Der erste und radikalste Leugner dessen, dass der Mensch eine Natur hat, war Jean-Paul Sartre (1905–1980). In seinem epochemachenden Essay «Ist der Existenzialismus ein Humanismus?»66 hat der französische Philosoph als «das erste Prinzip des Humanismus» folgende These aufgestellt:
«Es gibt keine menschliche Natur» – warum? – «… weil es keinen Gott gibt, der sie entworfen haben könnte»67. Und er legt noch nach: «Es gibt keine Zeichen in der Welt»68. Die Welt ist für Sartre tumber Stoff, sonst nichts – Material für die Freiheit des Menschen.
Nun hat bereits der deutsche Philosoph Josef Pieper (1904–1997) die These von Sartre einfach umgedreht: Was aber, wenn man davon ausgeht – und dafür gibt es ja sehr gute Gründe –, dass es Gott gibt und er der Schöpfer der Welt ist? Dann müsste selbst Sartre zugestehen, dass die Schöpfung Natur ist und als solche etwas widerspiegelt von ihrem Schöpfer.
Wenn Gott der Schöpfung Sein verleiht, existiert sie, vereinfacht gesagt, durch einen Sprechakt Gottes, der sich von Moment zu Moment wiederholt: Ich will, dass ist, was ist. Die Schöpfung ist also weniger eine einmalige Hervorrufung als eine permanente Beziehung.
Es kommt noch mehr hinzu: Hinter der Welt – versteht man sie einmal als Schöpfung – steht dann kein blinder Zufall69, sondern ein Wille und die «vernünftige» Idee eines persönlichen Gottes, der für seine Geschöpfe das Beste will. Wenn nun die Schöpfung Idee Gottes ist, so ist sie durchdrungen von seinem Geist, seinem Logos.70 Sie kommt aus dem Licht, ist logisch und von lichter Struktur, ist durchsetzt mit Zeichen. Anders gesagt: Das Haus ist voller Spuren und Hinweise auf den Architekten, der die Dinge sinnvoll geplant und gebaut hat. Thomas von Aquin (1225–1277): «Notwendig ist Gott in allen Dingen, und zwar auf innigste Weise.»71 Da der Mensch aber Geist hat, also etwas vom gleichen Stoff, der die Welt entworfen hat, muss man eine «fundamentale Rationalität der Wirklichkeit»72 annehmen, also die Lesbarkeit ihrer Zeichen für die menschliche Vernunft. Das macht auch, dass ein christliches Denken, das von einer mit Sinn und Ziel erfüllten Natur ausgeht, geradezu wehrlos ist gegen Argumente, die aus der Vernunft oder der Gerechtigkeit kommen, mag noch so viel Frommes dagegensprechen.
Ethik ohne Gott
Nimmt man mit Sartre an, es gäbe keinen Schöpfer und also keine Natur, an der wir uns orientieren dürfen, so wären wir zwar frei, dafür wären wir aber komplett orientierungslos, weil sich dem Menschen «keine Möglichkeit (zeigt), sich auf etwas zu stützen, weder in sich selbst noch außerhalb seiner selbst»73.