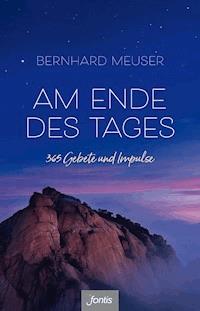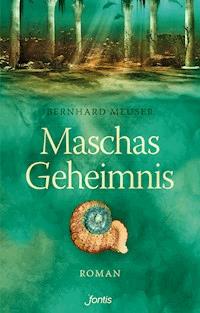Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hat eine junge Frau, die wie durch ein Wunder einen Fallschirmabsprung überlebt, mit Maria Montessori, der genialen Pädagogin, gemeinsam? Was verbindet John Rockefeller mit dem 13-jährigen Yehudi Menuhin? – Nichts. Oder doch dies: Dass sie alle ein wirkliches Wunder erlebt haben. Eine unerhörte Wendung der Dinge. Etwas, das ihr Leben auf den Kopf stellte, sie zu einem anderen Menschen machte. Bernhard Meuser hat über Jahre hinweg die wunderbaren Geschichten aus der Wirklichkeit gesammelt und veröffentlicht sie nun hier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Meuser Sternstunden
Bernhard Meuser
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2016 by Fontis – Brunnen Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-772-2 ISBN (MOBI) 978-3-03848-773-9
www.fontis-verlag.com
Inhaltsverzeichnis
1 Von der Kunst des richtigen Anklopfens (Moses Mendelssohn)
2 Die Augen der Nacht (Paul Ahrens)
3 Weidenflötenlegende (Wilhelm Busch)
4 Unter dem Guavenbaum (Mutter Teresa)
5 Der Erfinder, der das Erfinden erfand (Genrich Saulowitsch Altschuller)
6 Der Traum von den weißen Mönchen (Frère Roger, Taizé)
7 Der Überlebenskünstler (Carl Zuckmayer)
8 Let's roll (Todd Beamer)
9 Die Frau in der Sonne (Juan Diego)
10 Das kleine Wunder (Ludwig Kraus)
11 Edyta (Karol Wojtyla)
12 Rosen für die Ewigkeit (Bischof Hezilo)
13 Der Traum des kleinen Bischofs (Dom Hélder Câmara)
14 Die Auslöschung (Israel Eugenio Zolli)
15 Der Mann, der Robinson war (Alexander Selkirk)
16 Die Reise nach Moskau (Konrad Adenauer)
17 Das Wunderkind (Yehudi Menuhin)
18 Tillys Entdeckung (Tilly Smith)
19 Der Schatz in der Satteltasche (Marion Gräfin von Dönhoff)
20 Die verbotene Musik (Gregorio Allegri)
21 Der SS-Mann Gottes (Kurt Gerstein)
22 Solo für Shayna (Shayna Richardson)
23 Das Zeichen von Dresden (Karl-Ludwig Hoch)
24 Beduinische Schatzsuche (Khalil Iskander Schahin)
25 Die Nacht auf dem Bahnhof (Mohandas Karamchand Gandhi)
26 Penny Black (Sir Rowland Hill)
27 Ein ganz starker Abgang (Alexander Rostowzew)
28 Der Klang des Lebens (Barbara Clear)
29 Die zweite Wahl (Angelo Roncalli)
30 Ida und die Mumie (John Davison Rockefeller)
31 Mario und die Dottoressa (Maria Montessori)
32 Die Tränen des mongolischen Kamels (Ugna Amgaa)
33 Dann gehe ich mit! (Hans Hornbostel)
34 Das kleine Radio (Waltraud Schreiner und Ruth Pfau)
35 Ein Bruder wie Theo (Vincent van Gogh)
Personenregister
Quellen
1Von der Kunst des richtigen Anklopfens(Moses Mendelssohn)
Plötzlich kam Bewegung in die Soldaten mit den schmucken preußischen Uniformen. Sie, die sonst wie die Ölgötzen am Tor standen und die Bauern und Händler passieren ließen, senkten die Bajonette vor einem Halbwüchsigen. Mit Händen und Füßen versuchte der hagere, verwachsene Junge den Soldaten deutlich zu machen, warum er unbedingt in die Stadt musste. Die schüttelten nur den Kopf und wiesen ihm mit den Bajonetten unmissverständlich die Richtung: «Sieh zu, dass du weiterkommst, Judenbub!»
Berlin, die Hauptstadt des aufgeklärten Fürsten Friedrichs II., war im Herbst 1743 für Juden noch immer eine verschlossene Welt. Der schmächtige jüdische Junge, dem die Soldaten am Halleschen Tor den Zutritt in die Stadt verwehrten, war die 150 Kilometer von Dessau nach Berlin barfuß herübergewandert. Schuhe besaß er nicht. Die Berliner Wächter und Zollbeamten waren angewiesen, einreisewillige Juden genau unter die Lupe zu nehmen. Sogenannten «Handelsjuden» wurde der Zutritt generell verwehrt. Andere Juden durften sich in Berlin nur niederlassen, wenn sie einen Ruf als Wissenschaftler besaßen oder über viel Geld verfügten.
Danach sah der halbverhungerte 14-jährige Moses, der seine ganze Habe in einem Säckchen auf dem Rücken trug, beileibe nicht aus. Zeitgenössische Beschreibungen erwecken heute noch Mitleid: Moses war ein kleines und schmächtiges Kerlchen, geradezu ein Knirps. Dünne Arme und Beine schauten aus den schlechten Kleidern. Der Junge stotterte, konnte kaum ein paar Brocken Deutsch. Die Juden lebten unter sich und hatten ihre eigene Sprache – das Deutsch ihrer Unterdrücker war verpönt. Zu allem Unglück trug der Junge einen deutlich sichtbaren Buckel durch die Welt. Dass der junge Moses ein liebenswertes, intelligentes Gesicht hatte, eine hohe Stirn und wache Augen, sollte die Hüter des Gesetzes nicht rühren.
Was sollte er machen? Nach Dessau zurückwandern? Das war keine Alternative. Die Eltern waren bettelarm, hatten jüngere Kinder und konnten den Heranwachsenden nicht länger versorgen. Moses musste selbst sehen, wie er durch die Welt kam. Und in Berlin lebte jetzt sein geliebter Dessauer Lehrer Rabbi David Hirschel Fränkel. Er hatte ihn eingeladen, zu ihm zu kommen. Bei ihm wollte Moses lernen. Sprachen lernen, studieren, die Welt durch Wissenschaft erobern – das war sein Traum! Es musste ihm einfach gelingen, in diese Stadt zu kommen. Wenn es an dem ersten Tor nicht möglich war, musste er halt an einem anderen Stadteingang anklopfen – vielleicht hatte er da mehr Glück.
Und so kam es, dass Moses von einem Berliner Tor zum nächsten zog: vom Halleschen Tor zum Potsdamer Tor, vom Potsdamer Tor zum Brandenburger Tor, vom Brandenburger Tor zum Neuen Tor, vom Neuen Tor zum Oranienburger Tor, vom Oranienburger Tor zum Hamburger Tor. Überall sah der Junge die gleichen Bajonette, die ihm den Zutritt verwehrten. Als er endlich am Rosenthaler Tor angekommen war, erfuhr er, was er auch schon am Halleschen Tor hätte erfahren können: Hier war der einzige Eingang, durch den ein Jude die Stadt betreten konnte.
Aber auch hier musste man für eine zeitweilige Einreise Zoll entrichten, «denselben Zollsatz, der auf polnische Ochsen erhoben wurde», wie Amos Elon bemerkt. Da im Preußen Friedrichs des Großen Ordnung herrschte, lesen wir in einem Berliner Wachjournal des Jahres 1743 die Eintragung: «Heute passierten das Tor 6 Ochsen, 7 Schweine, 1 Jude.»
Es sollte eine der besten «Erwerbungen» werden, die Berlin je machte. Aus dem schüchternen, verwachsenen Büblein, das schließlich doch erfolgreich am Rosenthaler Tor angeklopft hatte, wurde der Stammvater der Mendelssohn-Dynastie, zu der der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy, seine Schwester Fanny Hensel oder Arnold Mendelssohn ebenso gehörten wie berühmte Banker und Wissenschaftler.
In Berlin nannte man ihn bald den «deutschen Sokrates», auch den «jüdischen Luther». Aus dem kleinen Thora-Schüler, der in einem Loch hauste, heimlich Deutsch, Französisch und Latein lernte und sich seine kargen Mahlzeiten mit dem Abschreiben hebräischer Texte verdiente, wurde im Laufe der Zeit der europaweit geachtete Aufklärer und Philosoph Moses Mendelssohn, der Freund Herders und Wielands, der Mann, dem Lessing in seinem Drama Nathan der Weise ein unvergängliches Denkmal setzte.
1763 ging der erste Preis der Berliner Akademie der Wissenschaften nicht etwa an Immanuel Kant, der sich ebenfalls beworben hatte, sondern an den Juden Moses Mendelssohn. Zwar verweigerte Friedrich II. ihm selbst 1771 noch die Aufnahme als ordentliches Mitglied in die Akademie; damit aber stellte der König sich gegen die gesamte erste Garde des Berliner Geisteslebens, die den Affront gegen den Philosophen nicht mittrug. Die Stadt, die ihm einst die kalte Schulter gezeigt hatte, hofierte ihn nun. Ein bekanntes Berliner Diktum lautete: «Von Moses bis Moses war keiner wie Moses.»
Ein zweites Mal berichten die Mendelssohn-Chroniken von der Kunst des Anklopfens. Und dieses Mal war nicht ein Dutzend Berliner Torwächter zu überzeugen, und auch nicht das erlauchte Gremium einer wissenschaftlichen Akademie. Es ging um Liebe – ein Spiel also, in dem ein Mann mit einem missgestalteten Körper schlechte Karten hat. Moses Mendelssohn musste den Schlüssel zum Herzen eines bezaubernden Mädchens finden, in das er sich Hals über Kopf verliebt hatte.
Die Geschichte begann damit, dass Mendelssohn 1761 seinen Freund und Förderer, den Arzt Aron Gumpertz, in Hamburg besuchte. Gumpertz lebte mit seiner Frau im Haus des renommierten jüdischen Kaufmanns Abraham Gugenheim. So kam es, dass er in den vier Wochen seines Aufenthaltes auch mit Fromet Gugenheim, der Tochter, bekannt gemacht wurde. Dass sich der Mann des Geistes sofort unsterblich in das Mädchen verliebte, kann jeder nachvollziehen, der das anmutige Bildnis des jungen Mädchens betrachtet: Helle, wache Augen blitzen aus einem offenen Gesicht; ein liebes, angenehmes Wesen strahlt in die Welt.
Aber Fromet ist mehr als ein Frätzchen mit einem hübschen Gesicht. Fromet ist selbstbewusst und erstaunlich belesen. Natürlich kennt sie den Berliner Philosophen, hat sich in seine Schriften vertieft und sich manches aus seinen Büchern herausgeschrieben – Worte wie: «Wahrheit erkennen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun.»
Vielleicht hat sie sich auch ein Bild von ihm gemacht, in Gedanken damit gespielt, ihn kennen zu lernen, ihn für sich einzunehmen, ihn mit ihrem Charme zu bezaubern. Aber als sie den berühmten Mann jetzt leibhaftig vor sich sieht – klein, verwachsen, hässlich –, erschrickt sie fürchterlich. Es kommen ihr – so überliefert es die Familie Mendelssohn, und so hält ein jüdischer Hauskalender den Moment fest – die Tränen. Warum sie weint, liegt auf der Hand: Sie wollte sich verlieben – aber vor ihr steht ein Monster.
Eine normale Geschichte wäre an dieser Stelle zu Ende gewesen. Nicht aber die Geschichte des Moses Mendelssohn. Wie er, der Hässliche, Verwachsene, reagiert, wie er sein Handicap zum Vorteil macht, wie er mit Weisheit, Wärme und feinem Witz das Herz einer jungen Frau im Handstreich erobert – all das gehört zu einer der anrührendsten Liebesgeschichten der Welt. Die Geschichte geht so:
Moses und Fromet unterhalten sich. Nun ja, man kann auch mit hässlichen Menschen sprechen – besser vielleicht als mit oberflächlichen Schönlingen. Auch Fromet macht diese Erfahrung. Bald ist sie bezaubert von der angenehmen Stimme, der Eleganz und Tiefe des Berliner Philosophen. Sie sprechen über Gott und die Welt – ja, und auch über die Liebe.
Moses Mendelssohn: «Liebste Fromet, Sie haben vielleicht von dem Engel gehört, der im Himmel ausruft, wer füreinander bestimmt ist?»
Fromet: «Herr Moses, glauben Sie also auch, dass die Ehen im Himmel geschlossen werden?»
Moses Mendelssohn: «Ganz gewiss.»
Fromet: «Dass der Engel, wenn ein Kind geboren wird, ausruft: Der und der bekommt die und die?»
Moses Mendelssohn: «Aber ja doch. Und mir ist dabei noch was Besonderes geschehen. Wie ich nun geboren werde, ruft der Engel auch meine Frau aus. Aber dabei sagt er: Sie wird leider einen Buckel haben, einen schrecklichen!»
Fromet: «Oh, du meine Güte!»
Moses Mendelssohn: «Lieber Engel, habe ich da gesagt, ein Mädchen, das verwachsen ist, wird gar leicht bitter und hart, ein Mädchen soll aber schön sein. Deshalb, lieber Engel, gib mir den Buckel und lass das Mädchen schlank gewachsen und wohlgefällig sein.»
Die Überlieferung will es, dass Fromet darauf Moses Mendelssohn in die Arme gefallen sei. Der über alle Maßen glückliche Philosoph berichtet sofort an seinen Freund Lessing:
«Liebster Freund! Ich habe die Thorheit begangen, mich in meinem dreyßigsten Jahre zu verlieben. Sie lachen? Immerhin! Wer weiß, was Ihnen noch begegnen kann? Vielleicht ist das dreyßigste Jahr das gefährlichste, und Sie haben dieses ja noch nicht erreicht.»
In der Tat wird es gefährlich. Wieder schreibt er Lessing:
«Das Frauenzimmer, das ich zu heyrathen Willens bin, hat kein Vermögen, ist weder schön noch gelehrt, und gleichwohl bin ich verliebter Geck so sehr von ihr eingenommen, daß ich glaube, glücklich mit ihr leben zu können.»
Bis dahin sind noch etliche Hindernisse zu überwinden. Der Vater Gugenheim will es förmlich haben – eine Liebesheirat passt nicht in das Konzept der Zeit –, und die Berliner Stadtregierung baut dem «Ausländer» Mendelssohn neue Hürden auf, bevor er in der Stadt eine Familie gründen kann.
Aber im Juni 1762 ist es so weit: Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim heiraten. Es wird eine überaus glückliche Ehe, der sieben Kinder entspringen, eines begabter als das andere. Fromet Gugenheim überlebt ihren kränklichen Mann um 26 Jahre und sieht noch ihren Enkel Felix Mendelssohn-Bartholdy, der drei Jahre alt ist, als sie 1812 stirbt.
Zum Purimfest hatte Moses seiner geliebten Fromet einmal eine Geschichte geschrieben:
«Einst kam zum Socrates dem Weisen ein Schüler und sprach: ‹Mein lieber Socrates! Wer mit dir umgeht, bringt dir was zum Geschenk. Ich habe dir nischt zu schenken als mich selbst, sey so gut und verschmähe mich nicht.›
‹Wie!›, sprach der weise Mann, ‹achtest du dich so gering, daß du mich bittest, dich anzunehmen? – Nun gut! Ich will dir einen Rat geben: Bemühe dich, so gut zu werden, daß deine Person das angenehmste Geschenk werden mag.›
Mein Märchen ist aus. Auch ich, meine liebste Fromet!, will mich bemühen, so gut zu werden, daß Sie sagen sollen, ich könnte Ihnen nichts Besseres schenken als Ihren aufrichtigen Mausche aus Dessau.»
2Die Augen der Nacht(Paul Ahrens)
Paul Ahrens war ein begeisterter Flieger. Lange vor dem Krieg hatte er sich der Segelfliegerei verschrieben und hatte sogar Kurse bei Adolf Galland genommen, der später ein legendärer Fliegergeneral wurde. Wann immer sich eine freie Stunde bot, musste Ahrens hinaus zum Hangar.
Noch war es kaum fünfzig Jahre her, dass sich der uralte Menschheitstraum, fliegen zu können, erfüllt hatte. Noch brauchte man Mut, um sich mit klapprigen Maschinen in den Himmel aufzuschwingen. Es gab weder Navigationssysteme noch Automaten, die einem jungen Flieger, der sich plötzlich von den Wetterverhältnissen überfordert sah, helfen konnten. Erfahrung war alles. Fliegen galt mit Recht als ein tollkühnes Abenteuer.
Als deutlich wurde, dass es Krieg geben würde, merkte auch Ahrens, was für ein hochgefährliches, möglicherweise todbringendes Hobby er sich ausgesucht hatte. Spätestens seitdem die «Legion Condor» in Hitlers Auftrag in den Spanischen Bürgerkrieg eingegriffen hatte, galt die Fliegerei als Waffe der Zukunft. Junge Männer, die fliegen konnten, standen ganz vorne auf der Rekrutierungsliste. Paul Ahrens hatte Glück im Unglück: Nicht zu den Jagdfliegern wurde er beordert und auch nicht in ein Bombergeschwader. Die dort fliegen wollten oder fliegen mussten, kamen häufig nicht mehr zurück. Das konnte man sich an fünf Fingern abzählen.
Nein, es sollten «nur» die Transportflieger sein, bei denen der junge Mann Dienst tun würde. Ahrens erinnert sich: «Wir Transportflieger hatten keine Lobby im Führerhauptquartier; wir versenkten keine Schiffe, schossen keine Flugzeuge ab und warfen keine Bomben auf Städte, Eisenbahnen und Brücken.» Auf diese fragwürdige Art von Ehre konnte Paul Ahrens jedoch gut verzichten. Ihm war es lieber, wenn er eine reelle Chance hatte, mit halbwegs heiler Haut aus dem Krieg zurückzukehren.
Ahrens sollte sich täuschen. Je dramatischer sich das große Abschlachten entwickelte, je schmutziger, blutiger und grausamer der Krieg wurde, desto härter und gefährlicher wurden auch die Einsätze der Transportflieger. Wo die normalen Nachschubwege der Bodentruppen abgeschnitten waren, mussten die Transportflieger mit ihren gutmütigen, langsamen JU-52-Flugzeugen hin, um Verpflegung und Waffen zu bringen – ein wohlfeiles Ziel für die feindliche Artillerie. Jeder Flug wurde zu einer Art russischem Roulette, bei dem die Piloten sich fragten, wie viele Kugeln gerade geladen waren.
Dieser Flug da – jeder Flug – konnte der letzte sein. Ahrens und seine Kameraden wurden in der Tat mehrfach abgeschossen. Einmal sprang der Pilot mit dem Fallschirm aus der brennenden Maschine. Einmal musste Ahrens notlanden und sich hinter der Front durchschlagen. Einmal brachte er eine Maschine, bei der nur noch zwei Motoren funktionierten, heil durch einen Wald von Artilleriegeschossen; am Boden zählte er dann 148 Einschüsse in Rumpf und Leitwerk.
Zum Denken blieb nicht viel Zeit. Es ging immer weiter. Die wenigen Flieger waren permanent im Einsatz, oft tagelang, ohne Unterbrechung. Wenn den Piloten die Augen zufallen wollten, injizierte man ihnen eine Dosis Pervitin. Nach einem solchen letzten Aufputschen gab es häufig Zusammenbrüche.
Es sollte aber noch schlimmer kommen. Als sich Hitlers Russlandfeldzug zu einem einzigen Debakel entwickelte, als deutsche Truppen immer häufiger von der Roten Armee eingekesselt und gnadenlos aufgerieben wurden, da waren die Transportflieger fast nur noch dazu da, um in halsbrecherischen Manövern Verletzte aus dem Kessel zu fliegen. In Stalingrad wurden die Maschinen bis zur Belastungsgrenze vollgestopft mit verdreckten, vor Kälte bibbernden, vor Schmerzen wimmernden, manchmal halbtoten jungen Soldaten, die nur noch eine Hoffnung hatten: dieses Flugzeug, das sie aus der Hölle brachte.
Wenn Paul Ahrens sich in seinem Pilotensitz umdrehte, sah er immer dasselbe: diese Augen! Ihn starrten verzweifelte Augen an: «Mensch, mach doch! Hol uns hier raus!»
Ahrens tat, was er konnte. Jeder Start in den feindlichen Himmel war ein Spiel mit dem Tod. Es gab keinen Flug, der nicht begleitet war von links und rechts vorbeisirrenden Geschossen. Und immer wieder schlug eines von ihnen in die Metallhaut der unverwüstlichen JU 52 ein.
«Man musste sie lieben», sagt Paul Ahrens, «man konnte sie streicheln wie ein braves Pferd, dieses gute Flugzeug, die alte Tante JU.»
Irgendwie ging es halbwegs gut. Am Ende des Krieges hatte der junge Flieger fünf-, sechstausend verletzte Soldaten hinter die Front geflogen. Musste ihn das nicht für immer versöhnen mit dem Gedanken, für das Vaterland verheizt worden zu sein?
Es hätte ihn wirklich glücklich machen können, wäre da nicht das andere gewesen: die Erinnerung, die Träume, die ihn verfolgten, die ihn Nacht für Nacht schweißgebadet aufwachen ließen.
«Bis 1967 bildeten die blutenden, stinkenden, zerrissenen, schreienden, stöhnenden Verwundeten in meiner JU in meinen Träumen nur eine graubraune Masse mit vierzig so weiten, hilfesuchenden, gläubigen und hoffenden, übergroßen Augen.»
Beruflich und privat ging es ihm gut: Als Architekt und Ingenieur hatte er beruflichen Erfolg. Er war glücklich verheiratet, hatte zwei Söhne. Nur die Nerven spielten nicht mit. Die Vergangenheit holte ihn immer wieder ein.
Ahrens hatte Angst davor, schlafen zu gehen – bis zu diesem Sommertag im Jahr 1967.
Es war der 8. Juli 1967, an dem sich Paul Ahrens und seine Frau an jenen Julitag im Jahr 1942 erinnern wollten, an dem sie sich 25 Jahre zuvor mitten im Krieg das Jawort gegeben hatten. Da sie gläubige Menschen waren, begingen sie ihre Silberhochzeit mit einem Gottesdienst am Morgen. Dazu hatte das Ehepaar sich eine romantische Waldkapelle im Sauerland ausgesucht. Ein Priester aus dem benachbarten Dorf war gerne bereit, die Messe zu feiern. Die beiden schon erwachsenen Söhne ministrierten – und ein Tag begann, der für Paul Ahrens eine Überraschung der besonderen Art in sich bergen sollte.
Nach dem Gottesdienst begab sich die kleine Festgesellschaft, zu der man auch den Priester eingeladen hatte, in ein Waldhotel, wo man ein festliches Frühstück einnahm. Kaum hatten die Gäste Platz genommen, fühlte sich Ahrens von dem Priester mit merkwürdiger Intensität fixiert.
«Warum schauen Sie mich so an?»
«Sie kenne ich! Und zwar ganz genau», meinte der Pfarrer, «wenn ich bloß wüsste, woher!»
Das musste doch nicht schwer herauszufinden sein! Gemeinsam gingen die beiden Männer die Stationen ihres Lebens durch: Schule, Studium, die verschiedenen Wohnorte. Nein, es ergab sich keine Übereinstimmung! Aber im Krieg – man konnte sich doch im Krieg begegnet sein, irgendwo in den Weiten Russlands vielleicht! Plötzlich fiel das Wort «Stalingrad».
Als Ahrens den Schreckensort nannte, durchfuhr es den Priester. Er sprang auf, zeigte auf sein Gegenüber und rief: «Ja, das ist es! Sie sind es! Sie haben mich schwerverwundet am 13.12.1942 um 10.20 Uhr aus Stalingrad herausgeholt! Ich habe nur noch gebetet, dass Sie mich da herausbringen. Damals habe ich ein Gelübde abgelegt, dass ich Priester werden und Gott dienen wollte, wenn ich heimkäme und gesund würde.»
Das Erste, was Ahrens tat, als er am Abend dieses Tages nach Hause kam: Er schaute in seinem Flugbuch nach, das er über all die Jahre hinweg gehütet hatte wie einen Schatz. Alle Angaben stimmten: der Tag, der Ort, die Uhrzeit. Der Priester konnte nicht ahnen, was seine Äußerung bei Paul Ahrens bewirkte:
«Seit dem 8. Juli 1967 hat die graubraune Masse der Schwerverwundeten mit den stechenden Augen ein liebes, menschliches Antlitz. Der Alptraum ist vorbei.»
3Weidenflötenlegende(Wilhelm Busch)
Der Hütejunge, der zufällig so hieß wie der berühmte Dichter und Zeichner – nämlich Wilhelm Busch –, hatte viel Zeit zum Träumen und Nachdenken. Als Kind von westfälischen Bauern musste er tagaus, tagein das Vieh des Dorfes hüten. Aus lauter Langeweile schnitzte der Junge Stecken, bis ihm einmal jemand zeigte, wie man aus dem Holz der Uferweiden kleine Flöten baut. Von diesem Tag an schnitzte Wilhelm Busch Weidenflöten. Er probierte so lange herum, bis ihr Klang sich verfeinerte und die Tonabstände wirklich stimmten.
Aber er schnitzte nicht nur Flöten, sondern spielte auch mit immer größerer Kunstfertigkeit darauf. Vorbeifahrende Bauern lachten über den eigenartigen Jungen, der es mit der Kunst hatte. Und wirklich: Die Musik, die so fröhlich seinem Instrument entströmte und über das Wiesenland hallte, betörte ihn auf eine magische Weise und verzauberte sein tristes, einsames Leben. Bald ging die Fantasie mit Wilhelm Busch durch: Könnte es nicht noch ein ganz anderes Leben für ihn geben als dieses hier im Dorf? Wenn er in der Stadt wäre – könnte er dann nicht Musik lernen, sie so richtig lernen, bei einem Lehrer?
So kam es, dass aus dem Traum eines westfälischen Hütebuben eines Tages Wirklichkeit wurde: Eines Morgens fanden seine Eltern das Bett des Jungen leer. Wilhelm Busch war durchgebrannt. Barfuß, mit nichts als ein paar Lebensmitteln im Säckel, schlug sich der Halbwüchsige nach Hamburg durch. Es ist nicht überliefert, wie er dort überlebte. Aber es muss ihm gelungen sein. Denn die Familiensaga der Buschs erzählt, dass der Vater eines Tages mit einer Geige unter dem Arm von Hamburg aus aufbrach, um sein Glück im Rheinland zu suchen.
Wie er an die Geige kam und wer ihm die Grundbegriffe des Instruments vermittelte, wird wohl für immer unbekannt bleiben. Auch im Rheinland bestimmte ein einziger Traum das Leben des jungen Mannes: Musik machen, Musik lernen.
Bald traf er eine zwanzig Jahre ältere Frau – und heiratete sie prompt. Sie hatte ihm nämlich versprochen, ihm eine musikalische Ausbildung am Konservatorium in Lüttich zu ermöglichen. Das kuriose Paar kam nur bis zum Grenzstädtchen Venlo. Dort betrieben die beiden ein Gasthaus, wo der verhinderte Musiker sich weniger um den Bierausschank als ums Geigenüben kümmerte.
Der Zufall spülte ihm einen verkrachten und heimatflüchtigen Kapellmeister ins Gasthaus. Busch «verhaftete» ihn sofort – zum Musizieren. Bald gaben die beiden Mozart- und Beethoven-Sonaten zum Besten. Das stieß auf wenig Widerhall. Der Kapellmeister flüchtete weiter, die Gaststätte ging pleite, die Frau starb und Vater Busch machte sich als 23-jähriger Witwer wieder auf Wanderschaft – mit der Geige unter dem Arm.
Das unstete Leben fand erst ein Ende, als Busch «Fräulein Schmidt» kennen lernte, die spätere Mutter seiner Kinder. Bald wurde Hochzeit gefeiert, und eine Weile sah es so aus, als würde er im Schreinerhandwerk eine bürgerliche Existenz finden. Weit gefehlt! Vater Busch hatte Musik im Sinn und nur das. Seine arme Frau zwang er, Klavierstunden zu nehmen, damit sie ihn begleiten konnte, wenn er als Tanzgeiger auftrat. Mutter Busch brachte es tatsächlich zu einigen Fähigkeiten und zog mit ihrem Mann fortan Sonntag für Sonntag durch die rauchigen Wirtshäuser, bis es die Umstände – sprich: die acht Kinder aus dieser Ehe – nicht mehr zuließen.
Da hatte Vater Busch aber längst Ersatz gefunden in Gestalt seiner genialisch begabten Söhne Fritz und Adolf, die beide das absolute Gehör hatten. Fritz Busch sollte einer der großen Dirigenten des 20. Jahrhunderts werden, sein Bruder Adolf ein weltbekannter Violinist.
Vater Wilhelm Busch hatte die außerordentliche Begabung seiner Söhne beim Spaziergang mit den Kindern entdeckt. Ein Vogelruf – und Fritz und Adolf riefen unisono: «Fis!» Anstelle der Mutter mussten nun die Kinder bis in den frühen Montagmorgen zum Tanz aufspielen.
Inzwischen hatte der Vater eine kleine Musikalienhandlung eröffnet, die sich «keines blühenden Geschäftsganges» (Fritz Busch) erfreute, den Kindern aber die Chance bot, sich auf allen möglichen Instrumenten zu erproben. Außerdem war es ein Rahmen, innerhalb dessen sich Vater Busch einer neuen Wendung seines musikalischen Lebenstraumes zuwenden konnte. Eines Tages hatte er sich nämlich in den Kopf gesetzt, er sei zum Geigenbauer berufen. Der lange Weg von den Weidenflöten über Hamburg und die rheinischen Abenteuer – all das sei nur dazu bestimmt gewesen, dass er jetzt Geigen baue! Und zwar nicht irgendwelche!
Niemand weiß, wo Wilhelm Busch sich die Fähigkeiten dazu angeeignet hatte. Er ging bei keinem Geigenbauer in die Lehre, ja er sprach zeit seines Lebens nicht einmal mit einem wirklichen Fachmann. Tatsache ist aber: Wilhelm Busch baute Geigen – zunächst schlechte, dann immer bessere Instrumente – und experimentierte Tag und Nacht.
Er war versessen darauf, sich zu perfektionieren und das Geheimnis des unerreichten Klanges der Stradivari-Violinen zu entdecken. Manchmal weckte er mitten in der Nacht seine beiden Kinder mit den «großen Ohren», damit sie das Klangverhältnis zwischen Boden und Decke einer gerade in Arbeit befindlichen Geige überprüften. Irgendwo hatte Vater Busch aufgeschnappt, das müsse in einer reinen Quinte – was immer das sein mochte – bestehen.
An jede Violine, die der alte Busch vollendete, knüpfte er die Hoffnung, das möge nun doch das geniale Instrument sein, das man «für mindestens 5000 Mark» verkaufen könne. Was Vater Busch aber typischerweise von einer Verkaufsreise mitbrachte, war «ein Kanarienvogel, ein Spazierstock mit einer Krücke, von der er behauptete, sie sei aus Elfenbein, etwa zehn Mark und ein leichter Schwips» – so erinnerte sich später sein Sohn Fritz Busch in seinen Lebenserinnerungen.
Papa Busch hat das Geheimnis der Stradivari-Geigen leider nicht entdeckt. Dafür wurde sein Sohn Adolf zu einem legendären Violin-Virtuosen, der die Welt bereiste und überall sein Publikum zu Beifallsstürmen hinriss. Yehudi Menuhin sucht ihn als Meister auf, als er – Menuhin – schon alles konnte.
Die Geige, die Adolf Buschs internationalen Aufstieg begleitete, war ein Instrument seines Vaters. Adolf Busch legte sie erst dann in Ehren beiseite, als er in den Besitz eines der wirklich besten Instrumente der Welt kam. Es war – eine Stradivari.
4Unter dem Guavenbaum(Mutter Teresa)
Eines Tages im August 1948 öffneten sich die Pforten einer von Loreto-Schwestern geleiteten Schule in Kalkutta, um sich für immer hinter einer kleinen jungen Frau zu schließen. Sie war in einen weißen Sari mit blauen Streifen an den Rändern gehüllt – und musste sich erst an ihre neue «Uniform» gewöhnen. So wie die junge Europäerin kleideten sich nämlich die Abfallsammlerinnen von Kalkutta, die Tag für Tag von Haus zu Haus zogen, um die Fäkalien aus den Wohnungen zu holen und zu entsorgen. An der Stelle, an der die Abfallsammlerinnen den Schlüssel zu ihrer Wohnung in den Sari eingeknotet hatten, trug die Frau ein unauffälliges Kreuz. Die Frau war wenige Wochen zuvor noch Rektorin der Schule gewesen; ihre Schülerinnen nannten sie «Mother» – «Mother Teresa».
Kalkutta 1948 – das war eine heiße, stinkende Millionenstadt, ein tobender Hexenkessel, voll von sozialen Unruhen und schreiendem Elend, aber auch eine Stadt, die schon damals durchsetzt war mit Lichtern der Humanität. Immer wieder gingen sozial engagierte Menschen in diesen Moloch, weil sie dem Elend nicht tatenlos zuschauen mochten: Sozialarbeiter, Streetworker, Ärzte, christliche Ordensleute, Priester und Nonnen.
Auch die Schwestern von Loreto, eine ursprünglich italienische Ordensgemeinschaft, hatten es gewagt, mitten in der Hölle eine Schule zu eröffnen. Die Oberin hielt dies für Wagnis und Abenteuer genug, um ziemlich verstört zu reagieren, als ihre beste Kraft, eine energiegeladene junge Albanerin, eines Tages mit einer spleenigen Idee auf sie zukam. «Mother» Teresa glaubte eine Berufung in der Berufung erhalten zu haben. Sie wolle raus hier, müsse hier raus – Jesus, der Herr, habe sie dazu beauftragt.
«Wie bitte – wo?»
«Auf einer Bahnfahrt nach Darjeeling, am 10.9.1946, als ich zu den Exerzitien fuhr.»
«Und dann kam eine Stimme?»
«Nein, ich las in der Bibel – diese Stelle da, wo es heißt: ‹Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen?› … Ich spürte, wie sich die heiligen Worte bis in die innersten Nischen meines Herzens bohrten.»
«Und dann hatten Sie den Eindruck, Sie sollten …?»
«Ja, ich dachte an die Ärmsten der Armen und fragte mich: Kannst du denn gar nichts für sie tun? In jedem dieser erbarmungswürdigen Menschen musst du deinen geliebten Jesus sehen. Du musst diesen Jesus lieben, diesem Jesus dienen und dich um diesen Jesus kümmern! Vergiss nie, er selbst hat gesagt: Was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan!»
Was diese Erkenntnis für Mutter Teresa bedeutete, bekam Jahrzehnte später ein Journalist zu spüren, der zu Gast war im Sterbehaus der Teresa-Schwestern. Mutter Teresa machte kein Aufhebens von seiner Anwesenheit. Sie tat, was sie jeden Tag tat. Der Journalist durfte einfach mitkommen. Da lag ein Aussätziger. Mutter Teresa sah, was er brauchte: Seine Verbände mussten erneuert werden. Der Anblick überforderte den zartbesaiteten Medienmann: schwarzfaule Stümpfe. Eiter. Er konnte nicht hinsehen.
«Was Sie da tun – das würde ich nicht für eine Million Dollar tun!», meinte er anerkennend.
«Ich auch nicht», konterte Mutter Teresa knochentrocken.
Auf jener Zugfahrt nach Darjeeling im September 1946 hatte sie die Erkenntnis überfallen, dass «Jesus» für sie keine rhetorische Figur der Klosterfrömmigkeit bleiben durfte, sondern eine Herausforderung, die ihr in den Ärmsten begegnete. Den Aussätzigen, Slumhüttenbewohnern, Sterbenden in der Gosse, Müllkindern – Menschen also, denen um alles Geld in der Welt niemand Liebe erweist –, musste sie eine nicht mehr steigerungsfähige Form von Liebe entgegenbringen: eine solche Liebe, wie Jesus sie verdient. Das war ihr Programm.
Mutter Teresa setzte alle Hebel in Bewegung, ließ nicht locker bei ihrer Oberin, schaltete den Erzbischof und schließlich sogar den Papst ein. Und nach über zwei Jahren, nämlich im Dezember 1948, fand sie sich dann tatsächlich mit kirchlichem Segen, aber mutterseelenallein, gekleidet in das Gewand einer Fäkaliensammlerin, unter einem Guavenbaum im Viertel Motjihil wieder.