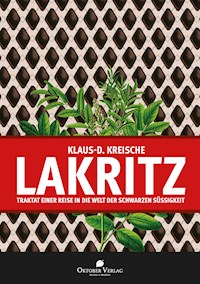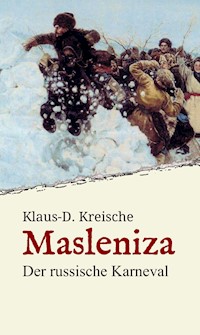
4,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Masleniza - der russische Karneval - ist in der westlichen Welt weitestgehend unbekannt. Auch in Russland drohte das Fest in Vergessenheit zu geraten, denn während der Sowjetzeit wurde es teilweise verboten und stigmatisiert. Seit dem Zerfall der Sowjetunion gehört die Masleniza wieder zum russischen Selbstbild. Ihre neue Ausrichtung ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Dieser Umstand regte zu einer grundlegenden Darstellung des russischen Karnevals an. Die Beschreibung der Masleniza anhand von Quellen, Berichten und wissenschaftlichen Abhandlungen steht ebenso im Fokus dieser Anthologie, wie ihre Deutungsmöglichkeiten, ihr kulturhistorischer Wandel und ihre Rekonstruktion seit dem Zerfall der Sowjetunion bis zu ihrer heutigen Begehung. Der Blick auf den russischen Karneval als ein jahrhundertealtes Kulturphänomen ermöglicht einen anderen Zugang zu Russland, der russischen Gesellschaft und ihrer wechselhaften Geschichte. Karnevalisten und Gegner, Russlandfreunde und -kritiker und interessierte Leser werden hier eine ungewöhnliche Seite des Landes entdecken - den russischen Karneval.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kreische
Masleniza
Karneval
Klaus-D. Kreische
Der russische Karneval
Masleniza
Ein traditionelles Fest im Spiegel der Zeit
Klaus-D. Kreische, »Masleniza –Der russische Karneval, Ein traditionelles Fest im Spiegel der Zeit«
©2021 Klaus-D. Kreische
Überarbeitete Neuauflage
Alle Rechte vorbehalten
Satz und Layout: Klaus-D. Kreische
Umschlag: Klaus-D. Kreische (unter Verwendung einer Abbildung von Vasilij I. Surikov: Masleniza, 1891)
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359Hamburg
ISBN:
978-3-347-04930-7 (Paperback)
978-3-347-04932-1 (e-Book)
Inhalt
Einleitung
I. Die Masleniza der Geschichtsschreibung
II. Das Bild der »alten« russischen Masleniza
III. Die Masleniza im Wandel der Zeit
IV. Die »neue« Masleniza
V. Der Karneval einer Scheinwelt
Epilog
Anhang
Danksagung
Formaler Hinweis
Glossar
Anmerkungen
Bildnachweis
Literaturauswahl
Für meine Mutter
und ihr herzhaftes Lachen
Vorbemerkung
Feste stellen einen eigenen Wirklichkeitsbereich dar. Es ist eine Wirklichkeit die nur gelebt und deshalb kaum in Worte gefasst und beschrieben werden kann. Dementsprechend ist das Bild, dass durch die Beschreibung eines Festes entsteht, ein Spiegelbild. Mit diesem Bild lässt sich eine Welt schaffen, die der gespiegelten, realen Welt ähnlich, aber nicht mit ihr identisch ist. Es ist aus dem natürlichen Kontext herausgerissen und kann darum leicht in einen modellbildenden Zusammenhang integriert werden. So ist auch diese Beschreibung des russischen Karnevals eine Metapher des Spiegels.
Masljanica (1889)
Einleitung
»Masleniza - noch heute spüre ich dieses Wort, so wie ich es in meiner Kindheit gespürt habe. Leuchtende Tupfer, Klänge ruft es in mir wach, glühende Ofen und blaue Dunstschwaden, ein zufriedenes Getöse der versammelten Menschen auf einem holprigen Schneeweg, der in der Sonne glänzt wie Fett, mit eintauchenden fröhlichen Schlitten, mit lustig geschmückten Pferden in Rosenkränzen, in Schellen und Schellenkappen, mit spielerisch-schrillem Wohlklang der Harmonika.«1 In diesen Worten erwächst aus einer Kindheitserinnerung des Schriftstellers Ivan Šmelev die Erzählung über eines der fröhlichsten Feste des russischen Kalenders - der Masleniza.
Masleniza heißt auf Deutsch »Butterwoche« und ist nach dem Kirchenkalender die Woche vor der Fastenzeit, in der kein Fleisch mehr gegessen werden darf, aber Fisch, Butter, Käse, Milch, Eier und Brot noch erlaubt sind. Die christliche Erklärung für das Fest und die anschließende asketische Zurückhaltung wird mit der Vertreibung Adams aus dem Paradies begründet. Vorher durfte er noch einmal ausgiebig schlemmen, um dann 40 Tage bis zu seiner Erlösung durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi zu schmachten.
Wie der Blick in das Wörterbuch verrät, spiegeln sich die kulinarischen Freuden auch in der Ableitung des Wortes von »maslo« (Butter) und »maslenaja nedelja« (Butterwoche) wieder, die von der Kirche mit »syrnaja nedelja« (Käsewoche) umschrieben wird. In der Redewendung »Emu ne Žit’e, a Masleniza« (Er lebt wie die Made im Speck) wird auf den ausladenden Charakter des Festes angespielt, und schließlich ist die »maslenyj golos« die schmeichlerische, verführerische Stimme und sind die »maslenye glaza« die schmachtenden Augen. Einzig in dem Ausspruch »Ne vse kotu Masleniza« (Nicht alle Katzen haben Masleniza – sinngemäß: Es ist nicht alle Tage Sonntag) kommt die begrenzte Gestalt des Festes zum Vorschein.
Obwohl die Bezeichnung »Masleniza« auf das 16. Jahrhundert zurückgeht, denn zu Beginn der Christianisierung Russlands hieß die Woche noch »M’jasopost« (Fleischfasten)2, verweisen die Bräuche auf ein Fest aus uralten Zeiten, dessen Wurzeln in einer vorchristlichen Gesellschaft liegen. Feste und Bräuche, die in diese Zeit zurückragen, sind zwar seit langem von der Geschichte überholt, doch sie sind nicht spurlos verschwunden.
Die Masleniza ist der russische Karneval. Hier weckt das Wort »Karneval« bei den meisten Lesern bestimmte Vorstellungen und es erscheint das Bild eines Festes, dass einmal im Jahr als rheinische Erscheinung über die Fernsehkanäle flimmert, dass in der Beschreibung Goethes Italienreise von 1789 als »Römischer Carneval« berühmt wurde oder in der kuriosen Anthologie des Kölner Karnevalisten Anton Fahne3, die den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zu bestaunen ist. Der Karneval ist nach Meinung des Theologen Florens C. Rang4, auf dessen Werk die psychologische Deutung des Festes zurückgeht, eine Kriegssituation, ein Aufruhr, dessen Urwesenszug das Hohngelächter ist. Auslöser dieses Gelächters sei das karnevalistische Element der Umkehr.
Bestimmte Gruppen, so der Literaturwissenschaftler V. Ivanov, die normalerweise eine untergeordnete Position einnehmen, würden in bestimmten Augenblicken des Jahreszyklus autoritäre Rituale gegenüber ihren Vorgesetzten ausüben, die ihre Herabwürdigung ertragen müssen.5 Doch mit Recht fragt Rang: »Glaubt wirklich wer, Sultane wie die altbabylonischen Kududriden, Götter-Söhne, hätten jemals auch nur im Scherz ihren Lakaien die Pantoffel geküsst? Aber sie zu Pantoffel-Helden zu machen, zu Pantoffel-Göttern, die nur einen lächerlichen Schein zu regieren an sich trugen, das war ihr Spaß«.6
Nach Meinung des Kulturwissenschaftlers Umberto Eco ist das Element der Umkehr in dem »animalischen Charakter« des Karnevals enthalten, um Situationen heraufzubeschwören, die nicht der Regel unterliegen. »In diesem Sinne wird der Karneval zu einem natürlichen Theater in dem Tiere und tierähnliche Erscheinungen die Macht übernehmen. […] Die verdrehte Welt wird zur Norm«.7 Doch stellt er fest, dass der Karneval nur als autorisiertes Vergehen existieren kann, dessen Bestandteile gerade an die Existenz der Regeln erinnern.
Die karnevalistischen Regeln wiederum führte der russische Literaturwissenschaftler Michail M. Bachtin in seinen Werken aus. Seine Deutung der Karnevalswelt ist bis heute prägend, obwohl ihn weniger das Fest, sondern der bestimmende Einfluss interessierte, den der Karneval auf die Literatur und ihre Gattungen gehabt hat. Er betont, dass der Karneval vor allem eine eigene Sprache hervorgebracht hat, die das karnevalistische Weltempfinden zum Ausdruck bringt und alle seine Formen durchdringt - eine Sprache, die sich nicht angemessen in die Sprache der Worte, geschweige denn abstrakter Begriffe übertragen lässt. Vor allem ist der Karneval »ein, das ganze Volk erfassende Weltempfinden vergangener Jahrtausende, ein Weltempfinden, das von Angst befreit, das in höchstem Maße die Welt dem Menschen und die Menschen einander annähert, das mit seiner Freude am Wechsel und seiner fröhlichen Relativität dem nur einseitigen und düsteren offiziellen Ernst gegenübersteht.«9
Bachtin benennt vier Kategorien, die ein karnevalistisches Fest ausmachen.10 Zunächst ist der Karneval ein Schauspiel ohne Rampe, bei dem nicht zwischen Darsteller und Zuschauer getrennt wird. Alle Teilnehmer sind aktiv beteiligt und kommunizieren am karnevalistischen Akt. Der Karneval wird gelebt und nicht betrachtet oder gespielt. Dieses karnevalistische Leben ist für die Dauer des Festes nach seinen eigenen Gesetzen ausgerichtet, während die Gesetze, Verbote und Beschränkungen der gewohnten Lebensordnung aufgehoben werden. Damit wird auch die hierarchische Ordnung außer Kraft gesetzt und jede Form menschlicher Ungleichheit annulliert.
Die Überwindung hierarchischer Barrieren lässt auch die Distanz zwischen den Menschen verschwinden und der freie »familiäre« Kontakt tritt als zweite Karnevals-Kategorie hervor. Dabei werden selbstauferlegte Schranken und Tabus aufgebrochen und die erotische Seite des Festes kommt zum Vorschein. Der familiäre Kontakt bestimmt sowohl die Organisation der Massenhandlungen als auch die karnevalistische Gestikulation und das offene, karnevalistische Wort. Ort der Handlung ist der öffentliche Platz.
Mit der »Familiarisierung« ist auch die dritte Kategorie verbunden: die karnevalistischen Mesalliancen. Hierzu wird die familiäre Einstellung auf alle Bereiche ausgedehnt. Was vorher voneinander getrennt war, tritt in Kontakt und wird miteinander verbunden. Dabei haben alle Karnevalsbilder einen ambivalenten Charakter: sie sind zweieinig und vereinen die Pole des Wechsels und der Krise in sich. So nähert der Karneval Geburt und Tod, Heiliges und Profanes, Segen und Fluch, Hohes und Niedriges, Großes und Nichtiges, Weises und Dummes, Lob und Tadel, Jugend und Alter, Gesicht und Gesäß einander an und verbindet es miteinander. Zu den ambivalenten Karnevalsbildern zählen nach Bachtin auch das Feuer und das Karnevalslachen. Das Feuer zerstört und erneuert die Welt zugleich. Das Lachen bezieht sich auf den Prozess des Wechsels, auf eine Krise, in der sich Tod und Wiedergeburt vereinen.
Aus den karnevalistischen Mesalliancen geht auch die vierte Kategorie hervor - die Profanierung. Dazu zählen die karnevalistischen Parodien auf heilige Texte und Aussprüche, aber auch die Lästerungen, Erniedrigungen und Obszönitäten, die auf die Zeugungskraft der Erde und des Körpers ausgerichtet sind.
Von den karnevalistischen Kategorien ist vor allem das führende Karnevalsspiel durchdrungen - die närrische Krönung und anschließende Erniedrigung eines Karnevalskönigs. Das Spiel ist bei allen karnevalistischen Festen zu finden. In dem Motivsystem ist der König ein Narr. Er wird vom ganzen Volk gewählt und nach Ablauf seiner Herrschaft ausgelacht, beschimpft und geschlagen. Dieser Zeremonie der Inthronisation und Entthronung des Königs liegt der Keim des eigentlichen karnevalistischen Weltempfindens, das Pathos des Wechsels und der Veränderungen, des Todes und der Erneuerung zugrunde.
Bachtin bezieht sich in seiner Beschreibung auf die Form des westeuropäischen, mittelalterlichen Karnevals. Paradoxerweise kommt in seiner Abhandlung die russische Karnevalstradition der Masleniza kaum vor. Er selbst wurde 1895 in Orel geboren, weshalb ihm nicht nur die russischen Jahrmärkte, sondern auch die Butterwoche bekannt gewesen sein dürften.
Seine scheinbare Ignoranz gegenüber dem russischen Fest erklärt sich vielleicht durch den Hintergrund, auf dem Werke wie »Rabelais und seine Welt« (1934) entstanden und die im Kontext von Manipulationen der russischen Volkskultur zu sehen sind, die seit der Oktober-Revolution vorangingen. Zur gleichen Zeit als sich Bachtin mit dem Karneval beschäftigte, waren die volkstümlich-russischen Karnevalsformen ein Tabu und konnten nur kritisch betrachtet werden. Dennoch regt er zu der Beschäftigung mit dem Fest an. Denn für ihn ist der Karneval, sein Wesen, seine tiefe Verwurzelung in der Urgesellschaft und im ursprünglichen Denken des Menschen, seine Entwicklung in der Klassengesellschaft, seine außerordentliche Vitalität und sein unvergänglicher Reiz eines der kompliziertesten und interessantesten Probleme der Kulturgeschichte.11
Dies zum Anlass genommen soll nun der russische Karneval - die Masleniza - im Mittelpunkt stehen. Erstaunten Lesern wird seine Existenz fragwürdig vorkommen, denn das Phänomen eines »russischen« Karnevals ist in Westeuropa weitgehend unbekannt. Vielmehr stößt es auf Befremden, denn es passt kaum zu den Stereotypen eines »geschundenen« Landes, dessen Bewohner nicht nur unter den harten Bedingungen zu leiden haben, die ihnen die Natur auferlegt, sondern auch jahrhundertelang unter dem Joch despotischer Herrscher standen, und muss gleichermaßen erklärt werden.
Eine Gegenüberstellung mit dem westeuropäischen Karneval, der auf die Dionysosfeiern zu Ehren des Bacchus im antiken Griechenland und die Saturnalien in Rom zurückgeführt wird, könnte sowohl auf die gemeinsamen und unterschiedlichen Regeln eingehen, die dem Fest seine Rechtfertigung geben, als auch auf die Rituale, die seine Form prägen. Denn zwischen dem westeuropäischen Karneval und der Butterwoche bestehen durchaus Analogien. Doch ein Vergleich kann auch den Blick auf die Masleniza verstellen. Denn Rituale und Feste, selbst wenn sie gleichen Ursprungs sind, haben eine Wandlung erfahren und werden unterschiedlich gedeutet.
Bei genauer Betrachtung offenbaren sich dann die Unterschiede zwischen den einzelnen Karnevalsformen. Zum Beispiel treten während der Masleniza nicht jene Narren in Erscheinung, die aus dem mittelalterlichen Verständnis als Personifizierung von Wahnsinn, Krankheit und Tod erwachsen und heute als »lustige Gesellen« für den westeuropäischen Karneval charakteristisch sind. Ebenso fehlt der »gesellschaftskritisch-politische« Aspekt, der es dem rheinischen Karnevalisten erlaubt, den Mächtigen »da oben endlich mal seine Meinung zu geigen«, um dabei doch nur gängige Vorurteile zu bestätigen.
Der gewichtigste Unterschied ist jedoch die geographische Verbreitung. Während der Karneval in den meisten Ländern nur eine regionale oder lokale Bedeutung hat, wird die heutige Form der Masleniza in Russland landesweit begangen. Eine nationale Bedeutung erhält das Fest durch seine Erklärung als »alte russische Tradition«. Als solche darf es in den verschiedensten Abhandlungen über »Das russische Volk« oder »Das Leben des russischen Volkes« keinesfalls fehlen.
Der Begriff »Tradition« suggeriert einerseits, dass es sich bei dem russischen Karneval nicht nur um einen »uralten« Brauch handelt, sondern das Fest auch kontinuierlich begangen wurde. Dem steht aber die unmittelbare Erfahrung aus der Sowjetzeit entgegen. Zwar gehörte die Masleniza über Jahrhunderte zum festen Bestandteil des russischen Festkalenders. Während der Sowjetzeit wurde das Fest jedoch geächtet - seine Ausführung war zeitweise zu einem »Hemmschuh des sozialistischen Aufbaus« stigmatisiert - und wurde in die häuslichen vier Wände verbannt. Erst in der postsowjetischen Ära fand eine »Wiederbelebung« des russischen Karnevals statt - genauer gesagt eine Rekonstruktion. Seitdem zählt sein neues Erscheinungsbild zum festen Bestandteil im öffentlichen Raum.
Andererseits ist die Masleniza in einem kulturellen Gedächtnis gespeichert - ein Gedächtnis, das nicht vererbbar ist, sondern über Generationen hinweg in Gang gehalten wird und durch eine Mnemotechnik, d.h. der Speicherung, Reaktivierung und Vermittlung von Sinn, aktiviert werden muss.12 Hier wird die Masleniza - als Tradition verstanden - durch die Verpflichtung zur Weitergabe zu einem Instrument der Identitätsvermittlung.
Auf diese Funktion machten u.a. die Historiker Eric Hobsbawn und Terence Ranger aufmerksam. In dem Sammelband »The Invention of Tradition« (Die Erfindung der Tradition) definieren sie Tradition über Rituale und Symbole, die eine sinnfällige Verbindung mit einer heroischen Vergangenheit markieren. Der Terminus beinhaltet Traditionen, die erfunden, konstruiert und formal institutionalisiert werden. Die Erfindung von neuen Traditionen ist allerdings nicht mit der Anpassung von genuinen Traditionen zu verwechseln. Alte Traditionen müssen nicht neu erfunden werden. Sie werden an den neuen Gegebenheiten angepasst. Doch gerade der Anpassungsprozess verweist darauf, dass Traditionen einen Bedeutungswandel durchlaufen, der oftmals verkannt und selten beschrieben wird.
Dies zum Anlass sollen nun die Butterwoche und ihre jahrhundertalte Geschichte beispielhaft genutzt werden, um den Prozess aufzuzeigen, mit dem volkstümliche Traditionen für die Gestaltung und Konstruktion kollektiver Identitäten eingebunden und instrumentalisiert werden.
Zusätzlich wird der Fokus auf die »Zeit« als Maßstab gerichtet. Mit Zeit ist einerseits jene Zeit gemeint, die das Fest selbst ausfüllt, andererseits die Epoche, in der es gefeiert wird. Dabei wird nicht nur eine Zeitreise in das Innere eines alten Festes angetreten, sondern auch ein Sprung über Jahrhunderte gewagt, mit dem das Fest in verschiedenen Situationen der russischen Geschichte dargestellt wird. Der Blick in den Spiegel dient hier als Metapher, um die verschiedenen Betrachtungsweisen, die sich daraus ergeben, zu berücksichtigen.
Demnach sollen wir nun mit dem Fragenkatalog: Was verbirgt sich hinter dem Phänomen der Butterwoche? Wie wird sie gefeiert? Wie hat sich das Fest im Laufe der Jahrhunderte verändert? Und was für eine Bedeutung hat es heute für die russische Gesellschaft? - entführt werden in die Welt des russischen Karnevals - der Masleniza.
I. Die Masleniza der Geschichtsschreibung
Zur Geschichte der Masleniza gehört auch die Geschichte ihrer Überlieferung. Dazu zählen all jene mündlichen und schriftlichen Beschreibungen aus denen sich das Bild des Festes zusammenfügt. Zwar ragen die Erzählungen über die Feste der russischen Landbevölkeung weit in unsere Vergangenheit zurück, trotzdem blieben sie lange Zeit in den historischen Darstellungen unberücksichtigt und wurden selten als Indikatoren für historische Umwälzungsprozesse hinzugezogen. Deshalb ist auch der Titel »Die Masleniza der Geschichtsschreibung« ein Paradox, denn das Fest ist in der Geschichtswissenschaft nicht präsent.
Die Geschichtswissenschaft wählt vergangene Ereignisse aus und ordnet sie chronologisch ein. Demnach betrachtet der Historiker jede Epoche als eine Gesamtheit, die unabhängig von der vorausgehenden und der nachfolgenden ist. Dabei werden Wandlungen auf einen kurzen Zeitraum konzentriert, obwohl sie sich innerhalb eines viel längeren Zeitraums vollzogen haben. Es ist dann die eine Geschichte, in der Historiker die aus den vielen Geschichten abgezogenen Fakten ansiedeln. Es sind Abstraktionen, die von jedem Bezug auf Identität und Erinnerung gereinigt sind.
Dem gegenüber stehen die vielen Geschichten, in denen ebenso viele Gruppen ihre Erinnerungen und ihr Selbstbild ansiedeln. Hierzu können die Quellen, Beschreibungen und Berichte gezählt werden, aus denen das Bild der Masleniza entsteht. Es sind kirchliche Chronisten nach der Christianisierung des Russischen Reiches, Reisende vom 16. bis zum 19. Jahrhundert und seit dem 19. Jahrhundert Forscher, die in unterschiedlichen Epochen einen Blick auf den russischen Karneval werfen.
Das Bild der Kirche
Die Masleniza ist seit Jahrhunderten eines der beliebtesten russischen Feste. Ihre Wurzeln, so der Tenor in den meisten Darstellungen, lassen sich weit in die vorchristliche Zeit zurückdatieren. Umso erstaunlicher ist es, dass über die frühen Jahre des russischen Karnevals keine Berichte vorliegen. Verständlich allerdings, da die Ostslawen bis zu dem Zeitpunkt ihrer Christianisierung über keine eigenständige Schriftkultur verfügten. Ihre Mythen, Epen, Sagen und ihre Vorstellungen vom Jenseits - all dies wurde mündlich von Generation zu Generation weitergegeben.
Erst im christlichen Gewande kam eine Schriftkultur auf, die Zeugnis über das Leben der Russen ab der ersten Jahrtausendwende ablegte. So stammen auch die frühesten Vermerke über das Fest aus kirchlichen Quellen. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass diese Texte tendenziös gefärbt sind und aus einer christlichen Sicht geschrieben wurden. Was bedeutet, dass eine andere Meinung unterdrückt oder Ereignisse in einer einseitigen Perspektive dargestellt wurden. Denn alles was den Sieg der Kirche über die vorchristlichen »Heiden« schmälern oder gar deren Legitimität in Frage stellen konnte, wurde verschwiegen, verdreht und verfälscht. Das galt insbesondere, solange sich die Kirche ihrer errungenen Position unsicher war. Sie versuchte die Erinnerung an die pagane Kultur zu tilgen oder diese wenigstens in den Augen der Nachwelt in ein schlechtes Licht zu rücken.
Dabei hatte die russisch-orthodoxe Kirche schon früh ihren Blick auf die vorchristlichen Feste und Bräuche gerichtet. In den kirchlichen Erwähnungen werden sie mit Verboten belegt. Doch in der Umkehr dieser Verbote erfährt die Nachwelt nicht nur von der Existenz und der Art der Feste, sondern auch von ihrem Rückhalt in der Bevölkerung. Schließlich werden Verbote nur dann ausgesprochen, wenn es etwas zu verbieten gibt. Durch sie sollten neue Gesetze oder gar ein anderes Weltbild installiert werden.
Beispiele solcher Richtlinien sind in der Nestorchronik festgehalten, die mit »Erzählungen« oder »Erzählungen von den vergangenen Jahren«1 überschrieben ist. Die Entstehung dieser Chronik fällt in das 12. Jahrhundert. Seit dem 13. Jahrhundert wird der Name des Hagiographen Nestor aus Kiew mit dem Werk in Verbindung gebracht. Seine Autorenschaft ist allerdings nicht eindeutig nachgewiesen. Die in der Nestorchronik enthaltenen Überlieferungen sind ausgewählt, gesichtet und umgestaltet worden und davon geprägt, das »alte« vorchristliche Weltbild zu verleumden, um die »neue« Welt des Christentums nach der Konvertierung Russlands (988) zu legitimieren.
Einige Passagen der Erzählungen richten sich auch gegen die Volksbräuche. In der Aufzeichnung aus dem Jahre 1068 ist vermerkt, dass der Teufel mit Hilfe der »Skomorochen« (russische Gaukler) die Gläubigen verführe und von Gott weglocke. Damit wurden schon sehr früh die Skomorochen, die während der Masleniza die Menschen mit ihren Späßen belustigten, diskreditiert. Die Bezeichnung »skomoroch« stammt aus dem Griechischen und bedeutet »Der Herr über das Lachen«. Skomorochen traten sowohl bei bäuerlichen Festen als auch an Fürstenhöfen in Erscheinung, bis sie im 17. Jahrhundert verfolgt wurden und in den Norden des Landes flüchteten. Sie gelten in vielen Darstellungen als die Hüter der Tradition und Vermittler der Bräuche.
Die Nestorchronik erwähnt im Jahre 1074 in dem Bericht von dem Tod Feodosija‘, dem Abt des Höhlenklosters in Kiew, auch die Butterwoche im Zusammenhang mit einer Belehrung über die Fastenzeit. »Er hatte die Gewohnheit zur Fastenzeit, am ›Buttersonntag‹ abends dem Brauche nach alle Brüder zu küssen und sie lehren, wie man die Fastenzeit verbringen und sich vor unreinen Gedanken und der Verlockung der Teufel hüten solle«.2
Eine weitere Erwähnung findet die Masleniza in den Schriften der Moskauer »Hundert-Kapitel-Synode« aus dem Jahre 1551 (Stoglav - benannt nach den in hundert Kapiteln zusammengefassten Beschlüssen der Synode).3 Die Beschlüsse der Synode richteten sich gegen kirchliche Missstände und sollten der Vereinheitlichung der Rituale und der Reform der Kirche dienen. Dem Stoglav ging die Verabschiedung eines neuen »Rechtsbuches des Zaren« voran, das der erste russische Landtag 1550 ausgearbeitet hatte. Zar Ivan IV. ließ das Rechtsbuch von der Stoglav-Synode prüfen und bestätigen, wodurch die Synode an der weltlichen Gesetzlichkeit Anteil hatte.4
Die Synode zeigte, dass man bestrebt war, alle von der orthodoxen Lehre abweichenden Ansichten zu unterdrücken. Grund für die Befürchtungen war eine Warnung des Hofpriesters Sylvester an den Zaren, wonach die Irrlehre bereits Wurzeln geschlagen habe und in Moskau die Häresie gedeihe. Die Menschen seien ins Schwanken geraten und würden unangemessene Äußerungen über Gott machen.
Neben den Kirchenfragen stand das gesellschaftliche Leben im Mittelpunkt der Beratungen, so zum Beispiel in Kapitel 41 die Totenklage zu Pfingsten von tanzenden und musizierenden Narren auf den Gräbern der Friedhöfe; die Lieder, Tänze und Schreie in der Nacht der »Rusalien«, am Vorabend zu Weihnachten und Epiphanias; oder das Verbrennen von Stroh und die Anrufung der Toten. In den Antworten5 wurden die nächtlichen Ausschreitungen an Weihnachten und zum Fest des Heiligen Vlasius (11. Februar) als »griechischen« Ursprungs und Erfindung des Teufels bezeichnet. Von der orthodoxen Kirche seien diese »teuflischen Freuden« bereits abgeschafft und durch heilige Feste ersetzt worden, die nun durch die zaristischen Befehle durchgesetzt werden sollten.
Zur Begründung galt, dass Müßiggang, Trunksucht und Spiele die Verdammnis hervorrufen würden. Darunter fallen sowohl das Spielen der Gusli (Zither), anderer Blasund Saiteninstrumente sowie Spiele und Tänze. Mit der gleichen Begründung werden die »heidnischen Bräuche der Griechen«, Anrufungen von Zauberern, Spiele, Tänze, Handschläge (Faustkämpfe), das Halten und Züchtigen von Bären und anderer Tiere untersagt. Die Calende-, Pan- und Dionysosfeiern, und vor allem die Feiern zur Sonnenwende in den ersten Tagen des März seien zu unterbinden. Frauen dürften nicht in der Öffentlichkeit tanzen, Männern sei es verboten Frauenkleider zu tragen und umgekehrt, da all dies Skandal und Lachen verursache.
In diesen Regeln werden mehrere Elemente angesprochen, die auch Bestandteil des russischen Karnevals sind. Das Fest selbst wird im Zusammenhang mit dem Verbot der Sonnenwendfeier in den ersten Tagen des März oder den Ausschreitungen zum »Heiligen Vlasius«, das oft zur Zeit der Butterwoche stattfand, erwähnt. Auch die Gusli- und Flötenspiele, Tänze und Faustkämpfe, das Verbrennen der Strohpuppe und das Tragen von Frauen- oder Männerkleidern des jeweiligen anderen Geschlechts gehören zur Masleniza.
Aus Sicht der Kirche waren die Verbote notwendig, um ihren Glauben gegenüber einer Bevölkerung durchzusetzen, die erst spät christianisiert wurde und deren alte Rituale noch sehr lebendig und tief im gesellschaftlichen Leben verwurzelt waren. Die Verbote sollten jedoch nicht nur die Feste und ihre Elemente abschaffen, sondern auch die »heidnische« Welt als Teufelei »griechischen« Ursprungs verleumden, wobei »griechisch« als Synonym für alles »heidnische«, vorchristliche stand. Dem entsprach das entworfene Bild einer paganen Gegenwelt, die auf die Darstellungen aus der Nestorchronik zurückgeht und bis heute Anlass für Spekulationen über ein Pantheon der urslawischen Götter liefert.
In der Nestorchronik tauchen diesbezüglich die Götternamen Perun und Volos, der auch als »Viehgott« bezeichnet wird, zum ersten Mal bei der Unterzeichnung eines Friedensvertrages zwischen den Russen und Byzantinern aus dem Jahre 907 auf. In jenem Jahr war der russische Fürst Oleg mit einem gewaltigen Heer gegen Konstantinopel gezogen. Nachdem sie die Umgebung der Hauptstadt verwüstet hatten, erklärte sich der byzantinische Kaiser zu Tributzahlungen bereit und schloss mit den Russen einen Vertrag. Zur Bekräftigung des Vertrages küssten die christlichen Byzantiner das Kreuz, Oleg ließ sie aber ihren Eid nach russischem Brauch ablegen, wonach sie bei den Göttern Perun und Volos den Frieden bekräftigen mussten.
Aus dem Jahre 980 wird berichtet, dass Fürst Vladimir zu Beginn seiner Herrschaft in Kiew Götzenbilder aufstellte. »Und Wladimir begann allein in Kiew zu herrschen. Und er stellte Götzenbilder auf dem Hügel außerhalb des Teremhofes auf: einen hölzernen Perun, sein Kopf aber war silbern, sein Schnurrbart golden; und den Chors, den Daschbog und den Stribog, und den Semargl und die Mokosch. Und sie brachten ihnen Opfer dar, sie Götter nennend, und führten ihre Söhne und Töchter herbei und opferten sie den Teufeln und besudelten die Erde durch ihre Opfer; und die russische Erde und dieser Hügel ward mit Blut besudelt.«6
Das russische Götterpantheon (1698)
Allerdings wurden einen Tag vor der Taufe der Rus‘ die Götzenbilder geschändet und zerstört. Das Standbild des Perun hatten zwölf Männer ausgepeitscht, einem Pferd an den Schwanz gebunden, von einer Anhöhe hinunter zum Dnjepr geschleppt und ins Wasser geworfen, wo es den Fluss hinabtrieb. Obwohl Perun aus den Fluten emporkam, damit sinnbildlich der alte Glaube aufbegehrte, siegt in der Chronik der christliche Glaube, denn das Standbild verschwand. Ein solches Bild konnte instrumentalisiert werden, in dem das »alte« als schwach dargestellt und die neue Welt des wahren Glaubens als Sieger gegenübergestellt wurde, denn am nächsten Tag hatte sich jedermann, »er sei reich oder arm, Bettler oder Knecht«, am Fluss einzufinden und musste sich taufen lassen.
Zu den Werkzeugen der Kirche gehörte jedoch nicht nur das Verbot und die Diffamierung, sondern auch die Zensur.7 Alles profane, ob mit literarischer oder folkloristischer Ausrichtung galt von vornherein als suspekt und wurde verboten.8 Die Kirche, die fast das gesamte Kulturleben kontrollierte, war ebenfalls daran interessiert, westeuropäische Bildung vorzuenthalten. Sie befürchtete, dass der westeuropäische Kultureinfluss eine Säkularisierung des Kulturlebens mit sich bringen könnte.9 Demzufolge wurden Berichte über Russland und Berichte aus dem Ausland zurückgehalten.
Die Zensur hatte zur Folge, dass es in Russland bis in das 17. Jahrhundert keine unabhängigen Berichte über die Masleniza und andere Volksfeste gab. Dies änderte sich erst, als die russisch-orthodoxe Kirche durch die Kirchenspaltung (1666) die Glaubwürdigkeit an die Einzigartigkeit ihrer Lehre beim Volk verlor und aufklärerische Gedanken an Einfluss gewannen. Damit geraten auch die kirchlichen Quellen über die Masleniza aus dem Blickwinkel der Beschreibungen. Denn mit der Öffnung des Russischen Reiches berichteten zunehmend Reisende über das Land und die Butterwoche.
Trotz der Verbote, Verleumdungen und der Zensur ist es der Kirche nicht gelungen die vorchristlichen Bräuche zu tilgen. Im Gegensatz zu dem paganen Götterpantheon, das erstaunlich schnell aus dem Bewusstsein der Bevölkerung verschwand - denn »für den Chronisten des 12. Jahrhunderts waren die heidnischen Götternamen kaum mehr als leere Worthülsen«10 - sind die alten Bräuche und Sitten bis in die Neuzeit hinein lebendig geblieben und widerstanden allen Versuchen der Kirche, sie zurückzudrängen. Häufig wurde ihnen ein christliches Gewand gegeben, so dass sie relativ unbehelligt neben dem offiziellen kirchlichen Ritus fortbestehen und weitergegeben werden konnten.
Das Bild des Fremden
Mit der Öffnung des Russischen Reiches im 17. Jahrhundert und dem zunehmenden Einfluss des Westens bezeugen Reiseberichte und Beschreibungen jener Autoren, die länger vor Ort waren, die Ausgelassenheit des russischen Karnevals. Diese Berichte erfreuten sich bei einer westlichen Leserschaft zunehmender Beliebtheit, denn dadurch konnte, angeregt durch die großen geographischen Entdeckungen, die Neugierde und der Wissensdurst nach dem Unbekannten ferner Kulturen gestillt werden.
Einen der frühesten und bekanntesten Reiseberichte über Russland schrieb Sigmund Freiherr von Herberstein , der 1517 einen Waffenstillstand zwischen Polen-Litauen und dem Moskauer Staat im Auftrag des Habsburger Kaisers Maximilian I. aushandeln sollte. In seinem Bericht wird der russische Karneval zwar nicht erwähnt, dennoch sind aus seinen Schilderungen einige Hinweise über das Festverhalten der russischen Bevölkerung, die Faustkämpfe, die als ein fester Bestandteil der Butterwoche gelten, und die Bärenkämpfe, zu entnehmen. Vor allem stellt er fest, dass alle Feiertage, die von der Obrigkeit eingehalten wurden, den unteren Schichten versagt waren. Jedoch waren die Verbote für die »gemeinen Leute« zur Zeit der Masleniza aufgehoben. Daraus geht hervor, dass der russische Karneval nicht auf eine bestimmte Gruppe beschränkt, sondern ein Fest der Allgemeinheit war.
Adam Olearius, Mitreisender der holsteinischen Gesandtschaft, die sich am 6. November 1633 im Auftrag des Fürsten Friedrich von Hamburg nach Moskau aufmachte, um von Zar Michail Fedorovič eine Durchreiseerlaubnis für eine darauffolgende Reise nach Persien zu erwirken, stellte einen weiteren Reisebericht zusammen. Da die 34-köpfige Gesellschaft das russische Territorium erst vor Pfingsten erreichte, hatte Olearius die Masleniza ebenfalls nicht selbst erlebt. Doch gibt sein Bericht erstmals Zeugnis über die Opfergabe russischer »Bliny« (Pfannkuchen) auf den Gräbern der Verstorbenen, russischer Tänze und die Umtriebe russischer Komödianten und Puppenspieler. Darüber hinaus vermerkt er in einem postum verfertigten Porträt des Landes den Karneval in Bezug auf das Fasten:
»Sie haben durch das Jahr mehr Fast- als andere Tage, in welchen sie Fleisch essen mögen. Neben der zweitägigen jetzt erwähnten Fasten in der Woche, haben sie die erste große siebenwöchige Fasten […]. Die erste Woche dieser Fasten nennen sie Maslaniza Butterwoche, da sie weder Fleisch noch Fisch, sondern nur Butter, Milch und Eier essen, dabei aber sich alle Tage mit Brandwein, Meeth und Bier also anfüllen, und sich mit dem trinken lechzen, dass sie von ihren Sinnen nichts wissen, worauf denn allerhand Üppigkeit und Leichtfertigkeit erfolgt, und vor diesem, wie oben gemeldet, viel Mord und Todschlag begangen worden. Ist also eine schlechte Vorbereitung zur Fasten«.
Wie in dieser kurzen Passage nur angedeutet, bezichtigt er die Russen allgemein der Barbarei. Große Höflichkeit und ehrbare Sitten dürfe man bei ihnen nicht suchen, denn sie seien ziemlich versteckt. So trügen sie auch keine Scheu, »dass, was die Natur nach dem Essen oben und unten zu wirken pflegt, vor jederman hören und empfinden zu lassen«. Weil sie viel Knoblauch und Zipollen genießen, falle jedem, der dies nicht gewohnt sei, ihre Gegenwart schwer. Und selbst in geheimen Audienzen mischten sie sich durch Recken und überlautes Rülpsen ein. Auch seien ihre Reden meist dahin gerichtet, wozu sie ihre Natur und gemeine Lebensart veranlassen würde, nämlich von »Üppigkeiten, schendlichen Lastern, Geilheiten und Unzucht«, von ihnen selbst oder von andern begangen. Den fleischlichen Lüsten und der Unzucht seien sie so ergeben, dass sich etliche mit dem abscheulichen Laster der »Sodomiterey« [Homosexualität] rühmen würden. Letztendlich sei auch das Laster der Trunkenheit in allen Ständen, bei geistlichen oder weltlichen Männern und Frauen hohen und niedrigen Standes, egal ob jung oder alt, so weit verbreitet, dass »wenn man sie auf den Gassen hin und wieder liegen und im Koth wälzen sieht, es als ein täglich gewohntes nicht achtet.«
Die Fülle seiner Beobachtungen mit ihrer unglaublichen Detailbesessenheit sind beachtlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass Olearius als Mitglied einer offiziellen Gesandtschaft reiste, deren Bewegungsfreiheit von den Strelitzen, der Leibgarde des Zaren, eingeschränkt war - was ihnen jedoch im »unwirschen« Russland des 17. Jahrhunderts den notwendigen Schutz bot, um die gefahrvolle Reise zu bestehen.
In den Aufzeichnungen des englischen Leibarztes Samuel Collins, der von 1659/60 bis 1666 in Diensten des russischen Zaren Aleksej Michajlovič stand und noch bis 1669 in Moskau weilte, findet sich eine weitere Episode über die Masleniza.16 Allgemein verweist er auf die Trunksucht, die schließlich an Festtagen der größte Ausdruck für Freude sei, denn Männer, Frauen und Popen auf der Straße taumeln zu sehen, galt nicht als Schande.
»Während des Karnevals vor Quadragesima oder der Fastenzeit stürzen sich die Russen in alle Arten von Schwelgerei und Genuß und trinken in der letzten Woche so, als sollten sie nie wieder trinken. Manche nehmen Aquavit viermal destilliert, bis er sich in ihrem Munde entzündet und eine Flamme erzeugt, […], welche aus ihrem Schlund herauskommt. Sie sterben sofort, wenn man ihnen nicht Milch gibt, die Flamme auszulöschen. Viel weiser sind m. E. unsere englischen Feuerfresser, die das Feuer nur in gebührender Entfernung zu halten lieben, mindestens eine Pfeifenlänge von ihrer Nase. Diese Trinkkämpfe haben gewöhnlich Streiteren, Kämpfe und Morde im Gefolge. […] Wenn einige von diesen nun betrunken nach Hause gehen und nicht von einem nüchternen Gefährten begleitet werden, fallen sie schläfrig in den Schnee - böses kaltes Bett! - und dort erfrieren sie. Wenn irgendwelche Bekannte von ihnen zufällig vorbeikommen, so helfen sie ihnen nicht, obwohl sie doch sehen, wie sie verderben: Sie wollen der unangenehmen Befragung aus dem Wege gehen, [die erfolgen würde], wenn sie in ihren Armen stürben. Denn die vom Zemskij Prikaz [Polizeibehörde] pressen etwas aus dem Geldbeutel aller derer heraus, die ihre Behörde aufsuchen. Es ist ein trauriges Bild, zu sehen, wie ein Dutzend erfrorener Menschen aufgeschichtet in einem Schlitten fortgebracht wird. Einigen haben die Hunde die Arme weggefressen, anderen die Gesichter und von anderen haben sie nur Knochen übriggelassen. Auf diese Weise sind 200 oder 300 Menschen in der Fastenzeit umgebracht worden. Daraus kann man die traurigen Folgen der Trunkenheit ersehen, der epidemischen Krankheit nicht nur in Rußland, sondern in England auch«.17
Diese Beschreibung lässt aufhorchen, denn erstmals berichtet ein Augenzeuge von seinen eigenen Erlebnissen zu Beginn der russischen Fastenzeit. Zwar unterscheidet sich Collins in seiner Berichterstattung von seinen Vorgängern durch einen langjährigen Aufenthalt in der Stadt und einer hohen Stellung, die er am russischen Hofe als Leibarzt des Zaren innehatte. Doch kam er sich in dem Lande, das ihn neun Jahre lang beherbergte, wie in einer Wildnis vor und glaubte sich unter lauter Betrügern, Trunkenbolden und unkeuschen »Heiden« zu befinden. Nach Meinung heutiger Kommentatoren zeigen seine Aufzeichnungen letztlich nur, wie fremd sich der englische Arzt in Moskau gefühlt haben muss.18
Ein weiterer Bericht der Masleniza findet sich in der Abhandlung über die »Religion der Moscowiter« von Georg Andreas Schleising, die erstmals als »Anhang von der Preußischen und Moskovitischen Religion« im Jahre 1698 veröffentlicht wurde.19 Hier wird das ausgelassene Treiben des russischen Karnevals als »Liderlichkeit« beschrieben, in der die »elenden Leute« Tag und Nacht in der »greulichsten Schwelgerey« zubringen und mit »Weibsbildern ein sehr unzüchtiges Leben« führen. Sie »erwürgen sich einer den andern«, »Trinken eine unbeschreibliche Menge Honigwein, Bier und Brandtwein« und »wann ihnen die Getränke zu Kopffe steigen« bringen sie »als wie unvernünftige Thiere einander um«. Zu der Zeit, als der Autor in Moskau weilte, seien ebenfalls einige hundert Tote in diesen acht Tagen gezählt worden, weshalb die Masleniza auch als die »Teuffels-Woche« zu bezeichnen sei.
»Die Deutschen und andere Nationen gehen in dieser Schwerm-Woche selten aus ihren Häusern, wiewohl man des Tages nicht viel zu befürchten hat; weil die Moscowiter, welche sich voll getruncken haben, alsdenn in tiefem Schlaf liegen. Aber gegen den Abend wachen diese Nacht-Raben wieder auf, laufen auf den Gassen und machen einen greulichen Lärm und Unordnung. Solches tun nicht die Männer allein, sondern auch die Weiber, die Kinder und die Hausgenossen«.20
Seine Informationen stützen sich jedoch nicht allein auf eigene Erlebnisse oder Erfahrungen, vielmehr hat er das meiste, was er von der Moscowitischen Religion anführte, »von einem zum Christentum bekehrten Juden, der sich nach Russischer Art hatte taufen lassen.«21
Solche Beschreibungen prägten auch die Sicht der nachfolgenden Reisenden, die oft die Berichte ihrer Vorgänger gelesen hatten. In ihren Darstellungen vermischen sich die eigenen Beobachtungen mit den anderen Quellen so sehr, dass sie schwer zu trennen sind. Auf diese Weise werden einzelne Elemente des Russlandbildes über Jahrhunderte weitergegeben. Vor allem Schleisings Bericht ist ein Topos in den Darstellungen der Butterwoche, wie er bis in die heutige Zeit auch von russischen Autoren immer wieder zitiert wird. Viele der nachfolgenden Beschreibungen haben kaum eine Gelegenheit versäumt, unter Berufung auf diesen Text, die ungehobelte Barbarei während der Masleniza hervorzuheben.
Masljanica – Butterwoche (1851)
Ein anderes Bild vermittelt der Werkzeugmacher Christian Gottlob Züge aus Gera22, den die Abenteuerlust nach Russland trieb und der dem Aufruf der Zarin Katharina II. von 1763 folgte, sich dort niederzulassen. Er wollte ursprünglich nach Amerika auswandern, ließ sich aber in Lübeck abwerben und schiffte nach Russland ein. Züge lernte während der Reise Russisch. In Saratov, wo er 1765 ankam, verdingte er sich seinen Lebensunterhalt als Fabrikarbeiter, Hausierer und Musikant. Er beteiligte sich selbst an einer Neujahrskoljada (s.u.) und trat in einem deutschen Theater auf. Insgesamt verbrachte Züge sieben Jahre in Russland und kehrte 1774 nach Deutschland zurück.
Die Masleniza, die Züge in Saratow erlebte, beschreibt er folgendermaßen: »Man labt sich diese Zeit über noch möglichst an Milch mit Buttergebackenen, um sich für lange Entbehrungen schadlos zu halten, und sucht sich überhaupt des Lebens auf alle Weise zu erfreuen. Ein Schlitten jagt den andern, so dass man Mühe hat, sich durch die Straßen zu drängen, auf welchen man auch ganze Gesellschaften Männer oder Weiber, oder auch untermischt trifft, welche singend und vom Branntwein taumelnd einher wandeln. Der gemeine Ruße, welcher kein größeres Vergnügen kennt, als sich im Branntweine zu berauschen, verzehrt, wo möglich in der stärksten Sorte desselben, diese fröhliche Zeit über das Sümmchen, das er zu diesem Behufe schon längst sammelte, und so kann man leicht in einer mäßigen Stadt Russlands in acht Tagen mehr berauschte Menschen sehen, als in einer deutschen Stadt Zeitlebens. Große Gesellschaften von mehreren Familien ziehen umher, fallen bei den ersten besten ihrer Bekannten ein, und verlassen ihn nicht eher wieder, bis aller Vorrat von Speisen und Getränken aufgezehrt ist. Die auf solche Art beschmausten ziehen dann selbst aus, und halten sich bei Andern schadlos.
Während dieser Zeit ist auch ein Spektakel üblich, der so einfach ist, den Rußen großen Spaß macht. Man bindet zwei Schlitten zusammen, befestigt darauf ein großes Rad, durch dessen Achsenloch ein Pfahl geht, auf welchem ein kleineres Rad fest gemacht wird. Auf diesem sitzt ein Kerl in eine Bärenhaut genäht. Der Kopf stellt einen Vogelkopf vor mit einem gewaltig langen Schnabel, dessen untere Hälfte vermittelst eines Fadens beweglich ist. An langen Tauen werden die Schlitten von ungefähr fünfzig Menschen gezogen; eine Schar von etlichen Hunderten folgt jubelnd nach, wirft, so wie auch mancher aus dem Fenster Sehende, mit Schneebällen den Bär, welcher brüllt, schreit, den Schnabel aufreißt, und mancherlei Bewegungen macht, […].«23
Züge konnte einerseits auf einen langjährigen Aufenthalt zurückblicken und andererseits eröffneten ihm seine Russischkenntnisse, die er den meisten Reisenden seiner Zeit voraus hatte, den Zugang zu Denken und Handeln der Bevölkerung. Sein Verständnis für die anderen Lebensformen zeigt sich insbesondere in seiner Schilderung über die sonst so abschätzig beurteilten Trinkgewohnheiten, denn keine Nation sei diese »Schoßsünde« so leicht zu verzeihen, als den Russen, deren Klima zum Alkoholgenuss reize. Sie seien in der Trunkenheit auch so gutmütig, dass weit weniger Ausschreitungen vorkommen, als bei jenen, die sich in ihrem Urteil so überheblich zeigen.24
In seiner Beschreibung verweilt er jedoch nicht nur auf die Trinkgewohnheiten, sondern beschreibt ebenfalls das gegenseitige Bewirten, die Schlittenfahrten, das »Hinaustragen« der Masleniza und die Nachwehen des Festes. Nach der Butterwoche litten die meisten als Folge der Schwelgerei an Verdauungsstörungen.
Während Züge in seinen Aufzeichnungen das kleinstädtische Leben im 18. Jahrhundert beschrieb, absolvierte der gewöhnliche Russlandreisende des 19. Jahrhunderts einen Kanon an Sehenswürdigkeiten der Großstädte und nahm die Bevölkerung bestenfalls als »Staffage« wahr. Dies zeigt sich zum Beispiel in den Ausführungen des Franzosen J.-B. May über St. Petersburg von 1829, in denen er auch den Karneval anführte. Dieser sei in Italien angenehm, in Paris obszön, skandalös und abstoßend, in Russland aber ohne jegliche Anziehungskraft, kurz - langweilig.26
Neben den »absurden« Maskenbällen, zu denen May Zutritt hatte, erwähnt er auch den Jahrmarkt an dem Ufer der Newa, eine der Hauptattraktionen während der Masleniza. Hier würden die Bediensteten in ihrer freien Zeit nur kostenlose Vergnügungen suchen, in der Menschenmenge den Unachtsamen beklauen und ihr Diebesgut in Cabarets verschleudern. Ein weiterer Hort für Taschendiebe seien die kleinen Kirchen, die zur mitternächtlichen Stunde mit Beendigung des Festes die sühnende Menge aufnähmen, um mit Kreuzeszeichen und Gebeten die Bacchanalien zu überschatten.
Diese Episode zeigt, wie prägend sich negative Erlebnisse auf eine Beschreibungsperspektive auswirken, denn erklärend muss hinzugefügt werden, dass May zu Weihnachten in einer Kirche beraubt wurde, den Dieb fasste und sich einer peinlichen Situation ausgesetzt fand, weil er den Gottesdienst unterbrochen hatte.
Doch neben diesem Ausflug in den Trubel der Stadt beschreibt er den Karneval der oberen Zehntausend, »einer Gesellschaft der Langeweile und Eitelkeit, der Trunksucht und Falschheit«. In ihren Maskeraden und Banketten erkenne man die Geziertheit, den Zwang, das Unbehagen, und schließlich zeige sich in allen Lebenslagen doch nur eine Nation von Sklaven.
May, der nur für ein paar Monate in Russland weilte, lässt in seiner Beschreibung keinen Zweifel an seiner ablehnenden Haltung gegenüber den beobachteten Missständen und kritisiert scharf den russischen Despotismus. Bereits im Vorwort seines Berichtes fragt er, was eigentlich die russische Nation sei. »100.000 Familien die sich etwas darauf einbilden und 55 Mill. verrohte Menschen, die wie Pferde oder Ochsen verkauft, verschenkt, getauscht und geschlagen werden«, ist seine Antwort.