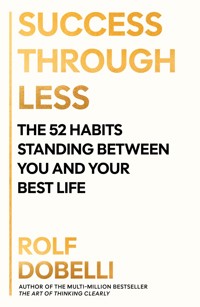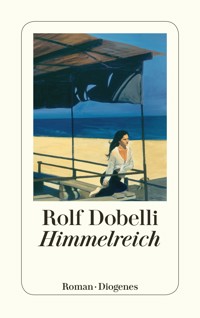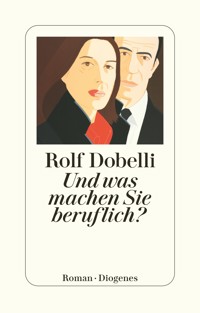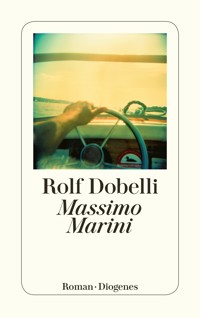
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist der Höhepunkt in der Karriere eines Mannes, als am 17. Oktober 2007 der erste große Durchstich des längsten Tunnels der Welt, des Gotthard-Basistunnels, gefeiert wird. Aber dieser Tag ist zugleich ihr Ende. Ein packender Gesellschafts- und Entwicklungsroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rolf Dobelli
Massimo Marini
Roman
Die Erstausgabe
erschien 2010 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Joerg Buschmann
Copyright © Joerg Buschmann/
Millennium/plainpicture
Website und E-Mail-Adresse des Autors:
www.dobelli.com
Die Namen, Personen und die Handlung
dieses Romans sind vom Autor frei erfunden,
jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten
oder real existierenden Personen, seien sie lebend
oder verstorben, ist rein zufällig.
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24092 4 (2.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60082 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Süd-Nord! Ha! Ha! Ha! O er ist dumm, ganz abscheulich dumm. Woyzeck, er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch – aber er hat keine Moral! Moral das ist, wenn man moralisch ist.
Georg Büchner, ›Woyzeck‹, 5. Szene
[7] Am 17.Oktober 2007 gelang den seit Jahren unermüdlich vorantreibenden Mineuren der Durchstich des längsten Tunnels der Welt – des Gotthard-Basistunnels. Die Tunnelbohrmaschine von Norden hatte sich durch das letzte Felshäutchen geschrammt. An seiner Stelle prangte die noch glühende Kreisscheibe. Die Maschine stand still. Steinstaubpartikel tanzten im Scheinwerferlicht.
Nach einer Weile und viel Applaus öffnete sich eine Luke, gerade groß genug, dass der Bauführer der Nordseite mit eingezogenem Kopf und mit Hilfe der ihm entgegengestreckten Hände hinüberklettern konnte. Auf der Südseite wurde er jubelnd empfangen. Seine Mineure folgten ihm wie Ameisen einer nach dem anderen durch dieselbe Öffnung.
Es war eine große, rührende Verbrüderung, als hätte man sein halbes Leben gemeinsam verbracht und sich anschließend jahrelang für verschollen gehalten – alles eingefangen von den Kameras des deutschen, schweizerischen und italienischen Fernsehens und einer Horde von Fotografen und Journalisten. Der Verkehrsminister sprach von einem »Sieg für Europa«.
Daher übersah man leicht die folgende Meldung, die an ebendiesem 17.Oktober 2007 über die Ticker der Nachrichtenagenturen lief: »Entführer gefasst. Der Entführer [8] des fünfzehnjährigen Raffael Marini wurde am frühen Morgen in Rom von der italienischen Polizei festgenommen.
Es handelt sich um einen neunundvierzigjährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser hatte am 4.April dieses Jahres den Sohn des Zürcher Bauunternehmers Massimo Marini entführt, dessen Firma den zentralen Abschnitt des Gotthard-Basistunnels baut. Am Tag nach der Entführung verlangte der Kidnapper von den Schweizerischen Bundesbahnen eine Zusicherung, dass das Jahrhundertbauwerk für den Transport radioaktiver Abfälle für immer gesperrt sein würde.
Nachdem die SBB auf die Erpressung nicht eingegangen waren, wurde Raffael Marini am 18.
[9] Im Frühjahr 2004, drei Jahre vor der Entführung seines Sohnes, gestand mir Massimo Marini, dass er sich in die berühmte Cellistin Julia Bodmer verliebt habe und mit dem Gedanken kämpfe, sich von seiner Frau scheiden zu lassen.
Marini hatte bis dahin sein halbes Leben mit der Entwicklung des Bauunternehmens verbracht, das sein Vater gegründet und dessen Leitung er nach dem überraschenden Tod seines Vaters 1986 übernommen hatte. Seit bald zwanzig Jahren war Massimo, dieser gesunde, kräftige Mann im besten Alter von sechsundvierzig Jahren, Herr über einen beachtlichen Maschinenpark, bestehend aus Bulldozern, Landraupen, Tieflöffelbagger, Felsbohrern, Steintrennmaschinen und Sprengstoffmischgeräten, über einen Personalbestand von zweihundert qualifizierten Mineuren und ein Portfolio erfolgreich abgeschlossener Tunnelbauten im In- und Ausland.
Massimos Mutter und Vater stammten beide aus derselben apulischen Ortschaft und kamen als junge Leute auf der Suche nach Arbeit in die Schweiz. Von ihnen hatte Massimo die gesunde, kräftige Hautfarbe geerbt, von seiner Mutter die imposanten Augenbrauen, die kühn geschnittenen Backenknochen vom Vater und die schwarzen Augen von beiden.
Für sein Alter hatte er erstaunlich sattes, schwarzes Haar, das er morgens mit ein bisschen Pomade zu bändigen [10] versuchte und das den ganzen Tag in beneidenswerten Wellen glänzte. Sein Gesicht hatte etwas Strahlendes, und er strotzte vor Gesundheit. Seine Hände waren sehr schön. Weder sein Haar noch sein Gesicht noch sein Körper noch die Art, wie er ging, wie er sprach oder dachte – nichts von alldem zeigte Symptome jener Katastrophe, die man das Alter nennt – jenes Ungeheuer, das seinen Vater innerhalb weniger Jahre von einem vitalen Mann in ein keuchendes, krankes Männchen verwandelt und ihn schließlich ganz niedergerungen hatte.
Massimo hatte die Cellistin zum ersten Mal gesehen, als er vom Zürcher Opernhaus-Management aufgefordert wurde, einen kleinen Werkfehler anzuschauen, den seine Arbeiter beim Umbau der Dachkonstruktion angeblich gemacht hatten. Er betrat die Bühne durch den seitlichen Künstlereingang, und als er die Tür aufstieß, warf ihn das Gleißen der Scheinwerfer zurück.
Es war mehr als ein Blenden, es war eine Flut von Licht, die seinen ganzen Körper erfasste. Massimo musste sich mit beiden Händen am Türrahmen festhalten, und erst nach einer Weile gewöhnten sich seine Augen an die Helle: Vor ihm öffnete sich die unendliche Weite der Bühne, dahinter ragten die leeren Sitzreihen des Parketts und der Balkone wie eine Felswand empor, und im Zentrum der Bühne, dort, mitten im Lichtkegel, sah er eine Frau, die ein Cello umarmte.
Sie saß reglos da. Er sah sie nur von hinten. Soweit er ausmachen konnte, trug sie einen dunklen Rollkragenpullover, ihre Haare waren sehr hell und mit einem Gummi [11] zusammengebunden. Er sah weder ihr Gesicht noch ihre Hände, nur ihren Hinterkopf, den Hals, die Schultern, die letzten zwanzig Zentimeter ihrer Beine und ihre Schuhe. Neben ihrem Hinterkopf leuchtete die Schnecke des Cellos bernsteinfarben auf.
Die Frau saß reglos, und Massimo wusste einen Moment lang nicht weiter. In diesem Flutlicht konnte er den angeblichen Fehler in der Dachkonstruktion natürlich nicht sehen. Stille füllte den Saal, und außer ihm, der noch immer wie versteinert im Türrahmen stand, und dieser Frau mit dem Cello war niemand da. Schlief sie? Meditierte sie?
Gerade als er sich entschloss, diese Verschwendung von Licht auf ein erträgliches Maß herunterzudrehen, damit er nach oben schauen konnte, legte sie ihre Hand an den Wirbelkasten und setzte zu einem Ton an, einem rauchigen, rußigen, tiefen Ton. Als der letzte Hauch verebbt war, ließ sie ihre Hand sachte das Griffbrett entlangrutschen, bis sie hinter der Schulter verschwunden war. Anschließend drehte sie ein bisschen an dem Bogen herum.
Massimo wusste, dass er in einer halben Stunde zu einem Treffen mit der städtischen Planungskommission erwartet wurde, das mit schnellen Schritten und einem pünktlichen Tram in genau einer halben Stunde zu erreichen war.
Wieder legte sie ihre linke Hand an das Griffbrett, senkte den Kopf, als wollte sie den Cellohals küssen, umschlang das Instrument, war daran, es sich einzuverleiben – und plötzlich brach aus dieser herrlichen, organischen Skulptur eine Musik hervor, die Massimo vollends überwältigte.
[12] Unmöglich zu sagen, wie lange das Stück gedauert hatte – geschweige denn, was für eine Komposition es war. Massimo war in diesen Dingen nicht zu Hause. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass er in der Fülle dieser Eindrücke das Meeting mit der Planungskommission verpasste, ja sogar vergaß, den angeblichen Fehler in der Dachkonstruktion zu überprüfen.
»Sie haben mich beobachtet.« Sie hatte sich umgedreht.
Sie war groß und sehr schlank. Ihr Gesicht war hell und von der Anstrengung etwas gerötet, und ihre Augen waren von einem intensiven Blau. Alles in allem der nordische Typ, aber ihre Lippen waren voller, als er dies bei einer so hellen Erscheinung erwartet hatte. Eine schöne Frau um die dreißig, mit einem Körper, der seinen kühnsten Vorstellungen entsprach.
Aber Massimo spürte sogleich eine Unnahbarkeit. Es war mehr als der übliche Nord-Süd-Graben der sich sonst zwischen Männern wie ihm und diesem Typ Frau auftat. Es war eine seltsame Entrücktheit. Er fühlte sich mit einem Mal unsicher und überspielte seine Beklemmung mit einer doppelten Portion Selbstsicherheit.
»Anscheinend war mein Einfluss positiv. Es hat sich jedenfalls so angehört.«
Sie gestattete sich ein Lächeln.
»Überschätzen Sie sich nicht.«
Sie stand auf, zog das Gummiband aus ihrem Haar und schüttelte ihren Kopf. Das Haar fiel über die Schultern, und die Spitzen zeigten wegen der elektrostatischen Aufladung allesamt ein bisschen nach oben.
Sie packte das Cello am Hals, ziemlich unsanft – aber [13] wohl nicht heftiger, als dies Cellisten eben tun –, hob es hoch und ging Richtung Künstlereingang. Er musste schlucken. Für einen Augenblick fühlte es sich an, als hätte diese Frau seinen Hals gepackt und ihn, Massimo, hochgehoben.
»Hören Sie, das war großartig!« Er holte sie kurz vor dem Eingang ein, öffnete ihr die Tür zur Hinterbühne, dann die nächste, dann noch eine und noch eine, bis – bis sie beide im Garderobenraum standen. Sie legte das Cello sorgfältig in den Kasten, streckte sich in einer Art frei inspirierter Yogapose, kämmte ihr Haar und wusch sich die Hände.
Massimo stand daneben, die Hände in den Hosentaschen, und staunte, als würde er gerade die Entstehung einer neuen Tierart miterleben. Sie packte ihre Sachen, ihren Mantel, den Cellokasten und trat in den Gang hinaus.
»…wo ich sie küsste. Einfach so. Auf die Stirn. Ich konnte nicht anders. Es war die reinste Albernheit, ich meine, ein Mann in meinem Alter, glauben Sie mir, wenn ich das sage, ich kam mir wie ein Jüngling vor, noch heute komme ich mir dreißig Jahre jünger vor, wenn ich mit ihr bin…«
Das Chateaubriand wurde gerade serviert. Eine kleine Pause entstand. Erst als sich die Kellnerin genügend weit von unserem Tisch entfernt hatte, sagte er: »Wyss…«, und jetzt beugte er sich zu mir vor und flüsterte: »Ich will diese Frau.«
Als Anwalt bin ich es gewohnt, Einblicke in persönliche Schicksale zu erhalten. Ich nehme sie mit der angebrachten professionellen Distanz zur Kenntnis, ich behandle sie wie [14] Lottozahlen oder Resultate von Fußballspielen, als Fakten, die nichts mehr sind als das.
Keine Ahnung, warum ich gerade an diesem Tag meine bewährte Distanz zu gerade diesem Klienten aufgab. Dass jemand davon träumt, seine Frau wegen einer anderen zu verlassen, ist ja nun wirklich nichts Neues, besonders wenn man seine Klienten über Jahre betreut.
Und Massimo war seit Jahren mein Klient. Schon seine Eltern hatte ich beraten, da war er noch ein Teenager, und sein Vater – dieser zäh und unbeirrt malochende süditalienische Gastarbeiter – auf dem besten Weg, ein Tunnelbauunternehmen aus dem Boden zu stampfen.
Massimo stand noch jahrelang im Schatten des mittlerweile verstorbenen Alten, und gerade weil sein Vater und ich eine so hervorragende Beziehung gepflegt hatten, dauerte es eine Weile, bis sich Massimo für mich erwärmte.
Dass ich seine unrühmliche Vergangenheit kannte – als Student und einige Jahre danach war Massimo im linken Milieu aktiv und machte »tonnenweise Dummheiten«, wie sein Vater mir gegenüber andeutete, nicht ohne die eine oder andere davon auszuführen –, war sicher der wichtigste Grund, warum Massimo mich lange Zeit mied und nur mit dem Allernötigsten zu mir kam. Unsere Meetings waren rar, kurz, sachlich und frostig.
So richtig gut und damit meine ich persönlich wurde unsere Beziehung erst vor kurzem, durch den peinlichen Zwischenfall zwei Monate zuvor. Es war ein Samstagmorgen, die Sonne machte sich schon kräftig ans Werk, ein Frühlingsgewitter war in der Nacht über der Stadt niedergegangen, und überall dampfte die feuchte Erde.
[15] Ich war gerade dabei, meine Joggingschuhe anzuziehen, als Massimo anrief: »Wyss, Sie müssen mir helfen.«
»Ja, was ist denn?«, fragte ich.
»Ein Teil des Dachs vom Opernhaus ist eingestürzt.«
»Das Sie umgebaut haben?«
»Würde ich Sie sonst anrufen?«
»Schäden?«
»Natürlich.«
»Große?«
»Ein verletzter Hausmeister und ein kaputter Steinway-Flügel der Orchesterklasse. Beschädigungen am Boden, an den Orchesterstühlen, und natürlich muss das Dach neu gemacht werden. Ich brauche Ihre Hilfe, Wyss.«
Als wir uns am selben Nachmittag in meiner Kanzlei trafen, war er noch immer aufgewühlt. Er besaß die ausgemergelten Züge eines Rückkehrers von einem Russland-Feldzug. Er war bleich und hatte Ringe unter den Augen. Das Destillat sämtlicher Sorgen schien sich in seinen Tränensäcken abgelagert zu haben. Ich konnte mich nicht erinnern, diese schwammigen Ausstülpungen jemals an ihm gesehen zu haben.
»Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, Herr Marini, für solche Fälle haben Sie eine Versicherung.«
»Die werden alles prüfen.«
»Ja und?«
»Meine Ausweise. Meine Diplome. Wyss…« – er packte meinen Arm und zog ihn über die Tischplatte, er zog, bis ich seinen Atem in meinem Gesicht spürte, »…ich habe nie Architektur studiert.«
[16] Und nun gab mir Massimo einen ersten Einblick in das komplizierte Verhältnis der Kräfte, die das geschaffen hatten, was man bei einem Mann seines Alters Charakter nennt, in den tosenden, verworrenen, gesetzlosen Maschinenraum einer Seele, einen Einblick, der mich zu dem dummen, selbstgefälligen, zeitverschlingenden und ökonomisch vollkommen sinnlosen Vorhaben trieb, diesen Bericht zu schreiben.
Jahrelang war Massimo mit einem falschen Architekturdiplom durchgekommen. Es war die Kopie des Diploms eines Kollegen, dessen Namen er mit einer Messerspitze weggekratzt und dafür seinen eigenen mit schwarzem Filzstift eingetragen hatte. Dann machte er einige Fotokopien und setzte sie ein, wo immer sie erforderlich waren.
Tatsächlich hatte er keinen einzigen Tag Architektur studiert. Er hatte sich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich eingeschrieben, wechselte aber noch im gleichen Semester zur Philosophie an der dortigen Universität. Sein Vater wollte ihm die Ausbildung nur unter der Bedingung finanzieren, dass es sich um ein Architekturstudium handelte, doch Massimos Interessen lagen schon seit dem Gymnasium auf ganz anderen Gebieten.
Vielleicht war der heimliche Studiumswechsel ein unbewusster Versuch, sich von einem starken Vater abzunabeln und seinen eigenen Weg zu finden. Im Grunde steckte dahinter die Auflehnung gegen den Zwang, als einziger Sohn einmal das Baugeschäft der Eltern übernehmen zu müssen. Und schließlich hat er es doch übernommen.
Es war eine dumme, unnötige Lüge, die Massimo all die [17] Jahre mit sich herumtragen musste. Niemand wusste von seinem Titelschwindel, weder sein Vater noch seine Mutter noch seine Mitarbeiter. Einzig seiner Frau Monika hatte er es Jahre später in einem Anflug von Hochgefühl bei der Geburt von Raffael – ihrem einzigen Kind – gebeichtet. Massimo hoffte, dass sie es danach gleich wieder vergessen hatte.
Der Einsturz des Opernhausdaches. Das löste ich innerhalb von kürzester Zeit durch einen Vergleich mit der Versicherungsgesellschaft, der Massimo zwar ein Vermögen kostete, ihn aber davor bewahrte, dass jemand in seiner Vergangenheit herumschnüffelte. Sein erschwindeltes Architekturdiplom hätte ihn nicht nur die Baulizenz am Gotthardstollen gekostet, sondern Hand in Hand mit seiner zweifelhaften Studentenzeit seinen Ruf als geradliniger Unternehmer gefährdet.
Darum hatte mich Massimo an diesem Tag zum Lunch in die Kronenhalle eingeladen. Und darum entwickelte sich unser Verhältnis zu etwas, das weit über eine Mandantenbeziehung hinausging. Ich hatte ihn vor einer Katastrophe bewahrt.
Und er revanchierte sich, indem er mich in das Geheimnis seiner Affäre einweihte? Ja, genau das tat er. Und er tat es mit einer Verzückung, einer geradezu erregten Trunkenheit, wie sie sonst nur Pubertierende an den Tag legen. Ich hörte zu, weil er mein Klient war, selbstverständlich – aber auch weil Massimo etwas hatte, das mich sonderbar anzog.
[18] »Nach diesem Kuss«, fuhr Massimo fort, »den sie weder erwiderte noch abschmetterte, der sie ebenso überraschte wie mich – machte ich für sie eine kleine Führung durch das Opernhaus. Das war, wie gesagt, wenige Wochen vor dem Einsturz des Daches. Sie stellte den Cellokasten in eine Ecke und zog ihren Trenchcoat über.
Wir nahmen den Lift zur obersten Galerie, dann die Wendeltreppe hoch zur Kuppel. Die meiste Zeit ging sie voraus. Ich folgte nicht ihr, sondern ihren Schuhen, ihren Beinen, ihren Hüften. Ich verfolgte wie ein Besessener die Uraufführung dieser Symphonie der Gelenke. Jede einzelne ihrer Bewegungen bekam eine so bizarre Bedeutsamkeit, dass ich mir gar keine andere Handlung vorstellen konnte, als für immer diesen geschmeidigen Beinen nachzulaufen.
Sie kennen das vielleicht, diese Dichte der Empfindung. Alles war mit Bedeutung aufgeladen – alles war mit Bedeutung elektrifiziert.
Dann nahm ich ihre Hand und führte sie über eine steile Holztreppe zu einer Luke. Ich war überrascht, wie wendig sie sich auf den hohen Absätzen ihrer schwarzen Pumps bewegte. Ich stieß die Luke auf, und wir standen auf dem Dach des Opernhauses. Unter uns der See, um uns herum die Türme und Dächer der Stadt. Weit weg, im Dunst, die Alpen, weiß bis in die Niederungen. Es war ein herrlicher Februartag, kalt, aber sonnig. Die Sonne klein wie eine Aprikose.«
Ich hatte meinen Teller schon beinahe leer gegessen, aber Massimo kam vor lauter Erzählen gar nicht dazu, einen [19] einzigen Bissen zu nehmen. Ein saftiges Stück Chateaubriand steckte seit einer halben Ewigkeit an seiner Gabel, die er immer wieder zum Mund führte. Aber im letzten Moment gewann stets das Reden, und er legte die Gabel mit dem erkalteten Stück Fleisch erneut auf den Teller.
Eigentlich wäre es an mir gewesen, ihn zu unterbrechen und meinerseits etwas zum Besten zu geben, doch mein Leben war im Vergleich zu seinem eine Ödnis. Da waren Klienten, die dem Anwaltsgeheimnis unterstanden, da waren Bücher – eine Menge gelesener und ungelesener – und vor langer Zeit vereinzelte Liebschaften, allesamt kaum berichtenswert. Von einer Liebe, von einer Verzückung, wie sie Massimo gerade erlebte, nicht die Spur.
Massimo fuhr fort, ohne einen einzigen Bissen verschlungen zu haben: »›Das also ist Ihr Dach‹, sagte sie. – ›Wohl eher Ihr Dach als meins‹, sagte ich. ›Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Konzert oder in einer Oper war. Muss während meiner Studentenzeit gewesen sein. Hier, sehen Sie.‹
Ich erläuterte ihr den Umbau der Dachträger, den meine Leute vorgenommen hatten. Einer dieser Träger schien mir nicht richtig befestigt zu sein, aber da ich wenig von Hochbau verstehe und vor einer Frau stand, die mein Urteilsvermögen spürbar beeinträchtigte, überspielte ich meine Bedenken. Ich zeigte ihr noch dies und jenes, das man von dem Dach aus sehen kann – die zur Agglomeration verschmolzenen Dörfer entlang des Zürichsees, die Promenade, das riesige Zifferblatt von St.Peter, die beiden Raketentürme des Großmünsters, lauter Dinge, die sie natürlich [20] auch kannte –, und dann stiegen wir Stufe um Stufe wieder hinunter.
Selbstverständlich hätte ich den unbefestigten Dachträger gleich meinen Leuten melden sollen, aber angesichts dieser Frau hatte ich es schlicht vergessen. Ich Dummkopf! Zwei Wochen später ist das Ding eingekracht.
Wyss, ich kann Ihnen nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass Sie mich aus dieser brenzligen Situation befreit haben. Diese Dachsanierung war unser erster Versuch im Hochbau, und ich kann Ihnen garantieren, unser letzter. Ein idiotischer Versuch, wohl nur zu erklären durch das Streben nach Höherem. Aber wissen Sie was? Tunnelbau ist gar nicht so schlecht. Weniger Glamour, mehr Rentabilität.«
Jetzt legte er das Besteck zur Seite, nahm einen kräftigen Schluck Réserve de la Patronne und wischte sich mit der Serviette die Lippen ab. Aus seinen Augen sprach mehr als Erleichterung. Es flackerte eine kindliche Lust am Leben darin, die alle abstrakten Probleme auf ein Nichts reduzierten.
Was für ein Unterschied zwischen dem Massimo vor zwei Monaten und dem, der mir jetzt gegenübersaß. Die Tränensäcke waren verschwunden, und sein Gesicht hatte den dunklen Glanz wieder, der ihm schon immer eigen war.
»Sie ist dreiunddreißig«, fuhr er fort, »schön, gebildet, sinnlich. Sie hat Ausstrahlung. Erotik. Eleganz. Grazie.«
Ich staunte, mit welcher Inbrunst er mir das alles erzählte. Ich beobachtete seine Gestik, seine kraftvollen Bewegungen, wie er die Stirn in Falten legte und sie wieder [21] glattlachte, wie er die Augenbrauen hob und senkte, das Leuchten seiner Augen, ich sah, wie er die Lippen bewegte, um all das auszudrücken, was auszudrücken immer nur misslingen kann: die Ekstase der Verliebtheit.
Ich war eingenommen von diesem Mann, den ich bisher nur als Klienten gekannt hatte. Als Sohn eines Bauunternehmers hatte er den unspektakulären Schritt getan, seinerseits Bauunternehmer zu werden, und sein Sohn würde sich unweigerlich in diese Linie einfügen.
»Kommen Sie.« Er stand auf, kaum hatte er den Espresso leer getrunken, ich folgte ihm über den Bellevueplatz zum See, wo ein Sportboot angelegt hatte, ein schönes, kleines, edles Boot vom Typ Boesch, Schweizer Fabrikat aus Mahagoni mit einem winzigen Rückspiegel, der in der Sonne blinkte. Beide Sitze vorne, das Liegepolster hinten sowie die Innenseiten waren in weißes Naturleder gefasst.
»Meine einzige Leidenschaft.«
»Neben Ihrer Cellistin«, lachte ich.
Er streckte mir seine Hand entgegen, ich fasste sie, und er half mir ins Boot.
Es war ein perfekter Frühlingstag. Wir spritzten über den See. Noch nie hatte ich einen bald fünfzigjährigen Mann so ausgelassen gesehen.
Er drehte die Musik voll auf: »I shot the sheriff; But I didn’t shoot no deputy, oh no! Oh! I shot the sheriff; But I didn’t shoot no deputy, ooh, ooh, oo-ooh; Yeah! All around in my home town; They’re tryin’ to track me down…« Die Stimme Bob Marleys vermischte sich mit [22] dem rasenden Gedröhn des 370-PS-Volvo-Penta-Sechszylinders.
Und Massimo sang mit. Er sang laut und tanzte ausgelassen, während seine Hände am Steuerrad damit beschäftigt waren, die wilden Bewegungen seines Oberkörpers zu kompensieren. Sein Haar glänzte in der Sonne.
»Haben Sie Lust auf Ski?«, rief er zu mir herüber.
»Auf was?«, schrie ich zurück. Der Wind flatterte mir um die Ohren. Ich musste mich hinter die Scheibe ducken, um ihn zu verstehen.
»Auf das!« Massimo ließ das Steuerrad für einen Augenblick los, lehnte seinen Oberkörper weit zurück und zog dabei seine Fäuste, eine über der anderen, ganz an seine Brust. »Ski. Wasserski!«
»Ich weiß nicht, wie das geht!«, rief ich zurück.
»Ich zeig’s Ihnen!«
Er nahm das Gas ganz zurück. Die Heckwelle, die uns die ganze Zeit gefolgt war, holte uns nun ein, hob das Boot von hinten und ließ uns hinter ihr zurück. Wir kamen zu einem schlingernden Stillstand.
Keine Ahnung, was in mich gefahren war. Noch nie hatte ich das Bedürfnis gehabt, Wasserski zu fahren, und genau genommen hatte ich es auch jetzt nicht. Aber Massimos Beschwingtheit hatte mich angesteckt. Irgendetwas ging von ihm aus, das mir bedeutete: Leg deinen Panzer ab, brich deinen Trott, und stürz dich ins Leben, bevor die endgültige Plage des Alters diesen unschuldigen Freuden ein Ende bereitet.
[23] Massimo kramte eine Schwimmweste, das Polypropylen-Seil und die Skier hervor. Dann begann er, sich bis auf die Unterhosen auszuziehen.
Weder er noch ich hatten Badehosen dabei, aber da wir – mit Ausnahme der wenigen Passagiere auf den Kursschiffen – die einzigen Menschen auf diesem See waren, schien es ihm nichts auszumachen. Und so folgte ich seinem Beispiel, knöpfte mein Hemd auf, zog Schuhe, Socken und Hosen aus und verstaute alles unter dem Sitz. Zwei Männer – ein sechsundvierzigjähriger Bauunternehmer und sein sechzigjähriger Anwalt – nur in Unterhosen.
Erst jetzt bemerkte ich, wie jung, wie gut erhalten Massimos Körper war. Er besaß diese Art gut definierter Muskeln, die man nicht durch Bodybuilding bekommt, sondern die ein Geschenk der Gene sind. Er war schlank, fit und strotzte vor Elastizität. Sein Körper und die energische Art, mit der er das Wasserskiseil am Heck festmachte, hätten diesen Sechsundvierzigjährigen problemlos als einen Dreißigjährigen durchgehen lassen.
Er trug bunt gestreifte Boxershorts (ich hingegen die peinlichen weißen Briefs, wie sie schon mein Vater und vermutlich Großvater getragen hatten), eine IWC Typ Aquatimer (soweit ich erkennen konnte, die limitierte Auflage mit dem blau-orangenen Ziffernblatt), einen Ehering und sonst nichts.
Ich kam mir neben Massimo bleich und käsig vor, aber gleichzeitig fühlte ich mich verjüngt von dem spitzbübischen Einfall, an einem normalen Werktag, wenn ganz Zürich bei der Arbeit war, Wasserski zu fahren. Die Luft war frisch, aber die Sonne schon stark.
[24] »Los!«, sagte Massimo. »Am besten, Sie versuchen’s mit zwei Skiern, das ist einfacher. Sie bilden ein Päckchen mit angezogenen Armen und Beinen und warten, bis ich Gas gebe. Stehen Sie erst auf, wenn die Skier halb aus dem Wasser sind. Und dann nicht Bücklingshaltung, sonst spüren Sie’s die nächste Woche im Kreuz, sondern mit durchgestrecktem Rücken. Alles klar?«
Ich zurrte die Schwimmweste fest, zwängte meine Füße in die Gummibindung, packte die Leine und sprang ins Wasser.
»Zum Teufel, kalt!«
»Gleich geht’s los, und dann werden Sie’s vergessen haben.«
Er fuhr das Boot so weit, bis die Leine gestreckt war.
»Okay?«, rief er. Ich nickte.
Mein Puls hämmerte. Meine Hände umklammerten die Plastikhantel. Dann spritzte es los. Auf einmal war ich oben, die Bretter schlitterten wie auf Betonplatten.
Als ich einigermaßen stabil auf dem Wasserbuckel stand, versuchte ich, ein bisschen seitwärts auszuscheren. Ich wagte mich vorsichtig bis zur linken Heckwelle, dann zur rechten. Mehrmals versuchte ich, die Heckwelle zu übersteigen, ein paar Mal wäre ich fast gestürzt, aber dann schaffte ich es doch, und nun befand ich mich jenseits des Wellenkamms auf dem unberührten, spiegelglatten Wasser des Zürichsees. Die Skier flatterten und hämmerten nicht mehr, sondern glitten wie auf Pulverschnee.
Mit der Zeit verließ mich die Kraft in den Händen, und plötzlich entglitt mir das Seil. Massimo legte das Boot in eine enge Kurve und brachte es neben meinem Kopf zum Stillstand.
[25] »Das war großartig, Wyss, Sie haben ja einiges drauf in Ihrem Alter. Noch mal?«
»Nein danke, ich glaub, das reicht für heute.«
Ich kroch ins Boot zurück. Meine Hände brannten. In meinen Fingerspitzen kribbelte es wie Ameisen. Massimo reichte mir ein Frotteetuch. Ich schlotterte, trocknete mich ab und schlüpfte, jetzt ohne Unterhosen, in meine Kleider.
Dann erklärte er mir kurz, wie man ein Boot steuert und austrimmt.
»Wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, geben Sie Vollgas. Danach drosseln Sie auf etwa 2300 Touren, und wenn’s mich zerschellt, drehen Sie einfach um und kommen mich holen. Alles klar?«
Ich hatte außer einigen Runden mit einem Pedalo – vor vielen Jahren, als ich es noch für nötig erachtete, romantische Beziehungen einzugehen und zu erhalten – noch nie ein Boot gesteuert, geschweige denn einen Wasserskifahrer gezogen. Aber am heutigen Tag hinderten mich weder meine Unkenntnis noch mein Alter noch meine grundsätzliche Abneigung gegen Frivolitäten; ich genoss diesen sonnigen Nachmittag wie ein Kind, das zum ersten Mal in einen Sandkasten gesetzt wird.
Bald ritt Massimo auf seinem Monoski von einem Wellenbuckel zum nächsten, legte sich scharf in die Kanten, spritzte dabei meterhohe Fontänen auf, alles athletisch, voller Eleganz, so, wie es eben Massimo zutiefst entsprach.
Die Wellen trommelten gegen den Bug. Links und rechts zogen die sanften Hügel vorbei. Der See rollte sich wie eine unbenutzte Alufolie vor uns aus. Er glänzte hart im Licht des Nachmittags. Ab und zu Enten, die erschreckt aufflogen.
[26] Aber eigentlich gab es nur den See und das Licht und das Gefühl, ohne innere Beschränkung zu leben. Wir glitten Richtung Süden, und das Einzige, was uns an jenem Nachmittag im Weg stand, waren die Alpen, sonst wären wir durchgefahren, Richtung Italien, Richtung Mittelmeer. Ich war selig.
Ich denke oft an diesen Tag zurück. Ich habe ihn gut in Erinnerung und verwende ihn manchmal als eine Art Kletterstange, an der ich mich hochzuziehen versuche, wenn die Depression wieder akut wird.
Kurz danach schlug das Wetter um, der Juni war grau, es verging kein Tag ohne Regen, ein langweiliger, müder Landregen, der nicht abziehen wollte. Wenn man auf den See hinausschaute, vereinigte er sich mit der Wolkendecke, und es sah aus, als würde er sich in einem weiten Bogen um sich krümmen und von oben auf sich selbst heruntertropfen. Der Regen gab der Landschaft eine schräge Schraffur.
Es lohnte sich kaum mehr, einen Schirm aufzuspannen, die Luft war so feucht, dass der Regen einen wie ein Mantel umschloss. Regen wie Unkraut. Die Dächer glänzten, die Enten hockten reglos im See, die Schwalben waren verstummt oder weggezogen, ein S-Bahn-Tunnel, so hörte man, musste wegen Sickerwasser gesperrt werden. Man war froh, auf 400Meter Höhe zu wohnen, einen Abfluss zu wissen, der sich dieser maßlosen Übertreibung annahm und sie in den Rhein überführte.
Mit dem Juli kam die Sonne wieder. Ich hatte gehofft, dass die Antriebslosigkeit der letzten Wochen auf den Regen [27] zurückzuführen war. Aber als das schöne Wetter zurückkehrte, wurde es nicht besser. Es wurde schlimmer.
Nur unter größter Anstrengung gelang es mir am Morgen aufzustehen. Ich stand vor dem Kleiderschrank und konnte mich nicht zwischen Nadelstreifen und Uni entscheiden. Die Wahl der Krawatte und noch mehr der Manschettenknöpfe überforderte mich. Mit Neid dachte ich an Einstein, der in Princeton morgens vor einem Dutzend identischer grauer Anzüge gestanden hatte und mit geschlossenen Augen hineingreifen durfte.
Wenn ich die Kanzlei erreicht hatte und an meinem Schreibtisch saß, ging es dann einigermaßen. Ich bewältigte den Tag mit einer Art hohlem Fleiß. Die Akten diktierten meine Gedanken. Ich war reaktiv, phantasielos und ineffizient.
Mein Körper, der vielleicht alles ist, was ich bin, fühlte sich auf einmal fremden Strömungen ausgeliefert. All die Gerichtsentscheide, die Strategien, die ziselierten, feinsinnigen Verträge, die elementare Rohheit eines Telefonapparats oder eines Kugelschreibers, alle Gedanken, ja sogar Affären, die man sich vorstellen konnte, schienen in eine dumpfe Schalheit eingewickelt.
Die Mittagszeit war ein Graus. Ich verließ die Kanzlei unter dem Vorwand eines Klienten-Lunches, um allein zu sein. Ich starrte auf den See hinaus und glitt dabei in diesen dunklen Schacht der Gefühle hinunter. Was mich am meisten störte, war die Unfähigkeit, dieser Landschaft eine positive Emotion abzugewinnen. Der See, die Hügel zu beiden Seiten, die Alpen im Hintergrund, die Schneespitzen, die Federwolken im tiefen Blau – alles, was vor mir lag, [28] war erhaben, ich wusste es, fühlte aber nichts dabei. Ich versuchte mir die frühlingshafte Spritzfahrt mit Massimo in Erinnerung zu rufen und was ich dabei gefühlt hatte – vergeblich.
An den Nachmittagen hing ich matt über den Akten. Ich war bestrebt, jeden Kontakt zu umgehen – sei es ein Meeting oder ein Telefongespräch – und ausschließlich schriftlich zu kommunizieren.
Wenn ich mich am Abend erschöpft ins Bett warf, wusste ich: Ich werde nicht schlafen können, das Bett ist mein Feind. Es sprach zu mir: Lies so viele Seiten von dem langweiligsten Schrott wie du willst, ich werde dich trotzdem nicht schlafen lassen. Schlucke so viele Tabletten wie du kannst, ich werde dir keine Erholung gönnen, ich bin wie ein dreifacher Ristretto, und deine Gedanken werden kreisen und kreisen und kreisen, die immer gleichen unergiebigen Gedanken, du wirst dich an ihnen aufreiben, bis deine ganze Energie erlischt und du matt zusammensackst, aber selbst dann werde ich dich nicht schlafen lassen, bis der Morgen mit seiner falschen Helligkeit da ist. Und genau so war es.
Als ich nach einigen Wochen meinen Hausarzt aufsuchte, schickte er mich noch am selben Tag zu einem psychiatrischen Facharzt, der mich sofort mit einer Sammlung Antidepressiva ausstattete – Efexor (für den Morgen), Remeron mit Orangengeschmack (für den Abend) und Temesta zur sofortigen Entlastung.
Weil man mich nicht als suizidgefährdet einstufte – ich war es wirklich nicht, ich wollte doch nur arbeiten und [29] endlich wieder schlafen können –, sah man von einem Klinikaufenthalt ab. Die psychologische Betreuung wurde in konzentrierten Dosen und ambulant verabreicht, zuerst in wöchentlichen Sitzungen, später monatlich.
Das war sie jetzt also, die Depression. Ich hatte mich stets als zufriedenen Menschen gekannt. Einsam, ja, und nachdenklich – aber beides, die Einsamkeit und die Selbstbesinnung betrachtete ich immer als Privileg. Nun war sie da, die Depression, sie war schleichend gekommen wie eine fünfte Jahreszeit.
Ich informierte noch am selben Abend Thomas Ladner, den Geschäftsführer der Kanzlei. Wir einigten uns auf die Sprachregelung »Urlaub aus persönlichen Gründen«. Keinesfalls sollten unsere Mitarbeiter oder die Klienten davon Kenntnis erhalten.
Ich behielt Massimo als einzigen Kunden, alle anderen verteilten wir auf die jüngeren Anwälte. Warum gerade Massimo? Weil er sich strikte weigerte, mit einem anderen Anwalt vorliebzunehmen.
Auch wenn man seit einigen Jahren gern den Begriff »Burnout« anstelle von »akuter Depression« verwendet, um vom Stigma des Hirnkranken abzulenken, handelt es sich eben doch um eine Hirnkrankheit. Biologisch ausgedrückt: ein Mangel an Serotonin und anderen Neurotransmittern. Kompensation durch Einnahme von sogenannten Wiederaufnahmehemmern (Psychopharmaka), damit das Serotonin länger zwischen den Hirnzellen verweilt und seinen Dienst erfüllen kann.
Man müsste das Hirn dazu bringen, den [30] Hormonhaushalt selbst im Gleichgewicht zu halten. In einfachen Fällen durch Psychotherapie möglich. In schweren Fällen nicht.
Außer dem einen oder anderen Vertrag – Bauverträge, ab und zu Leasingverträge für Baumaschinen – hörte ich über ein Jahr lang nichts von Massimo. Was ich mitbekam, war, dass er inzwischen tatsächlich diese Cellistin Julia Bodmer geheiratet hatte.
Die Fotos, nach denen ich die Zeitschriften absuchte (die halbe Stunde alle zwei Monate beim Friseur erlaubten mir, den bunten Klatsch nachzuverfolgen – Hollywoodsternchen, Herren im Smoking, pfundweise Schmuck an Damenhälsen, das breite Grinsen allerseits, die gestelzte Darstellung jener seichten Glückseligkeit, die einen überkommt, wenn man im Rampenlicht steht, kurz, dieses ganze armselige Bedürfnis nach modernem Adel und Adelsklatsch), zeugten von einer pompösen Selbstinszenierung.
Sie hatten wenig mit dem bodenständigen Massimo zu tun, den ich kannte, und im ersten Moment dachte ich an Fotomontage. Die Bilder zeigten Massimo und Julia in vollem Hochzeitskitsch, beklatscht von einer Traube herausgeputzter Menschen.
Viele Gesichter waren mir bekannt: die immer gleichen Leute der Zürcher Lokalprominenz – der Direktor des Opernhauses mit seiner kriminell jungen Freundin, der Baudirektor, ein bekannter Promi-Koch, der Meteorologe des nationalen Fernsehens, eine hübsche Astrologin, der braungebrannte Gründer eines lokalen Privatradios, der sich tapfer jeder Art von Älterwerden widersetzt, [31] Schlagersänger im Ruhestand, ausrangierte Kabarettisten, ein Zirkusbesitzer und eine Handvoll Zeitungsverleger.
Bald darauf, es war im August oder September 2005 – erhielt ich eine Einladung zu einer halbtägigen Rundfahrt per Schiff auf dem Vierwaldstättersee mit anschließendem Konzert im Kunst- und Kongresszentrum Luzern. Eingeladen hatte Massimo.
Den offiziellen Grund der Feierlichkeiten habe ich vergessen, aber der wahre Anlass war wohl, seine schöne neue Frau zu präsentieren. Eingeladen waren »geschätzte Geschäftsfreunde«, wie es auf dem Kärtchen hieß. Nachdem ich schon die Festlichkeiten zu seiner Hochzeit ausgeschlagen hatte – glücklicherweise, wie sich nachträglich herausstellte –, gab es für mich keinen Grund, an einem Firmenanlass mit noch mehr Leuten teilzunehmen.
Ich konnte es mir genau vorstellen: Weißwein und Salzmandeln auf einem historischen Raddampfer, während links und rechts die Postkartenberge vorüberziehen. Vor allem aber: Smalltalk mit dem dritten stellvertretenden Gemeindepräsidenten irgendeines Kaffs am Gotthard, der Massimo erlaubt hatte, seine Lastwagen gratis zu parken. Ich warf das Kärtchen in den Müll.
»Sie dürfen sich der Gesellschaft nicht verschließen, Wyss. Zwingen Sie sich, aus dem Haus zu gehen. Zwingen Sie sich, mindestens einmal die Woche Menschen zu treffen.«
Rampl, mein Psychotherapeut, ein sechzigjähriger Österreicher mit hässlichen Zähnen und schweren Augen, zu dem ich monatlich zur Konsultation muss, damit die [32] Krankenkasse die Medikamente bezahlt, hat die Art eines müden Brigadekommandanten.
»Menschen sind anstrengend«, antworte ich, »und die meisten Gespräche sind unergiebig.«
»Das spielt keine Rolle. Die Forschung zeigt, dass Menschen mit intensiven Sozialkontakten eindeutig glücklicher sind als einsame.«
»Vielleicht neigen die Glücklicheren eher zu sozialen Kontakten.«
»Wyss, tun Sie es für sich. Sie werden sonst noch zum Eremiten. So wie Sie Antidepressiva schlucken, gegen Ihren innersten Willen, gehen Sie außer Haus und treffen Sie Menschen – gegen Ihren innersten Willen. Das ist Teil der Therapie. Nehmen Sie die Aufforderung weder als Wunsch noch als Bitte, sondern als Anordnung Ihres Arztes.«
Also krame ich Massimos Einladung wieder aus dem Mülleimer und melde mich an für den »genüsslichen halben Tag auf dem schönsten See der Schweiz«, wie es auf dem Kärtchen heißt.
Der Ausflug bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Dreihundert Personen auf der herausgeputzten »Stadt Luzern«, Disneyland, aber authentisch, Baujahr 1928, fast allesamt Männer, vom Steuerexperten zum Maschinenparkverwalter, vom Benzinlieferanten zum Kreditsachbearbeiter, vom mittelrangigen Vertreter der Schweizerischen Bundesbahnen zum mittelrangigen Vertreter des Sprengstofflieferanten – die meisten in kurzärmligen Hemden und Krawatte.
Die Garderobe – ein Fest des schlechten Geschmacks. Massimo mit Zigarre spielt den Gastgeber perfekt, ein [33] kleiner Schwatz hier, ein kleiner Schwatz dort, ab und zu klopft er jemandem auf die Schulter und lacht, und ich frage mich, woher ein so intelligenter Mann die Energie für dieses unmögliche Spektakel bezieht. Der Wahn der Geselligkeit! Zum Glück scheint die Sonne.
Alle tummeln sich draußen, und so habe ich den Unterdecksalon für mich allein. Ich lese ein Buch (The Black Swan von Nassim Taleb) und bin froh um jeden Meter, den das Dampfschiff auf dem Weg nach Luzern zurücklegt.
Dann das Konzert im Kunst- und Kongresszentrum Luzern. Beethovens Cellosonaten Nr.1, 2 und 3. Ich kenne sie in der klassischen Einspielung von Jacqueline du Pré und Daniel Barenboim – eine Aufnahme aus den siebziger Jahren, als Barenboim noch der hungrige Pianist war, und die multiple Sklerose seine Frau Jacqueline noch nicht niedergestreckt hatte. Nun also mit Julia Bodmer und dem deutschen Pianisten Karl-Heinz Wollmann.
Julia schlägt sich tapfer, gerät nur einmal ins Schlingern, im Scherzo der dritten Sonate, aber das fällt mir nur auf, weil ich du Pré im Ohr habe.
Julia sehr gewagt mit schwarzen Lederstiefeln und einem schwarzen Kleid, dessen Saum knapp bis zu den Knien reicht und dessen Ärmel die Ellbogen überdecken. Aus jeder ihrer Bewegungen spricht exquisiter Stolz, und sie verströmt eine elegante Kälte.
Die ganze Zeit beobachte ich Massimo, wie er Julia fixiert, und denke: Seiner Hand wird es überlassen sein, solche schönen Beine auseinanderzubringen. Ihre schimmernde Haut. Der Perlmuttglanz. Massimo betrachtet sie, [34] als wäre sie soeben aus dem Paradies herabgestiegen, zu ihnen, den Geschäftsfreunden der Marini Bau AG. Diese Frau, eine einzige Augenweide.
Massimo und Julia wollen dem Sprengstofflieferanten eine neue Welt zeigen, eine Umlaufbahn, die der Sprengstofflieferant aus eigenem Antrieb niemals erreichen kann. Aber warum? Warum, Massimo, tust du dies?, frage ich mich die ganze Zeit.
Applaus. Julia und der Pianist verneigen sich. Das Publikum tobt. Es will eine Zugabe und bekommt sie in Form der sehr traurigen zweiten Cellosonate von Bach.
Anschließend Bankett. Nun ist Julia auch dabei. Ich sehe sie zum ersten Mal aus der Nähe. Ihr Gesicht ist schön, ihre Augen sind groß, aber nicht blau, wie Massimo behauptet hat, sondern blaugrün wie ein Metallstück, das man in eine Gasflamme hält. Ihre Stirn ist so perfekt und gleichmäßig gewölbt, als käme sie direkt aus einer Spritzgussfertigung.
Sie hat diesen freundlichen Ausdruck, der wie eine hauchdünne Maske über allem zu schweben scheint. Darunter erwartet man Dunkles, aber nichts Verrufenes – der Schimmer einer schicksalhaften Vergangenheit. Ihre Lippen sind nicht unerotisch, und wenn sie lacht, lacht sie ein breites, unbefangenes Lachen. Sie genießt es, aus der Ferne betrachtet zu werden, aber es ist ihr unwohl, wenn ihr jemand zu nahe tritt – ihre ganz feinen Härchen am Hals stellen sich dann auf.
Ihre virtuose Schlichtheit hat etwas Bezwingendes, man fühlt sich von dieser Frau eingenommen und gleichzeitig auf Distanz gehalten. Man fühlt sich ernst genommen und [35] trotzdem ein bisschen unernst. Ich glaube nicht, dass es einen Mann gibt, den diese Frau an ihr Innerstes heranlässt.
»Wir haben bewusst etwas ›Allgemeinverständliches‹ ausgesucht – Rachmaninow, Kodály oder Hindemith hätten Massimos Gäste überfordert«, sagt sie, als ich sie auf das Konzert anspreche. »Ich meine das nicht überheblich«, korrigiert sie gleich, »schließlich verstehe ich auch nichts vom Tunnelbau. Es sind einfach zwei Welten. Und ich denke nicht, dass die zusammenpassen.«
»Aber genau das scheint Massimo ja zu wollen«, sage ich. »Und in gewisser Weise hat es doch geklappt: Das Publikum hat applaudiert.«
»Es war ein Applaus aus reiner Begeisterung. Das sind Menschen, die kaum je ein Konzert besuchen, aber dieses Juwel von einem Konzerthaus schon hundertmal von außen bewundert haben. Es ist, als würde man Ihnen ständig Bilder vom Wiener Riesenrad vorführen, und plötzlich sitzen Sie in der Gondel. Da kann es regnen und ächzen wie es will, Sie werden begeistert sein. Glauben Sie mir, nach so vielen Jahren des Musizierens kann ich den Applaus lesen wie eine Schrift.«
»Aber Massimo scheint die Verschmelzung der beiden Welten hinzukriegen. Er hat Sie, und er hat den Tunnelbau.«
Sie lachte. »Wie Sie das sagen… Aber da haben Sie wohl recht.«
»Und Sie lernen etwas über Tunnelbau.«
»Ach wissen Sie, ich kann sehr gut mit meiner Einseitigkeit leben. Mein Inneres, das ist eine Kollektion von [36] Unvollkommenheiten und Abgründen; ein ganzer Kontinent fehlt – der allerdings nicht durch den Tunnelbau zu erreichen ist.«
Sie lachte wieder, aber diesmal bemerkte ich, wie die scheinbar natürliche Freundlichkeit abfiel und eine steinerne Wand hervortrat. Ich sah, aus welchem Grund auch immer, die Klagemauer in Jerusalem vor mir. Doch schon einen Augenblick später war die entspannte Schönheit ihres Gesichts wiederhergestellt. Dass sie so offen und gleichzeitig so verdeckt mit mir sprach, überraschte mich, schließlich kannten wir uns erst seit wenigen Minuten.
Es standen nun ein halbes Dutzend Männer um uns herum, die alle darauf warteten, ihr zu gratulieren oder sie genauer zu inspizieren, so wie ich das ja auch getan hatte. Ich verabschiedete mich.
Gerade als ich mich von ihr entfernen wollte, zupfte sie mich am Ärmel und flüsterte mir ins Ohr: »Ich bin froh, dass Massimo Sie hat. Er schätzt Sie sehr – als Rechtsanwalt und als Mensch.«
»So, das war dein Tag unter Menschen. Hausaufgaben erledigt«, klopfte ich mir auf die Schulter, als ich die Haustür hinter mir zuzog. »Jetzt darfst du wieder ein paar Tage drinnen bleiben.« Ich las noch ein bisschen in meinem Buch, dann stellte ich, wie jeden Abend, den Cocktail an Antidepressiva zusammen, den ich wohl noch eine Weile lang würde schlucken müssen: zwei grüne Efexor, eine Remeron mit Orangengeschmack und zwei rote Kapseln Temesta.
Dass die »Abgründe«, von denen Julia gesprochen hatte, [37] dereinst Massimos Sohn verschlingen sollten, konnte ich damals natürlich nicht wissen. Massimos Ehe mit Julia machte mir einen stabilen, ja glücklichen Eindruck. Er war in Julia vernarrt, wie man nur in eine Frau vernarrt sein kann. Und umgekehrt vernahm ich nichts als Zuneigung, Herzlichkeit und Respekt.
Was mich betrifft: Niemals hätte ich gedacht, dass Massimos schicksalhaftes Zusammentreffen mit Julia mein Leben vollkommen umpflügen würde. Aber so war es, und darin liegt wohl der Grund, warum ich mich zu dem zweifelhaften Vergnügen habe hinreißen lassen, private Aufzeichnungen, die niemanden etwas angehen, zu veröffentlichen.
Zwei Monate nach Massimos öffentlicher Präsentation seiner neuen jungen, schönen, kultivierten Frau sind wir unterwegs zur Baustelle des Gotthard-Basistunnels. Massimo steuert seinen Porsche Cayenne nicht wie ein typischer Porsche-Cayenne-Fahrer, sondern so, als hätte man sich alle PS dieser Maschine sparen können, die über die Leistung eines Cinquecento hinausgingen.
Massimo trägt einen dunkelblauen enggeschnittenen italienischen Anzug ohne Krawatte, eine Prada-Sonnenbrille, sein Hemd steht am Hals ehrgeizig offen, und darunter leuchtet seine gesunde, südländische, dunkle Haut, die verrät, wie viel Vitalität und Energie in diesem bald fünfzigjährigen Mann stecken.
Aus den Lautsprechern rieselt diesmal nicht Bob Marley, sondern irgendeine Cellosonate, vermutlich eine Aufnahme mit Julia. Ich frage nicht. Ich denke mir, dass diese [38] Musik ebenso Bestandteil seines grandiosen persönlichen Verjüngungsprojekts ist wie sein Porsche Cayenne, seine neue Sonnenbrille, sein neues Haus am See, seine neuen Freunde in der Prominentenszene und die Trophäe von einer Frau.
Massimo findet, dass sein Rechtsanwalt die Gotthardbaustelle mit eigenen Augen gesehen haben müsse, um die Verträge vernünftig beurteilen zu können. Ich denke, dass ein guter Rechtsanwalt seinen Schreibtisch nie verlassen sollte, es sei denn, zum eigenen Vergnügen. Ein Anwalt braucht ein gewisses Maß an Abstraktion, darum sind seine Stunden im Büro besser investiert als draußen in der detailverseuchten Wirklichkeit.
Der Gotthard-Basistunnel ist der dritte Durchstich dieses Massivs, das aus Europa einen Norden und einen Süden macht.
Der erste Tunnel, zwischen 1870 und 1882 unter unvorstellbaren Qualen und erbarmungslosem Verschleiß von Menschenleben gebaut, gilt mit seiner Zufahrt über sechs Kehrtunnels noch heute als technisches Wunder.
Der zweite Tunnel, 1980 eröffnet und parallel zum ersten angelegt, verbindet das Autobahnnetz im Norden Europas mit dem Italiens. Es ist ein langweiliger, dünner, schlecht durchlüfteter, unspektakulärer Tunnel von siebzehn Kilometer Länge, den die Autofahrer erreichen, nachdem sie die erforderlichen Höhenmeter über eine von Erstfeld nach Göschenen ansteigende Rampe überwunden haben – um sie auf der Tessiner Seite ebenso langwierig wieder zu vernichten.
[39] Der dritte Tunnel, der nun im Bau befindliche Gotthard-Basistunnel, ist etwas komplett anderes. Man hat die Bohrung ganz unten im Tal angesetzt. Ein Zug wird zwischen Zürich und Mailand mit zweihundert Stundenkilometer geradewegs durchbrausen können.
»Mit 57Kilometer wird er der längste Eisenbahntunnel der Welt sein. Ein Wunderwerk wie die Pyramiden von Giseh«, schwärmt Massimo. Und Massimo baut mit! Seine Firma ist Teil eines internationalen Konsortiums, das den Zuschlag für die zentrale Bauetappe erhalten hat. Im Jahr 2000 ging es los mit den Ausschreibungen, 2001 erhielt er den Zuschlag, und seit 2002 ist er am Löchern.
Dieser mittlere Bauabschnitt, der sogenannte Sedrun-Abschnitt, ist der technisch kniffligste, weil er nur über einen vertikalen Zugangsstollen erreicht werden kann. In der winzigen Berggemeinde Sedrun im obersten Rheintal hat man einen 800Meter tiefen Schacht getrieben. Vom Endpunkt dieses Schachtes aus fressen sich die Mineure ihren Kameraden entgegen, die von Norden beziehungsweise von Süden her in den Berg eindringen. Weil der Tunnel aus drei großen Bauabschnitten besteht – Amsteg im Norden, Sedrun in der Mitte und Biasca im Süden –, wird es zu zwei großen Durchstichen kommen.
»Es ehrt mich, an einem so gigantischen Projekt beteiligt zu sein«, sagt er, während wir auf der Autobahn den Vierwaldstättersee entlanggleiten. Der Anblick dieses stillen, geheimnisvollen, verwinkelten Sees und die enganliegende Krone dunkel bewaldeter Berghänge erinnert mich an den schrecklichen Ausflug vor zwei Monaten, den Massimo für [40] seine »Geschäftsfreunde« veranstaltet hatte – als ich mich im Salon des Dampfschiffs verkrochen hatte, um zu lesen.
»Es ehrt mich…«
Ich nahm es Massimo nicht ab, dass er tatsächlich so dachte. So redet keiner, der denken kann, sagte ich mir. Es ehrt mich… Dieser neue, glatte, rundum zufriedene Massimo war nicht der, den ich kannte. Er war nicht der rebellische Sohn eines emsigen süditalienischen Fremdarbeiterpaars, den ich aus den verzweifelten Schilderungen ebendieser Eltern zu kennen glaubte.
Und er war nicht der vorurteilslose junge Mann, der ein Baugeschäft nach dem Tod seines Vaters aus Pflicht, Schuldgefühl und vielleicht auch in Ermangelung einer Alternative übernommen hatte und die Entscheidung, Tunnelbauunternehmer statt Philosoph zu sein, nach einem zermürbenden inneren Kampf mit aller Konsequenz verteidigt hatte.
Nein, dieser neue Massimo schien sämtliche inneren Zweifel beseitigt zu haben und war unterwegs zu einer zweiten Lebenshälfte voller Genuss und Widerspruchslosigkeit, in der die Lebensstränge frei von Knoten und Verwirrungen parallel, direkt und glatt in Richtung eines goldenen Lebensabends führten.
Doch irgendetwas ließ mich daran zweifeln. Ich war fast überzeugt, dass er sich eine grandiose Fassade geschaffen hatte, hinter der es brodelte. Aber vielleicht lag ich falsch. Vielleicht hatte er tatsächlich das Unmögliche geschafft: diese heraldische Glückseligkeit als widerspruchsloser, mit sich im Einklang befindlicher Monolith.
Als wir so auf der Autobahn dahinglitten – wir hatten [41] das Ende des Sees passiert und fuhren nun entlang der Reuss, die, weil es die letzten Tage nur geregnet hatte, uns grünbraungrau und kräftig brodelnd entgegenquoll –, erzählte mir Massimo das eine oder andere von seinem Sohn Raffael, von seiner Begeisterung für Fußball, von seiner kompletten Trikotsammlung italienischer Mannschaften. Er sprach in solch hochfliegenden Worten von einem, wie mir schien, recht durchschnittlichen Burschen – es grenzte an Vergötterung.
Und wie sehr es ihn schmerzte, dass er, nach der Scheidung von Monika, Raffael nur jedes zweite Wochenende zu sehen bekam! Jedes Mal steuerte er die Diskussion zu dem Punkt, ob man da rechtlich nicht doch etwas ausrichten könne. Und jedes Mal musste ich ihn enttäuschen. Einmal alle zwei Wochen, das wurde bei der Scheidung so ausgemacht, schriftlich, und daran gab’s nichts zu rütteln. Wir zogen hinauf nach Andermatt und dann über den sattgrün glänzenden Oberalppass nach Sedrun.
Massimo parkte auf dem Kiesparkplatz neben einem abgestellten Raupenlader seiner Firma. Über dem engen Tal türmten sich Kumuluswolken. Ich sah hoch zu den Bergspitzen und beobachtete, wie der Wind Wolkenschleier herumwirbelte und sie in Fetzen riss. So eng und tief war das Tal, es kam mir vor, als wollten die Berge über uns zusammenschlagen.
Wir wurden von dem Bauleiter begrüßt, einem großen, schätzungsweise vierzigjährigen Mann. »Ohne ihn würde hier nichts gehen«, sagte Massimo und klopfte ihm auf die Schulter. Mich stellte er als seinen »Rechtsanwalt und [42] Freund« vor, was mich irritierte. Ich ließ mir nichts anmerken.
Der Bauleiter rüstete Massimo und mich mit je einem orangenen Schutzanzug, einem sogenannten »Selbstretter« (einer Art Notfilter), Stiefeln, einer Schutzbrille und einem Helm aus. Dann marschierten wir zum Stolleneingang.
Ein Frachtlift riss uns 800Meter in die Tiefe. Als wir das Scherengitter beiseitestießen, befanden wir uns in einer zwanzig Meter hohen Kaverne, die die beiden parallelen Tunnelschächte miteinander verbindet.
Es herrschte emsiges Treiben. Alles, was in diesen Tunnelabschnitt gelangte – Mineure, Maschinen, Vermessungsgeräte, Sprengstoff, Strom, Ersatzteile –, und alles, was diesen Tunnelabschnitt verließ – Aushubmaterial, Sickerwasser, abgewetzte Kernbohrer und die Mineure am Ende der Schicht –, musste zwingend durch dieses Nadelöhr.
Ein Transportzüglein nahm uns zur Stollenbrust mit. Im Stollen war die Luft heiß und staubig. Neonlampen hingen in Zehnmeterabständen an einem Kabel, das an der frisch ausgebrochenen Tunnelwand festgemacht war. Entlang der Tunneldecke schwebte ein gigantischer Luftwurm, eine kilometerlange, aufgeblähte Kunststoffhülle von einem Meter Durchmesser in der Farbe einer Kalbsbratwurst. Durch diesen Luftwurm strömte Frischluft in den vorderen Bereich des Tunnels.
»Willkommen im Gotthard-Basistunnel.« Massimo kam das Wort »Tunnel« so kompakt über die Lippen wie ein veralteter französischer Mädchenname, und er legte ein Timbre in dieses Wort, als würde man dem Berg etwas schenken, statt ihm etwas zu entnehmen.
[43] »Es gibt zwei Arten von Vortrieb im Tunnelbau.« Er musste laut sprechen, beinahe schreien, damit ich ihn verstand. »Maschinell und konventionell. Maschinell, das sind riesige Tunnelbaumaschinen, die sich drehend durch den Fels fressen. Ihre Bohrköpfe sind mit Industriediamanten bestückt. Sie schrammen den Fels ab. Tunnelbaumaschinen werden dort eingesetzt, wo der Fels eine mittlere Dichte hat. Das Team im Norden kommt uns mit einer Tunnelbaumaschine entgegen. Aber nicht hier. Hier, in diesem Abschnitt, haben wir es mit einem anspruchsvollen Fels zu tun. Manchmal ist er zu hart, manchmal zu weich, und wir treffen auf Quarzadern, Wasserbrüche und zuckerkörnigen Dolomit.«
Ein Traktor mogelte sich an uns vorbei. Ich verstand vor lauter Motorengeräusch kein Wort mehr. Ich beobachtete, wie Massimo von Hand losen Stein von der Tunnelwand wegkratzte und in der Hand zerrieb.