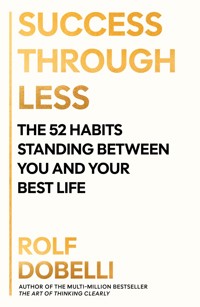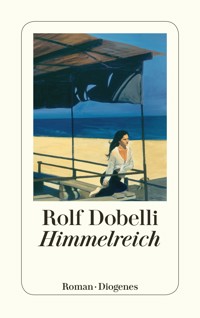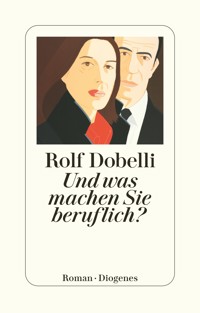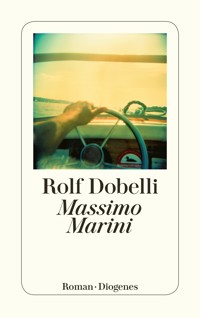9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Neuausgabe des Bestsellers: Komplett überarbeitet, neu gestaltet, mit großem Workbook-Teil und zahlreichen Illustrationen! Wer Rolf Dobellis gescheite Texte über unsere häufigsten Denkfehler gelesen hat, weiß mehr, doch er ist noch lange nicht aus dem Schneider. Denn auf dem Weg vom Denken zum Handeln lauern weitere Fallstricke. Glücklicherweise kann man die umgehen – wenn man weiß, wie. Genau das verrät »Die Kunst des klugen Handelns«: In 52 Kapiteln zeigt Dobelli - warum es sich lohnt, Türen zu schließen und auf Optionen zu verzichten, - warum Informationsüberfluss zu unklugem Handeln anstiftet, - warum Geld stets in emotionale Kleider gehüllt ist, - warum wir es darum oft unbedacht ausgeben. Rolf Dobelli gibt Ihnen das nötige Rüstzeug. Sein Rat: Schlagen Sie nicht jeden Irrweg ein, nur weil andere ihn gehen. Lernen Sie aus den Fehlern, die andere freundlicherweise für Sie machen. Denken Sie klar und handeln Sie klug! Rolf Dobellis Texte sind sowohl inhaltlich ausgesprochen bereichernd als auch ein echtes Lesevergnügen. »Die Bücher des Schweizers Rolf Dobelli machen nicht nur klüger, sondern tatsächlich glücklicher. Das liegt an seinen angenehm unaufgeregten, profunden Ratschlägen.« Denis Scheck, Tagesspiegel »Rolf Dobellis Bücher habe ich nicht nur gelesen, sondern jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen.« Frank Elstner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2020Illustrationen: El Bocho und Simon Stehle, BerlinLitho: Lorenz & Zeller, Inning am AmmerseeCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: busypix/Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
VORWORT
1 Begründungsrechtfertigung
2 Entscheidungsermüdung
3 Berührungsdenkfehler
4 Das Problem mit dem Durchschnitt
5 Motivationsverdrängung
6 Plappertendenz
7 Will-Rogers-Phänomen
8 Information Bias
9 Clustering Illusion
10 Aufwandsbegründung
11 Das Gesetz der kleinen Zahl
12 Erwartungen
13 Einfache Logik
14 Forer-Effekt
15 Volunteer’s Folly
16 Affektheuristik
17 Introspection Illusion
18 Die Unfähigkeit, Türen zu schließen
19 Neomanie
20 Schläfereffekt
21 Alternativenblindheit
22 Social Comparison Bias
23 Primär- und Rezenzeffekt
24 Aderlasseffekt
25 Not-Invented-Here-Syndrom
26 Der Schwarze Schwan
27 Domain Dependence
28 Falscher-Konsens-Effekt
29 Geschichtsfälschung
30 In-Group/Out-Group Bias
31 Ambiguitätsintoleranz
32 Default-Effekt
33 Die Angst vor Reue
34 Salienz-Effekt
35 Die andere Seite des Wissens
36 House Money Effect
37 Prokrastination
38 Neid
39 Personifikation
40 Was-mich-nicht-umbringt-Trugschluss
41 Aufmerksamkeitsillusion
42 Strategische Falschangaben
43 Zu viel denken
44 Planungsirrtum
45 Déformation professionnelle
46 Zeigarnik-Effekt
47 Fähigkeitsillusion
48 Feature-Positive Effect
49 Rosinenpicken
50 Die Falle des einen Grundes
51 Intention-To-Treat-Fehler
52 News-Illusion
Dank
DER DOBELLI-DISCLAIMER
Stimmen zu Rolf Dobelli
DAS WORKBOOK
EINFÜHRUNG
BEGRÜNDUNGSRECHTFERTIGUNG
ENTSCHEIDUNGSERMÜDUNG
BERÜHRUNGSDENKFEHLER
DAS PROBLEM MIT DEM DURCHSCHNITT
MOTIVATIONSVERDRÄNGUNG
PLAPPERTENDENZ
WILL-ROGERS-PHÄNOMEN
INFORMATION BIAS
CLUSTERING ILLUSION
AUFWANDSBEGRÜNDUNG
DAS GESETZ DER KLEINEN ZAHL
ERWARTUNGEN
EINFACHE LOGIK
FORER-EFFEKT
VOLUNTEER’S FOLLY
AFFEKTHEURISTIK
INTROSPECTION ILLUSION
DIE UNFÄHIGKEIT, TÜREN ZU SCHLIESSEN
NEOMANIE
SCHLÄFEREFFEKT
ALTERNATIVENBLINDHEIT
SOCIAL COMPARISON BIAS
PRIMÄR- UND REZENZEFFEKT
ADERLASSEFFEKT
NOT-INVENTED-HERE-SYNDROM
DER SCHWARZE SCHWAN
DOMAIN DEPENDENCE
FALSCHER-KONSENS-EFFEKT
GESCHICHTSFÄLSCHUNG
IN-GROUP/OUT-GROUP BIAS
AMBIGUITÄTSINTOLERANZ
DEFAULT-EFFEKT
DIE ANGST VOR REUE
SALIENZ-EFFEKT
DIE ANDERE SEITE DES WISSENS
HOUSE MONEY EFFECT
PROKRASTINATION
NEID
PERSONIFIKATION
WAS-MICH-NICHT-UMBRINGT-TRUGSCHLUSS
AUFMERKSAMKEITSILLUSION
STRATEGISCHE FALSCHANGABEN
ZU VIEL DENKEN
PLANUNGSIRRTUM
DÉFORMATION PROFESSIONELLE
ZEIGARNIK-EFFEKT
FÄHIGKEITSILLUSION
FEATURE-POSITIVE EFFECT
ROSINENPICKEN
DIE FALLE DES EINEN GRUNDES
INTENTION-TO-TREAT-FEHLER
NEWS-ILLUSION
AUSWERTUNG
IHRE TOP-FIVE-DENKFEHLER
Literatur
VORWORT
Der Papst fragte Michelangelo: »Verraten Sie mir das Geheimnis Ihres Genies. Wie haben Sie die Statue von David erschaffen – dieses Meisterwerk aller Meisterwerke?« Michelangelos Antwort: »Ganz einfach. Ich entfernte alles, was nicht David ist.«
Seien wir ehrlich. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was uns erfolgreich macht. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was uns glücklich macht. Aber wir wissen mit Sicherheit, was Erfolg oder Glück zerstört. Diese Erkenntnis, so einfach sie daherkommt, ist fundamental: Negatives Wissen (was nicht tun) ist viel potenter als positives (was tun).
Klarer zu denken, klüger zu handeln bedeutet, wie Michelangelo vorzugehen: Konzentrieren Sie sich nicht auf David, sondern auf alles, was nicht David ist, und räumen Sie es weg. In unserem Fall: Entfernen Sie alle Denk- und Handlungsfehler, und ein besseres Denken und Handeln wird sich von alleine einstellen.
Die Griechen, Römer und mittelalterlichen Denker hatten einen Namen für dieses Vorgehen: Via Negativa. Wörtlich: der negative Weg, der Weg des Verzichts, des Weglassens, des Reduzierens. Es war die Theologie, die als Erste die Via Negativa beschritt: Man kann nicht sagen, was Gott ist, man kann nur sagen, was Gott nicht ist. Auf die heutige Zeit angewandt: Man kann nicht sagen, was uns Erfolg beschert. Man kann nur sagen, was Erfolg verhindert oder zerstört. Mehr muss man auch nicht wissen.
Als Firmengründer und Unternehmer bin ich selbst in eine Vielzahl von Denkfallen getappt. Ich konnte mich zum Glück immer noch daraus befreien, aber wenn ich heute Vorträge halte (aus unerfindlichen Gründen neuerdings »Keynotes« genannt) vor Ärzten, Vorständen, Aufsichtsräten, Managern, Bankiers, Politikern oder Regierungsmitgliedern – dann fühle ich mich ihnen verwandt. Ich habe das Gefühl, im selben Boot mit meinen Zuhörern zu sitzen – versuchen wir doch alle, durch das Leben zu rudern, ohne von den Strudeln verschluckt zu werden. Theoretiker haben Mühe mit der Via Negativa. Praktiker hingegen verstehen sie. So schreibt der legendäre Investor Warren Buffett über sich und seinen Partner Charlie Munger: »Wir haben nicht gelernt, schwierige Probleme im Geschäftsleben zu lösen. Was wir gelernt haben: sie zu vermeiden.« Via Negativa.
Auf Die Kunst des klaren Denkens folgt nun also Die Kunst des klugen Handelns. Sie fragen: Worin unterscheiden sich Denk- von Handlungsfehlern? Die ehrliche Antwort: eigentlich gar nicht. Ich brauchte einen neuen Buchtitel für die folgenden 52 Kapitel, und dieser erschien mir passend. Die Texte stammen wiederum aus den Kolumnen, die ich für die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Schweizer SonntagsZeitung geschrieben habe. Nimmt man beide Bücher zusammen, sind die wichtigsten 100 Denkfallen nun aufgedeckt.
Mein Wunsch ist ein ganz einfacher: Wenn es uns allen gelänge, die wichtigsten Denkfehler zu vermeiden – sei es im Privatleben, im Beruf oder im politischen Entscheidungsprozess –, resultierte ein Quantensprung an Wohlstand. Kurzum: Wir brauchen keine zusätzliche Schlauheit, keine neuen Ideen, keine Hyperaktivität, wir brauchen nur weniger Dummheit. Der Weg zum Besseren führt über die Via Negativa. Michelangelo hatte dies erkannt, und vor ihm schon Aristoteles: »Das Ziel des Weisen ist nicht Glück zu erlangen, sondern Unglück zu vermeiden.« Jetzt ist es an Ihnen, sich in die Schar der Weisen einzureihen.
Ganz wichtig: Für die Neuausgabe hat das Buch einen Workbook-Teil bekommen.
Rolf Dobelli
Bildeins
1 Begründungsrechtfertigung
Warum schlechte Gründe oft ausreichen
Stau auf der Autobahn zwischen Basel und Frankfurt. Belagsanierung. Ich regte mich auf, quälte mich eine Viertelstunde lang im Schritttempo auf der Gegenfahrbahn vorwärts, bis ich den Stau endlich hinter mir hatte. Hinter mir glaubte. Eine halbe Stunde später stand ich wieder still, wieder wegen Belagsanierung. Aber komischerweise regte ich mich jetzt nicht mehr groß auf. Neben der Straße standen in regelmäßigen Abständen Schilder: »Wir sanieren die Autobahn für Sie.«
Der Stau erinnerte mich an ein Experiment, das die Harvard-Psychologin Ellen Langer in den 70er-Jahren durchführte. In einer Bibliothek wartete sie, bis sich vor dem Kopierer eine Schlange gebildet hatte. Dann fragte sie den Vordersten: »Entschuldigen Sie. Ich habe fünf Seiten. Würden Sie mich bitte vorlassen?« Nur selten gab man ihr den Vortritt. Sie wiederholte das Experiment, aber diesmal gab sie einen Grund an: »Entschuldigen Sie. Ich habe fünf Seiten. Würden Sie mich bitte vorlassen? Ich bin in Eile.« In nahezu allen Fällen ließ man ihr den Vortritt. Das ist nachvollziehbar; Eile ist ein guter Grund. Überraschend waren die folgenden Versuche. Wieder wartete sie, bis sich eine Schlange gebildet hatte: »Entschuldigen Sie. Ich habe fünf Seiten. Würden Sie mich bitte vorlassen, denn ich möchte ein paar Kopien machen?« Wieder ließ man sie in fast allen Fällen vor, obwohl der Grund lächerlich war, denn jeder stand in der Schlange, um Kopien zu machen.
Wir stoßen auf mehr Verständnis und Entgegenkommen, wenn wir für unser Verhalten einen Grund angeben. Was überrascht: Oft spielt es keine Rolle, ob der Grund sinnvoll ist oder nicht. Das ist die Begründung durch das Wörtchen »weil«. Ein Schild, das verkündet: »Wir sanieren die Autobahn für Sie«, ist komplett überflüssig, denn was sonst wird wohl auf einer Autobahnbaustelle vor sich gehen? Spätestens bei einem Blick aus dem Fenster wissen wir, was los ist. Und doch beruhigt uns die Angabe des Grundes. Umgekehrt nerven wir uns, wenn dieses »weil« ausbleibt.
Flughafen Frankfurt, das Boarding verzögerte sich. Dann die Durchsage: »Ihr Flug LH 1234 ist um drei Stunden verspätet.« Ich schritt zum Gate und fragte die Dame nach dem Grund. Ohne Erfolg. Ich war stinksauer: eine Ungeheuerlichkeit, uns Wartende auch noch im Unwissen zu lassen! In einem anderen Fall lautete die Durchsage: »Ihr Flug LH 5678 ist aus betrieblichen Gründen um drei Stunden verspätet.« Ein komplett nichtssagender Grund, aber er genügte, um mich und die anderen Passagiere zu beruhigen.
Menschen sind »weil«-süchtig. Wir brauchen das Wort, selbst wenn es nicht stichhaltig ist. Wer andere Menschen führt, weiß das. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern kein »weil« geben, lässt ihre Motivation nach. Es genügt nicht, zu verkünden, der Zweck Ihrer Schuhfirma bestehe in der Produktion von Schuhen – obwohl genau das der Zweck ist. Nein, es braucht Zwecke wie: »Wir wollen mit unseren Schuhen den Markt revolutionieren« (was immer das heißt) oder: »Wir verschönern Frauenbeine und damit die Welt.«
Steigt oder sinkt die Börse um ein halbes Prozent, wird ein Börsenkommentator niemals schreiben, was der Wahrheit entspricht: dass es sich nämlich um weißes Rauschen, also das zufällige Resultat aus unendlich vielen Marktbewegungen handelt. Die Leser wollen einen Grund, und den wird ihnen der Kommentator liefern – was er sagt, ist dabei völlig nebensächlich (besonders beliebt sind Äußerungen von Zentralbankpräsidenten).
Werden Sie nach dem Grund gefragt, warum Sie eine Frist verpasst haben, antworten Sie am besten: »Weil ich leider noch nicht dazu gekommen bin.« Eine redundante Information (denn wären Sie dazu gekommen, hätten Sie die Frist ja eingehalten), aber eine oft akzeptable.
Eines Tages beobachtete ich meine Frau, die schwarze Wäsche sorgfältig von blauer trennte. Das war aus meiner Sicht sinnlos, denn Abfärben ist hier, soweit ich das beurteilen kann, kein Problem. Zumindest war es das nie seit meiner Studentenzeit. »Warum trennst du Blau von Schwarz?«, fragte ich. »Weil ich’s lieber separat wasche.« Mir genügte das als Antwort.
Fazit: Das »weil« muss sein. Dieses unscheinbare Wörtchen ist der Schmierstoff des Zwischenmenschlichen. Verwenden Sie es inflationär.
Bildzwei
2Entscheidungsermüdung
Warum Sie besser entscheiden, wenn Sie weniger entscheiden
Sie haben wochenlang bis an den Rand der Erschöpfung an dem Projektpapier gearbeitet. Die PowerPoint-Folien sind poliert. Jede Zelle im Excel stimmt. Die Story-Line besticht durch glasklare Logik. Für Sie hängt alles von diesem Projekt ab. Bekommen Sie das grüne Licht vom CEO, sind Sie auf dem Weg in die Konzernleitung. Wird das Projekt abgeschmettert, suchen Sie sich besser einen neuen Job. Die Assistentin schlägt Ihnen folgende Zeiten für die Präsentation vor: 8:00 Uhr, 11:30 Uhr oder 18:00 Uhr. Welche Zeit wählen Sie?
Der Psychologe Roy Baumeister belegte einen Tisch mit Hunderten von billigen Artikeln – von Tennisbällen über Kerzen, T-Shirts, Kaugummi bis zu Cola-Dosen. Er teilte seine Studenten in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe nannte er die »Entscheider«, die zweite die »Nichtentscheider«. Den Versuchspersonen der ersten Gruppe sagte er: »Ich zeige euch jeweils zwei beliebige Artikel, und ihr müsst entscheiden, welchen der beiden ihr vorzieht. Je nachdem, wie ihr wählt, werde ich euch am Ende des Experiments einen Artikel schenken.« Den Versuchspersonen der zweiten Gruppe sagte er: »Schreibt auf, was euch zu jedem Produkt einfällt, und ich werde euch am Ende des Experiments einen Artikel schenken.« Unmittelbar danach musste jeder Student die Hand in eiskaltes Wasser stecken und möglichst lange ausharren. Das ist in der Psychologie die klassische Methode, um die Willenskraft beziehungsweise Selbstdisziplin zu messen – denn es braucht Willenskraft, um gegen den natürlichen Impuls anzukämpfen, die Hand aus dem Wasser zu ziehen.
Das Resultat: Die »Entscheider« rissen die Hand viel früher aus dem Eiswasser als die »Nichtentscheider«. Die intensive Entscheidungsarbeit hatte sie Willenskraft gekostet – ein Effekt, der in vielen anderen Experimenten bestätigt wurde.
Entscheiden ist also anstrengend. Jeder, der mal einen Laptop online konfiguriert oder eine lange Reise inklusive Flügen, Hotels und Freizeitangeboten zusammengestellt hat, kennt das Gefühl: Nach all dem Vergleichen, Abwägen und Entscheiden ist man erschöpft. Die Wissenschaft nennt das Entscheidungsermüdung (englisch: Decision Fatigue).
Entscheidungsermüdung ist gefährlich. Als Konsument werden Sie anfälliger für Werbebotschaften und Impulskäufe. Als Entscheidungsträger werden Sie anfälliger für erotische Verführungen. Im Kapitel über Prokrastination werden wir sehen: Willenskraft funktioniert wie eine Batterie. Nach einer Weile ist sie leer und muss wieder aufgeladen werden. Wie? Indem man Pause macht, sich entspannt, etwas isst. Hat Ihr Kreislauf zu wenig Blutzucker, fällt die Willenskraft zusammen. IKEA weiß das nur allzu gut: Auf dem langen Weg durch 10.000 Artikel macht sich bei den Konsumenten Entscheidungsermüdung bemerkbar. Darum befinden sich die IKEA-Restaurants genau in der Mitte des Rundgangs. IKEA opfert gern etwas von der Marge auf Schwedentorten, wenn Sie danach wieder fit genug sind, um sich für Kerzenständer zu entscheiden.
Vier inhaftierte Männer eines israelischen Gefängnisses ersuchten das Gericht, frühzeitig entlassen zu werden. Fall 1 (vom Gericht angehört um 8:50 Uhr): ein Araber, zu 30 Monaten verurteilt für Betrug. Fall 2 (13:27 Uhr): ein Jude, zu 16 Monaten verurteilt für Körperverletzung. Fall 3 (15:10 Uhr): ein Jude, zu 16 Monaten verurteilt für Körperverletzung. Fall 4 (16:35 Uhr); ein Araber, zu 30 Monaten verurteilt für Betrug. Wie urteilten die Richter? Entscheidender als die Religion oder die Schwere des Verbrechens war die Entscheidungsermüdung der Richter. Den Gesuchen 1 und 2 wurde stattgegeben, weil der Kreislauf der Richter voller Blutzucker war (vom Frühstück beziehungsweise Mittagessen). Die Gesuche 3 und 4 wurden abgelehnt. Die Richter brachten nicht genug Willenskraft auf, um das Risiko einer frühzeitigen Entlassung einzugehen. Folglich fielen sie auf den Status quo zurück (der Mann bleibt im Gefängnis). Eine Studie über Hunderte von Gerichtsentscheiden zeigt: Der Prozentsatz von »mutigen« Gerichtsentscheiden fällt innerhalb einer Gerichtsverhandlung von 65 % fast auf null und steigt nach einer Pause abrupt wieder auf 65 % an. So viel zur sorgfältig abwägenden Justitia. Und so viel auch zur Eingangsfrage, um welche Zeit Sie Ihr Projekt dem CEO präsentieren sollten.
Bilddrei
3Berührungsdenkfehler
Warum Sie Hitlers Pullover nicht tragen würden
Würden Sie einen frisch gewaschenen Pullover anziehen, den Adolf Hitler einst getragen hat?
Im neunten Jahrhundert, nach dem Zerfall des karolingischen Reichs, versank Europa – besonders Frankreich – in Anarchie. Grafen, Burgvögte, Ritter und andere lokale Herrscher kämpften pausenlos gegeneinander. Die rücksichtslosen Haudegen plünderten Bauernhöfe, vergewaltigten Frauen, zertrampelten Ährenfelder, verschleppten Pfarrer und zündeten Klöster an. Weder die Kirche noch die Bauern konnten dem irrsinnigen Kriegstreiben des Adels etwas entgegensetzen. Im Gegensatz zu den Rittern waren sie waffenlos.
Im zehnten Jahrhundert kam dem Bischof von Auvergne eine Idee. Er bat die Fürsten und Ritter, sich an einem bestimmten Tag auf einem Feld zu einer Art Symposium einzufinden. Pfarrer, Bischöfe und Äbte sammelten derweil alle Reliquien, die sie in der Umgebung auftreiben konnten, und stellten sie auf dem Feld aus – Knochenstücke von verstorbenen Heiligen, blutgetränkte Stofffetzen, Steine und Fliesen, ja überhaupt alles, was je in Berührung mit Heiligen gekommen war. Der Bischof – damals eine Respektsperson – forderte nun die versammelten Adligen auf, in der Präsenz all dieser Reliquien der maßlosen Gewalt abzuschwören und künftig auf Angriffe gegen Unbewaffnete zu verzichten. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, wedelte er vor ihren Gesichtern mit den blutigen Tüchern und heiligen Knochen. Der Respekt vor den Reliquien muss gewaltig gewesen sein, denn das Beispiel des französischen Bischofs machte Schule: Seine eigenwillige Art des Gewissensappells breitete sich unter den Begriffen »Gottesfrieden« (lateinisch Pax Dei) und »Waffenruhe Gottes« (Treuga Dei) in ganz Europa aus. »Man sollte niemals die Angst der Menschen im Mittelalter vor den Heiligen und deren Reliquien unterschätzen«, kommentiert der amerikanische Historiker Philip Daileader.
Als aufgeklärter Mensch können Sie über diese dumpfe Furcht nur lachen. Aber warten Sie mal – wie haben Sie auf die Eingangsfrage geantwortet? Würden Sie Hitlers Pullover tragen? Wohl kaum, oder? Das ist erstaunlich, denn es zeigt, dass auch Sie keineswegs allen Respekt vor unfassbaren Kräften verloren haben. Hitlers Pullover hat rein materiell nichts mehr mit Hitler zu tun. Trotzdem ekeln Sie sich davor.
Magische Wirkungen dieser Art lassen sich nicht einfach ausschalten. Paul Rozin und seine Forschungskollegen der University of Pennsylvania baten Versuchspersonen, ein Foto von einer ihnen nahestehenden Person mitzubringen. Die Wissenschaftler pinnten das Foto ins Zentrum einer Zielscheibe und forderten die Probanden auf, Dartpfeile darauf zu werfen. Es tut der Mutter ja nicht weh, wenn ihr Bild mit Pfeilen durchlöchert wird! Trotzdem war die Hemmung groß. Die Teilnehmer trafen viel schlechter als eine Kontrollgruppe mit leerer Zielscheibe. Ja, sie verhielten sich so, als würde sie eine magische Kraft abhalten, auf die Bilder zu zielen.
Verbindungen zwischen Personen und Dingen – selbst wenn sie längst vergangen oder nur immaterieller Art sind wie bei den Fotos – lassen sich kaum ignorieren: Das besagt der Berührungsdenkfehler (englisch Contagion Bias). Eine Freundin war lange Zeit Kriegskorrespondentin für den staatlichen Fernsehsender France 2. So wie Passagiere einer Karibik-Kreuzfahrt von jeder Insel ein Souvenir mitnehmen – einen Strohhut, eine bemalte Kokosnuss –, besitzt auch sie einen Schrank voller Kriegssouvenirs. Einer ihrer letzten Einsätze war Bagdad 2003. Wenige Stunden nachdem die amerikanischen Truppen Saddam Husseins Regierungspalast gestürmt hatten, schlich sie sich in die Privatgemächer. Im Speisesaal erspähte sie sechs vergoldete Weingläser, die sie prompt mitgehen ließ. Als ich sie neulich in Paris besuchte, servierte sie den Wein in diesen Gläsern. Jedermann war von dem Prunk begeistert. »Gibt es die bei Lafayette?«, fragte jemand. »Das sind Saddam Husseins Gläser«, sagte sie lakonisch. Eine aufgebrachte Kollegin spuckte den Wein angeekelt zurück ins Glas und begann hysterisch zu husten. Ich konnte nicht anders und musste noch einen draufsetzen: »Ist es dir eigentlich klar, wie viele Moleküle du mit jedem Atemzug einatmest, die Hussein auch schon in seiner Lunge hatte?«, fragt ich sie. »Ungefähr eine Milliarde.« Ihr Hustenanfall verstärkte sich noch.
Bildvier
4Das Problem mit dem Durchschnitt
Warum es keinen durchschnittlichen Krieg gibt
Angenommen, Sie sitzen im Bus mit 49 weiteren Personen. Bei der nächsten Haltestelle steigt die schwerste Person Deutschlands ein. Frage: Wie stark verändert sich das Durchschnittsgewicht der Menschen im Bus? Um 4 %? 5 %? – Etwas in dieser Größenordnung.
Angenommen, Sie sitzen immer noch im selben Bus, aber jetzt steigt Karl Albrecht ein, der reichste Mann Deutschlands. Wie stark verändert sich das Durchschnittsvermögen der Passagiere? Um 4 %? 5 %? – Weit gefehlt!
Rechnen wir das zweite Beispiel kurz durch. Nehmen wir an, jede der 50 zufällig ausgewählten Personen hat ein Vermögen von 54.000 Euro. Das entspricht dem statistischen Zentralwert (Median). Nun setzt sich Karl Albrecht mit geschätzten 25 Milliarden Euro hinzu. Das neue Durchschnittsvermögen im Bus schießt auf 500 Millionen hoch, eine Steigerung von einer Million Prozent. Ein einziger Ausreißer verändert das Bild komplett, und der Begriff »Durchschnitt« macht in diesem Fall überhaupt keinen Sinn mehr.
»Überquere nie einen Fluss, der im Durschnitt einen Meter tief ist«, warnt Nassim Taleb, von dem ich auch die Bus-Beispiele habe. Der Fluss kann über lange Strecken wenige Zentimeter seicht, aber in der Mitte ein reißender Strom von zehn Metern Tiefe sein – in dem man ertrinken würde. Mit Durchschnitten zu rechnen kann gefährlich sein, weil der Durchschnitt die dahinterliegende Verteilung maskiert. Ein anderes Beispiel: Die durchschnittliche UV-Strahlenbelastung an einem Sommertag ist gesundheitlich unbedenklich. Wenn Sie aber praktisch den ganzen Sommer im abgedunkelten Büro verbringen, dann nach Mallorca fliegen und dort eine Woche lang ungeschützt in der Sonne braten, haben Sie ein Problem – obwohl Sie im Durschnitt nicht mehr UV-Licht abbekommen haben als jemand, der regelmäßig im Freien war.
Das alles ist nicht neu und ziemlich logisch. Neu aber ist das: In einer komplexen Welt sind die Verteilungen zunehmend unregelmäßig. Oder um zu den Bus-Beispielen zurückzukehren: Sie gleichen eher dem zweiten Beispiel als dem ersten. Von Durchschnitten zu sprechen ist deshalb immer öfter unangemessen. Wie viele Besuche hat eine durchschnittliche Website? Es gibt keine durchschnittliche Website. Es gibt ganz wenige Webseiten (jene von Bild, Facebook oder Google zum Beispiel), die die Mehrzahl der Besuche auf sich ziehen – und es gibt die restlichen Webseiten, beinahe unendlich viele, die ganz wenige Besuche verbuchen. Mathematiker sprechen in diesen Fällen von einem sogenannten Potenzgesetz. Extreme dominieren die Verteilung, und das Konzept des Durchschnitts wird nichtssagend.
Was ist die durchschnittliche Größe einer Firma? Was ist die durchschnittliche Einwohnerzahl einer Stadt? Was ist ein durchschnittlicher Krieg (in Anzahl Toten oder in Anzahl Kriegstagen gerechnet)? Was ist die durchschnittliche tägliche Veränderung des DAX? Wie groß ist die durchschnittliche Kostenüberschreitung von Bauprojekten? Wie hoch ist die durchschnittliche Auflage von Büchern? Wie hoch die durchschnittliche Schadenssumme eines Wirbelsturms? Was ist der durchschnittliche Bonus eines Bankers? Der durchschnittliche Erfolg einer Marketingkampagne? Wie viele Downloads hat im Durchschnitt eine iPhone-App? Wie viel verdient der durchschnittliche Filmschauspieler? Natürlich lässt sich das alles ausrechnen, aber es bringt nichts. In all diesen Fällen haben wir es mit Verteilungen nach dem Potenzgesetz zu tun. Um nur das letzte Beispiel herauszupicken: Eine Handvoll Schauspieler kassieren mehr als zehn Millionen pro Jahr, während Abertausende am Existenzminimum kratzen. Würden Sie Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn also raten, sich im Schauspielfach zu versuchen, weil dort die Löhne im Schnitt ganz anständig sind? Besser nicht.
Fazit: Wenn jemand das Wort »Durchschnitt« sagt, werden Sie hellhörig. Versuchen Sie die dahinterliegende Verteilung zu ergründen. In Bereichen, wo ein einzelner Extremfall fast keinen Einfluss auf den Durchschnitt hat – wie im ersten Bus-Beispiel –, macht das Konzept des Durchschnitts Sinn. In den Bereichen, wo ein einzelner Extremfall dominiert – wie im zweiten Bus-Beispiel –, sollten Sie (und Journalisten) auf das Wort »Durchschnitt« verzichten.
Bildfünf
5Motivationsverdrängung
Wie Sie mit Boni Motivation zerstören
Vor einigen Monaten zog ein Freund von Frankfurt nach Zürich. Ich bin oft in Frankfurt, und so bot ich ihm an, seine heiklen Gegenstände (mundgeblasene Gläser aus altem Familienbesitz und antike Bücher) nach Zürich zu fahren. Ich weiß, wie stark er an diesem Besitz hängt. Es hätte ihn geärgert, wenn die Umzugsfirma seine Wertsachen weniger sorgfältig als rohe Eier behandelt hätte. Also lud ich die Ware in Zürich ab. Zwei Wochen später bekam ich einen Brief, in dem er sich bedankte. Beigelegt war eine 50er-Note.
Die Schweiz sucht seit Jahren ein Endlager für ihre radioaktiven Abfälle. Verschiedene Standorte kommen für ein Tiefenlager in Betracht, darunter Wolfenschiessen in der Zentralschweiz. Der Ökonom Bruno Frey und seine Mitforscher der Universität Zürich befragten die Teilnehmer einer Gemeindeversammlung, ob sie dem Bau eines Tiefenlagers zustimmen würden. 50,8 % beantworteten die Frage mit Ja. Dies aus verschiedenen Gründen: nationaler Stolz, Fairness, soziale Verpflichtung, Aussicht auf Arbeitsplätze. Die Forscher befragten sie ein zweites Mal. Diesmal offerierten sie jedem Bürger (hypothetische) 5.000 Franken Kompensation – bezahlt von allen Steuerzahlern der Schweiz. Was passierte? Die Zustimmung fiel auf die Hälfte zusammen. Nur noch 24,6 % waren bereit, ein Endlager zu akzeptieren.
Und noch ein Beispiel: Kinderkrippen. In aller Welt kämpfen sie mit dem gleichen Problem: Eltern, die ihre Kinder nach der Öffnungszeit abholen. Der Krippenleiterin bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Sie kann das Kind ja nicht einfach in ein Taxi setzen. Viele Krippen haben deshalb eine Gebühr für Eltern eingeführt, die ihre Kinder zu spät abholen. Studien zeigen: Die Anzahl der zu spät kommenden Eltern nimmt dadurch nicht wie erwartet ab, sondern zu.
Die drei Geschichten zeigen eines: Geld motiviert in diesen Fällen nicht. Im Gegenteil. Indem mir mein Freund 50 Franken zuschob, entwertete er meine Hilfe – und entwürdigte damit unsere Freundschaft. Die Bußen der Kinderkrippen transformierten das Verhältnis zwischen Eltern und Krippe von einem zwischenmenschlichen in ein monetäres. Das Zuspätkommen war jetzt legitim – schließlich bezahlte man dafür. Und das Geldangebot für ein Atomendlager wurde als Bestechung wahrgenommen, oder zumindest reduzierte es den Bürgersinn, die Bereitschaft, etwas für das Gemeinwohl zu tun. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen Motivationsverdrängung (englisch Motivation Crowding). Überall dort, wo Menschen etwas aus nicht monetären Gründen tun, führt Bezahlung zum Zerfall dieser Bereitschaft. In anderen Worten: Monetäre Motivation verdrängt die nicht monetäre.
Angenommen, Sie leiten eine Non-Profit-Unternehmung. Die Löhne, die Sie bezahlen, liegen natürlicherweise unter dem Durchschnitt. Trotzdem sind Ihre Mitarbeiter hoch motiviert, denn sie glauben an ihre Mission. Wenn Sie nun eine Art Bonussystem einführen – soundso viel Prozent Lohnzuschlag pro eingeheimste Spende –, wird genau der Motivationsverdrängungseffekt einsetzen: Die monetäre Motivation wird die nicht monetäre verdrängen. Ihre Leute werden sich keinen Deut mehr um Dinge scheren, die nicht direkt bonusrelevant sind. Kreativität, die Reputation der Firma oder die Weitergabe von Wissen an neue Mitarbeiter: All das wird ihnen egal sein.
Wenn Sie eine Unternehmung führen, wo es keine intrinsische Motivation zu verdrängen gibt, dann ist das kein Problem. Kennen Sie einen Anlageberater, Versicherungsagenten oder Wirtschaftsprüfer, der seine Arbeit aus Leidenschaft macht? Der an eine Mission glaubt? Ich nicht. Deshalb funktionieren Boni in diesen Branchen so gut. Wenn Sie hingegen ein Start-up gründen und Mitarbeiter suchen, tun Sie gut daran, Ihre Firma mit Sinn aufzuladen – und nicht mit Geldreserven für deftige Boni.
Und noch ein Tipp, falls Sie Kinder haben: Die Erfahrung zeigt, dass gerade junge Menschen nicht käuflich sind. Wollen Sie, dass Ihre Kinder die Schulaufgaben erledigen, ihr Musikinstrument üben oder auch mal den Rasen mähen, dann winken Sie nicht mit Geld. Geben Sie ihnen stattdessen ein fixes Taschengeld pro Woche. Ansonsten werden sich die Kleinen bald weigern, abends ins Bett zu gehen – es sei denn, Sie bezahlen etwas dafür.
Bildsechs
6Plappertendenz
Wenn du nichts zu sagen hast, sage nichts
Gefragt, warum ein Fünftel der Amerikaner ihr Land auf einer Weltkarte nicht findet, antwortete die Miss Teen South Carolina, immerhin eine Frau mit Highschool-Abschluss, vor laufenden Kameras: »Ich glaube persönlich, dass US-Amerikaner es nicht können, weil einige Leute draußen in unserer Nation keine Karten haben, und ich glaube, dass unsere Ausbildung, wie zum Beispiel Südafrika und Irak, überall so und so ähnlich, und ich glaube, dass die sollten, unsere Ausbildung hier, in den USA sollte den USA helfen, sollte Südafrika helfen, sollte Irak helfen und die Länder in Asien, damit es möglich sein wird, unsere Zukunft zu wachsen.« Das YouTube-Video ging um die Welt.
Okay, sagen Sie, aber mit Missen gebe ich mich nicht ab. Wie wär’s dann mit dem folgenden Satz? »Das Reflexivwerden der kulturellen Überlieferungen muss nun keineswegs im Zeichen von subjektzentrierter Vernunft und futuristischem Geschichtsbewusstsein stehen. In dem Maße, wie wir der intersubjektiven Konstituierung der Freiheit gewahr werden, zerfällt der possessiv-individualistische Schein einer als Selbstbesitz vorgestellten Autonomie.« – Erkannt? Jürgen Habermas in Faktizität und Geltung.
Die Beispiele der Schönheitskönigin und des deutschen Starphilosophen sind Ausprägungen des gleichen Phänomens: der Plappertendenz (englisch: Twaddle Tendency). Denkfaulheit, Dummheit oder Nichtwissen führen zu Unklarheit im Kopf. Ein Schwall von Wörtern soll diese geistige Unklarheit maskieren. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Bei der Schönheitskönigin hat die Vernebelungsstrategie versagt. Bei Jürgen Habermas hat sie funktioniert, zumindest vorläufig. Je eloquenter die Vernebelungsstrategie, desto leichter fallen wir darauf herein. In Verbindung mit der Autoritätshörigkeit (vorgestellt in Die Kunst des klaren Denkens) kann Geplapper zu einer gefährlichen Mischung werden.
Wie oft bin ich schon auf die Plappertendenz hereingefallen! In meiner Jugend war ich von Jacques Derrida fasziniert. Ich habe seine Bücher verschlungen, aber selbst nach intensivem Nachdenken nichts verstanden. Dadurch bekam seine Philosophie die Aura einer Geheimwissenschaft. Das Ganze hat mich dazu getrieben, sogar eine Dissertation in diesem Bereich zu schreiben. Rückblickend betrachtet war beides nutzloses Geplapper – Derrida und meine Dissertation. Ich hatte mich in meiner Unwissenheit selbst in eine verbale Rauchmaschine verwandelt.
Am deutlichsten ist die Plappertendenz bei Sportlern. Der arme Fußballspieler wird vom Interviewer zu irgendwelchen Analysen gedrängt. Eigentlich möchte er nur sagen: »Wir haben das Spiel verloren, so ist es halt nun einfach.« Doch der Moderator muss die Sendezeit irgendwie füllen – am besten, indem er drauflosplappert und Sportler und Trainer zum Plappern nötigt.
Aber auch in akademischen Sphären grassiert, wie gesehen, die Plapperei. Je weniger Resultate eine Wissenschaft generiert, desto mehr neigt sie dazu. Besonders anfällig für die Plappertendenz sind die Ökonomen – wie Sie unschwer aus den Kommentaren und Wirtschaftsprognosen ersehen können. Dasselbe gilt für die Wirtschaft im Kleinen. Je schlechter eine Unternehmung läuft, desto größer die Plauderei des CEOs. Hinzu kommt oft noch das Plappern durch Taten, also Hyperaktivität. Eine löbliche Ausnahme ist der frühere CEO von General Electric, Jack Welch. Er sagte in einem Interview: »Sie glauben es nicht, wie schwierig es ist, einfach und klar zu sein. Die Leute fürchten, dass sie als Einfaltspinsel gesehen werden. In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt.«
Fazit: Geplapper maskiert Nichtwissen. Ist etwas nicht klar ausgedrückt, weiß der Sprecher nicht, wovon er spricht. Die sprachliche Äußerung ist der Spiegel der Gedanken: Klare Gedanken – klare Äußerungen. Unklare Gedanken – Geplapper. Das Dumme ist, dass wir in den wenigsten Fällen wirklich klare Gedanken haben. Die Welt ist kompliziert, und es braucht viel Denkarbeit, um auch nur einen Aspekt zu verstehen. Bis Sie so eine Erleuchtung haben, ist es besser, sich an Mark Twain zu halten: »Wenn du nichts zu sagen hast, dann sage nichts.« Einfachheit ist der Endpunkt eines langen, beschwerlichen Weges, nicht der Ausgangspunkt.
Bildsieben
7Will-Rogers-Phänomen
Wie Sie als Manager bessere Zahlen ausweisen, ohne etwas dafür zu tun
Angenommen, Sie sind Fernsehdirektor eines Unternehmens mit zwei Sendern. Kanal A hat hohe Einschaltquoten, Kanal B extrem niedrige. Der Aufsichtsrat fordert Sie auf, die Quote beider Sender zu steigern, und zwar innerhalb eines halben Jahrs. Schaffen Sie es, winkt ein Superbonus. Schaffen Sie es nicht, sind Sie Ihren Job los. Wie gehen Sie vor?
Ganz einfach: Sie schieben eine Sendung, die die durchschnittliche Einschaltquote des Kanals A bisher leicht heruntergezogen hat, aber immer noch ganz gut läuft, zu Kanal B hinüber. Weil Kanal B miserable Einschaltquoten hat, erhöht die transferierte Sendung dessen Durchschnittsquote. Ohne eine einzige neue Sendung zu konzipieren, haben Sie die Quoten beider Fernsehsender gleichzeitig angehoben und sich damit den Superbonus gesichert.
Angenommen, Sie sind zum Manager von drei Hedgefonds befördert worden, die vorwiegend in privat gehaltene Unternehmen (Private Equity) investieren. Fonds A hat eine sensationelle Rendite, Fonds B eine mittelmäßige und Fonds C eine miserable. Sie möchten der Welt beweisen, dass Sie der weltbeste Fondsmanager sind. Was tun? Sie kennen nun das Spiel: Sie verkaufen einige Beteiligungen des Fonds A an die Fonds B und C. Welche? Jene Beteiligungen, die bisher die Durchschnittsrendite des Fonds A heruntergezogen haben, aber immer noch lukrativ genug sind, um die Durchschnittsrendite der Fonds B und C zu steigern. Im Nu haben Sie alle drei Fonds besser aussehen lassen. Weil sich das alles intern abspielt, fallen nicht einmal Gebühren an. Natürlich verdienen die drei Hedgefonds zusammengerechnet keinen Euro mehr – aber man wird Sie für Ihr glückliches Händchen feiern.
Diesen Effekt nennt man Stage Migration oder Will-Rogers-Phänomen, benannt nach einem amerikanischen Komiker aus Oklahoma. Dieser soll gewitzelt haben, dass Einwohner von Oklahoma, die Oklahoma verlassen und nach Kalifornien ziehen, den durchschnittlichen IQ beider Bundesstaaten erhöhen. Das Will-Rogers-Phänomen ist nicht intuitiv verständlich. Um es im Gedächtnis zu verankern, muss man es einige Male in verschiedenen Settings durchexerzieren.
Ein Rechenbeispiel aus der Automobilbranche. Ihnen sind zwei kleine Verkaufsfilialen unterstellt mit insgesamt sechs Verkäufern – Autoverkäufer 1, 2 und 3 in der Filiale A und Autoverkäufer 4, 5 und 6 in der Filiale B. Verkäufer 1 verkauft im Durchschnitt ein Auto pro Monat, Verkäufer 2 zwei Autos pro Monat und so weiter bis zum Starverkäufer 6, der sechs Autos pro Monat verkauft. Wie Sie leicht nachrechnen können, beträgt der durchschnittliche Umsatz pro Verkäufer in Filiale A zwei Autos, in Filiale B fünf Autos. Nun transferieren Sie Verkäufer 4 von Filiale B in die Filiale A. Was geschieht? Filiale A besteht neu aus den Verkäufern 1, 2, 3 und 4. Der durchschnittliche Umsatz pro Verkäufer ist von zwei Stück auf 2,5 Stück gestiegen. Filiale B besteht nur noch aus den Verkäufern 5 und 6. Der durchschnittliche Umsatz pro Verkäufer ist von fünf auf 5,5 gestiegen. Solche Umschichtungsspiele verändern gesamthaft nichts, aber sie machen Eindruck. Besonders Journalisten, Investoren und Aufsichtsräte sollten auf der Hut sein, wenn sie über steigende Durchschnittswerte in verschiedenen Ländergesellschaften, Abteilungen, Kostenstellen, Produktlinien etc. informiert werden.
Ein besonders tückischer Fall des Will-Rogers-Phänomens findet sich in der Medizin. Tumore werden üblicherweise in vier Entwicklungsstadien eingeteilt – von Stadium 1 bis 4 – daher der Begriff Stage Migration (Stadiumsmigration). Bei den kleinsten und am besten therapierbaren Tumoren spricht man von Stadium 1, bei den schlimmsten von Stadium 4. Entsprechend ist die Überlebenschance für Stadium-1-Patienten am größten, für Stadium-4-Patienten am geringsten. Nun kommen jedes Jahr neue Verfahren auf den Markt, die eine immer genauere Diagnose ermöglichen. Die Folge: Es werden winzige Tumore entdeckt, die früher keinem Arzt aufgefallen wären. Die Folge: Patienten, die früher – fälschlicherweise – als kerngesund galten, werden nun dem Stadium 1 zugerechnet. Automatisch steigt die durchschnittliche Lebensdauer der Stadium-1-Patienten an. Ein großartiger Therapieerfolg? Leider nicht: bloße Stage Migration.
Bildacht
8Information Bias
Hast du einen Feind, gib ihm Information
In seiner Kurzgeschichte Del rigor en la ciencia, die aus einem einzigen Abschnitt besteht, beschreibt Jorge Luis Borges ein Land, wo die Wissenschaft der Kartografie so ausgereift ist, dass nur die detaillierteste aller Karten genügt – also eine Karte im Maßstab eins zu eins, die so groß ist wie das Land selbst. Dass eine solche Karte keinen Erkenntnisgewinn liefert, leuchtet ein, denn sie dupliziert bloß das Vorhandene. Borges’ Landkarte ist der Extremfall eines Denkfehlers, den man Information Bias nennt: Des Irrglaubens, mehr Information führe automatisch zu besseren Entscheidungen.
Ich suchte ein Hotel in Berlin, stellte eine Vorauswahl von fünf Angeboten zusammen und entschied mich spontan für eines, das mir auf Anhieb gefiel. Doch so ganz vertraute ich meinem Bauchgefühl nicht und wollte die Qualität der Entscheidung dadurch verbessern, dass ich noch mehr Informationen einholte. Ich ackerte mich durch Dutzende von Kommentaren, Bewertungen und Blog-Einträgen zu den verschiedenen Hotels und klickte mich durch unzählige Fotos und Videos. Zwei Stunden später entschied ich mich für jenes Hotel, das mich schon ganz am Anfang angesprochen hatte. Die Lawine an zusätzlicher Information führte zu keiner besseren Entscheidung. Im Gegenteil, meinen Zeitaufwand in Geld umgerechnet, hätte ich ebenso gut im Adlon Kempinski absteigen können.
Der Forscher Jonathan Baron hat Ärzten folgende Frage gestellt: Ein Patient leidet an Symptomen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % auf Krankheit A hinweisen. Falls es nicht Krankheit A ist, handelt es sich entweder um Krankheit X oder Y. Jede Krankheit muss anders behandelt werden. Jede der drei Krankheiten ist etwa gleich schlimm, und jede Behandlung zieht vergleichbare Nebeneffekte nach sich. Welche Behandlung würden Sie als Arzt vorschlagen? Logischerweise würden Sie auf Krankheit A tippen und somit Therapie A empfehlen.
Angenommen, es gibt einen Diagnosetest, der im Fall von Krankheit X »positiv« angibt, im Fall von Krankheit Y »negativ«. Falls der Patient jedoch Krankheit A hat, sind die Testresultate in der Hälfte der Fälle positiv, in der anderen Hälfte negativ. Würden Sie als Arzt diesen Test empfehlen? Die meisten Ärzte, denen diese Frage gestellt wurde, empfahlen ihn – und das, obwohl die dadurch gewonnene Information irrelevant ist. Angenommen, das Testresultat ist positiv. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für Krankheit A noch immer viel größer als für Krankheit X. Die zusätzliche Information, die der Test liefert, ist für die Entscheidung komplett nutzlos.
Nicht nur Ärzte haben den Drang, Informationen zu sammeln, selbst wenn sie irrelevant sind, auch Manager und Anleger sind geradezu süchtig danach. Wie oft wird noch eine Studie in Auftrag gegeben und noch eine, obwohl die entscheidenden Fakten längst auf dem Tisch liegen? Mehr Information ist nicht nur überflüssig, sie kann auch nachteilig sein. Frage: Welche Stadt hat mehr Einwohner – San Diego oder San Antonio? Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut hat diese Frage einigen Studenten der Universitäten Chicago und München gestellt. 62 % der amerikanischen Studenten haben auf die richtige Antwort getippt – San Diego. Aber 100 % der deutschen Studenten haben richtig getippt! Der Grund: Alle deutschen Studenten hatten schon mal von San Diego gehört, aber nur wenige von San Antonio. Also tippten sie auf den bekannteren Namen. Den Amerikanern hingegen waren beide Städte ein Begriff. Sie hatten mehr Informationen und tippten genau darum öfters daneben.
Stellen Sie sich die 100.000 Ökonomen vor – im Dienste von Banken, Thinktanks und Staaten – und all das Papier, das sie in den Jahren 2005 bis 2007 produziert haben. All die Unmengen an Forschungsberichten und mathematischen Modellen. Den ganzen Wust an Kommentaren. Die geschliffenen PowerPoint-Präsentationen. Die Terabytes an Information auf Bloomberg und Reuters. Der bacchanalische Tanz zu Ehren des Gottes »Information«. Alles heiße Luft. Die Finanzkrise kam und pflügte die Welt um. Keiner hat sie kommen sehen.
Fazit: Versuchen Sie, mit dem Minimum an Informationen durchs Leben zu kommen. Sie werden bessere Entscheidungen treffen. Was man nicht wissen muss, bleibt wertlos, selbst wenn man es weiß.
Bildneun
9Clustering Illusion
Warum Sie im Vollmond ein Gesicht sehen
1957 kaufte der schwedische Opernsänger Friedrich Jürgenson ein Tonbandgerät, um seinen Gesang aufzuzeichnen. Beim Abspielen hörte er zwischendurch seltsame Geräusche, Geflüster, das sich wie Botschaften von Außerirdischen anhörte. Einige Jahre später zeichnete er Vogelstimmen auf. Diesmal vernahm er im Hintergrund die Stimme seiner verstorbenen Mutter, die ihm zuflüsterte: »Friedel, kannst du mich hören? Hier ist Mami.« Das war genug. Jürgenson krempelte sein Leben um und widmete sich fortan hauptsächlich der Kommunikation mit Toten via Tonbandaufnahmen.
Ein ähnlich verblüffendes Erlebnis hatte 1994 Diane Duyser aus Florida. Nachdem sie eine Scheibe Toast angebissen zurück auf den Teller gelegt hatte, fiel ihr auf, dass das Gesicht der heiligen Maria darauf zu sehen war. Sofort hörte sie zu essen auf und bewahrte die Botschaft Gottes (also das Toastbrot) zehn Jahre lang in einer Plastikdose auf. Im November 2004 versteigerte sie den noch recht gut erhaltenen Imbiss auf eBay für 28.000 Dollar.
Und man erinnerte sich: Schon 1978 war einer Frau aus New Mexico etwas Ähnliches geschehen, nicht mit einem Toast, mit einer Tortilla. Die verbrannten Stellen auf dem Fladen ähnelten Jesus. Die Presse schnappte die Geschichte auf, und Tausende von Menschen strömten nach New Mexico, um den Maisfladen-Heiland zu sehen. Zwei Jahre davor, 1976, fotografierte der Orbiter der Raumsonde Viking aus großer Höhe eine Felsformation, die an ein menschliches Gesicht erinnert. Das »Marsgesicht« machte fette Schlagzeilen.
Und Sie? Haben Sie auch schon ein Gesicht in den Wolken oder die Silhouette eines Tiers in einem Felsen gesehen? Natürlich. Das ist völlig normal. Unser Hirn sucht Muster und Regeln. Mehr noch: Findet es keine, dann erfindet es sie. Je diffuser die Signale – wie beim Rauschen des Tonbandes –, desto leichter ist es, Muster hineinzuinterpretieren. Je schärfer die Signale, desto schwieriger. 25 Jahre nach Entdeckung des »Marsgesichts« machte der Mars Global Surveyor gestochen scharfe Aufnahmen, und das schöne Antlitz zerbröselte zu gewöhnlichem Felsschutt.
Die frivolen Beispiele lassen die Clustering Illusion (Musterillusion) harmlos aussehen. Ist sie aber nicht. Nehmen wir den Finanzmarkt, der in jeder Sekunde eine Flut von Daten ausspuckt. Ein Freund erzählte mir freudestrahlend, dass er folgende Gesetzmäßigkeit im Datenmeer entdeckt habe: »Der Dow Jones multipliziert mit dem Ölpreis antizipiert den Goldpreis um zwei Tage.« In anderen Worten: Gehen heute Aktienkurse und Ölpreis hoch, steigt übermorgen das Gold. Das ging einige Wochen gut, bis mein Freund mit immer größeren Summen spekulierte und schließlich seine Ersparnisse verlor. Er hatte ein Gesetz gesehen, wo es keines gab.
OXXXOXXXOXXOOOXOOXXOO. Ist diese Sequenz reiner Zufall oder nicht? Der Psychologieprofessor Thomas Gilovich befragte Hunderte von Menschen. Die meisten mochten bei der Buchstabenfolge nicht an Zufall glauben. Irgendein Gesetz, sagten sie, müsse dahinterstehen. Falsch, erklärte Gilovich, und verwies aufs Würfeln: Auch dort liegt manchmal die gleiche Zahl viermal hintereinander oben, was viele Menschen verblüfft. Offenbar trauen wir dem Zufall nicht zu, solche Cluster hervorzubringen.
Im Zweiten Weltkrieg bombardierten die Deutschen London. Unter anderem setzten sie die V1-Rakete ein, eine Art selbständig navigierende Drohne. Die Einschlagsorte wurden säuberlich auf einer Karte eingezeichnet, was die Londoner in Schrecken versetzte: Sie glaubten, Cluster zu entdecken, spannen Theorien, welche Stadtteile wohl die sichersten seien. Doch die statistische Auswertung nach dem Krieg bestätigte, dass es sich um eine reine Zufallsverteilung handelte. Heute ist klar, warum: Das Navigationssystem der V1 war extrem ungenau.
Fazit: In Sachen Mustererkennung sind wir übersensibel. Bleiben Sie also skeptisch. Glauben Sie, ein Muster gefunden zu haben, rechnen Sie erst mal mit reinem Zufall. Wenn Ihnen dieser zu schön wird, um wahr zu sein, suchen Sie sich einen Mathematiker und lassen Sie die Daten statistisch durchtesten. Und wenn sich der Soßensee in Ihrem Kartoffelpüree plötzlich zu Jesu Gesicht verformt, dann fragen Sie sich: Wenn sich Jesus offenbaren will, warum tut er das nicht auf dem Times Square oder im Fernsehen, vor der Tagesschau?
Bildzehn
10Aufwandsbegründung
Warum wir lieben, wofür wir leiden mussten
John, ein Soldat der amerikanischen Luftwaffe, hat soeben die Fallschirmprüfung absolviert. In Reih und Glied wartet er darauf, den begehrten Fallschirm-Pin zu bekommen. Endlich pflanzt sich der Vorgesetzte vor John auf, legt die Anstecknadel an Johns Brust und hämmert sie mit der Faust so weit hinein, bis sie im Fleisch stecken bleibt. Seither öffnet John bei jeder Gelegenheit den obersten Hemdknopf, um die kleine Wunde zu präsentieren. Und noch Jahrzehnte später hängt die Nadel eingerahmt an seiner Wohnzimmerwand.
Marc hat eine verrostete Harley-Davidson eigenhändig restauriert. Alle Wochenenden und Urlaube gingen dafür drauf, die Maschine auf Kurs zu bringen, während seine Ehe haarscharf an der Katastrophe vorbeischrammte. Es war ein Krampf, aber nun steht das Prachtstück endlich fertig da und blitzt im Sonnenlicht. Zwei Jahre später braucht Marc dringend Geld. Er versucht, die Harley zu verkaufen, doch seine Preisvorstellung liegt weitab der Realität. Selbst als ein Interessent das Doppelte des Marktpreises bietet, verkauft Marc nicht. John und Marc sind der Aufwandsbegründung (Effort Justification) zum Opfer gefallen. Sie besagt: Wer viel Energie in eine Sache steckt, wird das Ergebnis überbewerten. Weil John für den Fallschirm-Pin körperlich leiden musste, misst er ihm einen höheren Wert bei als allen anderen Auszeichnungen. Weil Marc für die Restauration seiner Harley eine Menge Zeit und fast seine Ehe geopfert hat, setzt er den Wert der Maschine so hoch an, dass er sie nie und nimmer verkaufen wird.
Aufwandsbegründung ist ein Spezialfall der sogenannten kognitiven Dissonanz. Sich für eine simple Auszeichnung ein Loch in die Brust bohren zu lassen ist im Grunde lächerlich. Johns Hirn gleicht diese Verhältnislosigkeit aus, indem es den Wert der Stecknadel überhöht, sie von etwas Profanem zu etwas Quasi-Heiligem hochstilisiert. Das alles passiert unbewusst und ist nur schwer zu unterbinden.
Gruppen nutzen die Aufwandsbegründung, um die Mitglieder an sich zu ketten, etwa über Initiationsriten: Jugendbanden und Studentenverbindungen nehmen Aspiranten erst auf, wenn sie Ekel- und Gewaltproben bestanden haben. Die Forschung beweist: Je härter die »Eintrittsprüfung«, desto größer der nachträgliche Stolz. So spielen MBA-Schulen mit der Aufwandsbegründung, indem sie ihre Studenten pausenlos beschäftigen, manchmal bis an die Grenze der Erschöpfung. Egal, wie nützlich oder idiotisch die Hausarbeiten sind: Hat der Student seinen MBA erst mal in der Tasche, wird er ihn als essenziell für seine Karriere betrachten – weil ihm dafür so viel abverlangt wurde.
Eine milde Form der Aufwandsbegründung ist der sogenannte IKEA-Effekt. Möbel, die wir selbst zusammengeschraubt haben, betrachten wir bisweilen als wertvoller als ein teures Designerstück. Oder selbst gestrickte Socken: Sie einfach wegzuwerfen wie ein bei H&M gekauftes Paar fällt uns schwer – selbst wenn sie schon lange ausgeleiert und aus der Mode sind. Manager, die wochenlang an einer Strategie gearbeitet haben, werden dieser gegenüber unkritisch sein. Ebenso Designer, Werbetexter, Produktentwickler, die intensiv über ihren Kreationen gebrütet haben.
In den 50er-Jahren kamen Instant-Kuchenmischungen auf den Markt. Ein sicherer Verkaufsschlager, dachten die Hersteller. Weit gefehlt: Hausfrauen mochten die Mixturen nicht – weil sie es ihnen zu leicht machten. Erst als die Zubereitungsmethode leicht verkompliziert wurde – es musste jetzt laut Packungsangabe noch ein frisches Ei hinzugeschlagen werden –, stieg das Selbstwertgefühl der Hausfrauen wieder, und damit auch die Wertschätzung, die sie dem Convenience-Food entgegenbrachten.
Ende der Leseprobe