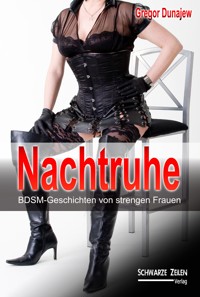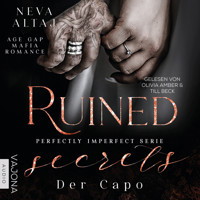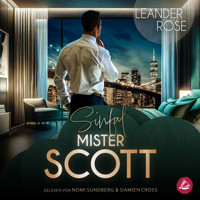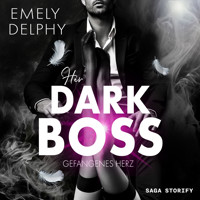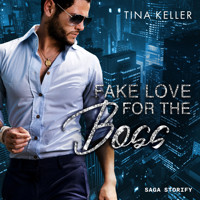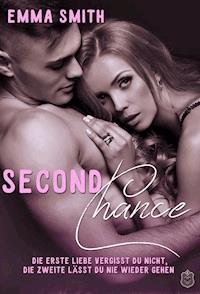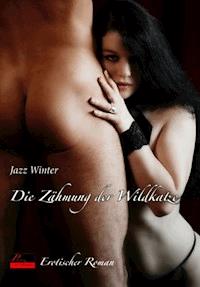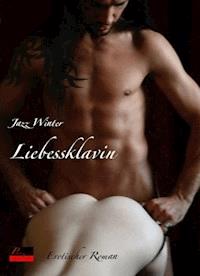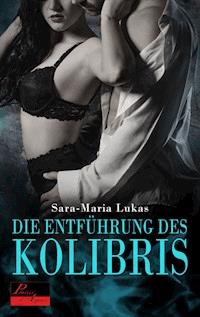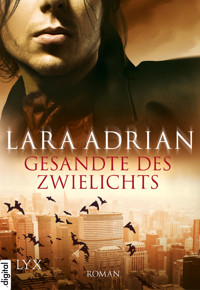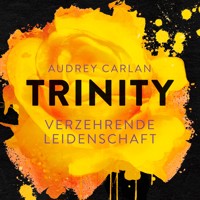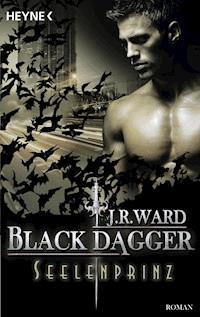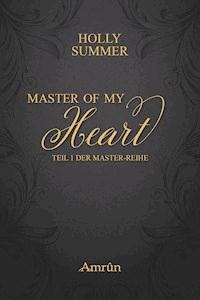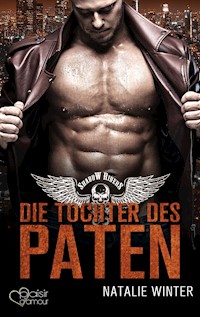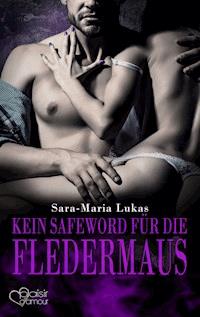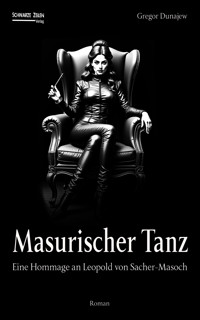
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarze-Zeilen Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1876 gerät das junge deutsche Kaiserreich in Gefahr, als brisante Briefe des verstorbenen Königs eine geheime sadomasochistische Affäre enthüllen. Die Stabilität des Reiches steht auf dem Spiel, und der Skandal muss um jeden Preis verhindert werden. Als der ostpreußische Gutsherr Gregor von Dunajew auf seinem Anwesen 32 dieser belastenden Briefe entdeckt, ist sein Leben in Gefahr. Während sich das Netz aus politischen Intrigen immer weiter um ihn zuzieht, entwickelt Gregor eine intensive und von Machtspielen geprägten Beziehung zu der geheimnisvollen Wanda. In expliziten BDSM-Szenen erkunden sie die dunklen Seiten von Lust, Kontrolle und Unterwerfung. Doch Wanda verbirgt mehr, als Gregor ahnt – ein gefährliches Geheimnis, das seine Welt ins Wanken bringen könnte. »Masurischer Tanz« ist eine packende Hommage an Leopold von Sacher-Masoch und verwebt historische Spannung mit einer tiefen Erkundung von Verlangen und Macht. Zwischen politischer Intrige und gefährlicher Leidenschaft verschwimmen die Grenzen von Hingabe und Verrat in einem fesselnden Erotikthriller, der Leser*innen nicht loslassen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gregor Dunajew
Masurischer Tanz
Eine Hommage an Leopold von Sacher-Masoch
ISBN 978-3-96615-033-0
1. Auflage
(c) 2024 Schwarze-Zeilen Verlag
www.schwarze-zeilen.de
Alle Rechte vorbehalten.
Für Minderjährige ist dieses Buch nicht geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass das Buch Minderjährigen nicht zugänglich gemacht wird.
Hinweis
Dieses Buch lädt dich ein auf eine Reise ins vorletzte Jahrhundert, in eine Welt, die von den Werken Leopold von Sacher-Masochs inspiriert ist. In einem historischen Setting entfaltet sich eine Geschichte, die gleichermaßen faszinierend und intensiv ist. Neben einer fesselnden Handlung erwarten dich explizite Szenen, die tief in die dynamischen Spielarten von Dominanz und Unterwerfung eintauchen – sinnlich und doch herausfordernd.
Der Roman richtet sich an Leser*innen, die offen und neugierig sind, das Spiel mit Macht, Kontrolle und Lust zu erforschen. Alle BDSM-Szenen basieren auf dem freien Willen der Beteiligten – der Nervenkitzel liegt im Austausch von Macht, nicht in deren Missbrauch. Doch Vorsicht: Dieses Buch ist nicht für Minderjährige geeignet, und die beschriebenen Szenen sind Fantasien, die anregen sollen, keine Anleitungen für das eigene Leben.
Wenn du selbst BDSM praktizierst oder daran interessiert bist, denke stets an den Grundsatz: »Safe, Sane & Consensual« – sicher, vernünftig und einvernehmlich. Respekt, Vertrauen und offene Kommunikation sind das Fundament jeder intensiven Begegnung. Für Anfänger*innen gibt es viele Ressourcen und Foren im Internet, um sich zu informieren und auszutauschen.
Nun wünschen wir dir, dass du dich von dieser packenden Erzählung fesseln lässt. Tauche ein in eine Welt, die von Macht und Leidenschaft durchdrungen ist, und genieße jeden Moment dieser besonderen Lektüre!
Ein Schloss am Fluss
Am späten Vormittag nahm der Wind an Heftigkeit zu. Die Wolken wurden dichter, änderten ihre Farbe vom freundlichen Weiß in ein dunkles Grau. Im Park sah ein Gärtner hoch zu den Baumkronen, die sich im beginnenden Sturm zur Seite bogen. Auf dem Fluss mühten sich Vater und Sohn, ihren Kahn in Richtung Stadt zu rudern. »Wir kommen kaum vorwärts!«, rief der Sohn. »Der Gegenwind ist zu stark!« »Noch das letzte Netz, Franz! Ich habe es gleich im Boot, dann rudern wir beide!« Der Alte zog an dem Seil, griff in die Maschen, zerrte das Netz in den Kahn. »Dass der Wind aber genau von vorn kommen muss!« Er schwankte zur Bank, nahm ein Ruder. »Weiter, Franz. Vor dem Mittag sind wir daheim. Elendes Wetter! Aber wir haben sieben Aale, dazu einige Zander, drei Hechte. Und hier, im letzten Netz sind sicher noch zwanzig Fische. Der Fang reicht für unsere heutige Mahlzeit und räuchern werden wir auch.« »Meine Hände sind steif vor Kälte«, schimpfte der Sohn. »Sei froh, dass kein Frost ist«, gab der Vater zurück. »Denk an letztes Jahr. Da hatten wir zur selben Zeit noch Eisschollen.« »Die da müssen nicht schinden in ihrer englischen Burg!«, rief der Sohn und wies mit seinem Kopf zum Schloss auf dem Berg. »Da oben ist gut geheizt. Vater. Wärst du eine Hoheit, bräuchten wir nicht mit Holz zu sparen.« »Schau nicht nach oben, Junge«, erwiderte der Alte. »Schau zu denen, die wirklich im Dreck liegen. Mit dem Herren da oben im Schloss möchte ich nicht tauschen. Das Glück unserer Welt liegt nicht in Geld und Macht.« »Aber auch nicht in Armut und Ohnmacht«, gab der Sohn zurück. »Verfressen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben.« »Verschlemmen heißt es, Junge, nicht verfressen«, lachte der Vater. »Heine schrieb das vor Jahren. Und wenn du möchtest, nehme ich dich heute mit zur Versammlung.« »Zu den Sozis?«, rief der Sohn. »Zu wem sonst? Dort sind wir Gleiche unter Gleichen.« Der Alte sah seinen Sohn prüfend an. »Heine ist seit zwanzig Jahren tot. Zu dem können wir nicht. Außerdem soll auch er mehr als nur Wein gesoffen haben im feinen Paris. Von wegen armer Poet. Und wenn du nicht so schlapp rudern würdest, könnten wir es bis zum Mittag nach Hause schaffen.«
***
Zur Mittagszeit des 15.03.1876 stand eine dunkelgraue Wand am Horizont. Das Gewitter begann mit kurzem Flackern, fern, kaum wahrnehmbar. Wie leises Gemurmel erreichte der Donner das Schloss. Auf dem breiten Fluss plagte sich ein Fischerkahn. Zwei Männer ruderten in Richtung Stadt. Am Fenster des Schlosses stand ein Mann, verfolgte stumm die Anstrengungen der Fischer. Er sah hinaus über den Park, den Fluss, die östliche Vorstadt. Seine Hände hatte er auf dem Rücken verschränkt, bewegte unruhig die Finger seiner rechten Hand. »Man verbaut mir die weite Sicht«, nahm er nach längerem Schweigen das Wort. »Villen und überwiegend Bürgerhäuser werden dort drüben errichtet. Auch möchte man ein Gelände am nördlichen See bebauen. Ist uns das zu nahe, Fürst? Was denken Sie? So viele Leute.« »Wer auf sich hält, bemüht sich, ein Grundstück in der Nähe Eures Schlosses zu erwerben«, erwiderte der zweite Mann im Raum, froh über das unverfängliche Thema. »Werten Sie es als Zeichen Ihrer Beliebtheit. Darf ich Sie über den Fortschritt in Baufragen informieren? Es wird Sorge getragen, dass keines der neuen Gebäude, sowohl am nördlichen See, als auch in der östlichen Vorstadt, das Aussehen der Stadt beleidigt. Nur Architekten mit Reputation entwerfen die neuen Gebäude. Ausschließlich gestandene Baumeister führen die Arbeiten aus. Jede Genehmigung behält sich die Stadt vor. Auch werden nur Bürger aus besserer Gesellschaft die Häuser beziehen.« »Andere werden es sich auch nicht leisten können«, brummte der Mann am Fenster. »Es bleibt abzuwarten, ob es für die Leute aus unserer sogenannten besseren Gesellschaft noch eine Ehre bedeutet, in meiner Nähe zu wohnen, wenn der Skandal bekannt wird. Im Adel wird man hinter geschlossenen Türen reden, doch das Bürgertum wird kaum an sich halten und die Leute aus dem Volk werden grob gegen uns lästern.« Der Mann am Fenster drehte sich um. »Schauen Sie, Ottfried. Das Gewitter kommt näher. Wenn es doch nur beim Wetter bliebe. Ich fürchte, ein Gewitter ganz anderer Art droht uns. Ich werde die bösen Gedanken nicht los.« »Hoheit«, seufzte der zweite Mann. »Wir werden die Sache in unserem Sinne erledigen. Gerüchte, Fälschungen, derartige Briefe kann jedermann schreiben.« »Ihr Wort möge Gottes Segen finden, Ottfried«, brummte Walter. »Ich mag gar nicht aus dem Fenster schauen. Weiß ich doch, was hinter Park, breitem Fluss und östlicher Vorstadt liegt. Mir graut, denke ich an den geheiligten See und an das Palais an dessen Ufer. Der stille Garten und seine Geschichte sind anrüchig, ein Ärgernis, und nun suchen uns die alten Geister heim. Pyramide, Neptungrotte, Schilfhaus, marmorne Bibliothek, all der Unfug dieser Rosenkreuzler. Diese alten Gespenstergeschichten geben allein schon genug Anlass zu Gerede bis auf den heutigen Tag. Wenn nun noch dieser Skandal hinzukommt, fürchte ich, dass der Ruf unseres Hauses schweren Schaden nimmt.« »Die Affäre ist nicht unbedenklich, doch lange her«, beschwichtigte Ottfried, die erneute Wendung des Gespräches bedauernd. »Die Sachlage ist pikant. Doch haben wir alle Möglichkeiten der Einflussnahme. Keinesfalls darf ich raten, die Affäre höher zu werten, als sie sich tatsächlich darstellt.« »Selbst wenn!«, fuhr der Mann am Fenster auf. »Ein Schatten wird bleiben. Das Hohe Haus wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Wir alle haben ein Reich gegründet, die deutschen Länder geeint. Wir werden derzeit eine Macht, groß wie nie zuvor. Unser Staat spielt auf gleicher Höhe mit England, Russland und den amerikanischen Vereinigten Staaten. Wir sind auf dem Weg zu einem Platz an der Sonne. Ottfried, der Versuch, mich zu beruhigen, ehrt Sie, aber die Lage ist durchaus heikel. Mit dem Ansehen eines Hohen Hauses wie dem Unseren ist auch das Ansehen des jungen Reiches verbunden. Großer Gott, auf jedem Empfang, jeder Reise wird man mich als Enkel eines skurrilen und abartigen Fürsten darstellen. Der Spott der Franzosen, das Gerede der Österreicher, die heftige Heiterkeit der Russen und das hochnäsige Gestichel der Engländer werden uns zusetzen. Wollen wir Zielscheiben des Spottes und der Verachtung werden? Sagen Sie es mir, Ottfried?« Bevor der Berater antworten konnte, fuhr der Fürst fort. »Mein Großvater«, seufzte er. »Nach beinahe hundert Jahren gibt es immer noch Ärger mit ihm. Ottfried, was tun wir? Wie schützen wir unser Haus?« Der Berater trat einige Schritte vor, bis er neben dem Fürsten vor dem zweiten Fenster des Arbeitszimmers stand. »Schauen Sie auf dieses Boot, Hoheit«, erwiderte er. »Draußen tobt der Sturm. Die beiden Männer auf dem Wasser haben schweren Gegenwind. Aber mit Anstrengung und Beharrlichkeit halten sie ihr kleines Schiff auf Kurs. Sie kämpfen gegen die Elemente und letztlich kommen sie vorwärts. Die Affäre, der wir derzeit ausgesetzt sind, ist außerordentlich bedauerlich, Hoheit. Aber wir sind wie die Fischer dort draußen. Diesen Sturm werden wir überstehen. Woher wissen wir sicher, dass die Briefe echt sind? Meiner Auffassung nach sind es allesamt Fälschungen. Anderes wird von uns nicht in Erwägung gezogen. Es liegt im Sinne der Feinde des Reichs, uns zu verleumden. Wir kennen genug Mächte, die sich solcher Mittel bedienen, um ein hohes Haus wie das Unsere zu besudeln. Lassen wir die Sache unwidersprochen in die Öffentlichkeit, können wir uns vielleicht der Achtung eines Teils der Bürgerschaft und des Adels sicher sein. Aber eben nur ein geringer Teil gebildeter und aufgeklärter Leute wird den Skandal mit einem Schulterzucken abtun. Verlassen Sie sich auf mich in dieser Angelegenheit. Wir werden Ihren Großvater nicht als lächerliche Figur dastehen lassen. Im Volke wird man nicht über das hohe Haus reden und kein Schatten fällt auf Sie, Hoheit. Das Ausland wird niemals Nutzen aus diesem angeblichen Skandal ziehen. Und weil wir handeln, Hoheit, wird das Ansehen der führenden Männer des Reiches nicht beleidigt. Ich werde die Sache beilegen.« »Mein Großvater, kriechend vor einer Mätresse«, seufzte der Fürst. »Sie verzeihen meine Offenheit, aber ich bin ein Mann, dessen Name in einem Zuge mit der Reichsgründung genannt wird. Diese Briefe, Ottfried, müssen Fälschungen sein. Etwas anderes werden wir nicht einmal denken. Sollte die Rede irgendwann darauf kommen, entrüsten wir uns über die Infamie der Fälscher.« »So ist es«, erklärte der Berater mit ruhiger Stimme. »Und wir werden die Helfershelfer feindlicher Mächte der Rufschädigung und der Majestätsbeleidigung anklagen. Das Ziel, diese Briefe zu schreiben, ist hochverräterisch. Jedoch, Hoheit, unter uns gesagt, darf man die Angelegenheit keinesfalls überbewerten. Vielfach sind die Fantasien der Menschen, besonders im amourösen Bereich. Bisweilen erleben wir einen Überschwang der Neigungen. Dennoch werden wir keinen Anlass zu Gerede geben und einen Skandal verhindern.« »Dieser amoröse Überschwang dauerte, den Briefen nach zu urteilen, eine lange Zeit während des Lebens meines Großvaters an, Ottfried.« Der Fürst drehte sich vom Fenster, strich sich über den Backenbart. »Natürlich gehen wir davon aus, dass wir es mit Fälschungen zu tun haben. Dennoch. Wir müssen handeln. Wie viele dieser peinlich indiskreten Briefe gibt es? Wie gehen wir vor?« »Über fünf Jahre wurde jede Woche ein Brief von der Gräfin verfasst. Ebenfalls jede Woche antwortete Ihr Großvater. Wir haben etwas weniger als fünfhundert Briefe.« »Sind die Briefe in unserer Hand?« »Selbstverständlich, Hoheit, überwiegend«, antwortete der Berater. »Wer hat sie gelesen?« »Ich, Hoheit«, antwortete Ottfried. »Als der Maurergeselle sie hinter der Verschalung im Palais entdeckte, übergab er sie dem Kastellan, einem alten Soldaten. Der reichte sie an den Verwalter. Dieser nahm die Briefe, ging sofort in die Waisenstraße, wandte sich direkt an den Kommandanten des Ersten Garde-Regiments zu Fuß. Der Oberst des Leibregiments eilte direkt zu mir.« »So viele Menschen«, grollte der Fürst kopfschüttelnd. »Was ist mit dem Maurer, dem Kastellan, dem Verwalter und dem Obristen? Lasen diese Leute die Briefe?« »Ich bestellte alle vier Personen unabhängig voneinander zu mir«, antwortete der Berater mit beruhigender Stimme. »Der Maurergeselle konnte kaum lesen. Den Inhalt verstand er nicht. Ich erklärte ihm, dass die Briefe keine Bedeutung besaßen. Es fehlten auch Siegel, also hatte sie jemand geschrieben, der nicht von hohem Adel war. Dennoch, so erklärte ich dem jungen Mann, ist jedes Schriftstück in den Schlössern geheime Sache. Noch bei mir unterschrieb der Geselle eine Verschwiegenheitserklärung. Seit einigen Tagen arbeitet er im Dienste der Krone als Aufseher über die Maurerarbeiten.« Ottfried schwieg, ließ seine Worte wirken. Der Fürst sah ihn prüfend an. »Der Kastellan hat die Briefe ebenfalls nicht gelesen«, fuhr der Berater fort. »Er kann es nicht, war Soldat und ein sehr schlechter Schüler. Als treuer Diener unseres Reiches bekommt der altgediente Mann ab sofort Pension. Ihm wurde bereits ein kleines Haus mit Garten und Kleinvieh bei Neuruppin zugewiesen.« »Sehr gut«, murmelte der Fürst. »Wie steht es mit dem Verwalter?« »Der Mann erkannte die Brisanz, übergab dem Obristen die Briefe persönlich. Durch seine schnelle Handlung zeigte er bereits seine verlässliche Haltung. Bedingt durch seine Stellung einschließlich der damit verbundenen besonderen Treueerklärung ist hier nichts zu fürchten. Der Mann wird demnächst für seine langjährigen Verdienste um die Krone geadelt. Alle drei Personen bleiben unter diskreter Beobachtung. Die wenigen mit der Observation beauftragten Beamten sind nicht informiert. Ich garantiere Diskretion, mein Wort, Hoheit.« »Und der Oberst?« »Schon bei der Übergabe der Briefe durch den Obristen an mich, zweifelte ich die Echtheit der Briefe an. Der Oberst teilte meine Ansicht. Solche Schandbriefe verbrennt man, sagte er. Die lässt man nicht liegen. Also müssen sie gefälscht sein.« »Fabelhafter Mann, der Oberst!«, freute sich der Fürst. »Den kenne ich gut. Er wurde im Franzosenkrieg in der Schlacht von Saint-Privat-la-Montagne verwundet. Könnte man sich für ihn einsetzen? Wird es nicht Zeit für eine Ehrung des Obristen.« »Er wird noch in diesem Jahr General, ich habe es ihm zu verstehen gegeben. Eine Ausnahme, da er nie im Generalstab diente.« »Ich danke Ihnen, Ottfried«, sagte der Fürst, zeigte auf die Kiste auf dem Arbeitstisch. »Ich werde die Briefe ins Familienarchiv schließen.« »Hoheit, ich empfehle Ihnen, bei allem Respekt, die Sache aus der Welt zu schaffen. Sie gestatten?« Der Berater stellte die Kiste neben den Kamin. »Ich erinnere mich an den Tag, an dem ein Kanzler die Papierfetzen der zerrissenen Abdankung eines Königs einsteckte und verbrannte«, sagte der Fürst und sah seinen Berater offen an. »Wir sollten ebenso verfahren.« Der Berater zog einen Stuhl neben den Kamin, setzte sich, warf einen Brief nach dem anderen ins Feuer. »Damit ist die Sache aus der Welt?«, fragte der Fürst. »Nicht ganz«, antwortete Ottfried. »Ich habe eine Liste gefertigt. Im vorletzten Jahr des Briefwechsels, in der Zeit von März bis Mai sowie von August bis November weilten die Gräfin und Ihr Großvater in Ostpreußen. Ich gehe davon aus, dass das Ritual des Schreibens in diesen Wochen auch dort Bestand hatte. Uns fehlen in Summe zweiunddreißig Briefe aus dieser Zeit.« »Was haben Sie unternommen?«, fragte der Fürst. »Mit Details möchte ich Sie nicht langweilen, Hoheit. Ich habe Grund zur Annahme, dass sich die Briefe noch immer auf dem Gut in Ostpreußen befinden, auf dem Ihr Großvater und die Gräfin weilten. Bestätigt sich meine Annahme, werde ich sie bald in meinen Händen halten. Hierbei sind allerdings äußerste Diskretion und gezieltes Vorgehen gefragt.« »Wie lösen Sie das Problem, Ottfried? Ein Feuer im Gutshaus? Es darf natürlich kein Unschuldiger zu Schaden kommen.« »Machen Sie sich bitte keine Sorgen, Hoheit«, erwiderte der Berater »Ich traf lediglich die Annahme, dass sich die Briefe in Ostpreußen befinden. Vielleicht gibt es sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie vor Abreise der hohen Herrschaften vor achtzig Jahren der Vernichtung anheimfielen. Im schlimmsten Fall besitzt der heutige Gutsbesitzer die Korrespondenz und hält sie versteckt. Wir werden es herausfinden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sache aus der Welt zu schaffen.« »So viele Verwicklungen.« Der Fürst ging zum Kamin, schaute auf die Briefe, die sein Berater nach und nach ins Feuer warf. »Wer ist dieser Gutsbesitzer, und warum sollte er skandalöse Briefe hoher Herrschaften verstecken?« »Das Gut ist Eigentum der Dunajews. Derzeit wird es von einem jungen Mann, dem Gregor von Dunajew bewirtschaftet. Wir haben uns informiert. Dunajew hat ebenfalls diese sonderbaren Neigungen, die Ihrem Großvater durch die Briefe unterstellt werden. Den schlimmsten Fall angenommen, könnte er die Briefe als eine Art fürstliche Absicherung bei drohendem Verlust seines guten Rufes verwenden.« »Kann mit dem Mann kein offenes Gespräch geführt werden?«, fragte der Fürst. »Ich fürchte, wir müssten in diesem Fall etwas eingestehen«, antwortete der Berater. »Ein solcher Aufwand wegen Fälschungen? Hier, im Zentrum des Reiches gelang es uns, die Lage genau zu erkennen und und jede Gefahr zu beseitigen. In Ostpreußen sieht es anders aus. Es ist weit entfernt. Wir wissen nicht viel, nur, dass dort vielleicht unsere zweiunddreißig Briefe liegen.« »Das Leben in den Weiten Ostpreußens birgt vielerlei Gefahren.« »Ich habe auch diese Möglichkeit durchdacht, Hoheit«, antwortete der Berater. »Der heutige Besitzer könnte, auch hier den schlimmsten Fall angenommen, die Briefe im Ausland deponiert haben, wo sie im Falle seines plötzlichen Ablebens öffentlich gemacht werden könnten. Das müssen wir verhindern.« »Unvorstellbar. Sind wir in kritischer Situation?« »Nein, Hoheit. Hätte Dunajew schadhaftes Interesse oder triebe ihn die Geldgier, wären die Briefe bereits öffentlich. Der Mann ist zwar in amourösen Dingen abseitig veranlagt, jedoch reichstreu, ehrbar und fleissig. Guter, preußischer Landadel, Hoheit.« »Weshalb sollte er die Briefe im Ausland deponiert haben, wenn er ein treuer Mann ist?«, insistierte der Fürst. »Er würde sie doch, sofern sie in seinem Besitz befindlich sind, ohne Zögern an uns übergeben. Das lässt den Schluss zu, dass dieser Gutsherr nicht im Besitz der Briefe ist.« »Hoheit können beruhigt sein«, sagte Ottfried. »Wie bemerkt, ist von Dunajew reichstreu. Allerdings kann ich nicht ausschließen, dass er fürchtet, in Gefahr zu geraten, sollte bekannt werden, dass er Briefe dieser Brisanz besitzt. Unsere Aufgabe ist es, herausfinden, ob es die Briefe noch gibt, und wer von ihnen Kenntnis hat. Wir werden die Sache aufklären. Sie dürfen ganz beruhigt sein.« »Wie werden Sie vorgehen, Ottfried?« »Skandalfrei, diskret, ruhig, durchdacht und am Ende erfolgreich, Hoheit.« »Ein führender Repräsentant, erniedrigt und gepeitscht von der Tochter eines Hoftrommlers«, sagte der Fürst kopfschüttelnd. »Mein Gott, was für eine Aufführung. Ich verlasse mich auf Sie, Ottfried. Die Sache muss aus der Welt.« »Hoheit, diese geschickt inszenierte Fälschung der Feinde des Reiches wird keinen Erfolg haben. Wir werden mehrere Wege gehen, diese Angelegenheit in unserem Sinne zu erledigen. Man wird uns nicht diskreditieren.« »Verstehe, Ottfried. Weiß schon, warum Sie mein erster Berater sind. Cognac?« »Zu Gnaden, Hoheit, habe die Ehre.«
Das Inserat
Mein Landhaus ist kleiner als das des Grafen Kolk. Würde man beide Häuser nebeneinanderstellen, zeigten sie ein Bild wie Stute und junges Fohlen. Sie ähneln sich im Stil, wirken wie komponiert, bis in die letzten Details aufeinander abgestimmt. Mit viel Geld und kunstsinnigem Geschmack haben unsere Familien vor langer Zeit beide Häuser errichten lassen. Sowohl der alte Graf Kolk als auch mein Vorfahre Baron Dunajew orientierten sich am damals modernen Stil königlicher Bauten. Den Begriff Schloss allerdings vermeide ich. Könige und Fürsten wohnen in Schlössern, nicht ein tätiger Mann einfachen Adels. Mein Haus besitzt nur sieben Achsen, die Seitenflügel fehlen und der Mittelrisalit ist in seinen Proportionen viel kleiner als der des Kolkschen Anwesens.
Als ich das Landhaus unserer Familie vor drei Jahren, anno 1873 zum ersten Mal betrat, führte mich mein Weg die hölzerne, geschwungene Treppe hinauf, hinein in eines der beiden Erkerzimmer. Sprachlos staunte ich über die imposante Landschaft. Mein Blick fiel aus dem großen Fenster in der Mitte auf einen liebevoll angelegten Park, hin zu einem Kutscherhaus im holländischen Stil. Hinter einer Reihe Birken lag ein schmaler Streifen Ufer, sanft zum See hin abfallend. Von dort führte der Lauf eines Weges, nur durch die Mauer des Parks unterbrochen, am See entlang zwischen den Feldern hindurch, bis in einen alten Mischwald, der bis zum Horizont reichte. Auch aus dem linken Fenster bot sich meinem Blick eine malerische Aussicht. Nicht weit entfernt stand eine Feldsteinkirche mit ihrem Glockenturm. Platanen beschatteten die Grabkreuze des Gottesackers, der bis an die Mauer meines Parks reichte. Aus dem rechten Fenster blickend sah ich über die roten Dächer der Stallungen hinüber bis zum Dorf. Dort lagen Anger mit Teich, angrenzend einige Bauerngehöfte und das zweigeschossige Gasthaus des Dorfes. Von dem weiten Land und seiner friedvollen Ausstrahlung überwältigt, richtete ich in diesem Raum mein Arbeitszimmer ein und ließ den Eichenschreibtisch aus dem Kontor im Erdgeschoss hinauf in meinen Erker bringen.
Weshalb es noch immer weit verbreitet war, Kontorarbeit in unzulänglichen Stuben zu verrichten, entzog sich meiner Logik. Sicher trug dazu die Auffassung bei, dass Schreiber nicht durch Ausblicke von ihrer Arbeit abgelenkt werden durften. Ich hingegen vertrat die Auffassung, dass Arbeit gleichsam im Maße der Schönheit ihres Umfeldes gedeiht. Aus diesem Grund ließ ich meinem alten Kameraden und Verwalter Karl Wede ein kleines Kontor im Zimmer des anderen Erker einrichten.
Wede war ein Fachmann in der Landwirtschaft, der sich aus ärmlichen Verhältnissen heraus erstaunlich gut entwickelt hatte. Wir kannten uns aus meiner Internatszeit. Er hatte durch ein kirchliches Stipendium dort Zugang, hielt sich trotz Schwierigkeiten recht wacker unter uns Söhnen aus besseren Häusern. Der Arbeit dieses hervorragenden Verwalters hatte ich es zu verdanken, dass mein Gut schwarze Zahlen schrieb. Wede wies mich von Beginn an in die Feinheiten effizienter Landwirtschaft und Viehhaltung ein, zog durch Geschick und Kenntnis aus unseren Feldern, Wäldern und Ställen den allergrößten Nutzen. Natürlich hatte seine Arbeit für mich ihren Preis. Als ich ihn einlud, bei mir zu arbeiten, machte er den möglichen Erwerb eines Hofes mit ausreichend Feld, Wald und Wiese zur Bedingung. Am Rande des Dorfes stand zu dieser Zeit ein solider Vierseitenhof zum Kaufe. Ich kam Wedes Bedingung nach, indem ich einen Kauf durch ihn möglich machte. Mein Verwalter war zwar trotz all seiner Anstrengungen damals kein wohlhabender Mann, hatte aber einige Ersparnisse, die zwar für den Kauf des Hofes nicht genügten, mir aber als Sicherheit meine Ansprüche genügten. Ich unterstützte ihn mit einem Darlehen, rückzahlbar aus dem Gewinn seines Hofes. Zinsen erließ ich ihm kulant, solange er bei mir als Verwalter arbeitete.
Karl Wede war es damals, der Streit zwischen mir und dem Grafen Kolk abwendete. Schon immer hatte ich den Verdacht, dass mein Gutshaus älter als das des Grafen war. Ich forschte und erlangte Gewissheit. Karl riet mir, meine Erkenntnisse um unsere Landhäuser nicht direkt zu offenbaren. Besser als ein direkter Hinweis an den Grafen war aus seiner Sicht die Publikation durch einen Fachmann. Stolz war der Graf auf seinen Besitz und das sollte er auch bleiben. Dennoch empfand ich es als notwendig, einen kulturgeschichtlichen Irrtum aufzuklären.
Der Architekt Jean de Bodt hatte das Schloss des Grafen Kolk in Masuren konzipiert. Der Graf war stolz darauf, behauptete, sein Haus wäre der erste Bau de Bodts in Ostpreußen, Westpreußen und Pommern. Nun hatte ich bei der Sichtung unseres Archivs hinter den Wirtschaftsbüchern meines Urgroßvaters ein verdecktes Fach entdeckt. Mir fiel das geheime Versteck auf, als ich die alten Schriften neu ordnete. Als ich sie in das Fach schob, bemerkte ich ein ungewöhnliches Geräusch. Bei näherer Untersuchung fand ich heraus, dass der alte Einbauschrank in diesem Bereich eine Hohlstelle enthielt. Nach einigem Suchen entdeckte ich einen Mechanismus, der die Rückwand arretierte. Vorsichtig schob ich das Holz nach oben, fand ein verborgenes Fach. Zuerst hoffte ich auf Schmuck, vielleicht eine kleine Goldreserve. Stattdessen fand ich die originalen Baupläne unseres Gutshauses und einen geschmiedeten Ring mit mehreren Schlüsseln. Die Zeichnungen stammten aus dem Jahr 1695, wurden also zehn Jahre vor der Errichtung des Schlosses derer von Kolk gefertigt. Bisher war man der Meinung, dass Jean de Bodt in unserer Gegend lediglich das Schloss des Grafen Kolk errichtete und mein Landhaus anlehnend an die Architektur seines Baus als kleinere, abgewandelte Version durch einen unbekannten Architekten entstand. Diesen Irrtum wollte ich aufklären und damit den wirklichen kulturgeschichtlichen Wert meines Hauses ins rechte Licht rücken.
Wede hatte mir gut geraten. Den Grafen zu brüskieren, lag mir fern. Unauffällig musste die Sache geklärt werden. Ich selbst wollte dabei nicht in Erscheinung treten. Niemand durfte mich mit der Entdeckung in Zusammenhang bringen. An Feindschaften war mir nicht gelegen. Lediglich meinen guten Bekannten, den Fritz Baedeker wollte ich bei seinem anstehenden Besuch auf meinem Gut von den Tatsachen in Kenntnis setzen. Wenn später, im Laufe der Zeit ein Buch der Sehenswürdigkeiten Ostpreußens erschien, würde die Geschichte unseres Landsitzes von berufener Stelle korrekt dargestellt sein. War es mein Urgroßvater, der die Zeichnungen in einem geheimen Fach versteckte, oder ein noch früherer Vorfahre? Ich fand keine Antwort. Auch der Sinn des geheimen Faches blieb mir verborgen. Vielleicht wollte man die Baupläne des Gutes an einem sicheren Ort aufzubewahren. Auch konnten die Zeichnungen für spätere Umbauten von Bedeutung sein. Nicht zuletzt handelte es sich um Pläne eines berühmten Architekten, der auch das Fortunaportal des Potsdamer Stadtschlosses entworfen hatte. Nach meiner Entdeckung studierte ich die Pläne vorerst nur oberflächlich, legte sie in ihr Fach zurück, wollte sie bei einer späteren Gelegenheit in Ruhe der näheren Betrachtung unterziehen. Den Schlüsselbund aus dem geheimen Fach nahm ich an mich, probierte die Schlüssel im Gutshaus, den alten Stallungen und dem Kutscherhaus. Meine Bemühungen blieben ohne Erfolg. Keiner der Schlüssel passte zu einer Tür. Ich maß der Sache keine weitere Bedeutung bei. Vielleicht gehörten die Schlüssel zu einem abgetragenen Gebäude. Da sie aber in dem geheimen Fache lagen, beschloss ich, sie aufzubewahren, legte den Schlüsselbund in das untere Fach meines Schreibtisches.
Die Sache mit dem Grafen Kolk nahm einen für mich beruhigenden Ausgang. Auf einem Empfang in seinem Gutshaus standen wir beisammen. Der alte Graf zeigte mir im Beisein seines Sohnes den soeben erschienenen Baedeker, der die Ostprovinzen des Reiches betraf. Mit ruhiger Stimme las er die Passage vor, in der mein Landhaus als der älteste Bau des Architekten de Bodt in Ostpreußen genannt wurde. Er schien davon völlig unbeeindruckt, erwähne jedoch, dass er gern das Recht des letzten Bieters hätte, falls meine Familie irgendwann einmal ihren ostpreußischen Besitz verkaufen wollte. Ein angenehmer Mann, der alte Graf, dachte ich. Sein Sohn, der junge Graf Erhard stand schweigend dabei und hörte mit undurchdringlicher Miene zu.
***
Die Grafen Kolk, das Schlüsselbund und die Baupläne Jean de Bodts gingen mir durch den Kopf, als ich an einem warmen Morgen im späten April des Jahres 1876 auf meinem Korbstuhl saß und über den Park blickte. Meine Hauswirtschafterin Maria hatte mir ein wunderbares Sonntagsfrühstück auf die Terrasse gestellt und so ließ ich es mir bei frischem weißem Brot, verschiedenen Käsesorten und Früchten wohl ergehen. Die ersten drei harten Jahre auf dem Gut, in denen ich nicht einmal an den Sonntagen Zeit fand, in aller Ruhe zu frühstücken, lagen hinter mir. Ich trank Kaffee, dachte zurück und erinnerte mich an die Zeit vor meiner Übernahme des Gutes unserer Familie in Tannwald. Es muss im November des Jahres 1872 gewesen sein, als ich von meinem Vater die Aufforderung erhielt, nach einigen Jahren des Weltenbummelns nunmehr der Familientradition zu folgen. Ich stand im dritten Jahr meiner Reise, empfand es spannend und lehrreich, fremde Länder zu bereisen, Städte und Landschaften kennenzulernen und die Gastfreundschaft fremder Völker zu genießen. Nachdem mich der Brief meines Vaters erreichte, stellte ich mir die Frage nach meiner Bestimmung. Wem nützte ein Gregor von Dunajew in Brasilien, den Weiten Russlands oder der Ödnis Arabiens? Welchen Zweck macht seine Anwesenheit in England, dem südlichen Afrika oder der Nordspitze Europas? Was hatte ich dort verloren? War ich Wissenschaftler wie Humboldt oder Reiseschriftsteller?
Fast drei Jahre des Umherreisens schienen mir genug. Damals, nach meinem Studium, wollte ich mein Bild der Welt weiten, mich im Lernen fremder Sprachen und dem Verständnis anderer Kulturen bilden. Meine Familie stand meinem Ansinnen freundlich und wohlwollend gegenüber, mein Vater schlug mir die Reise sogar vor und erklärte, sie vollständig zu finanzieren. Er ließ durchblicken, dass er der Auffassung war, mir nach den wirren Ereignissen in meinem Elternhaus mit der Magd Magdalena Skupinski und dem darauf folgenden Internatsleben etwas schuldig zu sein. Er lobte meine Studentenzeit, in der ich mit größter Ernsthaftigkeit arbeitete und mein Studium der Ökonomie mit summa cum laude abschloss. Zur Abrundung meiner Person fehlte mir lediglich erlebte Weltkenntnis. Deshalb hegten meine Eltern die Hoffnung, dass mir die Reisen den Verstand weiteten und mir Erfahrungen für mein weiteres Leben zutrugen. Beides gelang mir im Laufe dreier gefüllter Jahre. Mit meinen Reiseerfahrungen wuchs auch mein Verständnis für die Kräfte, die unsere Welt wie ein Uhrwerk antrieben. Ich genoss die ersten beiden Jahre in vollen Zügen, lebte das Abenteuerleben eines vermögenden Reisenden und machte mir die Welt zu Diensten. Der Wunsch meines alten Herrn nach Rückkehr erreichte mich in Barcelona. Vater schrieb mir von unserem alten Gut in Ostpreußen, das ich nach meiner Rückkehr übernehmen sollte. Es erwirtschaftete derzeit weder Gewinn noch Verlust. Seit dem Tod meines Urgroßvaters hatte es der damalige Verwalter Golombek geführt, danach der Sohn des Golombek, nach zwanzig Jahren dessen Sohn, der die Arbeit wiederum seinem Sohn übertrug. Nach vielen Jahrzehnten ohne einen Gutsherren zeigte sich die Wirtschaft unseres Besitzes in Masuren in keinem einträglichen Zustand. Aber nicht nur bei uns gab es Grund zur Sorge. Viele Kleinbauern in Ostpreußen hatten Mühe, nicht in Not und Armut zu verfallen. Junge Leute verließen ihre Heimat, suchten Arbeit in den Bergwerken an der Ruhr. Zudem wollte unser Verwalter Golombek, ein alter Herr, seine Arbeit beenden, hatte aber keinen Ersatz. Kurz, der Erhalt unseres Gutes verlangte eine kräftige Hand.
Der Brief meines Vaters erreichte mich auch aus anderem Grund zur richtigen Zeit. Tief in Herz und Verstand verwirrt hatte ich Quartier in Barcelona genommen. In einem kleinen Hotel im oberen Teil der Stadt bewohnte ich ein Zimmer. Von dort aus schrieb ich meinen Eltern, dass ich mich bald wieder in der Heimat einfinden und meinen Platz in der Familie einnehmen wollte. Kein Wort schrieb ich über meine seelischen Nöte, die sich auf eine seltsame Verirrung in den geheimen Dingen der Liebe gründeten. Seit den Episoden mit Magdalena Skupinski in meinem Elternhause fand ich keine Liebe, die dem üblichen Verhalten zwischen Mann und Frau entsprach. Stets sehnte ich mich zu der selten anzutreffenden Art eines Weibes, die in Willen, Bestimmtheit, Auftreten und Umgang dem Manne glich. Mein Verlangen galt nicht einem Weibe, das mir diente und untertan war, mir Kinder gebar und den Haushalt führte. Mein Drängen ließ mich Frauen suchen, die in ihrer Art einem strengen, strafenden und unbeugsamem Patriarchen entsprachen.
Fast gelang es mir, dieses Glück zu finden. Bevor ich Quartier in Barcelona nahm, durfte ich das Glück der speziellen Gemeinschaft mit einer strengen Frau erfahren. Es begann in einem Hotel der Stadt Rom. Im Speisesaal fiel mir eine besondere Dame auf, und allein ihre Erscheinung übte einen intensiven, fast magischen Reiz auf mich aus. Vom Portier erfuhr ich, dass sie allein reiste. Sah ich sie bei den Mahlzeiten, musste ich sie fast zwanghaft beobachten. Durch ihre Haltung, ihre Gesten und Worte spürte ich eine besondere Dominanz, die sie, unterstützt durch strenge Schönheit, auf ihre Umwelt ausübte. Mehr als nur empfänglich für diese Art, ließ ich mich vom Direktor des Hotels ihr vorstellen. Dabei ergab sich ein skurriler Zufall. Die Dame trug denselben Nachnamen wie ich. Es gab mehrere alte Familien, die den Namen Dunajew trugen, davon einige, die aufgrund ihrer Verdienste im Laufe der Jahrhunderte geadelt wurden. Ich fühlte mich glücklich, weil ich durch unsere Namensgleichheit die Grundlage eines besonderen Vertrauens annahm. In Frau Dunajew fand ich keine reiche und gelangweilte Dame, sondern eine kluge und umtriebige Frau, die in kaufmännischer Mission ihr Vermögen mehrte. Sie hatte es verstanden, mit besonderem Geschick im Handel eine kleine Erbschaft in ein ansehnliches Vermögen zu verwandeln. Bei ihren Aufenthalten in Rom logierte sie in demselben Hotel, in dem ich sie kennenlernen durfte. Meist jedoch bewohnte sie ein Landhaus in Fregene. Von dort aus steuerte sie ihren Warenfluss aus Italien zu den Händlern in Deutschland und Frankreich. Ich verhielt mich ihr gegenüber devot und äußerst aufmerksam, bemühte mich, jeden Wunsch aus ihren Gedanken zu lesen und umgehend zu erfüllen. Nach einiger Zeit offenbarte ich mich ihr in einem Brief als Mann, dessen höchstes Ziel es war, unter ihrer Herrschaft zu stehen, hoffte darauf, in ihr die besondere Frau meiner Sehnsucht gefunden zu haben. In ihrem Antwortbrief beschied sie mir, dass ich kein Entgegenkommen in Liebesfragen zu erwarten hätte. Ihr größtes Entgegenkommen bestünde in der Gestattung meines Kusses auf ihren Stiefelspitzen. Sie sei jedoch bereit, mich als Sklaven zu benutzen, und befahl mich zu einer Unterredung in ihr Landhaus, um zu prüfen, ob sie mich von meinen erotischen Verwirrungen nach und nach zu befreien vermochte.
Ich dankte meinem Schicksal und fieberte dem Treffen mit ihr entgegen. Zur Aussprache lag sie auf einer Chaiselongue, während ich vor ihr stand, wie die Natur mich schuf, nur dass meine Beine exakt einen halben Meter auseinanderzustehen hatten und ich meine Arme verschränkt hinter dem Rücken hielt. In dieser Stellung spürte ich ihren Blick, während sie mir ihre Bedingungen erklärte. Nicht auf einen Kavalier und beschützenden Mann legte sie Wert, sondern auf sklavische Dienstbarkeit, die keinen Widerspruch und noch weniger eigenes Denken zuließ. Auf dieser Basis sollte unser Verhältnis ruhen, unterstützt von einem ledernen Instrument, mit dem Hunde diszipliniert werden. Mein Herz zersprang beinahe vor Glück und ab sofort diente ich als Sklave in ihrem Landhaus. Zu jeder Zeit erfüllte ich ihre Befehle, die sie mir streng auftrug und deren Umsetzung sie peinlich genau kontrollierte. Mein Leben ähnelte tatsächlich dem eines Sklaven. Ich hatte mir jedoch vorgestellt, dass die Dame mir gegenüber zumindest die Neigung einer Herrin zu ihrem Hunde empfinden würde. Jedoch spürte ich keinen Hauch einer Liebe. Ich erspare mir die Erinnerung an ihre Körperstrafen, mit denen sie mich grausam peinigte, und mehr noch an ihre Worte, die mich fast zerstörten und mir jede Hoffnung auf eine Liebe ihrerseits zu mir nahmen. Ich war nicht gehorsamer Hund einer strengen Herrin, sondern wirklicher Sklave einer Herrscherin. Dennoch ertrug ich meine Leiden mit Freude. Ich lebte als Sklave einer Frau. Sie durfte alles, nahm sich alles und gab nichts. Ich hätte dieses Leben weitergeführt, jedoch teilte sie mir an einem Nachmittag knapp mit, dass sie ab sofort einem Gesellschafter und Kavalier aus Griechenland ihr Herz und ihre Körperlichkeit schenken würde. Als ich es wagte, Ansprüche anzumelden, ließ sie mich von eben diesem Herren auspeitschen. Meine Verzweiflung darüber kann ich nicht beschreiben. Noch in derselben Nacht flüchtete ich von dieser Frau und reiste nach Spanien.
In Barcelona versuchte ich, meine Gefühle und Gedanke zu ordnen. In diese Zeit fiel der Erhalt des Briefes meines Vaters. Mein Leben konnte wieder einen Sinn bekommen. Ein Rittergut zu übernehmen und es durch tüchtige Arbeit in einen profitablen Bereich zu bringen, schien genau die Aufgabe zu sein, die mir über die Verwirrungen hinweg half. Meine Kenntnisse der Landwirtschaft schätzte ich als überschaubar ein, doch als guter Kaufmann hatte ich keine Bedenken vor dieser Aufgabe. Auch erinnerte ich mich an Karl Wede, einen meiner Mitschüler aus dem Internat, der unter den Söhnen alter Familien zwar litt, sich aber durch Fleiß und beste Lernergebnisse auszeichnete. Ich hatte gehört, dass er nach unserer gemeinsamen Internatszeit ein Studium der Agronomie erfolgreich absolviert hatte und als Verwalter auf einem Potsdamer Gut in Stellung stand. Ich schrieb ihm, dass ich einen Verwalter für mein Gut in Ostpreußen suchte, und bat ihn, falls er selbst nicht zur Verfügung stünde, Augen und Ohren für mich offenzuhalten.
Meinem Vater schrieb ich, meldete meine baldige Ankunft in Holstein auf dem Gut meiner Eltern. Ich kündigte ihm an, meine Arbeit auf dem Gut der Familie so bald wie möglich aufzunehmen, und dankte ihm für die gewährte Möglichkeit, die Welt zu sehen und mich in Kultur und Sprache zu bilden.
Einen weiteren Brief schrieb ich an die Adresse der Wanda Dunajew. Ich bat um Verständnis für meine Flucht aus ihrer Sklaverei. Ich verzichtete auf jede Anklage oder Anschuldigung. Schließlich lebte ein Sklave lediglich als gehorsamer Diener. Seine Rechtlosigkeit beruhte auf dem Recht seiner Herrin. Ich hätte dulden müssten, von ihrem Liebhaber ausgepeitscht zu werden, sofern es ihrem Willen entsprach. Als wirklicher Sklave hatte ich versagt und entschuldigte mich wortreich und aufrechten Herzens. Ich schrieb ihr, dass die Ursache für mein Scheitern darin lag, dass meine Sehnsucht zur Sklaverei wohl nur auf erotischem Grunde stand, als Basis meines Lebens jedoch nicht taugte.
In weniger als zwei Wochen reiste ich von Barcelona nach Holstein. Ich fand meine Eltern und meinen Bruder bei bester Gesundheit und sah in ihnen große Zufriedenheit über mich und meine Heimkehr. Nach der Wiedersehensfreude widmeten wir uns meinen Berichten über die Welt, wobei ich meine außergewöhnlich gearteten, amourösen Begegnungen verschwieg.
Schon am ersten Abend bat ich darum, schnell meine Arbeit auf dem Gut in Tannwald zu beginnen. Während mein Vater große Freude zeigte und sofort begann, mich mit den geschäftlichen Dingen des Gutes vertraut zu machen, spürte ich bei meiner Mutter den Wunsch, mich doch eine Weile bei sich zu haben. Ich blieb volle drei Wochen, fühlte mich auf unserem Familiensitz willkommen und nach kurzer Zeit auch zu Hause. Kein Wort und keine Geste erinnerten mich an den Schatten, der über meiner Jugend schwebte, an das plötzliche Ende meines Lebens auf dem Gut meiner Eltern und den folgenden Umzug in ein Internat. Jedes Gespräch, das einen Bogen zu den Hausangestellten nahm, wurde schnell auf andere Bereiche gelenkt. Meine Affäre mit der Magd Magdalena Skupinski geriet nie in Erwähnung.
Ich reiste an einem kalten Januartag im Jahr 1873 über Hamburg und Königsberg nach Ostpreußen. Meine Ankunft kündigte ich auf dem Tannwalder Gut mit telegrafischer Depesche an. An der Bahnstation in Kirchstein empfing mich ein alter Herr in guter Stimmung, der sich als unser Gutsverwalter Stephan Golombek vorstellte. Wir luden mein Gepäck in den Landauer, fuhren aus der Stadt heraus, über weite, schneebedeckte Felder, hinein in den Forst. Leider, so sagte Golombek, gab es keinen Haltepunkt der Eisenbahn in Tannwald, obwohl die Bahnstrecke zwischen Kirchstein und Komberg weniger als eine halbe preußische Meile entfernt am Dorfe vorbei führte. So musste jede Ware, jede Person und jede Postsendung über eine Stunde mit dem Fuhrwerk in die nächstgelegenen Städte transportiert werden. Gäbe es einen Haltepunkt, würden sich Transportzeiten und Kosten reduzieren. Ich gab ihm recht und lenkte die Unterhaltung auf sein Befinden. Golombek dankte und erwiderte, dass er sich durch meine Person baldige Ablösung von seinem Posten erhoffte. Während der guten Stunde, die der Landauer bis Tannwald brauchte, erklärte er mir, dass ihm, als Mann in den hohen Sechzigern, die alleinige Verwaltung des Gutes oblag. In heutigen Zeiten, so sagte er, war es fast unmöglich, geeignetes Personal in Buchhaltung und Verwaltung zu finden. Gab es noch für verdiente Landarbeiter den Aufstieg zum Aufseher, so war es nicht möglich, aus dem vorhandenen Personal einen geeigneten Verwalter zu formen. Ohne die Hilfe seines Sohnes Bernhard hätte er die viele Arbeit nicht bewältigen können. Der jedoch habe ihn vor einigen Wochen verlassen und sei nach Königsberg gegangen, um eine Laufbahn bei der Feld- und Forstpolizei zu beginnen. Ich fragte Golombek, bis wann er mir unterstützend zur Verfügung stünde. Froh erwiderte er, dass ihm ab Mitte des Jahres seine vertraglich vereinbarte Pension zustünde und er zu diesem Zeitpunkt auch seine Arbeit auf dem Gut beenden würde.
Bei einbrechender Dunkelheit erreichten wir das Gutshaus. Am Eingang brannten zwei Petroleumlampen. Golombek stellte mir die Bediensteten des Hauses, das Ehepaar Maria und Rudolf Baltrusch vor. Im Speisezimmer war für mich und Golombek gedeckt, der mir stolz erklärte, dass vom Brot über den Schinken und die verschiedenen Käsesorten sogar der Kräutertee aus dem Anbau des Gutes stammte. Er erwähnte, dass Maria mir zwei gemütliche, leicht zu heizende Zimmer zur Parkseite hinaus als erste Wohnstätte hergerichtet hatte. Wenig später schlief ich in einem weichen Bett so ruhig und traumlos wie lange nicht.
Mein Vater hatte mir ein schlechtes Bild vom Familienbesitz auf Tannwald gezeichnet. Bereits nach erster Betrachtung konnte ich den Zustand des Gutes keinesfalls als hinfällig oder kritisch bezeichnen. Der alte Verwalter Golombek führte unsere Wirtschaft mit fester Hand. In den ersten Tagen nach meiner Ankunft begingen wir die einzelnen Bereiche, sodass ich mir schnell ein umfassendes und klares Bild machen konnte. Der Forst befand sich in bestem Zustand, es wurde beständig nachgepflanzt. Die Wälder standen nicht in der effizienten Art der Monokultur, sondern zeigten sich als gesunde Mischwälder. Golombek erklärte mir, dass die meisten Waldarbeiter als fest angestellte Männer arbeiteten. Nur in besonderen Zeiten wurde die Gruppe durch Saisonkräfte aufgestockt. Wir gingen die Bücher durch, ich studierte die Karten der Forste, las Bilanzen und fand auf den ersten Blick keinen Ansatz für eine mögliche Verbesserung.
Wir inspizierten die Felder. Golombek erläuterte mir die Fruchtfolgen. Neben Weizen und Hafer wurden auf den großen Flächen Rüben, Gerste und Kartoffeln angebaut. In den Ställen und Außenbereichen fand ich eine kaum überschaubare Vielfalt von Tieren. An Geflügelhaltung beeindruckte mich ein Hühnerhof mit großem Bestand. In einer Teichanlage mit Enten und Gänsen fanden sich auch Puten und sogar Wachteln. Von Ziegen, Schafen, Schweinen und Kühen bis zu Eseln reichte das Spektrum. Allerdings hielt man von jeder Art nur eine begrenzte Anzahl, die überwiegend im Gut Verwendung fanden oder als Deputat an die Angestellten verteilt wurden. Hier gab es zwar Vielfalt, aber auch jede Menge Arbeit, während sich der Gewinn überschaubar darstellte. An Pferden fand ich kräftige Tiere, gutmütige Kaltblüter, geeignet für Feld- und Transportarbeiten. In keinem guten Zustand standen die Gebäude. Zeigte sich das Gutshaus noch ansehnlich in frischer Farbe, so schienen mir die Dächer von Stallungen und Scheunen hinfällig. Feuchte stieg in den Mauern vieler Gebäude nach oben. Golombek machte mich mit zwei Handwerkern bekannt, die jeden ihrer Arbeitstage damit verbrachten, Dächer zu reparieren, Schäden in Putz und Mauerwerk auszubessern und den Verfall der Gebäude nach besten Kräften zu bremsen. Mir war klar, dass ich hier etwas unternehmen musste.
Nicht nur an den Wirtschaftsgebäuden, auch an Bauwerken, die keinem Erwerbszwecke dienten, nagte der Zahn der Zeit. Den Gutspark umgab eine Feldsteinmauer, die an den Friedhof grenzte. In Teilbereichen fand ich sie eingestürzt. Ein in roten Klinkern gebautes Kutscherhaus am Ende des Parks stand leer und zeigte Schäden durch ein marodes Dach. Auch im Dorf musste vieles getan werden. Der hölzerne Kirchturm ragte windschief in den Himmel, Wege zeigten sich durch Schlamm kaum begehbar, die Hauptstraße durch das Dorf bestand aus Pfützen und Löchern.
In den ersten Wochen nach meiner Ankunft verbrachte ich meine Tage bis auf die Sonntage fast ausschließlich mit Golombek. Ich begleitete ihn auf seinen Wegen, lernte die Leute im Dorf kennen, bekam Einblick in die Bewirtschaftung und staunte darüber, mit welch Weitblick der Mann das Gut betreute. Vom alten Verwalter lernte ich, so viel ich konnte. War es Zufall oder Glück? Mich erreichte zwei Wochen nach meiner Ankunft ein Brief meines Internatskameraden Karl Wede, der sich für die Verzögerung seines Antwortschreibens an mich entschuldigte und mir anbot, seine jetzige Stellung aufzugeben, um als Verwalter auf meinem Gut zu arbeiten, sofern er eine eigene, kleine Wirtschaft erwerben konnte. Erfreut telegrafierte ich ihm unverzüglich und bot ihm neben einem üblichen Verwaltergehalt eine Gewinnbeteiligung von zehn Prozent sowie meine Unterstützung beim Kauf eines Hofes. Wede sagte unverzüglich zu.
Als mein alter Internatskamerad tatsächlich im April anreiste, besaß ich dank Golombek gute Kenntnisse über das Gut. Am Kirchsteiner Bahnhof durfte ich statt des damals noch hageren Schülers einen kräftigen Mann begrüßen, der Vollbart trug, sich englisch kleidete und Pfeife rauchte. Er wirkte auf mich gereift, erfahren in vielen Lebensdingen und hatte dennoch nichts von seiner zurückhaltenden Art verloren. In den folgenden Wochen erstellten wir zu dritt Inventur und Finanzplan.
Wir packten gemeinsam an und scheuten auch ungewöhnliches Vorgehen nicht. Golombek verkaufte nicht genutztes Mobiliar aus dem Speicher des Gutshauses an interessierte Bürger aus Kirchstein und Komberg.
Wenig gewinnträchtige Bereiche verpachteten wir an interessierte Bauern. Wedes Idee einer Versteigerung von Jagden, Wald- und Fischereirechten wurde ein finanzieller Erfolg. Von den Einnahmen schafften wir zwei Lokomobile zum Pflügen und als Antrieb für eine neue Dreschmaschine und die Schmiede an. Die Gutsarbeiter erhielten zur Steigerung ihrer Leistung ab sofort Zuschläge bei jeder Überbietung der Tagesziele.
Ich stellte Herrn Guschow ein, einen älteren Baumeister aus Komberg, dem ich unsere beiden Handwerker zuteilte. Guschow stockte seine Truppe mit Handwerksburschen auf der Walz auf und so gelang es uns, neben der Unterhaltung der Gebäude, Altes durch Neues zu ersetzen.
Wir arbeiteten uns hart durch die ersten Jahre. Dank Wede machten wir bereits im zweiten Jahr Gewinn. Nach drei Jahren reduzierte ich meine Arbeit von sechzig auf vierzig Stunden in der Woche, nahm mir Zeit für meine Bibliothek und einen guten Weinkeller. Im weiteren Umfeld Tannwalds verschaffte ich mir die Achtung der Honoratioren und nahm häufig an Gesellschaften einiger Gutsbesitzer aus der Umgebung teil. Meine großen Anstrengungen in einer harten Zeit lohnten sich. Es gelang mir, aus einem durchschnittlichen Gut eine tragfähige Wirtschaft aufzubauen, meiner Familie Ehre zu machen und wirklichen Sinn in mein Leben zu bringen.
***
»Herr Baron, soeben brachte Frau Wolf die Zeitung.« Maria nahm die Kaffeekanne. »Wünschen Sie noch etwas zum Frühstück?« »Nur Kaffee, danke, Maria.« Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf den Kirchsteiner Boten. Diese Zeitung hielt mich auf dem Laufenden über die gesellschaftlichen Neuigkeiten meiner Umgebung, amtliche und kirchliche Nachrichten, sowie mein Hobby, die Immobilien. Gab es irgendwo eine Brachfläche, ein Sumpfland, eine feuchte Wiese oder schwer zugänglichen Forst, so beriet ich mit Wede eine mögliche Nutzung und kaufte. Kein Geld gab ich für Spiel oder Vergnügen aus. Nur eine Ausnahme, ein Laster hatte ich mir bisher geleistet. Zu meinem Bedauern fand es vor einiger Zeit ein bitteres Ende.
Seite für Seite blätterte ich durch die Zeitung. Heute gab es keine interessanten Immobilien. Nichts, was lohnte. Ich las allerlei im Bereich der Kuriositäten und erstarrte, als ich ein Inserat in der Rubrik FUNDSACHEN fand. DAMENSTIEFEL UND PEITSCHE GEFUNDEN. GEGEN FINDERLOHN ABZUHOLEN BEI FRAU W. LEOPOLD, POSTLAGERND, KIRCHSTEIN.
Ich konnte es nicht glauben, las das Inserat wieder und wieder. Dabei erinnerte ich mich meiner besonderen Erlebnisse mit strengen und grausamen Frauen in verschiedenen Ländern. Ich dachte an Wanda von Dunajew, der ich eine Zeit lang als Sklave diente. War diese Annonce ein verdecktes Angebot? Bot hier eine Dame ihre besonderen amourösen Dienste an? Ich spürte ein Kribbeln, das mir über den Rücken zog. Meine Hand zitterte leicht, als ich die Kaffeetasse hob. Die meisten Herren konnten der Neigung, sich einer Dame zu unterwerfen, nichts abgewinnen. Es war gegen die Natur, lachhaft und abstoßend. Ich dagegen empfand es als anziehend, reizend. Unterordnung und Gehorsam einer Frau gegenüber übte seit dem Einfluss der Magdalena Skupinski einen magischen Zauber auf mich aus.
Da meine Abweichung von der natürlichen Rolle des Mannes gesellschaftliche Ächtung nach sich gezogen hätte, verschwieg ich meine Neigung und lebte sie im Geheimen. Im Laufe der Zeit hatte ich ein Gefühl für Damen gewonnen, die bereit waren und die Stärke besaßen, einen Mann zu unterwerfen. Diese Frauen hatten einen seltenen Wert. Dem Gatten zu dienen wurde von einer Frau erwartet und es lag seit jeher durch die Natur in ihrer Bestimmung. Umso kostbarer schienen mir die geheimen anderen Damen. Speziell in Bereichen, in denen es um die käufliche Liebe ging, war die gestrenge Behandlung des Herren durch die Dame ein besonderes, geheimes Gebiet.
In den letzten drei Jahren verschaffte ich mir diese Form der Liebe einmal monatlich über ein Wochenende in der Stadt Elbing. Unter dem Namen Breslow mietete ich mich in der Pension der Freifrau von Wettin ein. Dieses Haus besaß vier Etagen und ein Dachgeschoss.
Im Erdgeschoss befand sich ein Restaurant für die Hotelgäste, das auch unter den Bürgen von Elbing einen guten Ruf genoss. Das erste und zweite Geschoss diente als Hotel. Die Zimmer wurden an Reisende und Geschäftsleute vermietet. Die dritte Etage blieb den sogenannten künstlerisch interessierten Gästen vorbehalten, die allesamt allein reisten und sich für ein bis drei Tage einmieteten. Hohen Anklang fanden die speziell eingerichteten Ateliers. Dazu gab es in der vierten Etage einen großzügigen Bereich mehrerer Zimmer, in dem einzelne sogenannte kunstinteressierte Herren und Damen zwanglos aufeinandertrafen. Diese Räume enthielten allesamt Mobiliar und Ausstattung für besondere Liebesdienste. Eine Freifrau von Wettin sah ich nie. Stattdessen wurde das Haus von einem geschäftstüchtigen Herrn geführt, der sich als ihr Cousin ausgab. Die einzelnen Damen warb er allesamt im Maitressenmilieu für sein Etablissement. Sie wohnten möbliert unter dem Dach. Auf diese Art und Weise fanden die besonders unzüchtigen Vergnügungen diskret und fern vom normalen Hotelbetrieb statt. Ich verlebte im Hotel der Freifrau von Wettin einmal monatlich ein Wochenende. In einem der Ateliers ließ ich mich von einer der Damen des Hauses knechten, unterdrücken, erniedrigen, schlagen und quälen. Dabei ging es mir nach meinen Erfahrungen mit Wanda von Dunajew nur um die körperliche Unterwerfung. Alle weitergehenden Möglichkeiten schloss ich aus. Wo meine Neigung hinführen konnte, wenn sie die Seele traf, hatte ich in allzu schlechter Erinnerung. Nach einem meiner Besuche vor einem halben Jahr bemerkte ich, dass mir ein zwielichtig scheinender Herr folgte. Es gelang mir, ihn abzuschütteln, indem ich eine Postkutsche nahm, mich nach Forstenbach fahren ließ und von dort mit der Bahn weiterreiste. Dass die Verfolgung kein Zufall war, spürte ich, als sich nach meinem nächsten Besuch erneut ein Herr an meine Fersen heftete. Auch ihn schüttelte ich ab. Dieser zweite Anlass zwang mich, Konsequenzen zu ziehen. Ich musste ausschließen, dass halbseidene Geschäftemacher meine Identität herausfanden. Da ich kein Interesse an der öffentlichen Ausbreitung meiner besonderen Vorlieben verspürte und jeglichem Erpressungsversuch entgehen wollte, mied ich seitdem Elbing und bemühte mich, möglichst wenig geschäftliche Beziehungen in dieser Gegend zu unterhalten.
***
Noch immer sah ich auf meine Zeitung, konnte aber kein Wort lesen, so sehr nahmen mich meine Gedanken gefangen. Ich trank einen Schluck Kaffee, führte meine Gedanken zurück in die Gegenwart. Die aufgeschlagene Zeitung lag auf dem Tisch. Meine Gedanken kreisten um das Inserat. Ich stellte mir vor, dass die inserierende Frau Leopold eine dieser besonderen Damen war, die mit ihrem verdeckten Inserat Herren meiner Neigung suchte. In meinen Gedanken sah ich mich unbekleidet und kniend vor einer gestrengen Frau, der ich die Stiefel küsste, während sie mir ihre Peitsche zu fühlen gab. Weil mich diese Vorstellung völlig gefangen nahm, dachte ich über eine passende Antwort auf das Inserat nach. Meine Besuche in Elbing hatten mich vor schnellen Beziehungen mit leichten Damen, besonders in der von mir bevorzugten Spielart der Liebe gewarnt. Ich musste sehr vorsichtig zu Werke gehen. Aber vielleicht ergab sich durch dieses Inserat für mich die Möglichkeit, eine Dame in längerer und vertrauensvoller Beziehung an mich zu binden. Ausschließen musste ich, dass sich hinter der Annonce ein finsterer Kerl verbarg, dessen Sinn auf Erpressung und schnellen Gewinn gerichtet war.
Ritt mich der Teufel, als ich beschloss, der Dame einen Brief zu senden? Und überhaupt, was sollte ich schreiben, wie beginnen? Der Brief musste einerseits sehr offen, andererseits völlig unverfänglich sein. Ich musste ihn so tarnen, dass er sich, kam er in falsche Hände, für mich nicht kompromittierend auswirken durfte. Ich dachte über den Text nach. Falls die Dame spezielle Dienste anbot, sollten diese nicht nur ein einmaliges Erlebnis für mich sein. Wie gelang es mir, mehr zu erreichen, als eine Frau mit Finderlohn für den Gegenwert amouröser Stunden zu locken? Ich stand auf, begab mich in mein Arbeitszimmer und schrieb den Brief, der mir nach etwa zehn Versuchen recht gut gelang. »Sehr geehrte Frau Leopold, gestatten Sie, dass ich mich an Sie wende, obwohl ich die von Ihnen gefundenen Gegenstände nicht verloren habe. Ich suche dringend leitende Unterstützung auf meinem Gut. Stiefel und Peitsche an einer Dame zu bewundern, ist eine Sache, die mir fehlt. Eine Dame, die meine Pferde reitet, fehlt hier ebenso wie eine strenge Hand, die mir unterstützend in manch Fragen zur Seite steht. Sollte sich also die Dame bei Ihnen melden, die Stiefel und Peitsche verlor, so wage ich, Sie zu bitten, mich dieser Dame mit diesem Brief vorzustellen und sie in meinem Namen zu bitten, ein Treffen mit dem Ziele der Besprechung eines längerfristigen Engagements zu vereinbaren. In Erwartung Ihrer gnädigen Antwort, hochachtungsvoll, Gregor v. Dunajew, Tannwald.«
Wanda Leopold
Lautes Rattern schreckte Wanda aus ihren Gedanken. Sie sah aus dem Fenster. Der Zug hatte die Weichsel erreicht, fuhr über eine Brücke. Unter ihm lag ruhig der Fluss. Weißer Rauch stieg aus dem Schornstein eines Lastkahns. Es klopfte an der Tür ihres Abteils.
»Bitte!« »In einigen Stunden werden wir planmäßig in Königsberg eintreffen, gnädige Frau Leopold«, sagte der Konduktor höflich. »Im Speisewagen steht Ihnen ab sofort der Mittagstisch zur Verfügung. Darf ich Ihnen Tee servieren? Vielleicht ein Wasser? Kaffee?«
»Ich danke Ihnen«, erwiderte Frau Leopold freundlich. »Sollte ich etwas wünschen, hören Sie von mir.« So war es richtig. Der Mann zeigte sich höflich. Schnell ging es von Berlin nach Königsberg. Drei Züge befuhren täglich die Strecke. Man sprach davon, in einigen Jahren ein Schnellzugpaar einzusetzen. Wahrscheinlich würde das die Reisezeit erneut verkürzen. Doch momentan waren solche Überlegungen Frau Leopold gleichgültig. Sie fuhr mit dem Courierzug Nummer eins. Die Fahrt dauerte etwas über sechzehn Stunden. Ob es nun später zehn oder gar neun Stunden wären, scherte sie wenig. Sie nahm sich für ihre Belange stets die erforderliche Zeit.
Was aber nicht warten konnte, war Hunger. Der Speisewagen befand sich direkt an der ersten Klasse. Vielleicht einen Kaffee, Salat und ein gutes Beefsteak? Wanda Leopold stand auf, öffnete die Tür zum Gang. Der Konduktor erhob sich sofort, deutete eine Verbeugung an. Es erfüllte die Frau mit Genugtuung, dass sich ein uniformierter preußischer Beamter vor ihr, einer allein reisenden Frau erhob. Na bitte. So war es richtig. Doch diese Achtung zu erreichen, bedeutete jeden Tag erneuten Kampf. Sie bat den Mann, ihr Abteil zu verschließen, ging in den Speisewagen.
Meist stand die Kochkunst in Zügen denen der Restaurants bei Weitem nach. Frau Leopold wurde angenehm überrascht. Das Rindersteak, perfekt serviert, außen schokoladenfarbig gebräunt, innen rosa, fast roh, schmeckte ihr ausgezeichnet. Dazu reichte der Ober grünen Salat mit Pistazien, Bohnen an gebratenen Zwiebeln. Störend wirkte auf sie lediglich der Anblick des etwas verfetteten Herrn am Tisch gegenüber. Dieser impertinente Kerl war krampfartig bemüht, seinem weichen Gesicht einen preußisch-straffen Ausdruck zu verleihen. Es gelang ihm nicht. Frau Leopold orderte Kaffee und eine Karaffe Mineralwasser in ihr Abteil, stand auf. Manierlich erhob sich auch der Dicke, zwar mit korrekter Verbeugung, jedoch gelang es ihm nicht, sein besonderes Interesse an Frau Leopold zu verbergen. Mein Gott, dachte sie, wie sich manche Herren spreizten. Im Abteil wartete Wanda auf Kaffee und Wasser, ließ servieren und entnahm ihrem Handgepäck eine von mehreren Mappen mit Papieren. Das Berliner Büro hatte die Unterlagen vor ihrer Reise zusammengestellt. Sie fand Karten der Gebiete um Kirchstein und Komberg. Die Gegend schien verschlafen. Dörfer, kleine Güter, Wälder, die sich mit Feldern abwechselten. Was für ein wunderschöner Flecken Erde sich hier fand! Die Seen waren miteinander verbunden, man konnte Kahnpartien veranstalten. Auch wandern, schwimmen, der Besuch von Kirchen und alten Landhäusern war möglich. In dieser Gegend in den Fremdenverkehr zu investieren, würde sich lohnen. Wanda Leopold lehnte sich zurück, dachte nach. Oh ja, ganz sicher wollte sie in dieser lieblichen Gegend ein Hotel eröffnen. Es sollte ausschließlich der Erholung angespannter Gäste von den beruflichen Anstrengungen dienen. Keine Hinterzimmer, keine verborgenen Bereiche. Immer wieder klagten Gäste ihrer beiden anderen Hotels über die Anstrengungen täglicher Arbeit in verrauchten Kontoren. Die technische Entwicklung beschleunigte sich ungemein, immer schneller und komprimierter wurde industrialisiert und dabei guter Profit verdient. Wenn Wanda Leopold ihre Gäste auf gewünschte Kompensation der Anstrengungen ansprach, erklärten diese oft ihre Sehnsucht nach einigen Wochen der Entspannung im Jahr, weit abseits von den Forderungen der Zeit. Genau in diesem Bereich wollte Wanda Leopold ihr Geschäft erweitern. In der zweiten Mappe fand Wanda einige Dossiers über die Honoratioren der Gegend. Beginnend bei den staatlichen Mächten, den Beamten zu Gericht, Polizei und Armee, über die Angestellten der Verwaltungen bis hin zu Unternehmern enthielt die Akte Namen aller Herren, die Rang und Namen im Gebiet um Kirchstein und Komberg hatten. Zu ihrem Bedauern fand Wanda darunter keine Frau, die adligen Gattinnen der Gutsbesitzer ausgenommen. Wanda Leopold trank einen Schluck Kaffee, sah aus dem Fenster. Dichte Mischwälder, schmale Felder, Wiesen, Viehweiden und immer wieder Wälder zogen vorbei. In zwei Jahren, so nahm sich Frau Leopold vor, würde auch sie auf der Liste der Honoratioren stehen. Sie las interessiert, dachte über die Verbindungen und fein gewebten Abhängigkeiten der Mächte untereinander nach. Herauszufinden, wo die verschiedenen Interessen lagen, war wichtig für die Umsetzung ihrer Pläne.
Etwas ermüdet legte Wanda die Akte zur Seite. Basis aller Politik in den Provinzen waren die Gutsbesitzer. In Ostpreußen fanden sich wenige Fürsten, mehrere Grafen, im Bereich der Masuren überwiegend Männer von geringem Adel. Aber auch einige Bürgerliche besaßen größere Güter. Wanda stand auf, öffnete die Tür des Abteils und bestellte beim Konduktor frischen Kaffee.
Noch zwei Stunden bis Königsberg. Margarete war mit telegrafischer Depesche über Wandas Eintreffen informiert. Wie üblich würde die Verwalterin ihr die privaten Räume vorbereitet haben, sie mit der Droschke vom Bahnhof abholen und durch das schöne Königsberg hin zum Hotel kutschieren. Wanda freute sich darauf, mit Margarete am morgigen Tag die Bücher durchzugehen. Sie rechnete mit einer spürbaren Steigerung des Gewinnes. Wie stets würde sie in ihren zwei Königsberger Wochen viele Termine mit alter Kundschaft wahrnehmen, lästig, aber unverzichtbar. Wanda zog eine dritte Mappe aus ihrem Handkoffer, entnahm ihm gut zwei Dutzend Antwortbriefe auf ihr Inserat im Kirchsteiner Boten, und griff zu ihrer Schreibmappe.
***
Späte Sonne füllte die Stadt mit rotem Licht. Der Anblick erschien Frau Leopold gleichzeitig schön und furchtbar. Es wirkte, als stünde ganz Königsberg in Flammen. Was für ein Gedanke, unvorstellbar! Das Schloss, die Altstadt, ihr Hotel. War eine Stadt vernichtet, so brannte sicher auch das Gebäude der Feuerversicherung nieder. Aber nein! Niemals würde diese Stadt brennen. Königsberg verfügte über eine zentrale Wasserversorgung und gute Feuerwehren. Wer sollte so eine Stadt vernichten wollen? Vom Zimmerfenster aus sah Wanda hinüber zum Schloss. Seit 1871 erlebte Königsberg einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Wanda hatte einen Teil dazu beigetragen und lächelte bei diesem Gedanken. Bereits in diesem Jahr war es ihr gelungen, ein geeignetes Gebäude nahe beim Schloss zu erwerben und ihr Hotel einzurichten. Als die zentrale Wasserversorgung aufgebaut wurde, nutzte sie die Möglichkeiten sofort. Französische Handwerker arbeiteten mehrere Wochen in ihrem Hotel. Im Anschluss besaß sie das erste Hotel mit fließend warmen Wasser in der Stadt. Alle Zimmern verfügten über Waschbecken und wollte ein Gast sich die Hände waschen, drehte er an einem Ventil. In den Appartements erster Klasse hatte man Wannenbäder eingebaut, in einigen Suiten für die kurze Körperwäsche französische Duschen, eine Vorrichtung, bei der warmes Wasser aus einer Sprühvorrichtung von der Decke fiel und über den Boden abfloss. Wanda Leopolds Haus verfügte über fünf dieser neuen Einrichtungen. Eine in ihrer Privatsuite, zwei in den sogenannten Kaisersuiten, eine im Wohnbereich der Angestellten und eine im hinteren Flügel. Ihr kleines Hotel war fast durchgehend ausgebucht.
Wanda mochte es, die neuartige Wassersprühvorrichtung zu benutzen. Unterdessen setzte sich nach und nach der Begriff Dusche für diese wundervolle Erfindung durch. Natürlich kostete so ein Luxus auch Geld. Heizer hatten dafür zu sorgen, dass stets heißes Wasser für die Zimmer vorrätig war. Wanda trat vom Fenster zurück, ging durch ihr Appartement hinüber zum Badebereich, legte ihre Kleidung ab, stellte sich unter die Dusche und drehte das Wasser auf. Die feinen Strahlen reinigten, wärmten, wuschen den Staub der Reise von ihr. Nach dem Duschen legte sie sich auf ihr Bett. Was für schnelle Zeiten, dachte sie. Am frühen Morgen fort aus Berlin, am Abend in Königsberg. Sie sah eine Mappe auf ihrem Nachtschrank, nahm sie und las die Geschäftsberichte ihres Königsberger Hotels. Morgensonne drang durch die Fenster in die Suite. Wanda Leopold blinzelte ins Licht, orientierte sich. Königsberg, ihre Räume, natürlich. Sie stand auf, ging zu den Fenstern, schaute über den Platz hin zum Schloss. Von hier hatte sie eine wunderbare Aussicht, ihre Suite lag an der sogenannten guten Seite. Nach hinten hinaus gab es keine so gute Aussicht. Das war auch nicht nötig, stand doch der sogenannte hintere Bereich des Hotels ausschließlich privaten Besuchern zur Verfügung. Er war geheim, gesperrt. Ein normaler Hotelgast kannte weder den verborgenen Korridor, noch ahnte er von diesem besonderen Trakt. Um in ihn zu gelangen, bedurfte es persönlicher Empfehlungen, größter Diskretion und vorheriger Anmeldung. Betrat ein avisierter besonderer Gast das Hotel, so meldete er sich an der Rezeption. Nach kurzer Zeit erschien ein Page, nahm den Herrn in Empfang und bat ihn in den abgetrennten Bereich der Lobby, in dem sich die Waschgelegenheiten befanden. Von hier wurde er zu einer unauffälligen, als privat gezeichneten und stets verschlossenen Tür geleitet, die in einen Korridor führte. Der Page verschloss die Tür, nachdem er gemeinsam mit dem Gast den Korridor betreten hatte. Nach zwei Dutzend Schritten erreichte man eine weitere Tür. Wieder schloss der Page auf und der Gast wurde vom speziellen Personal im besonderen Bereich hinter dem Hotel in Empfang genommen.