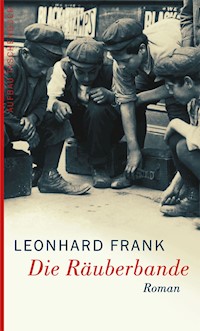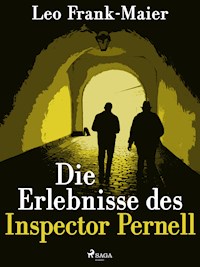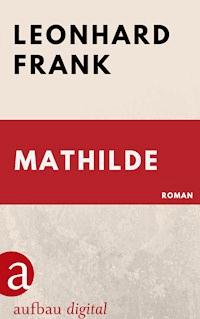
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helle Tage in dunklen Zeiten.
Die schöne, empfindsame Mathilde lebt Tag und Nacht in ihren Träumen. Sie heiratet einen Arzt und führt eine unglückliche Ehe. Durch viele Enttäuschungen hindurch bewahrt sie sich dennoch ihre menschliche Wärme und Güte. In dem englischen Gutsbesitzer und Flieger George Weston findet sie schließlich einen Seelenverwandten und ihre große Liebe. Doch gerade als ihr Glück am größten ist, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Weston meldet sich sofort zum Dienst. Mathilde und Weston, die einander so nahe waren, werden jäh getrennt.
Der leidenschaftliche Pazifist Leonhard Frank zeigt auf ergreifende Weise, wie zerstörerisch der Krieg sein kann, und erzählt zugleich von der Liebe, die scheinbar unüberwindbare Grenzen überkommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Helle Tage in dunklen Zeiten
Die schöne, empfindsame Mathilde lebt Tag und Nacht in ihren Träumen. Sie heiratet einen Arzt und führt eine unglückliche Ehe. Durch viele Enttäuschungen hindurch bewahrt sie sich dennoch ihre menschliche Wärme und Güte. In dem englischen Gutsbesitzer und Flieger George Weston findet sie schließlich einen Seelenverwandten und ihre große Liebe. Doch gerade als ihr Glück am größten ist, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Weston meldet sich sofort zum Dienst. Mathilde und Weston, die einander so nahe waren, werden jäh getrennt.
Der leidenschaftliche Pazifist Leonhard Frank zeigt auf ergreifende Weise, wie zerstörerisch der Krieg sein kann, und erzählt zugleich von der Liebe, die scheinbar unüberwindbare Grenzen überkommen kann.
Leonhard Frank
Mathilde
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Über Leonhard Frank
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Zuerst 1948 veröffentlicht
I
Die Dreizehnjährige, zart und strebend wie ein Halm, die auf dem schmalen Pfade durch die Wiese ging, sah aus wie ein Wesen aus dem roten Märchenbuch, in dem sie las. Das Gesicht, weich eingerahmt von rötlich-blondem Haar, war weißer als das grobe Leinenhemd, aus dessen Bund das Hälschen stengelhaft emporstieg. Der Mund war blaß. Aber die Sonnenpünktchen unter den felsgrauen Augen versprachen, daß diese Lippen einstens die Farbe des Lebens haben würden.
Noch unberührt vom Leben, schritt sie träumend auf den Tannenwald zu, bis zu den Hüften im Grase, leicht geneigt die hohe Unschuldsstirn, die nichts und alles wußte. Wo der Pfad, breiter geworden, den Bach erreichte, blieb sie stehen im wispernden Blumentumult und betrachtete aufmerksam die braune, lange, nasse Schnecke, die mit ihrem ganzen Hab und Gut auf dem Rücken mühsam auswanderte über den Staub auf die andere Seite der Welt.
Mathilde, den Tieren näher als den Menschen und mitfühlend stets bemüht, sie zu schützen vor den blinden Gewalten, prüfte an der Richtung der strotzenden Fühler gewissenhaft, wohin das nasse Leben wollte, und trug die Verirrte hinüber ins Gras.
»Jetzt glaubt sie gewiß, ein Wunder sei geschehen.«
Aber die Schnecke machte sich einfach wieder lang und setzte, als wären Luftreisen für sie etwas Alltägliches, ihren Weg ohne Aufenthalt fort, unbeirrt hinweg über Gräsergestänge und unter Blumenbrückenbogen durch, hinterlassend ihre Spur, die in der Sonne glänzte.
Die Stimme eines Bauern, der mit seinen Tieren sprach, schien fernher aus dem blauen Himmel zu kommen, an dem die Lerche hing, ein singender Morgenstern.
Fröhlich ging Mathilde den vertrauten Weg der Kindheit weiter und ließ sich mit ihrem Märchenbuch im Walde nieder, nah dem Rande, wo der dicke Moosteppich übersät war mit den winzigen lila Blütensternchen des Immergrün.
Sie zog sich nackt aus. Weil’s schöner ist, hatte sie der Mutter geantwortet. Der Körper, bläulich wie Milchglas, war stengeldünn, bis zum Querbalken der breitgedachten Schultern. Reglos kniete sie im Moose und beobachtete, plötzlich erschauernd, einen Zitronenfalter, der eins der lila Blütensternchen überfiel. Das nadelfeine Stengelchen schwankte und mußte sich schließlich beugen, das wehrlose winzige Sternchen, zu Boden gedrückt, zitterte und krümmte sich unter dem lautlosen Gewaltakt, der nicht enden wollte.
Der Schauer stieg von den Knien wieder aufwärts. »Er soll doch bei größeren Blumen essen«, flüsterte sie betroffen, mußte aber dem Gelben, der sich schwebend und flatternd und schwebend ins Innere wiegte, dennoch folgen, im Banne der unbekannten Empfindung, zögernd hinein in das lockende Geheimnis der Lichter und Schatten des Waldes. Der grüne Schein im Waldesinnern, weich, wie beständig aus sich selbst genährt, verwandelte das rötliche Haar in schimmerndes Moosgeflecht.
Der Gelbe hing jetzt flügelklappend an einer großen Glockenblume, die mit ihm hin und her schwang. Sie vermeinte, das duftfeine Läuten zu hören und schlich näher. Aber da flatterte er, aufblitzend im Sonnenstrahl, wieder weg und wiegte sich in langen Zickzack-Schwebesprüngen zwischen den graubemoosten Tannenstämmen durch, leuchtete in der dunkelgrünen Tiefe noch einmal auf und war verschwunden.
Sie spürte im Ohr das Pochen ihres Herzens, als sie, noch auf den Spitzen stehend, den gelben Sommervogel plötzlich nicht mehr sah. Aus unbekannter Tiefe kam über sie die Trauer der Enttäuschten. Sie tat langsam die paar Schritte zu der Ansammlung weißer Waldanemonen und ließ sich niedergleiten, kühlte Arme und Schultern in den Blüten und preßte, auf dem Leibe liegend, seufzend die heiße Wange hinein, wobei die Lider sich schlossen.
Der König der Zwerge, dessen Bart bis zu den Füßen reichte, saß auf einer dicken Baumwurzel unter der Erde. Zu seiner Linken war das ganze Volk der Zwerge versammelt und horchte andächtig auf den Sehnsuchtschor der noch nicht erblühten Blumen, deren safthelle Wurzelspitzen wie Sterne über den Lauschenden hingen. Da erteilte der König seinem Volke den Befehl, jetzt endlich wieder einmal neue Blumen zu machen, und deutete mit dem Zauberstabe auf die unzähligen Farbtöpfe, die zu seiner Rechten schon bereitstanden, gefüllt bis zum Rande. Sie tauchten die großen Pinsel hinein und strichen über die hellen Wurzelseelchen. Sofort schossen rings um Mathilde die Blumen aus der Erde, blitzschnell und spitz wie Pfeile, und entfalteten sich.
In einem langen Kleide nur aus Blumen flog sie schwebend weithin über Hang und Tal, und wo sie vorüberkam, schossen strichweise Blumen empor. Die große Wiese unter ihr wurde auf einmal ganz und gar gelb von Löwenzahn, und als sie den Rand des Waldes entlangschwebte, entstand unversehens ein Streifen blauer Glockenblumen, die noch ein bißchen schwankten. Der Bach konnte sich kaum noch durchwinden durch das Gedränge, soviel Butterblumengelb und Vergißmeinnichtblau verbrauchten hier die Zwerge. Plötzlich fuhr ein großer Pinsel aus dem Boden heraus, dicht neben einem Feldstein – der Zwerg unter der Erde hing, mit den Beinchen zappelnd, am Stiel und wollte seinen Pinsel, der in ein Mauseloch geraten war, wieder hinunterziehen. Aber der Pinsel wurde zu einer großen lila Distel, und der Zwerg fiel auf das Hinterchen.
Mathilde lachte noch, als sie schon erwacht war.
Die Waldhexe, graubemoost wie die alte Tanne, in deren Schatten sie mit dem Krückstock stand, blickte her. Von Angst gepackt, sprang Mathilde wieder zurück und sank am Waldesrande bei ihrem Märchenbuch ins Moos.
Mathilde hatte immer nur Märchen gelesen. Der Wald, in dem sie lag und las, war der Wald des Märchens, das sie las, und der Duft, den sie atmete, entstieg dem roten Märchenbuche, das den Wald mit Elfen, Hexen und Verzauberten füllte. Daß Arax, der Hofhund, der sie immer so schwermütig ansah, wenn sie kam, um heimlich ihr Frühstück mit ihm zu teilen, ein verzauberter Prinz war, wußte in der ganzen Gegend nur sie allein.
Märchen waren für sie bare Wirklichkeit. Sie hatten von früher Kindheit an ihr Gemüt gebildet und mit dem Wissen von Gut und Böse besternt, und wenn sie krank gewesen war, hatte das Zauberwort »Es war einmal« jeden Schmerz gelindert.
Sie umschlang das hochgezogene Knie und las, den Kopf auf die Rechte gestützt, das Märchen von dem »Mädchen ohne Hände«, dessen Mutter, eine ganz verarmte Müllerswitwe, dem Teufel auf dem Felde für Geld und Gut verschrieb, was hinter ihrem Hause stand.
Obwohl sie es schon oft gelesen hatte, wurde ihr doch gleich wieder bang ums Herz, da der Hinterlistige ja nicht den alten Apfelbaum meinte, sondern die schöne fromme Tochter, die hinter dem Hause soeben den Hof kehrte.
Ein neugieriger Fink hüpfte dicht an der Lesenden entlang und zurück, im Walde rief der Uhu, neben ihr hing ein hämmernder Specht senkrecht am Tannenstamm – sie sah und hörte nichts. Während ein Marienkäferchen auf dem Lesezeichen bis zur Hälfte herunter- und dann quer über die Seite krabbelte, auf die rechte Buchkante zu und herum, erlebte sie, wie der Teufel kam, die Müllerstochter aber nicht holen konnte, weil sie rein war. Sie fühlte in einer noch verschlossenen Kammer ihres dreizehnjährigen Frauenherzens, welche Art Reinheit das Mädchen geschützt hatte.
Eine dicke Kreuzspinne zog einen Faden von der Tanne herunter zum rötlichen Haar.
Auf des Teufels Verlangen mußte die Mutter alles Wasser fortnehmen. Aber die Tochter weinte so viele Tränen auf ihre Hände, daß sie doch wieder rein wurden. Da geriet der Teufel in Wut. Mathilde verhielt den Atem, als er schrie, er nehme die Mutter selber mit, wenn sie ihrem Kinde nicht sofort beide Hände abschlage.
Von Entsetzen durchronnen las sie diese Stelle noch ein mal und wieder und wieder. Auch sie würde ja die Hände auf den Block legen, wenn sie nur noch dadurch ihre Mutter schützen könnte.
Die Mutter schlug die Hände ab.
Die Kreuzspinne, grau wie der Tannenstamm, zog unterdessen zwischen Zweig und Haar weiter ihre Fäden und blieb manchmal mittwegs hängen, zurückblickend auf die Lesende wie auf ein Opfer, das in sein Schicksal schon unentrinnbar eingesponnen war.
Mathilde und die Müllerstochter weinten auf die Armstümpfe, so lange, bis auch diese ganz rein waren. Da hatte der Teufel keine Gewalt mehr.
Mathildes Kätzchen, schwarz wie Ofenruß, erschien am Ende des Pfades, trippelte in Pausen herbei und stieg tastend über seine nackte Herrin, deren Tränen in den Handteller rannen. Schnurrend schmiegte es sich an den atmenden Leib, den plötzlich Schluchzen erschütterte, weil die Müllerstochter jetzt auch nicht mehr bei der Mutter bleiben konnte, sondern in die Welt hinaus mußte, ohne Hände, die Stümpfe auf den Rücken gebunden.
Trost suchend warf sie sich mit dem nassen Gesicht über das Kätzchen, das zwischen die verschränkten Arme zu liegen kam. Das rote Märchenbuch klappte dabei zu – der Specht stieß sich ab vom Tannenstamm und huschte, zuerst das Moos fast streifend, in großem Aufwärtsbogen in den Wald. Zwischen Gesicht und Armen zwängte sich etwas Schwarzes heraus, mit dem Hinterteil voran, und kauerte sich auf die noch zuckende Schulter.
›Meine Mutter würde ja sicher zuerst hinter unser Haus treten und nach mir sehen, bevor sie sich mit dem Teufel einließe‹, dachte Mathilde, als sie auf dem Wiesenpfade heimwärts ging, durch den wogenden Sonnenchor der Grillen.
Sie rief ihr Kätzchen, konnte aber nur die Schwanzspitze entdecken, die wie das schwarze Schlötchen eines Dampfers durch das grüne Meer der Halme zog. Das Schlötchen wurde gekappt und wieder aufgestellt. Aber der Dampfer hatte den Kurs geändert – das Schlötchen steuerte jetzt auf sie zu.
Ihr Rock wurde hinten schwer, da beugte sie den Oberkörper nach vorne – im gleichen Zuge, wie sie sich wieder aufrichtete, erreichte das Kätzchen die Schulter.
»Blasses Weib, was suchst du hier?« sang die siebenjährige Ziegenhirtin, die mit ihrem roten Strickstrumpf auf dem Hügel saß. Die drei Ziegen blickten.
Die Kauernde auf der Schulter öffnete die moosgrünen Augen, als sie das Klappern eines Wagens vernahm. Der Bauerngaul, dem Mathilde vor einigen Wochen, bei der ersten Begegnung, über die Stirn gestrichen hatte, fiel aus dem Trabe, blieb vor ihr stehen und blickte ihr ins Auge. Da wurde ihr wieder leicht ums Herz.
Für Mathilde war jeder Tag wie der vorangegangene gewebt aus Märchenwelt und sanftem Traum und aus den großen kindlichen Gedanken und jeder doch auch eine neue Forschungsreise in das Leben.
Der verzauberte Prinz, ein schwarzweiß gefleckter Setter, der mit jedem Atemzuge auf die Heimkehr der beiden gewartet hatte, erhob sich bei seiner Hütte und verlangte, bebend vor freundschaftlicher Neugier, Bericht über die lange Reise in den Wald, zuerst vom Kätzchen, das von der Schulter heruntersprang. Da aber die Schwarze zum Haus fegte, wie vom Winde schief hinweggeweht, wandte er sich, dicke Kummerfalten auf der Stirn, an die andere Frau. Als wüßte er, daß Mensch und Tier Kinder der gleichen mystischen Mutter sind, bellte der Verzauberte, kurz und rauh, vorwurfsvoll sein Bruderrecht verlangend. Da kniete sie hin und strich die milliardenjährige Schranke fort mit der liebkosenden Hand. Kein Muskel blieb in Ruhe bei dem Erlösten, der sich zum Kreise bog und schließlich lang hinstreckte, zufrieden seufzend, da Welt und Leben nun wieder hell geworden waren.
Die Mutter stellte das Mittagessen auf den Tisch, Kartoffeln und saure Milch, und auf den Boden in die Ecke den Teller für die Schwarze, die aber unruhig um Mathilde herumstrich und verlangend miaute.
Sie ging in die Ecke, kniete hin und rückte den Teller. Das Kätzchen hopste sofort zu ihr. Zum Dank pinselte es mit der Schwanzspitze zuerst ein schwarzes S in das Gesicht der Knienden und eines an die geweißte Wand und schaufelte die Milch dann so eifrig ein, daß der schwarze Schnurrbart unversehens ein perlenbesetztes Geschmeide war.
Die Mutter schüttelte ablehnend den Kopf über das Tier, das lieber hungerte, als die Nahrung von anderen zu nehmen, und keine Vögel jagte, da es täglich sah, wie Mathilde sie fütterte.
Aber auch der Hund und der Bauerngaul spürten Mathildes Naturfrömmigkeit und liebten in ihr die Erlöserin aus der Verbannung in das Tiersein. Die Rehe, die im Menschen den Mörder fürchten, wechselten ruhig blickend langsam an ihr vorüber zur Tränke, abends, wenn die Sonne zu Gold gegangen war und Mathilde am Tannenstamm lehnte, reglos wie ein Bestandteil des Waldes, mit dem sie atmete. Der Blick des Tieres brachte Mathildes mitschwingendes Gemüt zum Tönen, als könnten Wellen vom Ursprung allen Seins her es erreichen.
Die Mutter schmuggelte die dicke Rahmschicht heimlich in Mathildes Teller und versenkte den Schöpflöffel resolut in die rahmlose Tiefe, als sie für sich selber nahm.
Am Nachmittag, als Tal und Hänge in der sengenden Sonne lagen, preisgegeben Halm und Blatt, die kein Hauch bewegte, schritt Mathilde, leicht gekleidet, übers Feld.
In der Ferne zitterte die Luft – ein farbloser Vorhang, glitzernd, als flösse Öl herab. Selbst die Ziegeldächer, hier und dort ins Laub geduckt, waren unter der Weißglut verblaßt.
Mathildes Freundin, die Lehrerstochter, stand wartend im Schatten des Apfelbaumes. Dunkles Rot leuchtete trügerisch auf den tiefgebräunten, vollen Wangen. Ein Jahr später, noch nicht erblüht, starb sie an Tuberkulose.
Wie ein Rad mit Flügeln fegte die Tochter des Notars die glühende Landstraße herab, mit fliegenden Zöpfen, und landete staubtrocken beim Apfelbaum – ein staksiges, weißblondes Kind mit weißen Brauen und Wimpern.
Die Vorstandssitzung konnte beginnen.
Die drei Mädchen hatten einen Blumenverein gegründet und auch einige Großbauerntöchter, die Beiträge und Strafgelder bezahlen mußten, als Mitglieder aufgenommen.
Die Tochter des Notars, die das Geld verwaltete und immer im Brustbeutel bei sich trug, schleuderte ihre geflochtenen Flachstaue in den Rücken und berichtete: »Unser Mitglied Kartoffelkraut hat gestern zwanzig Rappen Strafe glatt bezahlt.«
»Hat sie denn wieder aufgestoßen, Tulpe?« fragte Mathilde träumerisch.
»Auch das, Narzisse! Aber sie wollte auch nicht mehr Kartoffelkraut sein, sondern Lilie. Ich sagte ihr: Jemand, der draußen kaut, kann nicht Lilie sein.«
»Vorstehende Zähne sind aber sehr fein«, sagte die Rose gedehnt. »Englische Herzoginnen zum Beispiel …«
»Jaja, auch die kauen alle draußen. Deshalb können sie nämlich nicht küssen. Ha, eine Frau, die nicht küssen kann und Lilie sein will! Ich hab ihr jedenfalls sofort zwanzig Rappen Strafe auferlegt wegen … einfach wegen Unbotmäßigkeit.«
Die Narzisse schlug die Lider auf. »Ich werde zehn Männer heiraten und küssen.«
Sie saßen im Grase, neben dem Balkengehege, hinter dem braun-weiß gefleckte Kühe weideten.
»Ich gebe mein Jawort einem Grafen«, sagte die Rose. »Wir fahren in die Oper. Mein Kleid ist nilgrün. Oh, eine ganz einfach herabfallende Robe, nur mit einem Goldfaden abgebunden, hier unter meinem Busen.«
»Busen! Du hast ja noch nichts.«
Aber die Rose stand unbeirrt auf, ordnete mit leichter Hand rückwärts ihr Knieröckchen, damit die lange Schleppe schönen Fall bekomme, und begab sich hoheitsvoll in die Loge, preßte den Bauch gegen den Balken und hob, die kleinen Finger beider Hände weggespreizt, das Opernglas.
Zwei Kühe blickten aufmerksam herüber zur nilgrünen Gräfin und senkten die nassen Mäuler wieder ins Gras.
»Aber vielleicht, Narzisse, bist du zu dünn für zehn Männer«, sagte die Tulpe.
»Zu dünn? Warum?«
»Nun so!«
Nachdenklich öffnete Mathilde zuerst ein wenig die Lippen und legte dann langsam die Wange auf die Schulterkugel. »Nicht einmal für fünfzehn!«
Die Gräfin sauste mit zwei Sätzen von der Loge zum Apfelbaum zurück. »Habt ihr gesehen? Alle Operngläser waren auf uns gerichtet. Auf das gräfliche Paar! Mein Gemahl sagte, weil mein Dekolleté zu tief sei.«
Da fragte die Tulpe: »Soll ich euch etwas zeigen?« Resolut knöpfte sie die Bluse auf und streckte die flache Knabenbrust vor. Sie hatte über das Hemd einen rosa Büstenhalter ihrer Mutter gebunden, der nichts enthielt und tiefe Querfalten warf. »Ich, nämlich, bin schon soweit.«
Die Narzisse, die sich schämte, daß sie allein schon kleine Brüste hatte, senkte den Blick, und die Rose, die bald sterben mußte, sagte träumerisch vor sich hin: »Ich dekolletierte mich ja nur für ihn.«
Weiße Schleier schwebten über dem friedevollen Tal. Die Kuhglocken ertönten seltener – das Vieh lag wiederkäuend im Schatten der Obstbäume. Am Feldweg schwankte der Löwenzahn im Winde, der den schon abendlichen Duft der Wiesen zu den Mädchen trug, die schweigend in die Zukunft sannen. Der Büstenhalter war bis zum Hals emporgerutscht.
Ein ortsfremder Eismann und Zuckerbäcker, der seinen vielfarbigen Wagen schwitzend von Dorf zu Dorf zog, hielt an, als er die Mädchen erblickte, tat aber ganz uninteressiert. Er hatte seine Erfahrungen. Wenn er grüßt, brechen die Gänse in Kichern aus, das ihnen zur Hauptsache wird und schließlich sogar noch zum Hindernis, herzukommen und etwas zu kaufen.
»Er hat auch Limonade. Aber sie ist zu süß. Pappsüß!« erklärte die Rose, deren Gaumen schon trocken wurde.
Die Tulpe wandte dem Eismann den Rücken zu, zerrte den Büstenhalter wieder an den leeren Platz und sagte: »Zu süß – das gibt’s nicht. Ich kauf mir auch ein Eis dazu.«
Wie ein Hündchen, das von seinem essenden Herrn nicht beachtet wird, leckte die Narzisse die Lippen. »Hast du denn Geld?«
Die Tulpe streckte die Brust vor wie ein prahlerischer Knabe, während sie ihre Bluse wieder zuknöpfte. Das Beutelchen mit der Vereinskasse hatte sie herausgezogen. »Unser Blumenverein, finde ich, ist ein Blödsinn. Wir wissen ja gar nicht, zu was wir das Geld eigentlich verwenden sollen.«
Der Versucher saß auf dem Grabenrand und blickte über seine sehnsüchtig erwarteten Kundinnen hinweg, gleichgültig, als wäre er ganz allein auf dieser heißen Welt.
»Wir könnten den Verein ja einfach auflösen. Das Recht haben wir dazu – wir sind die Vorstandsdamen«, sagte die Rose gedehnt.
Die Tulpe starrte auf ein stacheliges Gewächs, nahm zuerst einen Anlauf und warf sich dann so wuchtig in den Sprung über die hohe Distel – Richtung Eismann –, daß der Rockrand über das weiße Höschen emporflatterte und das Beutelchen mit der Vereinskasse wie ein Glockenschwengel zwischen den gegrätschten Beinen baumelte.
In großer Haltung, als begebe sie sich in die Opernloge, schritt die Rose um den Distelstrunk herum und sagte leidend und verächtlich: »Ein richtiger Verein sind wir ja gar nicht, wir haben ja keine Statuten.«
Die Tulpe, die ihre Methode, sich dem kühlen, süßen Wagen unauffällig zu nähern, für erfolgversprechend hielt, beugte sich so tief hinab, daß ihre Stirn das kurze Gras berührte, und besah sich die Gegend, in der der Eismann saß, durch die gespreizten Beine.
Verschmähend den überreichen weißen Brautschmuck der Wiese, pflückte sie eine Marguerite, die vereinsamt in der Nähe des Wagens blühte. Nicht ob Er sie von Herzen, mit Schmerzen, über alle Maßen oder gar nicht liebe, sondern »Eis oder nicht Eis« war die Frage. Energisch zupfte die Tulpe, um den Spruch des Schicksals zu korrigieren, am Schlusse zwei Blättchen auf einmal ab, und die erleichterte Rose flüsterte schmachtend: »Eis! Jetzt wissen wir’s.«
Die Tulpe schickte ein verschämtes Lächeln hinüber zum Eismann, der aber das Risiko, die Mädchen durch ein einladendes Wort vielleicht wieder zurückzujagen zum Apfelbaum, nicht auf sich nahm, sondern weiter in die makellose Himmelsbläue sah, sehnsüchtig, als wünschte er, schon dort oben zu sein, um seinen Karren nicht mehr keuchend über die Berge zerren zu müssen.
Wie eine wandelnde Lilie schwebte Mathilde an den beiden vorüber und deutete mit der selbstverständlichen Entschlußkraft der Unschuldigen auf den inhaltsvollen Blechzylinder. »Himbeereis?«
Der Eismann krempelte die Hemdsärmel auf.
Der Schatten des Baumes, unter dem drei Kühe friedevoll wiederkäuten, war lang geworden. Auch die drei Vorstandsdamen ruhten reglos und verdauten. Schwalben, Futter suchend, zuckten wie schwarze Blitze drüber hin. Der Eismann zog schon durch ein anderes Tal.
Übriggeblieben waren eine grüne und eine rote Schlange aus Gummizucker, die Mathilde zusammengebunden und sich um den Hals gelegt hatte, die zwei Köpfchen vorne überkreuzt.
Die Kühe, die gemolken sein wollten, begannen verlangend zu brüllen. Die Tulpe dehnte sich und schnellte empor, preßte beide Fäuste auf ihr steinhartes Hinterchen und sagte schlicht: »Die ganze Vereinskasse ist futsch.« Das Beutelchen am langen Bändel hing schlaff auf ihrem Bauche, der jetzt ein wenig vorstand.
Die Rose, die zur Limonade und zweimal Eis vier große Lebkuchen gegessen und seither nur noch an die verschleckte Vereinskasse gedacht hatte, seufzte tief und richtete sich mühsam auf. »Wir kommen ins Gefängnis. Meine armen Eltern! Ins Frauengefängnis!«
Versunken betrachtete die Narzisse ihr Schlangenkollier im Handspiegel und tupfte die zwei klebenden Köpfchen besser an die zarte Brust.
Die Tulpe flitzte langbeinig hinter den nächsten Baumstamm und hob das Röckchen. Sie hatte drei Flaschen Limonade getrunken. »Wir sagen einfach, die Vereinsauflösung hat so viel gekostet, daß nichts übriggeblieben ist. Es war eine Bruthitze. So eine Vereinsauflösung kostet doch viel Geld, das weiß ich von meinem Vater. Und der ist ja Notar.« Sie sprach überlaut, um von den beiden verstanden zu werden. Ihre Stimme übertönte das Geräusch.
Das Kätzchen wand sich, den Schwanz aufgestellt, um den Pfosten des Gartentors herum, hopste plötzlich bocksteif in die Straßenmitte, blickte zuerst noch einmal zurück und wieselte dann in Wellensprüngen die einsame Abendstraße hinaus, Mathilde entgegen.
Sie nahm es auf die Schulter. Die Schwarze machte sofort den Hals lang und näherte die Nase vorsichtig den zwei gekreuzten Schlangenköpfchen, schob sich aber fassungslos wieder empor und staunte mit funkelnden Rundaugen hinunter. Schließlich versuchte sie, das Unbegreifliche mit dem bebenden Pfötchen zu enträtseln.
Auf dem Fensterbrett standen zwölf Gläschen mit winzigen Primeln. Die Nachtkerze brannte. Um den Fuß des Leuchters herum lag das Schlangenkollier. Die Mutter saß bei Mathilde auf dem Bettrand. Sie ließ ihr Kind seit Jahren jeden Abend die kleinen Sünden des Tages beichten, damit es ruhigen Gemütes einschlafen könne.
Aber diesmal wollte der ernste Mund sich nicht öffnen. Im schimmernden Porzellangesicht gingen die Augen unruhig hin und her und vermieden den Blick der Mutter.
»Jetzt sagst du mir aber sofort, was geschehen ist!«
Mathilde, die erklärt hatte, daß sie zehn Männer heiraten werde und sogar für fünfzehn nicht zu dünn sei, sagte stotternd: »Der Schmetterling ist so furchtbar lange auf dem Immergrün geblieben. Auf einer ganz kleinen Blüte! Immer noch auf ihr geblieben. Sie hat gezittert, furchtbar gezittert und sich so gewehrt.«
»Und was war noch?«
»Etwas war. Ich kann ja nicht sagen, was. Aber etwas.«
»Hast du ihn vielleicht totgemacht?«
»Nein, ich bin ihm, Mama, ich bin ihm dann noch nachgelaufen, tief in den Wald … Ist es eine große Sünde? Oder was ist es denn, Mama?«
Der Mutter bekam Angst. »Ist dir jemand begegnet im Wald?«
»Niemand, Mama! Auf einmal wurde ich so müde, daß ich eingeschlafen bin.«
»Tief in den Wald darfst du nie mehr«, sagte erleichtert die Mutter, die nicht erriet, warum der Anblick des Schmetterlings auf der zitternden Blüte Mathilde so sehr erregt hatte.
Den folgenden Morgen tönten Angstschreie aus dem Schlafzimmer. Die Mutter sprang hinein. Mathilde saß tränenüberströmt im Bett und blickte, die Hände abwehrend in Schulterhöhe, entsetzt an sich hinab.
Es war eine schwierige Aufgabe, der ahnungslosen Dreizehnjährigen das große Mysterium zu erklären und ihr Entsetzen in das Lächeln einer stolzen kleinen Frau zu verwandeln.
Ergriffen schrieb die Mutter an den Lehrer, daß ihre Tochter vier Tage nicht in die Schule kommen könne.
Mathilde schlug das rote Märchenbuch auf und legte sich mit genießerischer Umständlichkeit im Bett zurecht, erhoben von dem neuen und wunderbar tragenden Gefühl, daß sie wichtig geworden sei und von jetzt an dazugehöre.
Lächelnd sah sie noch einmal auf das Kollier aus Gummizucker zurück, ein wenig schon wie eine Entwachsene auf die Kindheit, und begann zu lesen. Von der tragischen Märchengestalt, die in der Fremde den vernichtenden Gewalten des Lebens wehrlos preisgegeben war und doch nicht untergehen wollte in der Seele, schlug ein brennender Bogen in das gleichgeartete Gemüt Mathildes, die das bitterschwere Schicksal der Müllerstochter wehrlos auf sich nahm.
Im Herbst durfte Mathilde das erstemal mit der Mutter in die Stadt fahren. »Zuerst auf die Sternwarte, Mama, wo man die Sterne ganz nahe sehen kann«, bat Mathilde, als sie die tobende Bahnhofshalle durchschritten hatten und in die Straßenbahn eingestiegen waren.
Sie trug die Tracht des Heimattales: ein maikäferförmig zugespitztes schwarzes Mieder, einen knöchellangen schwarzen Rock mit dunkelgrüner Seidenschürze und auf dem rötlichen Haar ein schwarzes Spitzengebilde, das dem Porzellangesicht der Dreizehnjährigen den Ernst einer mädchenhaften Witwe verlieh.
Während der Fahrt durch die Bahnhofstraße bewegte sich der Kopf Mathildes, die spitz auf der Kante saß, das Hälschen gereckt, regelmäßig wie ein Perpendikel nach rechts und nach links zu den großen Glasquadraten, hinter denen silberne und goldene Schuhe glänzten, himmlische Gewänder aus Samt und Seide in den wunderbarsten Farben leuchteten, Edelsteine, Gold und prächtiges Geschmeide blitzten und ihr eindrucksvoll bestätigten, was sie im Herzen nie bezweifelt hatte: daß die Märchenwelt hauchfeiner Sterngewänder, goldner Schuhe und der endlichen Erlösung aller Herzensreinen erdenwirklich war. Aus dem Wagen blickend, las sie, wie so viele Male, nur wieder in dem roten Märchenbuche, gläubig, selig und gar nicht erstaunt.
Der See, bei dem die Märchenstraße endete, war eine Platte aus purem Silber, über die hin goldene Segel glitten.
Am Ufer stand die kleine Familienpension, inmitten eines alten Gartens. Unbefangen wie das Tier läuft, der Baum steht, der Vogel fliegt, gab Mathilde dem Stubenmädchen die Hand und sprang zum Fenster, als sie einen winzigen blauen Schmetterling entdeckte, der immer wieder gegen die Scheibe prallte. Der Bläuling entschwand in die Freiheit. Sie sagte zum Stubenmädchen: »Sonst wäre er gestorben.«
Das Zimmer war modern eingerichtet, mit weißen Schleiflackmöbeln. Auch die Wände waren weiß. Als einzige Farbe leuchtete das rote Märchenbuch auf dem Nachttisch. Die Mutter war zu Besuch bei einer befreundeten Familie. Mathilde lag im Bett und schlief nicht. Sie dachte auch nicht. Sie blickte – und sah nichts vom Zimmer. Ihr Kätzchen, das Haus, die Kühe, die Freundinnen, die Berge waren im Zimmer. Sie schluckte und begann zu lesen.
Am frühen Morgen, die Mutter schlief noch, trat Mathilde im Nachthemd an die Glastür, die aus dem Zimmer in den Garten führte. Vier senkrechte Rasenspritzen, weit auseinander im Quadrate aufgestellt, schleuderten Wasserkreise empor, die von den ersten Sonnenstrahlen getroffen wurden. Die vier Regenbogen, durch die wechselnde Bewegung des zerstäubten Wassers oft vervielfacht, bildeten über der Mitte, wo die Wasserkreise einander schnitten, eine riesige Krone.
Der junge Gärtner, der neben dem Rosenbeet kniete, sah auf. Mathilde stand, Kopf im Nacken, reglos wie eine Gartenfigur, splitternackt unter der funkelnden Krone, die Haut besetzt von Tropfen, die in allen Farben blitzten.
Während sie über den Rasen wieder auf die Glastür zuflog – in der hochgestreckten Hand das flatternde Nachthemd wie eine Fahne hinterher –, trat die Mutter heraus.
Der Gärtnerbursche senkte den Kopf unter dem Blicke der verwirrten Mutter, deren starke Backenknochen plötzlich glühten.
›Buben tragen Hosen, Mädchen Röcke, das ist der ganze Unterschied‹, hatte sie zu Mathilde gesagt.
Daheim, im abgelegenen Bergdorf, das nur aus sieben Häusern bestand, konnte die Dreizehnjährige nackt in den Garten gehen – das Gesträuch den Zaun entlang war dicht und hoch. Mathilde wußte nichts. Sie war unter der Obhut der Mutter wie eine Pflanze aufgewachsen.
Der Gedanke, sie aus dem Paradiese vertreiben zu müssen, bekümmerte die Mutter, die angstvoll fühlte, daß mit der Stunde des Wissens Leiden begannen, die ihr empfindsames Kind tiefer als andere Mädchen verwirren und verstören würden. Sie erinnerte sich, wie entsetzt Mathilde im Bett gesessen hatte an jenem Morgen, da das natürliche Ereignis zum erstenmal bei ihr eingetreten war. Ratlos legte sie die Fingerspitzen an die Lippen.
»Du darfst nicht mehr ohne Kleider umherlaufen«, sagte die Mutter, als der Kaffee in den Tassen dampfte.
»Warum nicht?« Mathilde brach die dunkelbraune Spitze des Brötchens ab und fragte, den Leckerbissen zwischen den Zähnen, noch einmal: »Warum nicht?«
»Die Leute könnten dich sehen, und das geht jetzt nicht mehr … Ich wollte es dir schon lange sagen.«
Mathilde schwankte, ob sie zuerst auch noch die andere angebräunte Spitze essen solle, und entschloß sich, sie bis zuletzt aufzusparen. »Ich bin ganz sauber, Mama, mich kann jeder sehen.«
»Aber du bist ein Mädchen!«
Verständnislos blickte Mathilde die Mutter an. »Deshalb soll man mich nicht sehen dürfen?«
»Du bist jetzt schon zu groß.«
Mathilde fischte ein Stückchen Milchhaut aus ihrem Kaffee und sagte dabei: »Weil ich ein Stück größer bin? Das versteh ich nicht.«
»Verstehst du nicht! Du bist eben jetzt kein Kind mehr. Das ist es … Sieh mal, später wirst du eine Frau sein und wirst heiraten. Auch dein Mann wird sicher nicht wollen, daß du nackt umherläufst vor den Leuten.«
»Dann heirate ich ihn einfach nicht … Wieso soll ich denn überhaupt jetzt kein Kind mehr sein?«
»Weil das schon angefangen hat bei dir. Du weißt schon, was.«
»Ich will aber immer ein Kind sein.«
»Du willst! Du willst! Auch der Apfel wird größer und schließlich ist er reif. So ist es auch bei den Menschen … Ein Mädchen in deinem Alter schämt sich, vor anderen nackt zu sein.«
Mathilde dachte nach und fragte schließlich: »Muß ich mich auch vor dir schämen?«
»Vor mir natürlich nicht – ich bin deine Mutter.«
»Warum denn dann vor den anderen? Und überhaupt– warum denn schämen? Nur wenn man lügt und stiehlt, muß man sich schämen, sagst du.«
»Aber auch, wenn man nichts anhat!«
»Sag mir doch, warum ich mich deswegen schämen soll. Dann schäm ich mich sicher, das versprech ich dir.«
»Du solltest es jetzt schon von selbst wissen. Bist wirklich groß genug dazu.«
»Woher soll ich es denn wissen? Wer soll’s mir denn sagen, wenn du es mir nicht sagst!«
Die Mutter blickte, als dächte sie: Da hat sie recht.
In Gedanken versunken tupfte Mathilde die Brosamen auf und holte sie mit der Zungenspitze vom Finger. »Etwas wollte ich dich schon lange fragen, Mama. Wie kam ich denn auf die Welt? Ich meine, wie hast du denn das gemacht?«
Der Mutter wurde heiß. Das Gesicht brannte wieder. Sie kramte zwecklos in der Handtasche und sagte nebenhin: »Das erzähle ich dir später einmal.«
»Jetzt bist du ganz rot geworden.«
»Weil mir heiß ist! Der Kaffee!«
Mathilde lächelte überlegen und zärtlich. »Heute bist du einfach komisch, Mama.«
»Du – sei nicht frech!«
Sofort traten die Tränen in Mathildes Augen.
»Ist schon wieder gut«, sagte die Mutter schnell. »Aber du mußt folgen und tun, was ich sage.«
»Warum willst du mir denn nicht erzählen, wie du das gemacht hast, daß ich auf die Welt kam?«
»Weil du dazu noch zu klein bist!«
»Jetzt sagst du, ich sei zu klein …! Sag mir doch, wie du es gemacht hast! Sag’s mir, Mama!«
Da sagte die Mutter schüchtern: »Dein Vater liebte mich und nahm mich zur Frau.«
Plötzlich lief wieder der Schauer an Mathildes Beinen hinab, wie damals im Walde. Sie sah den gelben Schmetterling auf der kleinen Blüte. Sie zitterte und blickte schuldbewußt. »Und weiter, Mama, was kam dann?«
»Dann kamst du auf die Welt.« Die Mutter hob die Hand, als sagte sie: Ganz einfach, nicht wahr?
Der Schmetterling war immer noch auf der Blüte, die sich tief zu Boden beugen mußte. Mathildes Augen weiteten sich vor Grauen – die Blüte war riesengroß geworden, zum rotverweinten Gesicht der Mutter. Sie wich zurück, sie wimmerte kläglich: »Ich will ein Kind bleiben, Mama, ich will ein Kind bleiben.«
Von Entsetzen plötzlich aufgerissen bis zum Urgrund des Gemüts, schrie sie gellend: »Ich will ein Kind bleiben«, in der Sekunde, da sie kein Kind mehr war, und glitt besinnungslos zu Boden,
Nach zehn Tagen, als die Mutter ihre vier Zentner Honig, die Ernte des Jahres, verkauft hatte, fuhren sie heim.
»Ja, die ist schon lang nicht mehr da. Anfangs hab ich ihr immer den Napf hingestellt. Aber gefressen hat sie nie«, berichtete die Nachbarsfrau.
Tagelang hatte die Katze kläglich miauend Mathilde überall im Haus gesucht und zuletzt auch noch an deren Lieblingsplatz am Waldesrande. Hier hatte Mathilde nackt gelegen und über das Schicksal des Mädchens ohne Hände geweint. Von dort war die Katze nicht mehr zurückgekehrt.
Nach Wochen, Mathilde stand vor dem herbstlichen Asternbeet, strich sie wieder einmal durch den Garten, mager, mit glühenden Augen, schielend an Mathilde vorbei, den Bauch am Boden, im Maul einen blutverschmierten Vogel.
Sie bog den Kopf zurück und blieb stehen. Sie ließ den Vogel fallen und sah empor zu Mathilde mit einem unsäglichen Blick. Der Vogel zuckte noch.
Die zwei Vertriebenen standen reglos. Mathildes Lippen bebten in unbegreiflicher Trauer.
Die Katze wandte sich ab und schlich geduckt aus dem Garten. Sie sah nicht mehr zurück. Sie lief den Feldweg entlang, dem Walde zu, in dem sie für immer verschwand.
II
Der Frühlingsföhn zog durch das Tal. In der Nacht war plötzlich lauer Regen gefallen. Auf den Abhängen und am Waldesrande lag noch Schnee; die Wiesen waren schon frei. Der Bach war zu einem tosenden, lehmigen Gewässer angeschwollen.
Als Mathilde das Haus verließ und bergan stieg, durchbrach die Sonne das zackige Gewölk. In dem knöchellangen blauen Drillichkleide, das die Brust und die dünne Taille straff umspannte und unten rundum halbmeterweit abstand, glich sie einer großen blauen Glockenblume, die gewichtlos auf dem Wiesenpfad schwebte. Auf dem wollenen Brusttuch lagen die Hände überkreuzt.
Das Gras war naß, die Straße trocken und das Gezweig an den noch kahlen Bäumen nur wie von einem Hauche angegrünt. Wolken, weiß wie Dampf, lang und bauchig, schwammen zwischen den Gebirgsketten, und in weitester Ferne, himmelsnah, glühte der Gletscher, getroffen von der Sonne. Reglos schwebten zwei Bussarde über dem Tale, das ihr angestammter Jagdbezirk war.
Mathilde blieb stehen. Als sie rundum blickte, lauschend auf die Geräusche des Frühlings, der unaufhörlich damit beschäftigt war, den Winter aus dem Heimattale zu vertreiben, glaubte sie, die feinen und wuchtigen Linien des Gebirgs, den Zug des Waldes und den schnellen Lauf des Wildbachs in den Schultern und Gliedern zu spüren.
Durchströmt von Frische und Wärme zugleich, stieg sie weiter, den Kopf ein wenig schulterwärts geneigt, als lausche sie auch den Ratschlägen ihres Gemüts, das unaufhörlich damit beschäftigt war, die dunklen Geheimnisse des Lebens zu entschleiern. Diesen Morgen hatte sie auf ihrem Kinderbett gesessen, in Gedanken versunken, und wie im Traume aus dem rotschimmernden Zopf ein dickes Nest gebaut. Ihr Gesicht war im Laufe des Winters noch weißer geworden.
Seit dem Erwachen aus der Ohnmacht in der kleinen Familienpension war Mathilde verändert. Selbst ihre Gebärden, die sich vorher ausladend vollendet hatten, waren jetzt verhalten. Sie offenbarte auch der Mutter ihre Gefühle nicht mehr und wurde nicht mehr ungeduldig, wenn ihr die Mutter morgens die Bürste wohlgezählte hundertmal durchs Haar zog. Sie hatte viel mit sich selbst zu tun, seitdem sie wußte, warum sie kein Kind mehr war. Oftmals wurde die Erkenntnis des vergangenen Tages schon durch die des folgenden widerlegt. Sie wurde nie fertig.
Für diese Lebensstufe gab es keinen Lehrer. Jetzt prüfte die Keuschheit jeden Wunsch und Gedanken: ein riesiger und unbestechlicher Wächter. Mathilde ging bei ihrem Gemüt in die Schule, das eifrig und unbeirrbar für sie tätig war. Sie mußte nur lernen, die reinen und wunderbaren Gesetzestafeln, die das Gemüt ihr schrieb, richtig zu lesen.
Ein alter Bergbauer, mit immer abgebogenen Knien talwärts stapfend, grüßte, den Finger an der Mütze, stumm die Tochter der Witwe und paffte dabei aus der Pfeife ein blaues Wölkchen, das stehenblieb in der reinen Luft.
Als Mathilde in dem größeren Dorfe, wo die Schule war, das geheizte Haus des Lehrers und die ofenwarme Stube ihrer Freundin Rose betrat, prickelte ihr Gesicht, und die felsgrauen Augen strahlten frisch im Glanze der Gesundheit.
Auf der altersbraunen Tapete fuhren winzige Schiffchen über den Atlantischen Ozean, den der mächtige Kachelofen in zwei Teile trennte. Den heimeligen Geruch der Äpfel, die auf dem Ofen brieten, durchzog der süße Duft blühender Levkojenstöcke. Auf dem anderen Fenstersimse standen hohe Gläser mit Hyazinthenzwiebeln. Die nackten Wurzeln bebten im nährenden Wasser, und die noch schmalen lanzenstraffen Blätter strebten dem Licht und dem Leben entgegen.
Über dem Bett hing eine Landkarte. Paris, London und Schanghai waren rot unterstrichen. In diese Städte wollte die Rose einstens als Gräfin reisen, um in die Oper zu fahren und sich in einem Teehaus in Schanghai von der knienden Chinesin das Täßchen reichen zu lassen, wie es auf der Teebüchse in der Küche abgebildet war.
Sie legte Mathilde den Arm um die Schultern und ging mit ihr hin und her. Ihre vollen Wangen waren rot und heiß. Aber den Arm spürte Mathilde nur wie einen Hauch, so unkörperlich war die Lungenkranke schon geworden, und da wußte Mathilde plötzlich, daß die Rose sterben mußte.
Vor dem Levkojenfenster blieb die Rose stehen, angelehnt an Mathilde, die kein Gewicht spürte und erschauernd dachte: ›Sie ist nichts. Sie ist nichts.‹
»In drei Monaten bin ich tot, das weiß ich.« Sie wußte es. Aber zwischendurch, wenn es ihr ein wenig besser ging, zog die Hoffnung mächtig in sie ein. Dann wieder spürte sie, wie die Kräfte schwanden, und wußte, daß sie sterben werde. »Denkst du dann an mich?«
›Was sag ich, was sag ich?‹ dachte Mathilde. »Ach, was redest du denn da!« sagte sie, mit einem sorglosen Lächeln, das im Erbeben der Lippen gleich wieder zerbrach.
Obwohl die Rose wußte, daß der Vater, der selbst ein halber Doktor war, ihren hoffnungslosen Zustand schon seit langem kannte, flüsterte sie eindringlich: »Ich bitte dich, ich flehe dich an, sag es meinem Vater nicht, daß ich sterben muß. Er würde zu sehr leiden. Auch mußt du mir versprechen – aber feierlich! –, meinem Atem auszuweichen, sonst könnte ich dich heute nacht nicht in meinem Zimmer schlafen lassen.« Sie preßte die heiße Wange auf das kühle Ohr Mathildes, die plötzlich verwirrt wurde durch den Gedanken, die Freundin sei stolz auf ihre Krankheit.
Die Augen der Rose glänzten fiebrig. »Ich will dir jetzt ein Geheimnis verraten. Aber ich enthülle es dir nur dann, wenn du es bis zu meinem Tode hütest.«
»Das versprech ich dir. Aber du stirbst nicht.«
»Du mußt schwören.«
»Ich schwöre«, sagte Mathilde, deren Herz im Halse schlug.
»Nun gut! Gestern bekam ich einen Brief aus Luzern. Von einem Fremden! Ein sehr hoher Herr, das kannst du mir glauben. Du würdest staunen. Er fragte an, ob er sich mir nähern dürfe, um sich mit mir zu verloben.« Sie deutete auf den Papierkorb. »Ich zerriß den Brief und schrieb nur: Ihr Antrag ehrt mich. Aber es hat keinen Sinn mehr.«
Eine Stunde vorher hatte sie diesen Brief an sich geschrieben, überkommen von der Sehnsucht nach Leben, die schon so übersteigert war, daß sie zeitweise ihre Wünsche für bare Wirklichkeit hielt.
Mathildes Herz wurde schwer, weil die Rose geschrieben hatte: Aber es hat keinen Sinn mehr. Sie schluckte, damit die Tränen nicht heraustraten.
Die Abendschleier sanken. Schon waren Dorf und Halden grau. Die Mutter rief. Im Nebenzimmer stand das Essen schon auf dem Tisch. Es gab Haferbrei. Die Mutter nannte ihn Porridge. Sie war vor dreißig Jahren einmal in England gewesen. Seitdem liebte sie alles, was englisch war. Sie war eine stille, einfache Frau.
Der Lehrer teilte aus. Seine Schülerinnen nannten ihn Papa. »Du kannst wohl die Beine nicht still halten unterm Tisch, weil der Porridge so gut ist«, sagte er lächelnd zu Mathilde, obwohl er den Grund ihrer Unruhe sofort erkannt hatte.
Von ihrem siebten Jahre an hatte Mathilde in den Wintermonaten, solang der Schnee so hoch lag, daß sie den weiten Weg von Dorf zu Dorf nicht gehen konnte, auch gegessen und geschlafen im Lehrerhause, das ihre zweite Heimat war.
Über ihrem Bett, das gegenüber dem der Rose stand, hing ein Stahlstich mit der schön verschnörkelten Aufschrift »Faust und Margarete im Garten«. Im Hintergrunde grinste Mephisto aus dem Gebüsch hervor auf das klassische Liebespaar.
Mathilde hatte ihre Kindheitsfreundin im Laufe der Jahre sehr oft nackt gesehen und sich ihr unbekümmert nackt gezeigt. Als die Rose, die nur aus überlangen Beinen und Armen zu bestehen schien, nackt am warmen Ofen lehnte, sah Mathilde plötzlich das Zimmer in der kleinen Familienpension, wo sie erfahren hatte, warum sie kein Kind mehr war, und blickte verwirrt zu Boden.
Die Rose bog die Schultern vor, verdeckte mit den langen, dünnen Händen, die ihr größter Stolz waren, schamhaft die Stelle, wo die Brüste hätten sein sollen, und rief: »Mein Hemd! Ich finde mein Hemd nicht. Mein Gott, wenn jetzt ein Mann ins Zimmer käme.« Sie huschte ins Bett.
Mit einem winzigen rosa Quästchen, das sie heimlich im Dorfladen gekauft hatte, puderte die Rose, die gegenwärtig »Die Kameliendame« las, eilig Nase und Wangen. »Jetzt könnte er eintreten. Ich würde einfach zu ihm sagen: Sie sehen, mein Herr, Sie kommen ungelegen. Ich bedarf des Schlafes. Auch bin ich nicht allein.«
›Jetzt lösch ich einfach die Kerze aus‹, dachte Mathilde. Aber der Mond stand voll am Himmel über dem scharfen Grat – das Zimmer blieb hell. Sie stieg hinter dem Kopfteil des Bettes aus dem Kleid und zerrte das Hemd erst herunter, als sie schon lag und das Nachthemd schon übergestreift hatte.
Melancholisch seufzend stützte die Kranke sich auf und formte mit edler Gebärde aus ihrer Hand eine hängende weiße Blüte. »Was würdest du gesagt haben, wenn ich ein uneheliches Kind bekommen hätte?«
›Das geht ja gar nicht. Aber sie weiß es halt noch nicht‹, dachte Mathilde und flüsterte, von Grauen durchronnen und doch begierig, weiterzugeben, was die Mutter zu ihr gesagt hatte: »Zuerst muß ein Mann uns lieben und zu seiner Frau machen. Dann kommt ein Kind auf die Welt.«
Aber die Rose, die »Das Liebesleben in der Natur« heimlich und aufmerksam gelesen hatte, entgegnete träumerisch: »O nein, es geht auch ohne Heirat. Das ist sogar das Schicksal vieler Frauen meiner Art … Erinnerst du dich noch an den vornehmen Fremden im ›Blauen Lamm‹?«
Dort war im Sommer ein fünfundsiebzigjähriger Engländer abgestiegen, der auf der Dorfstraße einmal »How do you do« zur Rose gesagt hatte. Einige Tage nach seiner Ankunft war er plötzlich gestorben.
»Er sagte: ›How do you do‹, als er mich sah. Mir wäre es ganz gleich gewesen, wenn ich ein uneheliches Kind von ihm bekommen hätte. Ich habe mich ihm einfach hingegeben. Ihn habe ich nämlich geliebt. Jetzt ist er tot. Nie mehr soll mich ein anderer Mann berühren. Kannst du das verstehen?«
»Oh, ja, sehr gut«, sagte Mathilde, die jetzt überhaupt nichts mehr verstand. Sie hätte gerne gefragt, was »hingeben« sei und wieso man ein Kind bekommen könne, wenn ein alter Engländer »How do you do« zu einem sagte und dann starb. Aber die Herzensangst, wieder etwas so Entsetzliches zu erfahren wie damals von der Mutter in der kleinen Familienpension, verschloß ihr den Mund. Das Kinderkriegen schien eine unheimliche Sache zu sein.
Sie huschte durch das mondhelle Zimmer, als die Rose bat: »Komm herüber. Mir ist kalt.« Die Wangen glühten. Aber Knie und Füße waren so eisig, daß Mathilde unwillkürlich zurückschreckte.
Im Haus rührte sich nichts mehr. Schon schliefen Dorf und Tal. Das Schneegebirg bebte glitzernd im Mondlicht, in aller Ewigkeit starr mit dem All vermählt.
Die zwei kleinen Mädchen waren verstummt. So hatten sie in den langen Winternächten oftmals reglos nebeneinander gelegen und von der Zukunft geträumt. Die Rose wollte eine große Dame werden, Mathilde »etwas Rechtes«. Beide hatten es schlecht getroffen auf der Welt. Die Rose mußte früh den Tod erleiden, und Mathilde, in deren Gemüt Empfindsamkeit und eingeborenes Mitgefühl allein regierten, ein »Mädchen ohne Hände«, sollte einstens wehrlos das Leben bestehen. Aber noch träumten beide, und da war alles schön und gut.
Plötzlich sah Mathilde über dem fernsten Grate, der durch das zauberkundige Mondlicht nah hergegeben war, einen Reiter auf einem riesenhaften weißen Pferd–scharf eingerissen in den kalten Himmel die funkelnde Kontur.
Sie hatte das Ganze und sofort auch alle Einzelheiten so plötzlich erblickt, daß sie glaubte, Roß und Reiter hätten erst soeben mit einem riesenhaften Sprung den Grat erreicht und würden mit dem nächsten Sprung jetzt über die ganze Schlucht hinweg den anderen Gipfel erreichen. Aber der wild galoppierende Gletscherschimmel von ungeheurer Größe blieb schwebend über den Grat gebannt. Das schattenschwarze Cape des Reiters und die langen Locken flatterten erstarrt. Der Schimmel, der die Zähne schaurig bleckte, riß zornig in den Zügeln. Mathilde vermeinte, das Gelächter des Reiters zu hören, so deutlich sah sie das triumphierend lachende Gesicht.
Sie glaubte nicht, was sie sah, sie schloß die Augen und schlug sie wieder auf – da war es wieder. Unfaßbar, daß es an der Stelle blieb, im rasenden Galopp. Die hochgebäumten Vorderbeine, die Muskelbrust und die gebleckten Zähne waren im Zorn Mathilde zugedreht.
Sie grub die Nägel in den Arm der Rose. »Sieh hin – das Pferd!«
»Ich seh kein Pferd. Du tust mir weh.« Aber plötzlich schnellte sie empor. Sie sah den Reiter mit dem schwarzen Cape auf dem im Mondlicht funkelnden Gletscherschimmel. Da schmiegte sie sich an Mathilde, so eng und zärtlich wie nie zuvor, und flüsterte. »Er galoppiert zu seiner Geliebten, die er entführen will. Er holt sie. Glaube mir, er holt sie.«
Mathilde durchrann der Schauer, sie dachte: ›Der Tod!‹
In der Nacht – sie lag wieder im Bett gegenüber – erwachte sie und blickte hinaus. Sie schlich durch das immer noch mondhelle Zimmer und hielt, am Bett der Rose kniend, den Kopf in gleicher Höhe mit dem der Schlafenden. Aber dort oben zogen nur noch graue Wolkenfetzen.
Ergriffen von Trauer und Zärtlichkeit, blickte sie die Freundin an. Auch jetzt bildete die dünnfingrige Hand eine hängende weiße Blüte, die über der Schulterkugel lag, umgeben vom dunklen Haar. ›Wenn sie wieder gesund wird, schenk ich ihr mein Märchenbuch.‹ Das war ein Gelübde.
»Nicht genug. Nicht genug«, flüsterte sie, angstvollen Herzens, als sie wieder lag. Aber es war das einzige, das sie besaß. »Lieber Gott, ich will mein Leben lang jeden Morgen auf Schottersteinen knien, wenn du sie wieder gesund werden läßt.«
Aber Er ging nicht darauf ein. In der Früh schreckte Mathilde aus dem Schlaf, geweckt durch ein gurgelndes Geräusch. Das Blut kam stoßweise aus dem Mund der Rose. Die Augen waren überweit aufgerissen – sie bekam keine Luft.
Mathilde schrie gellend: »Papa! Papa!« Sie sprang zum Bett, richtete die Kranke auf, die schon zu ersticken drohte, und hielt das Handtuch vor. Ein dicker Blutstrom schoß auf das zusammengeknüllte Tuch, das ein roter Ball wurde. Aber die Rose bekam wieder Luft. Die Lider schlossen sich, der Kopf sank haltlos an Mathildes Schulter. Das Blut rann immer noch.
Der Lehrer stürzte herein. »Mama!« rief er streng. Sie stand schon unter der Tür, fassungslos entsetzt. »Den Doktor!« Er kniete hin und hielt die Hand seines Kindes. Behutsam wischte er das Blut von Mund und Kinn. Die Rose schien zu schlafen, so entspannt war das Gesicht, kleiner und wie vom Leben schon weit entfernt. Aber der Atem ging.
Auch angesichts des drohenden Todes der Rose vergaß die verstörte Lehrersfrau nicht, Mathilde ein Stück Brot auf den langen Heimweg mitzugeben.
Die Tulpe, die im Fenster stand, warf zur Begrüßung beide Hände himmelwärts und hing Sekunden später an Mathildes Arm. Ihre festen Schnürstiefel hatten Absatzeisen, mit denen sie auch jetzt noch manchmal Funken aus dem Pflaster schlug. Sie war ein Stück länger geworden und dennoch breiter und voller in den Hüften. Über der Brust spannte das Mieder. Jetzt war sie wirklich schon soweit.
Sie konnte jetzt manchmal sinnend stehenbleiben und, als wollte sie gar nicht so genau wissen, was da in ihr vorging, den Kopf hochreißen und sich mit dem ganzen Körper in ein Unternehmen schleudern – die vier Stufen vor dem Hause in einem Satz hinauf.
»Du hast den Rocksaum herausgelassen?« Sie lächelte vielsagend, als hätte sie Mathilde ertappt, und sah dann ärgerlich hinab auf ihr Röckchen, dem sie längst entwachsen war.
Mathilde, die mit der Mutter früher alles besprochen hatte, war eines Morgens, befolgend den Hinweis ihres eifrig tätigen Gemütes, mit herausgelassenem Rock in der Wohnstube erschienen.
»Was ist denn mit dir?« Plötzlich bemerkte die Tulpe, warum Mathilde so verändert aussah. »Du, das mach ich aber auch.« Sofort legte sie die zwei Flachstaue um den Hinterkopf. Mathilde fingerte zwei Nadeln aus ihrem Knoten und befestigte das dicke Nest.
Die Verwandlung der Tulpe vom Kind zur Jungfrau geschah vor einem Kolonialwarenladen. Im Schaufenster stand ein zerkratzter farbiger Zwerg aus Gips, der Kaffeebohnen in einer Untertasse anbot.
Die Tulpe drehte sich um sich selbst und fragte: »Wie seh ich aus? Viel älter, nicht wahr?«
Mathilde, die an die Rose dachte, mußte zuerst schlucken, bevor sie lächelnd nicken konnte.
Mit einer langen knallroten Zuckerstange zwischen den Zähnen kam die Tulpe wieder heraus. Sie beförderte die Honigsüße ohne Hilfe der Hand in den Mundwinkel und sagte: »Gestern hat er mich wieder am Zopf gezerrt. Aber das ist jetzt aus. Mein lieber Beat, werd ich zu ihm sagen, küssen–ja. Aber am Haar zerren – da mußt du dir ein Schulmädchen suchen. Nun ja, schließlich bin ich doch kein Aff mehr.« Sie zeigte ihre Brust. »Schau her, sie werden immer größer. Ich seh sie mir jeden Morgen an. Und der reißt mich am Zopf! Aber der Martin vom Großbauern hat mich gestern angeglotzt, als ob er mich gleich auf der Stelle heiraten möchte … Pflüg du nur weiter, langer Lackel, hab ich mir gedacht.«
Die zwei wohlhabenden, schon angealterten Schwestern, die bei der Wahrheit blieben mit ihrer Behauptung, sie bräuchten gar nichts zu verkaufen, sie hätten den Kolonialwarenladen nur erworben, um sich weniger zu langweilen, traten vor die Tür, weil sie bemerkt hatten, daß Mathilde einen langen Rock trug. Sinnend blickten sie dem Ereignis nach.
Die Tulpe machte lange Schritte, und daran waren nicht allein die schweren Stiefel schuld – sie dampfte vor Lebenslust. »Jetzt ist es nicht mehr so wie früher, als wir klein waren. Jetzt geht’s los. Zum Geburtstag –fünfzehn, denk an – hab ich mir gleich einen Hut gewünscht. Aber einen richtigen! Nicht nur so einen Deckel!« Sie warf das Hinterchen ein paarmal hin und her. »Jetzt ist das anders. Jetzt geht’s richtig los.« Die Augen funkten.
Von der ersten Sekunde an hatte Mathilde sagen wollen, daß die Rose sterben müsse. Unversehens brach das zurückgehaltene Schluchzen durch. Sie heulte laut auf und erzählte und schluchzte und lief dabei, immer gradaus starrend, viel schneller als zuvor.
Die Tulpe, die sich nicht vorzustellen vermochte, daß die Rose, mit der sie von Kindheit an gespielt und gestritten hatte, jetzt auf einmal sterben könnte, sprang hinterdrein und rief ärgerlich: »Ach, du dumme Ursel, die wird doch sicher wieder gesund. Die muß nur tüchtig einhauen. Viel Eier! Und dazu Schinken! Wir haben drei Stück im Kamin. Ich bring ihr jeden Tag. Sollst sehen, wie das geht. Wer nicht ißt, kommt runter, sagt mein Vater. Aber sie wollte ja immer nur die allerfeinsten Sachen essen – Lakritz und so. Da will ich lieber keine Gräfin werden, erklär ich dir.«
Mit entblößtem Oberkörper, hinter dem das offene schwarze Haar flatterte, schritt die schwachsinnige Julie vorüber, den Kopf tief im Nacken, die schweren weißen Brüste vorgestreckt.
Ahnungsvoll verstört blickten die beiden ihr nach.
Einige Tage später wurde sie von ihrem Vater, einem armen Kleinbauern, im Walde gefunden, als sie aus dem Buschwerk heraus und über die Lichtung kroch, wie ein Tier auf allen vieren.
Flüsternd wiederholte die Tulpe wortgetreu, was sie gehört hatte: »Julie darf nie heiraten und hätte einen Mann doch wahrhaftig nötig. Aber es würde sich an den Kindern rächen.«
Mathilde, die gehört hatte, der Vater hänge Julie an die Kette wie einen Hund, sah verstört zu Boden, weil wieder der Schauer an ihren Schenkeln hinunterlief.
Die zwei Mädchen gingen anders als vorher und auch nicht mehr Arm in Arm. Sie sahen den schönen sonnigen Morgen nicht mehr und blickten auch einander nicht an. Sie spürten, was Julie zwang, die Brüste preiszugeben.
»Grüß dich«, sagte die Tulpe kurz, und Mathilde gab denselben Gruß. So unversehens hatten sie sich immer verabschiedet, und jede war ihres Weges gegangen. Aber diesmal wandten beide sich um, zögernd, und gingen wieder aufeinander zu. Sie lächelten ein wenig, atmeten zuerst noch einmal, lächelten wieder und küßten einander. Sie waren um ein Gefühl älter geworden. Jetzt aber raste die Tulpe los, quer über die dampfende Wiese.
An der Waldecke setzte Mathilde sich unter die mächtige Tanne auf den Kilometerstein. In der Wirrnis der Gefühle und Gedanken übersah sie die Schneeglöckchen, die in der löcherigen Schneedecke standen und im schwarzen Boden zwischen den krustigen Resten. Sie schwankten ein wenig, als versuchten sie, den Flocken auszuweichen, die vereinzelt zu fallen begannen. Traf eine Flocke, dann stand das schwerer gewordene Glöckchen still, so schwach war der Wind noch.
Plötzlich verschwand das ganze Tal, und auch das reglos sitzende Mädchen hatten die dichtfallenden Flocken lautlos fortgezaubert.
Beim ersten Windstoß, der die Flocken im Bogen wieder himmelwärts trug und dicke Schneestücke von der Tanne riß, stand Mathilde auf. Der nächste Stoß, der hart gegen ihren Rock klatschte, trug sie vom Kilometerstein weg, den Hügel hinab und in den pfeifenden weißen Wirbel hinein. Sie sah nichts. Aber sie kannte die Richtung. Sie stellte sich schräg gegen den mächtig aufkommenden Sturm, der vielstimmig pfeifend die Flocken waagrecht gegen sie jagte und dann plötzlich wie eine Mauer hinter ihr stand und sie zum Springen zwang. Sie wollte das Brot aufheben, das ihr entfallen war, und wurde dabei um sich selbst herumgewirbelt und wie ein Leichtes fortgeweht.
Die Füße versanken tief im Schnee – sie spürte, daß sie die Straße verloren hatte, und wußte die Richtung nicht mehr. Aber der zerrende, stoßende Sturm erlaubte ihr nicht, stehenzubleiben. Sie preßte die Hand auf die schmerzenden Lider und taumelte weiter. Fauchend bohrte der Sturm einen weißen Trichter in das jagende weiße Gewirbel und stieß beim Aufwärtssprung Mathildes Kopf in den Nacken.
Mit geschlossenen Augen sah sie plötzlich den galoppierenden riesigen Gletscherschimmel und glaubte, von Todesangst ergriffen, im triumphierenden Sturmgeheul das Gelächter des Reiters zu hören.
»Ich will nicht sterben. Nein! Nein!« Sie warf sich, Kopf und Schultern voran, von neuem gegen die eisige Wand. Aber sie wurde hochgehoben und zurückgeschleudert. Trotzdem nahm sie sich vor, von jetzt an immer diese Richtung einzuhalten, mit dem Sturm und gegen ihn. Dann müsse sie ja früher oder später zu einem Bauernhof kommen. Aber sie muß aufpassen, daß sie nicht in den reißenden Wildbach stürzt. Da war sie verloren. Auch als sie nach langem Kampf am Fuße eines Hügels auf die Knie stürzte, bog sie nicht ab, sondern bohrte sich in dieser Richtung weiter, wurde wieder hinabgestoßen und kämpfte sich keuchend noch einmal empor. Oben prallte sie plötzlich gegen einen Baumstamm und stürzte wieder in die Knie, unter der mächtigen Tanne, neben dem Kilometerstein, auf dem sie vor einer Stunde gesessen hatte.
Das Bergkind wußte, daß der Wald die rettende Zuflucht war. Mit den singenden, waagrecht sausenden Flockenpfeilen, die an den Stämmen zerbrachen, taumelte sie hinein und im Zickzack zwischen den knarrenden Tannen durch, deren Wipfel im Aufruhr der Natur riesige Bogen schlugen.
Als sie zurückblickte, sah sie Tannenwald – schwarzen Stamm neben schwarzem Stamm; als sie weiterlief, sah sie wieder nur weiße Säulen, an denen die Schneepfeile zerstäubten. Aber im Innern, wo der Schneesturm durch das Gebüsch und durch die dichter stehenden Stämme an Wucht verlor, graute und grünte es schon stellenweise, und in der tiefen Schlucht, über der die Sturmpeitsche nur noch die Wipfel traf, regte sich kein Blättchen am Brombeerbusch, und Mathilde spürte keinen Hauch.
Die Wangen glühten. Sie hatte Hunger und dachte an das Brot. »Das fressen jetzt die Raben«, sagte sie fröhlich und marschierte gleich los. Der Weg durch den Wald war viel weiter als der über die Wiesen, auf dem sie vielleicht nie mehr heimgefunden hätte.
Nur der Waldgeist kannte den geheimnisvollen Grund, warum der Pfad, den blitzklare Wässerchen überquerten, im Zickzack um Tannengruppen herum, durch Brombeerbüsche schnurstracks mitten hindurch und plötzlich eigensinnig in so scharfem Winkel wieder nach rückwärts zog, daß Mathilde glaubte, an dieser Stelle vorher schon gewesen zu sein.
Sie blieb stehen und blickte. Schnee fiel weich baffend zu Boden. Der Ast, ledig seiner Last, schwankte langsam auf und nieder und zeigte dabei Mathilde, daß ihn jetzt nur noch eine dünne Eislitze schmückte, durchwegs bis zur äußersten Spitze. Die Nadeln glänzten naß.
Melodisches Wispern und Summen zog durch den Wald, wo der Frühling seine stille und beharrliche Arbeit tat. Hier war der Boden schon schwarz; dort nagte der Frühling unverdrossen am krustigen Schneerest, unter dem dünnste Wässerchen hervorkamen und im winzigen Zickzack über die braune Decke vorjähriger Nadeln sickerten.
Drei Rehe standen auf dem Hange gegenüber. Sie fraßen nicht, sie blickten nur, sie bewegten sich nur wenig.
Mathilde ging auf den Fußspitzen, bis der eigenwillige Pfad sie von den Tieren, die sie seit langem kannte, fortgeführt hatte. »Die drei stecken doch wirklich immer zusammen.«
Sie kam zu einem grünen Abhang, auf dem kahle Sträucher standen. ›Hier könnten schon Veilchen sein‹, dachte sie und begann zu suchen und zu pflücken. Der Boden war naß und lehmig, sie rutschte immer wieder ab. Schneeglöckchen vergrößerten den Strauß.
Als sie endlich am Waldesrande stand, glaubte sie beim ersten Blick, in einer anderen Gegend herausgekommen zu sein. Dort unten mußte das Dorf liegen. Aber sie sah nur ein paar schwarze Giebellinien im Schnee, so dick eingeschneit und schneeverweht waren Dorf und Tal. Sie stieg hinunter.
Sie war im Frühling vom Hause fortgegangen und kehrte im tiefen Winter zurück, in der Hand einen Strauß Veilchen und Schneeglöckchen.
Vor der Haustür stieg sie aus den lehmigen Schuhen und ging strümpfig in die geheizte Wohnstube. Der Schnee in den Stirnlocken verwandelte sich sofort in Wasserperlen.
»Wo bist du denn heimgegangen bei dem Schneetreiben? Auf der Hauptstraße?« fragte die Mutter, die am Fenster saß und Wäsche ausbesserte.
›Ja, Hauptstraße!‹ dachte Mathilde und sagte: »Oh, es war ja nichts, es ging ganz leicht.«
»Aber bei uns war ein tüchtiger Schneesturm.«
»So?« Sie versorgte zuerst ihre Blumen und setzte sich dann auf den warmen Ofen, der aus einem weitläufigen gemütlichen Parterre und zwei Etagen bestand, durch die Zimmerdecke hindurchgebaut war und im Oberstock noch eine kleine Dependance hatte, auf dem zwei sich bequem ausstrecken konnten.
Das wuchtig ausladende Haus, zu dessen zweieinhalb Meter dicken Mauern Mathildes Urahn die Quadern der Burgruine verwendet hatte, war um den Ofen herumgebaut. Er wurde von der immer gut durchwärmten Küche aus geheizt und versorgte auch den langen, zimmerbreiten Flur, wo das zweite Feuerloch war, nebenbei mit Wärme. Der Ofen, selbst ein kleines Haus, erkaltete im Winter nie. Er würde in diesen Monaten ein ansehnliches Wäldchen gefressen haben, wenn er es bekommen hätte. Aber die Mutter kannte ihren Ofen und wußte ihn bei seinen guten Eigenschaften zu nehmen. Ein Künstler hatte ihn gebaut. Der war schon hundert Jahre tot.
Mathilde kletterte auf die erste Etage, weil ihr das Parterre zu warm geworden war.
Im Laufe zweier Tage wurde der Wildbach eine riesige lehmige Stromschlange. Hier und dort war die weiche Schneedecke schon eingesackt. Die welligen Hügel hatten Grasmützen. Nasses Geäst zeichnete sich schwarz in den Himmel, und auch die sieben Häuser, deren Dachtraufen Tag und Nacht liefen, standen wieder da. Ein lauer Märzregen fraß den Rest. Das Tal war naß und grün.
Mathilde stand in ihrem schwarzen Regenmantel auf der Bahnstation vor dem blau angestrichenen Schokoladenautomaten, in dem oben ein Spiegelchen war. Schon wollte sie von dem ersparten Geld ein Zwanzigrappenstück in den Schlitz stecken, da erblickte sie in dem Spiegelchen ihr von der Kapuze schwarz eingerahmtes weißes Gesicht und ließ die Hand wieder sinken.
Mathilde, die sich unzählige Male im Spiegel betrachtet hatte, sah das erstemal in ihrem Leben, daß sie schön war. Staunend wandte sie den Blick nicht mehr ab von den geschnittenen grauen Augen, dem kleinen Mund, blaßrot und dünn hineingezeichnet in das schmale, behutsam zugespitzte Oval, das seine milde Bewegtheit vom Gemüt empfing. Die Stirn war ruhig und klar.
Zur Frau geworden in einer Minute, nahm sie sich in Besitz mit einem winzigen sieghaften Lächeln. Und wie nun schon gewohnt, sich schön zu wissen, tupfte sie mit den Fingerspitzen die Locken eine Spur tiefer in die Stirn, prüfte, den Kopf zurücknehmend, kritisch noch einmal das Ganze, mit Befriedigung, die sie im Leib spürte, und ging – mit anderem Gange, als sie gekommen war.
An diesem Morgen – die Schülerinnen saßen schwätzend in den Bänken – kam der Lehrer später als sonst aus dem Oberstock herunter ins Schulzimmer und sagte in die plötzliche Stille: »Jetzt ist unsere Rose tot. Geht nach Hause.«
›Keinen Grabstein, kein Kreuz, keinen Namen, nur ein Fliederbäumchen‹, hatte die Rose gesagt.
So geschah es.
III
Mathilde befreite den Sohn des verzauberten Prinzen von der Kette. Der alternde Prinz, der nebenan aufrecht vor der Haustür saß, reglos wie ein schwarzweiß bemalter Gipsabguß seiner selbst, bewegte nicht einmal die Augen, so erhaben war er über das Freudengeheul seines Sprößlings.