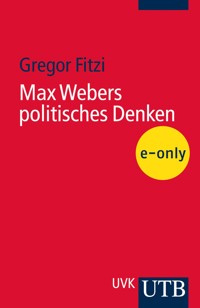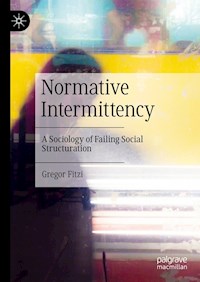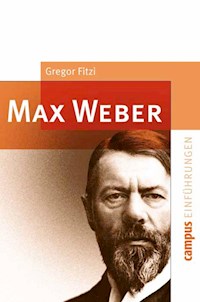
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Campus Einführungen
- Sprache: Deutsch
Max Weber (1864 – 1920) zählt zu den Mitbegründern der deutschen Soziologie und ist nach wie vor einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Gregor Fitzi stellt Webers Grundthesen vor: die Methodologie der Sozialwissenschaft, die Theorien der Moderne und des abendländischen Rationalismus sowie Webers Studien zur Wirtschaftsgeschichte. Darüber hinaus zeigt er Max Weber als Mann der Politik und der Öffentlichkeit und behandelt die Rezeption seiner Arbeiten in den Sozialwissenschaften. Viele aktuelle Auseinandersetzungen mit Weber belegen die bis heute ungebrochene Ausstrahlung seines Werks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Fitzi, Gregor
Max Weber
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2008. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40254-3
|7|Siglen
GPS: Weber, Max (1988e). Gesammelte politische Schriften (19211 ). 5. Aufl. Winckelmann, Johannes (Hg.). Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
MWG: Weber, Max (1984 ff.). Max Weber Gesamtausgabe. Hg. v. Horst Bayer, Reiner Lepsius, Wolfgang J. Mommsen †, Wolfgang Schluchter, Johannes Winckelmann †. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Jeweils mit Hinweis auf Abteilung (römisch) und Bandnummer (arabisch) zitiert.
MWL: Weber, Marianne (19261 ; 1984). Max Weber. Ein Lebensbild. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
RS I; RS II; RS III: Weber, Max (1988a). Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (19201 ). 3 Bde. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), jeweils Bd. 1, Bd. 2 und Bd. 3.
SSP: Weber, Max (1988c). Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik (19241 ). 2. Aufl. Weber, Marianne (Hg.). Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
SWG: Weber, Max (1988b). Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (1924 1 ). 2. Aufl. Weber, Marianne (Hg.). Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
WL: Weber, Max (1988d). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (19221 ). 7. Aufl. Winckelmann, Johannes (Hg.). Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
WuG: Weber, Max (1980). Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie (1921 – 221 ). 5., rev. Aufl. (Studienausgabe) Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
|9|Einleitung
Nicht nur der Landschaft und des Klimas wegen fahren jedes Jahr Hunderttausende nordeuropäischer Touristen nach Südeuropa, sondern auch weil sie dort das Gefühl des »süßen Lebens« suchen, das ihnen Erholung vom arbeitsbesessenen Alltag verspricht. So scheint der »Mittelmeermensch« ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen beibehalten zu haben, das sich im sozialen Verhalten widerspiegelt und auch auf Fremde und Besucher ausstrahlt. Ähnliches soll Weber (1864 –1920) widerfahren sein, als er in der Zeit der Genesung von seiner Nervenerkrankung nach Neapel kam, wo er sich zum ersten Mal in seinem Leben frei vom Arbeitseifer und vom Leistungsdruck fühlte, die sein kulturelles Umfeld prägten (MWL 262). Diese Erfahrung weist jedoch auch eine Kehrseite auf, die jeder kennt, der sich vorgenommen hat, für seinen Urlaub am Mittelmeer ein kleines Haus zu kaufen. Bürokratische Verfahren sind mühsam und langsam, wobei sich oft niemand zu finden scheint, der für eine bestimmte Sachlage wirklich zuständig ist. Es gibt insofern sozial und kulturell bedingte Formen der Lebensgestaltung, die den Umgang mit dem Alltag, die Arbeitsleistung, das Verantwortungsgefühl bestimmen und selbst innerhalb Europas stark voneinander abweichen können. Dabei stellt sich für die Soziologie die Frage, inwieweit sich diese Unterschiede historisch auf die verschiedenen soziokulturellen Hintergründe der betreffenden Länder zurückführen lassen. Dies betrifft auch und vor allem den Umgang mit dem Geld. Wenn für manche Gegenden der Spruch gilt, dass die Menschen »auf |10|dem Geld sitzen«, ohne irgendetwas von ihrem Reichtum preiszugeben, fahren anderswo Menschen ungeniert teure Wagen, die nicht einmal abbezahlt sind, um ihren Wohlstand zur Schau zu stellen.
Die Bedeutung dieser und ähnlicher Erscheinungen hängt mit der Art und Weise zusammen, wie das Prestigegefühl der betreffenden Schichten kodifiziert ist, sie ist jedoch ebenso durch deren kulturelle und religiöse Vorprägung bedingt. Wie sich in religiös gemischten Gebieten beobachten lässt, gelten zum Beispiel Vorurteile, die jeweils auf bestimmte konfessionell bedingte Eigenschaften der anderen abzielen. So heißt es über protestantische Bevölkerungsgruppen, sie seien materialistisch und geldgierig, während über Katholiken zu hören ist, dass sie faul und lax seien. Einiges deutet somit auf einen Zusammenhang zwischen der religiösen Zugehörigkeit und bestimmten Aspekten der Lebensführung, die für die Ausprägung der Wirtschafts- und Arbeitsethik der Menschen entscheidend sind. Ähnliche Beobachtungen, die auch Weber geläufig waren, bestätigten empirische Studien, die er am Anfang des 20. Jh. durchführte. Einerseits zeigte eine Untersuchung über die Produktivität der Industriearbeit (vgl. Kap. 1), dass Weberinnen mit pietistischem Hintergrund eine ausgesprochene Arbeitsethik aufwiesen; andererseits ergab eine Studie über die Beziehung von Konfession und Wirtschaftsgesinnung (vgl. Kap. 4), dass unter den Handwerkern die Katholiken überwogen, während die Unternehmer sowie die oberen Schichten der Fabrikarbeiter vorwiegend protestantischer Konfession waren. Des Weiteren schien die neuzeitliche Geschichte Europas die These eines Zusammenhangs zwischen der Reformation und der Entstehung moderner Wirtschaftsformen zu bestätigen, obwohl sie wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen war. Es waren nämlich die nordeuropäischen Länder und später die USA, in denen es ursprünglich zu den Produktionsformen gekommen war, die unter dem Namen des modernen |11|Kapitalismus aufgeführt werden. Dieselben Länder zeichneten sich dadurch aus, dass sie den religiösen Wandlungsprozess der Reformation durchlaufen hatten und eine starke Vertretung calvinistisch oder puritanisch geprägter Sekten in ihren Gebieten aufwiesen. Im Unterschied dazu hatten andere Hochkulturen wie der Buddhismus, der Taoismus und der Hinduismus keine vergleichbaren Phänomene gekannt und die kapitalistischen Produktionsformen erst spät und durch den kolonialen Druck Europas übernommen. Dies stellte für Weber zusammen mit der Entstehung moderner Wissenschaft und Technik sowie der bürokratischen Staatsverwaltung die historische Besonderheit des modernen Okzidents dar und warf eine Reihe von Fragen auf, die eine historische Sozialwissenschaft zu beantworten hatte.
Kann es Kapitalismus ohne Protestantismus geben? Welche ist die Besonderheit des europäischen Kulturraums, der sie hervorgerufen hat? Wie ist die historische Bedeutung des Kapitalismus und des modernen Zeitalters einzuschätzen? Diese Weber bewegenden Fragen gehörten zu den zentralen Interessen und Streitpunkten der Sozialwissenschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert, seitdem Marx sie im Kapital aufgearbeitet und durch seinen sozialphilosophischen Ansatz beantwortet hatte.
Karl, Marx
1818 –1883
Einer Rabbinerfamilie entstammend, die später zur protestantischen Kirche übertrat, wurde Karl Marx am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Nach dem Studium der Jurisprudenz und Philosophie in Bonn und Berlin war er zuerst als Journalist tätig, musste jedoch wegen seiner radikalen Positionen Deutschland verlassen und nach Paris gehen. Dort begann er eine engere Zusammenarbeit mit Friedrich Engels, mit dem er 1845 die Heilige Familie und die Deutsche Ideologie schrieb. Ausgewiesen aus Frankreich, ging er nach Brüssel, wo er 1847 Das kommunistische Manifest verfasste. Nach dem Scheitern der Revolution 1848 ging Marx nach London, wo er in bescheidenen Verhältnissen lebte und sich seiner wissenschaftlichen Arbeit widmete. Dort entstanden seine Hauptwerke, darunter Das Kapital (1867), das seine Untersuchung der Herkunft, der Struktur und der |12|Entwicklungstendenz der modernen Produktionsform enthielt. Neben der wissenschaftlichen Tätigkeit widmete sich Marx zeitlebens der Organisation der entstehenden Arbeiterbewegung. Marx starb am 14. März 1883 in London.
Den Ursprung des Kapitalismus als Produktionsform sah Marx in der Enteignung der Bauern im Zuge der Auflösung der mittelalterlichen Landverfassung, die durch die für die Textilindustrie notwendige Schafzucht und Umzäunung (Enclosures) der Gemeindefluren in England eingeleitet wurde (Marx: 1998, 744 f.). So wurden die Bauern zu besitzlosen Proletariern, die darauf angewiesen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und die Landbesitzer zu Geschäftsleuten, die ihren Reichtum nach und nach in die Fabrikproduktion investierten, um ihr Kapital zu vermehren. Seither zwingt für Marx der Zyklus der Industrieproduktion zur wachsenden Ausbeutung der Arbeiterschaft und zur Konzentration des Kapitals in wenigen Händen. Die Beurteilung der Moderne fällt dementsprechend negativ aus. Die kapitalistische Gesellschaft würde einen Kollaps erleiden, da sie die Gewinne nicht ständig maximieren könne, während der Kampf der besitzlosen Proletarier mit den Kapitalisten zu einem revolutionären Umbruch führe, der eine Neuordnung der Produktions- und Besitzformen einleite.
Gegenüber Marx’ Diagnose stellte sich für die Sozialwissenschaftler von Webers Generation die Frage, ob sie zutraf oder die Eigenart des modernen Kapitalismus sowie des abendländischen Kulturkreises historisch anders zu verstehen war. Dies spornte Weber an, die Entstehung des Kapitalismus sowie seinen Entwicklungsprozess durch eine Reihe historisch-soziologischer Fragestellungen zu untersuchen. Dabei nahm er sich vor, nicht nur den Wandel der Produktionsformen zu berücksichtigen, sondern auch die kulturellen Kräfte, die dazu beigetragen hatten, dass sich die moderne Wirtschaftsform ursprünglich nur |13|im neuzeitlichen Abendland entwickelte. Somit nahm die Frage nach dem »abendländischen Rationalismus«, der den Unterschied des Okzidents gegenüber anderen Kultursphären ausmachte, die zentrale Stellung in Webers Forschungsprogramm ein. Besonders die pragmatische Ausprägung dieses Rationalismus, die in der kapitalistischen Organisation der Arbeit am deutlichsten zum Vorschein kam, wies eine Herkunftsgeschichte auf, die mit dem Auftreten der Reformation in Europa verbunden war. Erst eine spezifische Art der Lebensführung hatte es nämlich ermöglicht, den Alltag so durchzurationalisieren, dass er sich den Bedürfnissen einer kontinuierlichen Geldakkumulation anpassen konnte. Der entsprechende Habitus existierte jedoch nicht von jeher, sondern war erst in der Religionspraxis bestimmter protestantischer Religionsgemeinschaften entstanden. Es galt folglich zu erklären, ob und inwiefern es zwischen der Entstehung des modernen Kapitalismus und dem religiösen Wandel der Reformation einen Zusammenhang gab.
Jede Untersuchung einer so umstrittenen Frage wie der des Ursprungs, der Entwicklungstendenz und der Bedeutung des Kapitalismus ist mit den Werturteilen konfrontiert, die in der politischen Auseinandersetzung darüber gefällt werden. Dies gilt sowohl heute als auch für Webers Zeit, in der die »soziale Frage« weit davon entfernt war, gelöst zu werden. Nach Marx war das Privateigentum ein Diebstahl, wobei er im kapitalistischen Produktionssystem die moderne Form des Sklaventums sah. Seine Gegner meinten hingegen, dass das moderne Zeitalter das Beste war, was der Menschheit je zugestoßen war. Demgegenüber durfte sich die Soziologie nicht einfach auf eine der entgegengesetzten Seiten schlagen, sondern sollte in der Lage sein, durch eine eigene Methodologie die Würde der wissenschaftlichen Objektivität zu erlangen. Ist es möglich, eine objektive Wissenschaft der Gesellschaft aufzubauen? Dürfen Wissenschaftler dabei Werturteile fällen? |14|Lässt sich eine Grenze zwischen Politik und Sozialwissenschaft ziehen? Dies sind die Fragen, die Weber dazu bewegten, eine Reihe von Studien zur Objektivität und zur Wertfreiheit der Soziologie sowie zur Bedeutung der »Wissenschaft als Beruf« zu verfassen. Dabei schlug er Lösungen vor, die nach wie vor für das Bestehen der Soziologie als Wissenschaft grundlegend sind.
Leben und Wirkung
Als Sohn des Juristen Max Weber senior (1836 –1897), der einer Kaufmannsfamilie von deutsch-englischen Textilfabrikanten entstammte, und von Helene Fallenstein (1844 –1919), die einer Familie des deutschen Bildungsbürgertums hugenottischer Herkunft angehörte, wurde Weber am 21. April 1864 in Erfurt geboren. Unter den sieben Geschwistern ist der Bruder Alfred (1868 –1958) zu erwähnen, der ebenfalls Nationalökonom und Soziologe war und zu Max’ Nachfolger in Heidelberg wurde. Nach der Übersiedlung der Familie nach Berlin, wo der Vater eine politische Laufbahn einschlug, erfolgte im Frühjahr 1882 das Abitur und im anschließenden Sommersemester das Studium der Jurisprudenz in Heidelberg mit Nationalökonomie, Geschichte und Philosophie als Nebenfächer. Auf Anregung des Vaters trat Max einer Burschenschaft, der Alemannia, bei und wurde zum Entsetzen der Mutter innerhalb von drei Semestern »dick und unverschämt«. 1883 verbrachte er ein Jahr in Straßburg, wo er seinen Wehrdienst ableistete und die Vorlesungen des Onkels, Hermann Baumgarten (1825 –1893), Professor für Geschichte, besuchte, der als Bismarckgegner und kritischer Liberaler zum Mentor des jungen Max und zur Gegenfigur des Vaters wurde. Aus dieser Zeit stammt auch Webers Verbindung mit dessen Tochter Emmy (1865 –1946).
|15|In den darauf folgenden Jahren setzte Weber sein Studium mit beispielhaftem Eifer fort, wobei er seine Gesundheit durch die Unerbittlichkeit des selbst auferlegten Arbeitsrhythmus überstrapazierte. 1889 erfolgte die Promotion magna cum laude in Handelsrecht, worauf Weber die Dissertation zu einer größeren Arbeit Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter ausbaute. 1890 erhielt er vom Verein für Socialpolitik, dem er 1888 beigetreten war, den Auftrag, die Materialien über dessen Landarbeiter-Enquête auszuwerten, und schrieb kurz darauf seine Habilitationsschrift über Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht. Trotz der vielen Verpflichtungen fand Weber auch die Zeit, um sich seinem Privatleben zu widmen. 1892 kam Marianne Schnitger (1870 –1954), eine Großnichte seines Vaters, für längere Zeit in Webers Haus nach Berlin, um ihre Ausbildung fortzusetzen. So lernten sich Max und Marianne näher kennen, verlobten sich und heirateten am 20. September 1893 in Örlinghausen. 1894 folgte der Ruf auf eine ordentliche Professur für Nationalökonomie nach Freiburg, wo Webers Antrittsrede 1895 auf große Resonanz stieß und ihn bekannt machte. 1896 wurde er schließlich als Nachfolger von Karl Knies auf den Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwirtschaft nach Heidelberg berufen.
Diese ungebrochene Serie von Erfolgen endete jedoch mit einer Krise, die als die bedeutendste in Webers Leben zu betrachten ist.Am 14. Juli 1897 kam es zu einer schweren Auseinandersetzung und zum Bruch mit dem Vater, der kurz darauf am 10. August starb. Kurz darauf traten erste Symptome einer schweren Nervenerkrankung auf. So lebte Weber, der heute als ein Klassiker der Soziologie gilt, lange Jahre als Privatier, entfernt vom universitären Alltag, und ließ sich am 1. Oktober 1903 aus gesundheitlichen Gründen vom Lehramt vollständig entpflichten. Die Erkrankung stellte die größte Wende in Webers Biografie |16|dar und barg insofern auch eine positive Entwicklungschance, als sie ihn zu einem neuen intellektuellen Horizont verhalf. So kam er in den Jahren der Genesung mehrmals auf Bildungsreisen nach Italien und anschließend im Jahr 1904 durch die USA: eine Erfahrung, die eine bedeutende Wirkung auf seine Studie über die protestantischen Sekten ausübte. 1904/05 erschien dann die erste Studie über die »Protestantische Ethik«, sodass sich die Jahre der Krise auch als die Zeit erweisen, in der Weber den disziplinären Wandel von der Nationalökonomie zur Soziologie vollzog.
Webers Wirkung ging somit nicht vornehmlich aus seiner akademischen Position hervor, sondern aus den Aktivitäten, die er in anderen gesellschaftlichen Kreisen ausübte. Diese waren von Anfang an mit seinen sozialpolitischen Interessen verbunden. So war Weber bereits 1888 dem Verein für Socialpolitik beigetreten, der 1872 von den sogenannten »Kathedersozialisten« Gustav Schmoller (1838 –1917), Adolf Wagner (1835 –1917) und Lujo Brentano (1844 –1931) gegründet worden war (Conrad: 1906; Boese: 1939; Wittrock: 1939; Lindenlaub: 1967; Plessen: 1975; Gorges: 1980). Im Austausch mit diesen Kreisen und durch die Forschungstätigkeit, die Weber für sie ausübte, konnte er einerseits seine soziologischen Erkenntnisse präzisieren und andererseits von der Qualität seiner Arbeit überzeugen. Die Auswertung der Landarbeiter-Enquête erfolgte 1892, sodass Weber im folgenden Jahr auf einer Tagung des Vereins für Sozialpolitik darüber berichten konnte. Daraufhin wurde er vom Evangelisch-sozialen Kongress beauftragt, eine zweite Enquête durchzuführen, in der die Lage der Landarbeiter vom Gesichtspunkt der Landpfarrer und nicht mehr dem der Grundbesitzer auszuwerten war. 1894 referierte Weber im Laufe einer Tagung des Evangelisch-sozialen Kongresses über die Ergebnisse der Landarbeiter-Enquête, wobei seine scharfe Kritik des Großgrundbesitzes zum Bruch |17|der linksgerichteten Christlich-Sozialen (Paul Göhre [1864 –1928], Friedrich Naumann [1860 –1919], Weber) mit den Konservativen unter Adolf Stoecker (1835 –1909) führte. Diese und ähnliche Episoden zeigen zwei Wesenszüge von Webers Persönlichkeit, die seine Wirkung auf die Zeitgenossen stets begleiteten: einerseits die außerordentliche wissenschaftliche Begabung, andererseits die Neigung zum undiplomatischen Vertreten von teils sehr radikalen Positionen, die bis zur öffentlichen Polemik reichte.
Als Weber sich nach der Jahrhundertwende auf dem Weg der Genesung befand, begann er in den Heidelberger Intellektuellenkreisen mitzuwirken. So nahm er am 28. Februar 1904 zum ersten Mal an einer Sitzung des sogenannten »Eranos-Kreises« teil, in dem er am 5. Februar 1905 über die »Protestantische Ethik« referierte (vgl. Kap. 5). Des Weiteren übernahm er nach der Rückkehr von der Reise in die USA zusammen mit Edgar Jaffé (1866 –1921) und Werner Sombart (1863 –1941) die Redaktion des Archivs für Socialwissenschaft und Socialpolitik (vormals Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik). Das Archiv wurde zum wichtigsten wissenschaftlichen Forum Webers, da er dort seine Studien zur Religionssoziologie und zur Erkenntnislehre der Sozialwissenschaft veröffentlichte. Unter Mitwirkung von Marianne, seiner Ehefrau, fand darüber hinaus seit 1910 ein Jour fixe in Webers Heidelberger Wohnhaus statt, an dem sich bedeutende Philosophen und Sozialwissenschaftler beteiligten (vgl. Kap. 5). Schließlich bemühte sich Weber um die Etablierung der Soziologie in Deutschland durch seine Beteiligung an der Gründung der Soziologischen Gesellschaft, wie die Sitzungsberichte der ersten Soziologentage bezeugen (Verhandlungen des ersten Soziologentages: 1911). Trotzdem ist zu Webers Lebzeiten seine wissenschaftliche Arbeit nicht von allen Seiten positiv aufgenommen worden. So stieß beispielsweise die »Protestantische Ethik« auf Kritik |18|und Missverständnisse, die Weber zu teils wütenden, den Tenor der wissenschaftlichen Auseinandersetzung überschreitenden Reaktionen auf seine Kritiker verleitete, wie in den »Antikritiken zur Protestantischen Ethik« zu lesen ist (Weber: 1995).
Nach dem Kriegsausbruch 1914 verhielt sich Weber zunächst zurückhaltend und widmete sich seiner Aufgabe als Reserveoffizier in der Organisation der Lazarette in Heidelberg. Seit der Entlassung aus dem Lazarettdienst im Herbst 1915 bemühte er sich mehrmals um eine politische Beraterstelle, wobei seine Kandidatur im letzten Moment immer wieder abgelehnt wurde. 1917 nahm Weber an den »Lauensteiner Tagungen« teil, bei denen er sich unter anderem mit Pazifisten wie Ernst Toller (1893 –1939) auseinandersetzte. Darauf folgten im November 1917 der öffentliche Vortrag über »Wissenschaft als Beruf« in München und ein Ruf nach Wien, wo er 1918 den Lehrstuhl für Ökonomie probeweise übernahm. Nach dem Ende des Krieges und der Räterevolution wurde Weber zum freien Mitarbeiter der Frankfurter Zeitung und nahm an den Beratungen für die Verfassung der späteren Weimarer Republik teil. Am 28. Januar 1919 hielt er einen Vortrag über »Politik als Beruf« vor revolutionären Studenten in München, der einen großen Eindruck auf die jüngere Intellektuellengeneration machte. Im Mai 1919 fuhr Weber mit der deutschen Friedensdelegation nach Versailles und übernahm Ende Juni den Lehrstuhl für Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie in München, wo er im Januar 1920 einen Konflikt mit rechtsgerichteten Studenten hatte. Dieser brach aus, als sich Weber für die Hinrichtung des Grafen Arco aussprach, der Kurt Eisner, den revolutionären Ministerpräsidenten der Räterepublik in Bayern, ermordet hatte (Grau: 2001; MWG I/16, 273 – 278).
Nach Webers Tod am 14. Juni 1920 in München nahm seine Bedeutung, wie allerdings die aller Intellektuellen |19|der Vorkriegszeit, allmählich ab. Nur der Einsatz von Marianne Weber bewirkte, dass er in den 1920er-Jahren nicht vollständig vergessen wurde. So erschienen unter ihrer Leitung in rascher Reihenfolge das »posthume Hauptwerk« Wirtschaft und Gesellschaft, sämtliche Aufsatzsammlungen sowie die von ihr verfasste Biografie (vgl. MWL). Das mangelnde Interesse an Webers »verstehender Soziologie« hing teils damit zusammen, dass das Fach in der Nachkriegszeit stark in die politische Alltagspolemik hineingezogen wurde und letztendlich vor dem Zeitgeist kapitulierte, der nach »Authentizität« und »Orientierung an der Wirklichkeit« strebte (vgl. Freyer: 1930). Mit wenigen Ausnahmen, etwa Karl Mannheim (Mannheim: 1927; 1929), konnten die Soziologen der Weimarer Zeit mit Webers »idealtypischer Begriffsbildung« nichts mehr anfangen. An Weber ließ sich eher anlässlich seines Todestages erinnern als im Wissenschaftsbetrieb der Universitäten, wobei er als »Denker und Politiker« im Vordergrund stand und sein soziologisches Werk nur selten hervorgehoben wurde. In Anbetracht des Scheiterns der Weimarer Republik blickte Karl Jaspers noch 1932 auf »den Politiker« Weber zurück. Als bedeutender Vertreter der wilhelminischen Intelligenz hätte er es verdient gehabt, so Jaspers, zum politischen Entscheidungsträger zu werden, sei aber daran gehindert worden. Dieser Umstand machte ihn für Jaspers zur Symbolfigur des Demokratieverfalls, aus dem sich nun die Diktatur speiste. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten geriet Weber schließlich in Vergessenheit, und dies wäre wahrscheinlich so geblieben, wenn die soziologische Fachwelt auf der anderen Seite des Atlantiks nicht auf ihn aufmerksam geworden wäre.
In den USA wie in Europa kämpfte die Soziologie noch in den 1930er-Jahren um ihre Anerkennung als Wissenschaft, die nicht nur bestimmte Bereiche der empirischen Forschung für sich beansprucht, sondern auch über |20|einen eigenen theoretischen Status verfügt. Aus diesem Grund blickten damals die amerikanischen Soziologen nach Europa, um die theoretische Arbeit ihrer Kollegen zu verfolgen. Unter ihnen war auch Talcott Parsons (1902 – 1979), der auf Bildungsreisen in Europa die Werke der wichtigsten Soziologen diesseits des Atlantiks studierte. Parsons’ zentrales Anliegen war, zu überprüfen, ob unter Berücksichtigung der Werke »einiger bedeutender europäischer Autoren« nachzuweisen war, dass eine übergreifende soziale Theorie besteht (Parsons: 1937).
Parsons’ Untersuchung diente natürlich keinem rein historischen Interesse, sondern der Herausbildung eines eigenen Theorieentwurfs, der auf der Idee einer »Konvergenz« von positivistischer (Durkheim) und idealistischer Tradition (Weber) der europäischen Soziologie beruht. Er entwickelte seine »Theorie sozialen Handelns«, für die Webers Werk die bedeutsamste theoretische Stütze war. Oft ist die Kritik erhoben worden, dass damit Webers Theorie des sozialen Handelns »voluntaristisch« uminterpretiert wird. Wie immer man zu Parsons’ Weber-Interpretation stehen mag, ihre Wirkung auf Webers Rezeption ist enorm gewesen. Denn erst dadurch wurde Weber zum Klassiker des soziologischen Studienkanons an amerikanischen Universitäten und konnte auf diesem Umweg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa »neu eingeführt« werden.
Die grundlegende Quelle für die Untersuchung von Webers Biografie bleibt nach wie vor das Buch, das seine Ehefrau kurz nach seinem Tod über ihn verfasste und in dem sie sich sowohl auf persönliche Erinnerungen als auch auf die Einsicht in seine Briefe stützte (vgl. MWL). Damit beabsichtigte Marianne Weber, ihren Mann der Nachwelt vorzustellen, der aufgrund seiner Nervenerkrankung der Öffentlichkeit so lange ferngeblieben und in dem Moment, als er gerade wieder zu vollen Kräften gekommen war, starb. Durch ihren außergewöhnlichen Einsatz |21|schaffte es Marianne in wenigen Jahren, das teils nachgelassene Werk ihres Mannes sowie die Biografie zu veröffentlichen, und leistete damit einen ausschlaggebenden Beitrag zu Webers Wirkungsgeschichte. Dabei prägte sie jedoch so manchen Text und vor allem das Lebensbild nach ihrem Ermessen. Sie legte besonderen Wert darauf, die Gestalt Webers als »Denker und Forscher« in den Vordergrund zu rücken, wobei sie die Dunkelzonen des familiären Lebens bewusst verschwieg. Somit ist Mariannes Biografie von Max Weber als eine Stilisierung zu betrachten, die sich bezüglich einiger Bereiche seines Lebens als bewusst mangelhaft erweist. Inzwischen sind diese Fragen in der Sekundärliteratur allerdings so reichlich behandelt worden, dass sie Auskunft über alle von Marianne »verschwiegenen Aspekte« von Max Webers Leben gibt (vgl. u. a. Radkau: 2005).
Zusammenfassung
Die Unterschiede im Umgang mit Arbeit und Freizeit, Verantwortungsgefühl und Geld, die sich selbst innerhalb Europas beobachten lassen, hängen mit dem soziokulturellen Hintergrund der Länder und Völker zusammen, der den Gegenstand der Soziologie ausmacht. Historisch betrachtet stellt sich damit auch die Frage nach der Besonderheit des modernen Abendlandes sowie der modernen kapitalistischen Produktionsform. Solche Fragen anzugehen, machte Weber zur Aufgabe seiner »verstehenden Soziologie«, von deren Methode er verlangte, dass sie nicht Meinungen, sondern objektive Aussagen über die soziale Wirklichkeit liefere. Durch eine schwere Nervenerkrankung wurde es ihm jedoch unmöglich, diesem Forschungsprogramm im Rahmen des universitären Alltagsbetriebs nachzugehen. Seine Wirkung ging somit eher von den außeruniversitären Kreisen aus, denen er durch seine Tätigkeit für sozialpolitische Vereine, Zeitschriften und wissenschaftliche Gesellschaften verbunden war.
|22|1 Weber als Experte und Politikberater
Qualifikationsarbeiten
Webers Anfänge als Wissenschaftler sind einerseits durch seine Qualifikationsarbeiten und andererseits durch seine sozialpolitischen Interessen geprägt. Unabhängig von der inhaltlichen Einschätzung dieser Beiträge liegt ihre Bedeutung allein schon in der Rolle, die sie für seine intellektuelle Entwicklung spielten. Daran lässt sich nämlich der Weg verfolgen, den Weber von der historischen Rechtswissenschaft zur Nationalökonomie und schließlich zur Soziologie zurücklegte. 1889 schrieb Weber bei dem Handelsrechtler Levin Goldschmidt (1829 –1897) seine Dissertation Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter (SWG 312 – 443). Die Art, nach der Weber seine Studie aufbaute, zeigt eine frühe Neigung zur komparativen Arbeit, die bei seinen Lehrern Bedenken hervorrief. Denn damit spezialisierte er sich sowohl in römischem als auch in deutschem Recht und geriet zwischen die Fronten der innerhalb der Rechtswissenschaft verfeindeten Lager der Germanisten und Romanisten. Weber wurde jedoch durch sein Erkenntnisinteresse angetrieben. Er wollte die historischen Entwicklungsstufen rekonstruieren, die zur Entstehung der modernen Wirtschaftsformen und der entsprechenden Rechtsinstitute führten (vgl. Kaesler: 1995, 40 f.).
Bereits 1887 hatte Weber ein Referat über »Die Handelsgesellschaften nach mittelalterlichen italienischen und spanischen Quellen« in Goldschmidts Seminar gehalten und arbeitete 1888/89 seine Studie »Zur Geschichte der |23|Handelsgesellschaften im Mittelalter« vollständig aus. Daraus wurde das dritte Kapitel gesondert abgedruckt und diente als Grundlage für die Promotion im Sommer 1889. In der Dissertation befasste sich Weber inhaltlich mit der Entstehung der kapitalistischen Handelsgesellschaften im späten Mittelalter, vor allem bezüglich der Loslösung der ökonomischen Unternehmung von der Familiengemeinschaft. Rechtsdogmatisch konzentrierte er sich auf die Frage, ob den germanischen oder den römisch-rechtlichen Vertragselementen eine größere Bedeutung für die Entwicklung der mittelalterlichen Handelsgesellschaften zuzuschreiben war. Seine These lautete, dass das individualistische römische Recht hinter bestimmten germanischrechtlichen Instituten zurücktrat, die für die Entwicklung des Kapitalismus ausschlaggebend waren.
Gegenstände der Weberschen Untersuchung waren die proto-modernen Handels- und Kommanditgesellschaften und die Herausbildung ihres Vermögensrechts, wobei er den wesentlichen Unterschied zwischen der societas des römischen Rechts und den modernen Handelsinstitutionen anhand der Tatsache festlegte, dass es im ersten Fall an einem Sondervermögen fehlte. Die Solidarhaftung und das Bestehen des Sondervermögens sind als die wesentlichen Indikatoren für die Entstehung moderner Unternehmen als selbstständige Subjekte und damit als eine der wichtigsten Voraussetzungen moderner kapitalistischer Wirtschaft zu sehen. Wo das römische Recht nur das Individualvermögen kannte, bildete die mittelalterliche Erwerbsgemeinschaft die Grundlage für die moderne Solidarhaftung gegenüber einem gemeinsamen Vermögen. Diese rechtshistorische Entwicklung verfolgte Weber an den Beispielen der seerechtlichen Societas maris in Pisa sowie der Societas terrae im mittelalterlichen Florenz. Dabei richtete er seine Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Rechtsformen: die Handelsgesellschaft, das heißt ein Geschäft mehrerer Personen mit Solidarhaftung gegenüber |24|dem Geschäftsvermögen, und die Kommanditgesellschaft, in der eine Person das Geschäft betreibt und die anderen sich nur mit ihrem Kapital daran beteiligen.
Sobald seine Erstlingsschrift abgeschlossen war, begann Weber mit der Vorbereitung der Habilitationsschrift, zu der ihn einer seiner »liebenswürdigsten Lehrer, der bekannte Agrarhistoriker August Meitzen« (1822 –1910), ermutigte (MWL 121 f.). Daraus ging Die römische Agrargeschichte (MWG I/2) hervor, die 1891 erschien und mit der Weber im Frühjahr 1892 in Berlin für römisches, deutsches und Handelsrecht habilitierte. Mit der Römischen Agrargeschichte lieferte der 27-jährige Weber eine Forschungsleistung, die noch heute als hochwertig eingestuft wird. Die Studie war jedoch sehr technisch und wendete sich an eine kleine Gelehrtengemeinschaft, sodass sie nur ein geringes Echo in der Fachwelt erfuhr. Der Fokus der Arbeit richtete sich auf die Agrarfrage, was mit unterschiedlichen biografischen und zeitgeschichtlichen Faktoren zusammenhängt. So ist zu erwähnen, dass Webers Regiment am 4. April 1887 von Straßburg nach Ostpreußen verlegt wurde, weshalb er seine zweite Offiziersübung in Posen abhielt und mit der Lage der dort ansässigen Landarbeiter in Berührung kam. Darüber hinaus war die Agrarfrage in Deutschland zu einem politischen Thema geworden, da es mit den Reformen des Bauern- und Bodenrechtes zu einer liberal-individualistischen Durchbrechung der alten Agrarverfassung kam. Vor diesem Hintergrund entwickelte Weber seine agrarpolitische Fragestellung, die er im Rahmen seiner Studie zur römischen Agrargeschichte zu verarbeiten versuchte.
In der Römischen Agrargeschichte ging es Weber hauptsächlich um die Stellung der unterschiedlichen römischen Bodenkategorien im öffentlichen und im Privatrecht. Dahinter steckte jedoch sein Erkenntnisinteresse sowohl den Verlauf der historischen Entwicklung dieser rechtlichen Institutionen als auch deren Bedeutung in der |25|Entstehung und im Verfall der römischen Weltherrschaft betreffend. Die Anfänge dieser Entwicklung sah Weber in einem gemeinwirtschaftlich gebundenen Agrarwesen ohne Individualeigentum an Ackerland (Flurgemeinschaft), das sich allmählich zerstückelte und vom Großgrundbesitz einverleibt wurde. Dadurch entstand schließlich eine Art kapitalistische Grundherrschaft, die sich auf die Ausbeutung von kasernierten Sklaven stützte und trotzdem stark saisonbedingt und nicht produktiv genug war. Dies führte dazu, dass sie durch die Ansiedlung von Kolonen integriert wurde, die sich mit der Zeit zu schollengebundenen Bauern entwickelten, sodass ihre Lebensbedingungen bereits frühmittelalterliche Verhältnisse einleiteten.
Methodologisch konzentrierte sich Weber auf den Zusammenhang zwischen den Rechtsstrukturen und den wirtschaftlichen sowie sozialen Verhältnissen und zielte darauf ab, ihre Entwicklungsstrukturen bis in die späte Kaiserzeit hinein zu erfassen. Dabei bemühte er sich zu zeigen, wodurch die Entwicklung des Großgrundbesitzes begünstigt wurde und welche Rolle der römische Staat dabei spielte. Besondere Aufmerksamkeit galt der Fortentwicklung der Landgüter zu förmlichen »Grundherrschaften«, die die soziale und politische Struktur des römischen Staatswesens untergruben. Der Übergang zum Kaiserreich in Rom und seine tendenzielle Befriedung verursachten einen Rückgang des Sklavennachschubs, der einen Zuwachs von Kleinpächtern mit sich brachte. Dabei tendierte der Staat dazu, die obrigkeitlichen und grundherrlichen Gewaltverhältnisse des Gutsherrn gegenüber den Sklaven und Kolonen rechtlich zu sichern, wodurch das städtische Gewebe des römischen Reiches allmählich aufgelöst wurde. Die wirtschaftliche Folge davon war, dass die Landgüter sich in einer substanziellen Autarkie einschlossen, die zu geringerem Einfluss des Staatswesens führte und schließlich den Übergang zu frühmittelalterlichen Strukturen einleitete.
|26|Die Agrarverhältnisse im Altertum
Auf die Frage der Agrarverhältnisse im Altertum kam Weber noch in späteren Beiträgen zurück, wie etwa im Artikel »Agrarverhältnisse im Altertum« für das Handwörterbuch der Staatswissenschaften