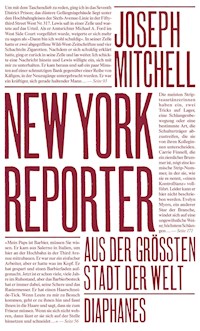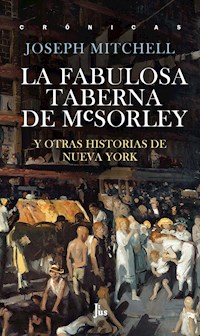16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein Besuch auf einer Schildkrötenfarm, die einen Großteil des nordamerikanischen Bedarfs an Schildkrötenfleisch deckt; das Porträt einer seit 1854 bestehenden New Yorker Kneipe; schwindelfreie Indianer im Stahlhochbau; findige Nichtstuer, hochbegabte Kinder, Muschelfischer und bärtige Damen; eine Schilderung der Institution »Beefsteak«, einem Begängnis, bei dem es ums Vertilgen ungeheurer Mengen Fleisch geht; der fundamentalistische Straßenprediger, der das Telefon für seine Zwecke entdeckt hat, oder Captain Charleys Museum für intelligente Menschen: Joseph Mitchells Geschichten, Porträts, Reportagen und Erzählungen sind längst Klassiker amerikanischer Literatur.
Mitchell ist ein begnadeter Zuhörer, der vor allem die von ihm Porträtierten selbst zu Wort kommen lässt. In seinen »teilnehmenden Beobachtungen« verbindet sich Sachlichkeit mit literarischer Anschaulichkeit der Beschreibung, subjektivem Humor und scharfer Beobachtungsgabe. Immer wieder zieht es ihn zu den Käuzen, Exoten und Exzentrikern seiner Stadt. Mit Hingabe widmet er sich aussterbenden Milieus, Phänomenen, die alsbald der Vergangenheit angehören werden, und immer wieder dem pulsierenden Leben der Hafenstadt New York.
Joseph Mitchells legendäre Reportagen gehören zur Geschichte New Yorks, sie lesen sich wie Bohrungen in einer heute verschütteteten Zeitschicht jener Stadt, die mehr als alle anderen die Moderne verkörpert. Die hier versammelten Geschichten sind in den Jahren 1938 bis 1955 im Magazin New Yorker erschienen. Sie eröffnen dem Leser ungeahnte, beglückende literarische Entdeckungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Ähnliche
McSorley’s Wonderful Saloon
Joseph Mitchell
McSorley’s Wonderful Saloon
Joseph Mitchell
New Yorker Geschichten
Aus dem amerikanischen Englisch von Sven Koch und Andrea Stumpf
diaphanes
Titel der englischen Ausgabe:McSorley’s Wonderful Saloon © 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1949, 1955 by Joseph Mitchell
1. Auflage © diaphanes, Zürich 2011 / 2021www.diaphanes.net Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-0358-0429-4
Umschlag und Layout: Bonbon, Zürich Satz: 2edit, Zürich Druck: Steinmeier, Deiningen
.
Inhalt
1
Old House at Home
Mazie
Mit einer Kuh am Kopf getroffen
Professor Möwe
Beduselt und besudelt
Lady Olga
Ein Abend mit einem hochbegabten Kind
Ein Sportsfreund
Die Höhlenbewohner
Der Zigeunerkönig
Die Zigeunerinnen
Der Taubstummen-Club
Santa Claus Smith
Der Fluchgegner
Nachruf auf eine Spelunke
Houdinis Picknick
Mohawks im Stahlbau
Essen, bis Sie platzen – für nur fünf Dollar
Ein Haufen Muscheln
Genau wie Affenhoden
2
Auf Wiedersehen, Shirley Temple
Trocken
Die freundliche alte Blondine
Ich wurde nicht schlau daraus
3
Der Untergang des Faschismus im Black Ankle County
Schuld ist Mamma
Uncle Dockery und der eigenwillige Stier
&
Über den Autor
1
OLD HOUSE AT HOME
Das McSorley’s befindet sich im Erdgeschoss eines roten Backsteingebäudes in der Seventh Street Nr. 15, gleich am Cooper Square, wo die Bowery endet. Es wurde 1854 eröffnet und ist damit die älteste Kneipe New Yorks. In den achtundachtzig Jahren seines Bestehens hat es nur dreimal den Besitzer gewechselt – auf den ersten, einen irischen Einwanderer, folgte sein Sohn, dann ein pensionierter Polizist und schließlich dessen Tochter, und allesamt standen sie jeglichen Änderungen ablehnend gegenüber. Heute ist das McSorley’s zwar ans Stromnetz angeschlossen, aber der Tresen wird noch immer nur von zwei Gaslampen beleuchtet, die flackernde Schatten auf die niedrige, mit Spinnweben überzogene Decke werfen, kaum tritt jemand von der Straße herein. Es gibt keine Registrierkasse. Münzen werden in Suppenschalen geworfen – eine für Fünfcentstücke, eine für Zehncentstücke, eine für Vierteldollar- und eine für Halbdollarmünzen –, Scheine wandern in eine Geldkassette aus Rosenholz. Es ist eine ruhige Kneipe; der Barmann macht keinen unnötigen Handgriff, die Gäste halten sich an ihren Ale-Gläsern fest und die drei Uhren an den Wänden können sich schon seit Jahren nicht auf eine gemeinsame Zeit einigen. Das Publikum ist buntgemischt. Mechaniker aus den vielen Werkstätten in der Nachbarschaft gehören ebenso dazu wie Verkäufer aus den Gastronomiebedarfsgeschäften am Cooper Square, Lastwagenfahrer von Wanamaker, Assistenzärzte aus dem Bellevue, Studenten der Cooper Union und Verkäufer aus den zahlreichen Antiquariaten nördlich des Astor Place. Das Rückgrat des Kundenstamms bildet allerdings ein rasch kleiner werdendes Häuflein mürrischer alter Männer vornehmlich irischer Herkunft, die schon seit ihrer Jugend zum Trinken herkommen und für die das McSorley’s inzwischen wohl das eigentliche Zuhause ist. Manche leben mutterseelenallein und von winzigen Renten in einem der Hotels auf der Bowery und verbringen praktisch jede wache Minute hier. Einige wenige dieser alten Kämpen erinnern sich sogar noch an den ersten Besitzer, John McSorley, der im Jahr 1910 im Alter von siebenundachtzig Jahren starb. Diese Alten versammeln sich gerne auf wackeligen Lehnstühlen um die einzige Heizquelle, einen Bollerofen, kauen an ihren Pfeifen und reden von Old John, wie sie ihn nennen.
Old John war ein wenig schrullig. Normalerweise leutseligen Wesens, wurde er gelegentlich von unerklärlicher Verdrießlichkeit erfasst und gab dann keine Antwort mehr, wenn man ihn ansprach. Schon als junger Mann gingen ihm die Haare aus, und noch vor dem vierzigsten Lebensjahr trug er zottelige, altväterliche Koteletten. Doch die vielen Fotografien von ihm lassen auch erkennen, dass er eine gewisse natürliche Würde besaß. Vorbild für seine Kneipe war eine Schankwirtschaft, die er noch aus seiner irischen Heimatstadt Omagh im County Tyrone kannte, und so nannte er sie anfangs Old House at Home. Als dann aber um 1908 herum der Wind das alte Schild abriss, gab er ein neues mit dem Namen McSorley’s Old Ale House in Auftrag. Offiziell heißt die Kneipe bis heute so, die Gäste nennen sie allerdings seit jeher nur McSorley’s. Old John hielt es für ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Mann in Gegenwart einer Frau in Ruhe sein Ale trinken kann, und obwohl die Kneipe über ein schönes Hinterzimmer verfügt, konnte man lange Zeit auf einem Schild an der Eingangstür lesen: »Achtung. Kein Hinterzimmer für Damen.« Der einzige weibliche Gast, dem jemals bereitwillig Zutritt gewährt worden war, war eine verwirrte, alte Hausiererin namens Mother Fresh-Roasted, deren Mann, wie sie behauptete, während des spanisch-amerikanischen Kriegs am Biss einer Eidechse gestorben war. Sie selbst zog jahrelang auf der Lower East Side von Kneipe zu Kneipe und verkaufte Erdnüsse, die sie in ihrer Schürze herumtrug. Wenn es warm war, verkaufte Old John ihr ein Ale, und sie schätzte ihn dafür so sehr, dass sie ihm eine kleine amerikanische Flagge stickte und an einem vierten Juli überreichte; er ließ sie rahmen und hängte sie über dem messinggefassten Zapfhahn an die Wand, wo sie bis zum heutigen Tage zu sehen ist. Sobald aber eine andere Frau die Kneipe betrat, eilte Old John herbei, verbeugte sich und sagte: »Madam, es tut mir leid, aber wir schenken hier nicht an Frauen aus.« Sollte die Frau darauf bestehen, zu bleiben, nahm Old John sie am Ellbogen und geleitete sie zur Tür, wo er sagte: »Bitte zwingen Sie mich zu nichts, Madam. Beeilen Sie sich lieber und verlassen Sie mein Lokal oder ich muss leider vergessen, dass Sie eine Dame sind.« So wird das bis zum heutigen Tag gehandhabt, in nahezu demselben Wortlaut.
Seinerzeit versorgte Old John die irischen und deutschen Arbeiter – Tischler, Gerber, Maurer, Schlachter, Fuhrleute und Bierbrauer –, welche die Gegend um die Seventh Street bevölkerten, und schenkte Ale zu fünf Cent je Zinnkrug aus. Dazu gab es ein kostenloses Mittagessen, das ausnahmslos aus Salzcrackern, rohen Zwiebeln und Käse bestand; die heutigen Gäste beklagen sich gerne, dass offenbar noch immer etwas von dem Käse da sei, den Old John schon am Eröffnungsabend im Jahr 1854 angeboten hatte. Neben dem kostenlosen Mittagessen hielt Old John stets einen großen Topf voll Tabak und auf einem Regal einige Ton- und Maiskolbenpfeifen vorrätig, denn der Erwerb eines Ale berechtigte dazu, eine Pfeife aufs Haus zu rauchen; nach wie vor stehen auf dem Regal ein paar von diesen Gemeinschaftspfeifen. Da Old John gut wirtschaftete, konnte er zehn Jahre nach Eröffnung seiner Kneipe das ganze Haus erwerben; auf den fünf Stockwerken leben acht Familien. Da er Banken nicht über den Weg traute, verwahrte er sein Barvermögen in einem gusseisernen Safe, der noch immer im Hinterzimmer steht. Allerdings hängt die Tür mittlerweile schief in den Angeln, und bis auf einen Stapel abgelaufener Lizenzen und einige Erbstücke wie Old Johns Rasiermesser ist er leer. McSorley selbst wohnte mit seiner Familie in der Wohnung über der Kneipe und stand jeden Morgen um fünf Uhr auf, um bei Wind und Wetter einen langen Spaziergang zu unternehmen. Um sieben schloss er dann die Kneipe auf, fegte sie aus und streute Sägemehl auf den Boden. Solange er die Kraft zum Führen eines Sulkys hatte, hielt er in einem Stall um die Ecke am St. Mark’s Place ein Pferd. Da er wie viele Pferdeliebhaber überzeugt war, dass Pferde nachts Gesellschaft brauchten, stellte er auch noch eine Ziege in den Stall. Während der nachmittäglichen Flaute führte ein Pferdeknecht das Pferd zu einem Holzpflock vor der Kneipe, und Old John trat in der Schürze zum Bordstein und striegelte das Tier. Sollte ein Gast einen Wunsch haben, klopfte er einfach an die Scheibe und Old John ließ die Bürste fallen, ging hinein, zapfte ein Ale und kehrte sogleich wieder zu seinem Pferd zurück. Sonntags ging er gern zu den Trabrennen an einer der Ausfallstraßen in Uptown.
Von seinem zwanzigsten bis zu seinem fünfundfünfzigsten Lebensjahr trank Old John regelmäßig. Danach nahm er bis zu seinem Tod keinen Tropfen mehr zu sich, da er, wie er sagte, seinen Teil gehabt habe. Außer während ein paar experimentierfreudiger Monate in den Jahren 1905 und 1906 wurde im McSorley’s nichts Hochprozentiges ausgeschenkt. Old John behauptete, es habe noch nie einen Menschen gegeben, der etwas Stärkeres braucht als einen Krug Ale, aufgewärmt auf dem Ofen. Dagegen hatte er einen gesegneten Appetit. Üblicherweise grillte er sich, kurz bevor er für die Nacht schloss, in dem Kamin des Hinterzimmers ein T-Bone-Steak von drei Pfund, das er auf eine Kohleschaufel legte und über eine Schicht Eichenkohle hielt. Gerne steckte er auch eine ganze Zwiebel in ein ausgehöhltes Stangenweißbrot und aß sie wie einen Apfel. Zwiebeln mochte er überhaupt gerne, und je schärfer sie waren, desto besser. Daher erklärte er auch zum Wahlspruch seiner Kneipe das Motto »Gutes Ale, rohe Zwiebeln und keine Frauen«. Im Winter lud er etwa einmal im Monat zu einem Beefsteak-Essen ins Hinterzimmer ein und in späteren Jahren war er Präsident einer Vereinigung von Schlemmern, die sich der »Honorable John McSorley Pickle, Beefsteak, Baseball Nine, and Chowder Club« nannte und an einem Picknickplatz auf der North Brother Island im East River regelmäßig New England Clambakes veranstaltete, bei denen auf heißen Steinen Muscheln und Meeresfrüchte gebacken wurden. Von diesen Ausflügen zeugen einige Fotografien an den Wänden der Kneipe. Auf den meisten sieht man Clubmitglieder um Ale-Fässchen herum sitzen, und alle außer dem Präsidenten grinsen betrunken und mit schiefem Mund und stierem Blick in die Kamera. Mit seinem Brummbass stimmte Old John gerne in einen Chor von Trunkenbolden ein. Seine Lieblings-Songs waren: »Muldoon, the Solid Man«, »Swim Out, You’re Over Your Head«, »Maggie Murphy’s Home« und »Since the Soup House Moved Away«. Sie stammen alle von Harrigan und Hart, die man damals »die Gilbert und Sullivans der USA« nannte. Er bewunderte sie sehr und war über die Maßen erfreut, als sie 1882 eine ihrer Vorstellungen in seine Kneipe verlegten; sie hieß »McSorley’s Inflation«.
Old John war gewiss niemand, der sich in den Vordergrund drängte, aber Berühmtheiten kannte er jede Menge. Einer seiner engsten Freunde war Peter Cooper, Präsident der North American Telegraph Company und Gründer der Cooper Union, die einen halben Block westlich vom McSorley’s ihren Sitz hat. In seinen letzten Lebensjahren verbrachte Mr. Cooper so viele Nachmittage im Hinterzimmer, wo er mit den Arbeitern philosophierte, dass er einen eigenen, mit einem aufblasbaren Gummikissen ausgestatteten Stuhl bekam. (Den Stuhl gibt es noch immer und nach Mr. Coopers Tod 1883 breitete man einige Jahre lang an seinem Todestag, dem vierten April, ein schwarzes Tuch darüber.) Wie andere Stammgäste hatte auch Mr. Cooper einen eigenen Zinnkrug, in den mit einem Bar-Eispickel sein Name eingraviert war. Er stiftete der Kneipe ein lebensgroßes Porträt von sich, das über dem Kamin im Hinterzimmer hängt. Dort befindet es sich auch ganz zu Recht, denn seit der Prohibition ist McSorley’s der allgemeine Treffpunkt für die Studenten der Cooper Union. Gelegentlich sieht man einen von ihnen mit bewegter Miene vor dem Porträt stehen und das Glas auf Mr. Cooper heben.
Old John war ein leidenschaftlicher Sammler von Erinnerungsstücken. So bewahrte er jahrelang die Gabelbeine der zu Thanksgiving und Weihnachten verspeisten Truthähne auf und fädelte sie auf die Verbindungsstange zwischen den beiden Gaslampen über dem Tresen; die verstaubten Knochen sind immer das Erste, wonach sich ein neuer Gast erkundigt. Vor nicht allzu langer Zeit brachte ein solcher Neuling einen der Barmänner mit der Bemerkung gegen sich auf, dass der »alte Knabe ja womöglich an Voodoo glaubte«. Old John schmückte die Zwischenwand zwischen Schankraum und Hinterzimmer mit Menükarten, Autogrammen, Seesternen, Theaterzetteln, Wahlplakaten und abgetretenen Hufeisen, die von verschiedenen Renn- und Brauereipferden stammten. Über dem Eingang zum Hinterzimmer befestigte er einen Knüttel und eine Hinweistafel: »BENIMM DICH ODER ICH VERTRIMM DICH.« Eine Wand des Schankraums schmückte er mit Porträts von Pferden, Dampfern, Tammany-Bossen, Jockeys, Schauspielern, Sängern und Staatsmännern. Um 1902 herum nagelte er einen schweren Eichenrahmen mit vortrefflichen Porträts von Abraham Lincoln, James Garfield und William McKinley an die Wand und befestigte daran ein Messingschildchen mit der Aufschrift: »DIESE DREI GUTEN MÄNNER HABEN SIE HINTERRÜCKS ERMORDET, DIE FEIGEN HUNDE.« Auf derselben Wand prangen gerahmte Titelblätter alter Zeitungen; auf dem Titelblatt der Londoner Times vom 22. Juni 1815 steht rechts unten im Eck eine kurze Meldung zum Beginn der Schlacht von Waterloo, auf dem des New Yorker Herald vom 15. April 1865 ist ein einspaltiger Bericht über das Attentat auf Lincoln zu lesen. Eine andere Wand ist über und über mit Lithographien und Stahlstichen bedeckt. Einer zeigt Garfield auf seinem Totenbett. Ein anderer trägt die Überschrift »Der große Kampf«, ausgetragen mit bloßen Fäusten zwischen Tom Hyer und Yankee Sullivan in Still Pond Heights, Maryland, im Jahre 1849. Hyer bezwang seinen Gegner nach sechzehn Runden und erhielt 10.000 Dollar Siegprämie. Die Ringrichter trugen Zylinder. Auf dem Schildchen eines anderen Stichs steht: »Die Rettung von Colonel Thomas J. Kelly und Captain Timothy Deacy durch Mitglieder der Irish Revolutionary Brotherhood vor der englischen Regierung in Manchester, 18. September 1867.« Auf derselben Wand findet sich auch die Emanzipationserklärung und – natürlich! – ein Faksimile von Lincolns Schanklizenz. Ein Stich von Washington und seinen Generälen hängt neben dem einer Zusammenkunft des irischen Parlaments. Irgendwann hatte Old John jedes freie Fleckchen zwischen Wandtäfelung und Decke mit Bildern und Andenken behängt. Heute sind sie zwar mit Spinnweben überzogen, aber nach wie vor in gutem Zustand. Neue Gäste verbringen Stunden damit, sie auf Stühlen stehend zu studieren.
Old John zog sich zwar erst wenige Jahre vor seinem Tod ganz aus dem Geschäft zurück, allerdings hatte er schon etwa 1890 seinem Sohn William den Ausschank übertragen, um nicht mehr tagein, tagaus hinter dem Tresen stehen zu müssen. Bill McSorley gehörte zu den Menschen, die sich kein bisschen darum scherten, was andere sagten. Er stand seinem Vater in Verdrießlichkeit in nichts nach, hatte aber wenig von dessen Leutseligkeit geerbt. War schon der Vater kein Säufer gewesen, verhielt sich der Sohn geradezu wie ein Abstinenzler: Außer Leitungswasser und Tee trank er nichts und brüstete sich auch gerne damit. Nur bei Schnupftabak gestattete er sich eine kleine Schwäche. Wegen seiner überaus gesetzten Art pflegten ihn einige Gäste, noch bevor er die Dreißig erreicht hatte, Old Bill zu nennen. Er verehrte seinen Vater, wobei erst bei dessen Tod zutage trat, wie tief dieses Gefühl reichte. Nach dem Begräbnis verriegelte Bill die Kneipe, ging nach oben in die Wohnung, verbarrikadierte die Fensterläden und kam fast eine Woche nicht mehr heraus. Hohlwangig und schweigend stieg er am folgenden Sonntagmorgen mit einem Hammer und einem Schraubenzieher die Treppe hinunter und verbrachte den ganzen Tag damit, die Bilder und Andenken seines Vaters Stück für Stück zu befestigen; bis dahin hatten sie nur lose an Drähten an der Wand gehangen und waren von den Gästen ständig abgenommen worden. Später beauftragte er einen Kunstlehrer von der Cooper Union damit, ein kleinformatiges Porträt Old Johns nach einer Fotografie zu malen. Bill hängte das Bild hinter dem Tresen auf und ließ fortan darüber ein elektrisches Lämpchen brennen. Dieses ewige Licht leuchtet dort bis zum heutigen Tag.
Sein Leben lang bestand Bills größte Sorge darin, McSorley’s genau so zu erhalten, wie es zu seines Vaters Zeiten gewesen war. Es schien ihm geradezu körperliche Schmerzen zu bereiten, wenn etwas geändert oder repariert werden musste. Zwanzig Jahre lang hing der Tresen im Schankraum durch. Wiederholt warnte ihn ein Tischler, dass er eines Tages zusammenkrachen würde, doch erst 1933 beauftragte Bill ihn, den Tresen abzustützen. Als der Tischler sich an die Arbeit machte, verzog sich Bill an einen Tisch ins Hinterzimmer, wo er den Kopf in den Händen vergrub, und noch Tage später konnte er nichts essen, so sehr hatte ihn die Sache aufgeregt. Im selben Jahr begannen sich Farbplacken von der von Tabakrauch und Spinnweben überzogenen Decke zu lösen und hinabzusegeln. Als Gäste sich beschwerten, weil sie Angst hatten, sie könnten an der Farbe, die in ihrem Ale schwamm, ersticken, ließ er murrend die Decke streichen. 1925 musste er zu Steingutkrügen wechseln, weil die meisten Zinnkrüge von Souvenirjägern entwendet worden waren. Etwas später im Jahr wurde im Hinterzimmer ein Münztelefon installiert, das er selbst freilich nie benutzte. Weitere größere Veränderungen ließ er nicht zu. Er füllte höchstens die Lücken auf, wenn von Zeit zu Zeit eines der Bilder, die noch sein Vater aufgehängt hatte, von der Wand fiel und das Glas zerbrach. Zu seinen Beiträgen gehören die Porträts sämtlicher Präsidentengattinnen bis zur ersten Mrs. Woodrow Wilson, ein Plakat von Barney Oldfield in einem roten Rennwagen und ein Gedicht namens »Der Mann hinter der Bar«. Er konnte das Gedicht auswendig, und die letzten beiden Verse mochte er besonders gern:
Wenn Petrus ihn einst kommen sieht, ruft er laut »Macht auf das Tor!« Weiß er doch, dass er schon in der Hölle war – als Mann hinter der Bar.
Bill war in geschäftlichen Dingen ein wandelnder Anachronismus und hasste alles, was mit Banken, Registrierkassen, Buchhaltung und Vertretern zu tun hatte. Wenn es voll wurde in der Kneipe, schloss er früher und sagte: »Die vielen Leute machen mich ganz kirre.« Brauereivertreter, von denen er sein Ale bezog, versuchten ihn von den Vorteilen eines Bankkontos zu überzeugen, aber beharrlich beglich er seine Ale-Rechnungen in bar, am liebsten mit Münzen. Bevor er dem Fahrer das Geld in einer Papiertüte überreichte, zählte er es vier, fünf Mal. Bill war ein guter Barmann. Er kannte sich mit Ale aus, wusste, wie man es zapft und lagert, und seine Zapfhähne waren stets blitzblank poliert. Bei wärmerem Wetter war er dazu übergegangen, die Steinkrüge in einem Bottich mit Eis zu kühlen, so dass das Ale, selbst wenn ein Gast lange davor saß, kalt blieb. Das würzige honigfarbene Ale im McSorley’s wurde außer in der Prohibitionszeit von der Brauerei Fiselio auf der First Avenue geliefert, die zwei Jahre vor der Kneipe gegründet worden war. 1934 verkaufte Bill der Brauerei das Recht, ihr Ale McSorley’s Cream Stock zu nennen und für das Etikett ein Bild von Old John zu verwenden, um das herum die Worte »Das Bier des McSorley’s Old Ale House« standen. Während der Prohibitionszeit wurde das im McSorley’s ausgeschenkte Ale heimlich in Fässern und Waschzubern im Keller gebraut; dazu kam der ehemalige Brauer Barney Kelly eigens dreimal in der Woche aus der Bronx. An diesen Tagen roch es durchdringend nach Malz und Hopfen. Kellys Bier schmeckte herb und war ausgesprochen kräftig, so dass Bill es für gewöhnlich mit Nährbier verdünnte. Aber Bill verdünnte sein Ale nicht nur mit Nährbier, er nannte es auch so, sehr zum Vergnügen seiner Gäste. Eines Abends schaute ein Polizist, der Bill kannte, kurz herein und sagte: »Gerade habe ich oben an der Ecke einen alten Mann gesehen, der ein Zugpferd umarmte. Als ich ihn fragte, was er getrunken hat, antwortete er: ›Nur das Nährbier von McSorley’s.‹« Das Prohibitions-Ale kostete fünfzehn Cent, und für einen Vierteldollar bekam man zwei Krüge. Heute kostet das Ale zehn Cent je Krug.
Bill war groß und breitschultrig, aber er wirkte nicht besonders kräftig; mit seinem schlurfenden Gang und dem ausgezehrten Gesicht machte er eher den Eindruck, als habe er sich gerade erst vom Krankenlager erhoben. Zu den braunschwarzen Anzügen und schwarzen Fliegen trug er überraschend extravagante, knallbunt gestreifte Seidenhemden. Er war kurzsichtig, der Gastraum war stets in schummriges Licht getaucht, und in einer Sache war er rigoros, dass nämlich an Minderjährige kein Alkohol ausgeschenkt wurde. Daher kam es vor, dass er einen kleingewachsenen Mann mit zusammengekniffenen Augen hinter dem Tresen hervor musterte und sagte: »Von mir kriegst du nichts, Freundchen. Geh heim zu Mama, wo du hingehörst.« Einmal starrte er lange in eine Ecke, bis er plötzlich brüllte: »Nehmen Sie den Fuß vom Tisch!« Offenbar hatte er einen Schatten gesehen, denn in der Ecke saß überhaupt niemand. Bill war tyrannisch. Wenn er Zeitung las, mochte eine ganze Schlange von Gästen darauf warten, bedient zu werden – er schenkte ihnen keine Beachtung. Sollte einer irgendwann ungeduldig werden und laut etwas zu trinken verlangen, sah Bill verärgert auf und beschimpfte ihn mit seiner hohen, näselnden Stimme. Eine solche Behandlung konnte die Gäste allerdings nicht verprellen, vielmehr fingen sie an zu kichern; sie fanden Bill amüsant. Trotz seiner Übellaunigkeit mochten ihn viele. Sie kannten ihn schon von Jugend auf und hatten sich an seine Schrullen gewöhnt. Auf eine verquere Art und Weise waren sie stolz auf ihn, und wenn sie erklärten, er sei der sauertöpfischste, knickrigste Mensch der westlichen Hemisphäre, dann schwang darin immer auch eine gewisse Eitelkeit mit; je exzentrischer er wurde, desto mehr Respekt brachten sie ihm entgegen. Gelegentlich gaben sie mit Bill vor einem Neuankömmling an und riefen: »He, Bill, leih mir mal fünfzig Dollar!« oder: »He, Bill, denk dran, das letzte Hemd hat keine Taschen!« Solche Bemerkungen zogen für gewöhnlich einen Schwall Unflätigkeiten nach sich. Dann wandte sich der Gast stolz dem Neuankömmling zu und sagte: »Sehen Sie?« Als die Prohibition in Kraft trat, machte Bill weiter wie gehabt. Er ignorierte sie einfach. Weder gab es bei ihm ein Guckloch in der Tür, noch zahlte er Schutzgeld, und dennoch fand im McSorley’s nie eine Razzia statt; der Umstand, dass mehrere Tammany-Politiker und niedere Polizeichargen zu seinen Stammgästen gehörten, verlieh ihm wahrscheinlich Immunität.
Bill hatte nie feste Schließzeiten, sondern sperrte einfach zu, wenn er die ersten Anzeichen von Müdigkeit verspürte, was normalerweise gegen zehn Uhr der Fall war. Davor rief er alle an den Tresen und gab eine Runde aus. Diese Gepflogenheit rührte noch von seinem Vater her und er setzte sie getreulich fort, auch wenn es ihm im Herzen wehzutun schien. Wenn die Gäste sich mit dem letzten Bier Zeit ließen, räusperte er sich ein, zwei Mal gereizt, dann schlug er mit beiden Fäusten auf den Tresen und rief: »Meine Herren! Der liebe Gott hat mir verflixt noch mal nicht aufgegeben, mir hier die ganze Nacht die Beine in den Bauch zu stehen, nur damit Sie sich an Ihren Gläsern festhalten können.« Gelegentlich bekam Bill einen solchen Wutanfall, dass er wie Rumpelstilzchen herumsprang und laut lamentierte. Eines Abends im Winter 1924 streifte eine Suffragette aus Greenwich Village Hose und Herrenmantel über, setzte einen Hut auf, klemmte sich eine Zigarre zwischen die Zähne und marschierte ins McSorley’s. Sie bestellte ein Ale, trank es, dann nahm sie den Hut ab und ließ ihre langen Haare auf die Schultern fallen. Sie beschimpfte Bill als männlichen Chauvinisten, brüllte etwas von der Gleichheit der Geschlechter und stürmte hinaus. Als Bill dämmerte, dass er soeben Bier an eine Frau ausgeschenkt hatte, stieß er einen Laut irgendwo zwischen Heulen und Bellen aus und fing an, auf und ab zu springen. »Das war eine Frau!«, brüllte er. »Das war eine gottverdammte Frau!«
Bill war schwerhörig oder tat wenigstens so, dennoch schienen ihn ganz gewöhnliche Geräusche ungemein zu stören. Um in seiner Kneipe für Ruhe zu sorgen, ersann er eine vielsagende Methode. Er besorgte einen Feueralarm-Gong, wie man sie aus Schulen und Fabriken kennt, und schraubte ihn an die gut zwei Meter hohe Eiskiste hinter dem Tresen. Wenn dann jemand ein Lied anstimmte oder die um den Ofen versammelten Alten anfingen, sich anzubrüllen, schlurfte er zu seinem Gong und riss einige Mal heftig an dem Strick. Der Gong hängt noch immer an seinem Platz und wird üblicherweise um Viertel vor zwölf betätigt, um die nahende Sperrstunde zu verkünden; kaum ertönt er, halten sich die Gäste schnell die Ohren zu. In seiner Abneigung gegen Lärm machte Bill keine Ausnahme, selbst den Klang der eigenen Stimme ertrug er nicht. Tagelang sagte er kein Wort und beantwortete alle Fragen nur mit einem Schnauben oder Grunzen. Ein Mann, der sechzehn Jahre lang regelmäßig sein Bier bei McSorley’s trank, erzählte, dass Bill während all der Zeit ganze fünf verständliche Worte zu ihm gesagt hätte. Sie lauteten: »Was geht dich das an?« Der Mann hatte sich höflich bei Bill erkundigt, was es mit den verrosteten Handschellen an der Wand auf sich habe. Später erfuhr er, dass ein Gast, ein alter Bürgerkriegsveteran, sie aus einem Gefängnis der Konföderierten in Andersonville, Georgia, mitgebracht und Old John als Andenken überlassen hatte.
Gelegentlich fasste Bill zu einem Gast aber auch eine unerklärliche Zuneigung. Um 1911 herum erkor ein Grüppchen Maler das McSorley’s zu ihrer Stammkneipe. Zu ihnen gehörten John Sloan, George Luks, Glenn O. Coleman und Stuart Davis. Es waren allesamt gute Maler, die sich aber nie irgendwie aufspielten, so dass die Arbeiter in der Kneipe sie als ihresgleichen akzeptierten. Eines Abends nun brachten die Maler den Anarchisten Hippolyte Havel mit. Havel war ein langhaariger, kurzsichtiger, sanftmütiger Tscheche, der wegen seiner Reden oft Schwierigkeiten mit der Polizei bekam. Sogar Bills Neugier weckte er. »Womit verdient dieser komische Kauz denn sein Geld?«, fragte er einen der Maler. Sicherheitshalber antwortete dieser, Havel sei mehr oder weniger Politiker. Havel gefiel die Kneipe und er kam regelmäßig. Nach fast jeder seiner aufrührerischen Reden am Union Square zog er sich rasch ins McSorley’s zurück. Zum Erstaunen der alten Kämpen entstand eine tiefe Freundschaft zwischen ihm und Bill, der ein Tammany-Demokrat und zutiefst reaktionär war, und keiner konnte sich erklären, was die beiden miteinander verband. Bill nannte den Anarchisten Hippo und gab ihm bis zu zwei Dollar Kredit, während er andere Gäste nicht einmal einen billigen Stumpen anschreiben ließ. Bill hatte im Grunde keinen blassen Schimmer von der politischen Einstellung Havels. Als Charles Francis Murphy, der Tammany-Boss, wieder einmal vorbeischaute, sagte Bill zu Havel, er wolle beim Boss ein gutes Wort für ihn einlegen. »Vielleicht kann er ja was für dich tun«, sagte Bill. Der Anarchist, für den ein Tammany-Boss übelster Abschaum war, lächelte und bedankte sich. Ein Polizeihauptmann nahm es einmal auf sich, Bill vor dem Langhaarigen zu warnen. »Warum?«, wollte Bill wissen. Die Frage verärgerte den Mann. »Ja, zum Teufel«, sagte er. »Havel ist Anarchist! Er wäre bereit, jede einzelne Bank in diesem Land in die Luft zu jagen.« »Das wäre ich auch«, erwiderte Bill. Bills Freundschaft zu Havel war wirklich in jeder Hinsicht bemerkenswert. In der Regel waren warmherzigere Gefühle nämlich seinen Katzen vorbehalten. Eine Zeitlang besaß er nicht weniger als achtzehn von ihnen, und sie gingen in der Kneipe nach Belieben ein und aus. Bill mästete sie mit Rinderleber, die er extra durch den Fleischwolf drehte. Wenn es Zeit fürs Füttern war, trat er hinter dem Tresen hervor, ganz egal wie viel gerade los war, und klopfte auf den Boden einer Bratpfanne. Sogleich sprangen aus allen Ecken der Kneipe fette Katzen herbei.
Bill war verheiratet, aber die Ehe war kinderlos geblieben, und er sagte oft: »Wenn ich einmal sterbe, stirbt die Kneipe mit mir.« Im März 1936 änderte er allerdings seine Meinung – wie es dazu kam, weiß niemand – und verkaufte zur Überraschung seiner Stammgäste das Haus mitsamt Lokal an Daniel O’Connell, einen pensionierten Polizisten, der seit 1900 den größten Teil seiner Freizeit im Hinterzimmer des McSorley’s verbracht hatte. O’Connell schied aus dem Dienst, und zwei Tage später ging die Kneipe in seinen Besitz über. Er war einer der Menschen, von denen es heißt: »Wenn er nichts Gutes über jemanden zu sagen weiß, sagt er lieber nichts.« Da er genauso stolz auf die Traditionen der Kneipe wie Bill war, ließ er sich bereitwillig auf eine der Bedingungen des Handels ein, nämlich nichts zu ändern. Kaum hatte Bill verkauft, ging es mit seiner Gesundheit bergab. Er nahm sich ein Zimmer im Haus eines Verwandten in Queens. An schönen Nachmittagen schlurfte er gelegentlich in die Kneipe und setzte sich in den Peter-Cooper-Sessel, ein blasser, verdrossener alter Mann mit knotigen, im Schoß verschränkten Händen. Stunden saß er dann da und starrte auf das Porträt von Old John. Die Gäste waren überzeugt, dass er es nicht mehr lange machen würde, aber wenn er hereinkam, sagten sie zu ihm: »Du siehst heute schon viel munterer aus, alter Knabe«, oder etwas in der Art. Er schien sich über solche Bemerkungen zu freuen. Er sprach kaum ein Wort, nur einmal wandte er sich an einen Mann, den er schon seit vierzig Jahren kannte: »Die Zeiten ändern sich, McNally.« »Du sagst es, Bill«, erwiderte McNally. Aber dann, als hätte er Angst, allzu sentimental geklungen zu haben, hustete Bill, spuckte aus und fügte zusammenhangslos hinzu: »Mit dem Brot, das sie dir heute verkaufen, kann man nicht mal Schweine füttern.« In der Nacht des 21. September 1938, nicht einmal einunddreißig Monate, nachdem er sein letztes Ale gezapft hatte, starb er im Schlaf. Freunde von ihm schätzten, dass er um die sechsundsiebzig Jahre alt geworden war.
Der pensionierte Polizist erwies sich als gutmütiger Kneipier. Anders als Bill setzte er niemals einen streitsüchtigen Trunkenbold vor die Tür, sondern versuchte, ihn mit Kaffee oder Suppe auszunüchtern. »Wenn ein Mann wegen des Zeugs, das ich ausschenke, durchdreht, kann ich ihn doch nicht rausschmeißen«, sagte er einmal. »Das hieße, mich meiner Verantwortung zu entziehen.« Er betrieb die Kneipe keine vier Jahre. Er starb im Dezember 1939 und vermachte seinen gesamten Besitz seiner Tochter, Mrs. Dorothy O’Connoll Kirwan. Mrs. Kirwan ist eine junge Frau mit Achtung vor der Tradition und hält sich daher lieber im Hintergrund. Anfangs befürchteten die Gäste, dass sie die Kneipe renovieren würde, aber bald wurde klar, dass ihre Angst unbegründet war. »Ich weiß genau, wie wichtig meinem Vater das McSorley’s war«, sagte Mrs. Kirwan, »und solange es sich in meinem Besitz befindet, wird sich hier nichts ändern. Ich werde nicht einmal etwas daran ändern, dass Frauen als Gäste unerwünscht sind.« Sie selbst betritt die Kneipe nur sonntagabends nach der Sperrstunde. Bald nachdem sie das Lokal übernommen hatte, beging sie allerdings einen Fehler, der das McSorley’s in eine tiefe Krise stürzte. Nur mit Mühe konnte sie ihn wieder ausbügeln, auch wenn sie ihn rückblickend als eine Art Glücksfall betrachtet und die Krise gewissermaßen als notwendige Abgrenzung zwischen dem McSorley’s unter Old John, Old Bill und ihrem Vater und dem heutigen McSorley’s unter ihrer Führung versteht. Sie erzählt die Geschichte gerne.
»Als mein Vater gestorben war, habe ich die Dinge im McSorley’s einige Monate schleifen lassen«, sagt sie. »Ich überließ das Geschäft seinen beiden alten Barmännern, dem Tages- und dem Abendbarmann, aber sie waren überfordert und die Sache lief irgendwann aus dem Ruder. Ich brauchte also einen Geschäftsführer – jemanden, der die Bücher führt, die Rechnungen bezahlt und sich auch sonst drum kümmert. Nach einigem Nachdenken gelangte ich zu der Überzeugung, dass mein Onkel Joe Hnida genau der Richtige für diesen Posten war. Ich bin Irin, und meine Familie lebt schon seit Generationen in einem Irenviertel im Westen von Greenwich Village, inmitten von Bohemiens und Exzentrikern. Jedenfalls glaubte ich, mich mit Menschen wirklich gut auszukennen, aber ich wurde schon bald eines Besseren belehrt. Als Mann der Schwester meines Vaters ist Joe Hnida nur angeheiratet und er ist tschechischer Abstammung. Er arbeitete damals für einen Limousinenverleih, der sich auf Hochzeiten und Beerdigungen spezialisiert hatte, und war für die Fahrer zuständig. Joe ist ein freundlicher, anständiger, fleißiger und grundehrlicher Mann, und so sprach ich mit ihm und fragte, ob er die Leitung des McSorley’s übernehmen wollte. Nachdem er eine Weile darüber nachgedacht hatte, sagte er zu. Joe fing also eines Montagmorgens im McSorley’s an. Die Woche war noch nicht einmal vorbei, da riefen mich schon einige der alten Stammgäste an, die alle Freunde meines Vaters gewesen waren, um sich über ihn zu beklagen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass Joe kein besonders redseliger Mensch ist, eher im Gegenteil – er kriegt einfach den Mund nicht auf. Außerdem ist er außerordentlich selbstgenügsam. Dazu kommt, und darin würde er mir sicher recht geben, dass er wenn überhaupt einen tschechischen Humor hat – einen irischen jedenfalls nicht. Wie dem auch sei, offenbar haben ein paar von den Alten, die den lieben langen Tag im McSorley’s herumhocken und schwatzen und sich kabbeln, öfter mal versucht, mit Joe ein Gespräch zu beginnen, doch Joe ging einfach nicht darauf ein. Einer von ihnen erzählte: ›Mehr als ein Guten Morgen, ein Wie geht’s? oder ein knappes Ja oder Nein kriegt man nicht aus ihm raus. Er schimpft nicht mal übers Wetter!‹ ›Wenn er hinter dem Tresen steht‹, berichtete mir ein anderer, ›dann zapft er für einen Gast ein Ale, nimmt das Geld, gibt ihm das Rückgeld und fertig. Mehr als das Allernötigste spricht er nicht.‹ Einige der Alten schlossen Joe ins Herz, aber nur diejenigen, die auch nie den Mund aufkriegten. Es dauerte nicht lange und einer nach dem anderen kam zu der Überzeugung, dass Joe sie für einen Haufen Langweiler und Schwätzer hielt und auf sie herabschaute. Aus Rache fingen sie an, sich hinter seinem Rücken über ihn zu mokieren und ihn ›diesen aufgeblasenen tschechoslowakischen Leichenwagenkutscher‹ zu nennen. Als die Alten mich anriefen, versuchte ich ihnen zu erklären, wie Joe tickte, und wollte ihn verteidigen und den Streit schlichten. ›Bill McSorley war schließlich auch nicht gerade ein großer Volksredner‹, sagte ich. ›Nach dem, was mein Vater mir erzählt hat, hat er an manchen Tagen kein einziges Wort von sich gegeben.‹ Aber es half nichts. Mit Bill McSorley sei es etwas anderes gewesen – ihm gehörte der Laden und er durfte aus irgendeinem Grund tun und lassen, was er wollte, und auch wenn es ihn nicht sonderlich interessierte, ob einer morgen vielleicht stirbt, gab er ihm doch nie das Gefühl, dass er auf ihn herabsah. Aber dann kommt dieser Neue daher und wahrt nicht einmal die einfachsten Anstandsregeln. So ging es in einem fort. Wochen und Monate zogen ins Land und es wurde und wurde nicht besser. Dann rief eines Tages der ältere der beiden Barmänner an, der mein ganzes Vertrauen genießt, und erzählt, das Schlimmstmögliche sei passiert. ›Es klingt vielleicht albern, Dot‹, sagte er, ›aber die Alten haben spitzgekriegt, dass Joe kein Ale mag. Er hat alles getan, um es zu verbergen, aber irgendwie ist es rausgekommen, und sie fingen gleich an, deswegen auf ihm herumzuhacken. Darauf wurde er sehr ärgerlich und erklärte ihnen, dass er nicht nur den Geschmack von Ale nicht ausstehen, sondern es nicht einmal riechen könne. Vom Geruch bekomme er Kopfweh. Tja, wie gesagt, es klingt albern, aber die Alten tun gerade so, als hätten sie etwas schrecklich Schockierendes über Joe herausgefunden. Und ich kenne die Kameraden – sie werden die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen. Zu allem Überfluss sind manche von ihnen plötzlich überaus empfindlich und reizbar – die ganze Situation hat alte Streitigkeiten wieder aufflammen lassen, die sie für längst begraben gehalten oder wenigstens vergessen hatten, und jetzt reden sie nicht mehr miteinander, auch wenn sie manchmal gar nicht mehr wissen warum, und gehen sich aus dem Weg und gucken dabei ganz verwirrt aus der Wäsche. Was für ein Kuddelmuddel.‹ Mir war klar, dass ich etwas unternehmen musste. Alles hing jetzt an mir. Nun, wie es so ist, wuchs mein Mann, Harry Kirwan, in einer alten irischen Stadt namens Ballyragget unten in Kilkenny auf. Ballyragget ist ein Marktstädtchen, das für seine vielen Gasthäuser bekannt ist. Harrys Mutter starb, als er noch ein Kind war, und er wuchs bei seiner Großmutter auf. Noch während seiner Schulzeit fing er an, in einem alten Gasthaus namens Staunton’s auszuhelfen. Auf dem Weg zur Schule machte er dort Halt und fegte den Schankraum aus, und nach der Schule blieb er den ganzen Nachmittag über, um Gläser zu spülen, die Kohlenkiste zu füllen, Besorgungen zu erledigen und sich auch sonst nützlich zu machen. Harry ist ein wissbegieriger Mensch, er hat schon immer viel gelesen. Damals wäre er sehr gerne Lehrer geworden, aber er konnte sich das Studium nicht leisten. Mit neunzehn wanderte er nach Amerika aus und bekam eine Stelle in einer Chemiefabrik in der Bronx, wo er sich bis zum Hauptbuchhalter hochgearbeitet hatte, als wir knapp ein Jahr vor dem Tod meines Vaters heirateten. Wie dem auch sei, als Harry an diesem Abend nach Hause kam, sagte ich zu ihm: ›Setz dich, Harry. Ich muss was Ernstes mit dir bereden.‹ Ich erläuterte ihm die Lage im McSorley’s und sagte dann: ›Ich weiß, wie sehr du deine Arbeit magst, Harry, und ich frag dich das nur sehr ungern, aber kannst du dir vorstellen, sie aufzugeben und das McSorley’s zu übernehmen?‹ ›Zunächst einmal, Dot‹, sagte er, und ich erinnere mich noch an jedes seiner Worte an diesem Abend, ›kann ich meine Arbeit nicht leiden. Ich tu zwar so, aber im Grunde verabscheue ich sie. Und zweitens, Dot, warum in Gottes Namen hat es so lange gedauert, bis dir das einfällt? Ich habe doch unzählige Male von Staunton’s in Ballyragget erzählt, wo die Kundschaft fast ausschließlich aus unausstehlichen alten Männern bestand, mit denen ich immer gut auskam. Ich kam nicht nur gut mit ihnen aus, ich hatte sogar Spaß dabei. Ich habe sie gerne beobachtet und ihnen oft zugehört. Sie waren für mich wie Schauspieler in einem Theaterstück, nur war’s die Wirklichkeit. Manch ein Falstaff war darunter – natürlich waren es nur geschwätzige alte Trunkenbolde aus den heruntergekommensten Winkeln von Ballyragget, aber in meinen Augen waren es Falstaffs. Auch Pistols gab es unter ihnen, echte Schwätzer. Und dann war da ein alter Mann mit unsagbar traurigem Gesicht, der kam immer herein und setzte sich auf einen Stuhl in der Ecke, neben sich ein Guinness, dann starrte er stundenlang ins Leere und nur gelegentlich brummte er etwas; aber jedes Mal, wenn er hereinkam, dachte ich bei mir: »King Lear«. Nicht wenige von ihnen waren gute, ehrliche Männer, aber es befanden sich auch echte Blutsauger darunter, Blutsauger und Aussätzige und Judase. Im McSorley’s scheint’s mir nicht viel anders zu sein. Kurz gesagt, Dot‹, fügte er hinzu, ›und um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin gerne bereit, es im McSorley’s zu probieren und zu sehen, ob ich zurechtkomme.‹ Der Wechsel fand schon bald statt. Gleich am nächsten Tag suchte ich morgens Joe Hnida in seiner Wohnung auf und schüttete ihm mein Herz aus. Ich sagte ihm, wie leid es mir täte, dass ich ihm all diese Unannehmlichkeiten beschert hatte, und er verzieh mir; er kehrte dann zurück zu seinem Limousinenverleih. Noch am selben Tag kündigte Harry in der Bronx und fing zwei Wochen später im McSorley’s an. Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Ich war beinahe krank vor Sorge, dass ich womöglich wieder einen Fehler gemacht hatte, weshalb ich mitten am Tag in der Kneipe anrief und Harry zu sprechen verlangte. ›Läuft alles bestens, Dot‹, sagte er. ›Dass es mir so gut gefällt, hätte ich selbst nicht gedacht. Ich hab das Gefühl, wieder daheim zu sein – zurück in Ballyragget und im Staunton’s.‹ Als er an jenem Abend nach Hause kam und die Tür aufschloss, war das Erste, was er sagte: ›Ich glaube, ich habe endlich meinen Platz in der Welt gefunden.‹«
Wie schon Old John und Old Bill und wie sein Schwiegervater und seine Ehefrau setzt auch Harry Kirwan auf Beständigkeit und hat, seit er die Kneipe übernommen hat, nur eine Änderung vorgenommen, und die war finanzieller Natur und schon längst überfällig. Die alten Barmänner Eddie Mullins und Joe Martoccio erhielten eine Lohnerhöhung genauso wie der Koch Mike Boiko, ein alter Ukrainer, und auch Tommy Kellys Lohn wurde erhöht, der in Tränen ausbrach, als Harry es ihm mitteilte. Tommy Kelly ist womöglich der wichtigste Mann im McSorley’s, wobei seine Aufgaben von so vielfältiger Natur sind, dass die Alten ihn einfach das Faktotum nennen. Wenn es rund geht, springt er als Schankkellner ein und trägt die Ale-Krüge vom Tresen zu den Tischen, immer zwei in jeder Hand, die Finger durch die Henkel gesteckt. Gelegentlich vertritt er den Barmann. Dann wieder erledigt er für Mike eine Besorgung beim Fleischer oder beim Krämer. Er nimmt die Anrufe entgegen, wenn das Münztelefon läutet. Im Winter hält er den Ofen in Gang. Wenn er gegen halb neun Uhr morgens auftaucht, ist er bloß ein kleiner Mann mit traurigen Augen und einem gewaltigen Kater, aber um die Mittagszeit hat er dank des lauwarmen Ale wieder merklich an Haltung gewonnen; um sechs ist er dann so guter Laune, dass er in der Nähe der Tür stehend die neu eintreffenden Gäste mit Handschlag begrüßt, gerade so als wäre er der Wirt. Gelegentlich halten ihn Fremde tatsächlich für den Wirt und sprechen ihn mit Mr. McSorley an. Kelly sagt, er habe schon viele seltsame Jobs gehabt, bevor er im McSorley’s landete. »Und wenn ich seltsam sage, dann meine ich seltsam«, erklärt er. Kurze Zeit war er Nachtwächter in einem großen Beerdigungsinstitut in Brooklyn, wo er kündigte, weil eine der Leichen mit ihm gesprochen habe. »Ich saß die ganze Nacht vorne im Büro«, erzählt er, »und in dem Spind im Hinterzimmer hing meine Jacke mit dem Flachmann. Immer mal wieder ging ich also nach hinten und nahm ein Schlückchen von dem Gin – keinen großen Schluck, nur ein Schlückchen, gerade genug, um mich die Nacht über wachzuhalten. Der Weg führte durch die Leichenhalle, wo die Särge mit den Leichen standen. In dieser speziellen Nacht musste ich an einem offenen Sarg vorbei, in dem die Leiche eines Mannes lag, aufgebahrt und hergerichtet für die Beerdigung am nächsten Morgen; ich war bestimmt schon ein Dutzend Mal an ihm vorbeigegangen, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, aber als ich nun vorbeiging, sprach er mich mit laut vernehmlicher Stimme an. ›Nimm gefälligst deinen Hut ab‹, sagte er, ›drück die Zigarre aus, gieß den Gin weg und schalt das verflixte Radio aus.‹«
Wer auf das McSorley’s schwört, der findet andere New Yorker Kneipen steif und förmlich. Im McSorley’s kann man zur Ruhe kommen. Zum einen ist es hier schummrig, und wo es schummrig ist, stellt sich die Erholung wie von selbst ein. Aber auch das kaum vernehmliche, herzschlagähnliche Ticken der alten Uhren wirkt beruhigend. Dann ist da der durchdringende, dumpfe Geruch, eine Mischung aus Fichten-Sägemehl, verschüttetem Ale, Pfeifentabak, Kohlenfeuer und Zwiebeln, der wie Balsam auf angegriffene Nerven wirkt. Ein Assistenzarzt vom Bellevue meinte einmal, dass der Geruch im McSorley’s bei manchen Geisteszuständen hilfreicher sei als eine Psychoanalyse, Beruhigungspillen oder Gebete.
Mittags füllt sich das McSorley’s. Nachmittags geht es ruhig zu, bis um sechs die Männer kommen, die in der näheren Umgebung arbeiten. An den meisten Abenden mischen sich einige Neugierige unter die Leute. Wenn sie sich zu benehmen wissen und nicht zu viele Fragen stellen, werden sie auch toleriert. Die meisten von ihnen haben durch die Gemälde von John Sloan von der Kneipe erfahren. Sloan fertigte zwischen 1912 und 1930 fünf äußerst detailreiche Bilder von der Kneipe an: »McSorley’s Bar«, auf dem man Bill majestätisch hinter dem Zapfhahn präsidieren sieht und das im Detroit Institute of Arts hängt; »McSorley’s Back Room«, das Gemälde eines alten Arbeiters, der im Zwielicht am Fenster sitzt, die Hände im Schoß, vor sich einen Krug auf dem Tisch; »McSorley’s at Home«, auf dem eine Gruppe streitender Stammgäste um den Ofen herum zu sehen ist; »McSorley’s Cats«, auf dem Bill gerade seine Katzenschar füttert; und schließlich »McSorley’s, Saturday Night«, das während der Prohibitionszeit entstand und Bill zeigt, wie er Ale an eine ausgelassene Schar von Gästen ausgibt. Jedes Mal, wenn eines der Bilder in einer Ausstellung gezeigt wird oder in einer Zeitung oder Zeitschrift abgebildet ist, stürmen Fremde die Kneipe. »McSorley’s Bar« wurde in Thomas Cravens dickem Band A Treasury of Art Masterpieces reproduziert, der 1939 erschien und ganze Hundertschaften Neugieriger in die Kneipe lockte. Das McSorley’s wurde sicher öfter gemalt als jede andere Kneipe im Land. Von Louis Bouché stammt das Bild »McSorley’s«, das sich im Besitz der Universität von Nebraska befindet. »Morning in McSorley’s Bar«, gemalt von dem Schiffszahlmeister Ben Rosen, gewann in einer Kunstausstellung von Handelsseeleuten im Februar 1934 den ersten Preis. Auch Reginald Marsh hat einige Zeichnungen der Kneipe angefertigt. 1939 gab es eine Retrospektive von Sloans Werken in der Kunstabteilung des Kaufhauses Wanamaker, die einige Gäste des McSorley’s gemeinsam besuchten. Einer von ihnen erkundigte sich nach dem Preis für »McSorley’s Cats«. »Dreitausend Dollar«, teilte man ihm mit. Bis zum heutigen Tag ist er beleidigt, weil er glaubt, dass man ihn auf den Arm genommen hat. Kelly mag die Sloan-Bilder, aber noch lieber ist ihm der in goldenes Licht getauchte weibliche Akt, den Old John vor vielen Jahren im Hinterzimmer aufgehängt hat, direkt neben das Porträt von Peter Cooper. Fremden, die durch die Sloan-Bilder in die Kneipe gelockt werden, sagt Kelly: »Mein lieber Freund, wenn du echte Kunst sehen willst, musst du dir die nackte Dame im Hinterzimmer ansehen.« Der Akt liegt ausgestreckt auf einem Sofa und spielt mit einem Papagei; das Bild ist eine Kopie von Gustave Courbets »La Femme au Perroquet«, wahrscheinlich aus der Hand eines Studenten der Cooper Union. Kelly übersetzt den Titel für Fremde bereitwillig. »Das ist französisch«, erklärt er gelehrt. »Es bedeutet Mädel mit Piepmatz«.
Der Tresen im McSorley’s ist kurz, er bietet schätzungsweise zehn Ellbogen Platz, und gestützt wird er von Eisenrohren. Er befindet sich rechts von der Tür, wenn man hereinkommt. Links steht an der Wandtäfelung eine Reihe Stühle mit gerader Rückenlehne. Die Stühle sind wackelig und quietschen schon, wenn ein dicker Mann, der darauf sitzt, auch nur Luft holt. Die Gäste sind überzeugte Hinsetzer, und keiner stellt sich an den Tresen, solange noch ein Stuhl frei ist. Seitlich befinden sich mehrere ramponierte Tische, deren Tischplatten von verschüttetem Ale kleben. Mitten im Raum steht der Bollerofen mit einer Tür mit Glimmereinsatz, der genauso aussieht wie die Öfen in den Bahnhöfen der Hochbahn. Den Winter über bringt Kelly ihn regelmäßig zum Rotglühen. »Je wärmer einem ist, desto betrunkener wird man«, sagt er. Einige Gäste trinken am liebsten warmes Ale. Sie stellen ihre Krüge so lange auf den Ofenrand, bis das Ale so heiß ist wie Kaffee. Eine faule Katze namens Minnie schläft in der Kohlenschütte neben dem Ofen. Die Bodendielen sind krumm und da und dort wurde ein Loch mit einer plattgedrückten Suppendose geflickt. Das Hinterzimmer geht auf einen lichtlosen Innenhof hinaus und bietet Platz für drei große runde Esstische. Eine Ecke des Zimmers nimmt die Küche mit Gasherd ein, der hinter einem zusammenklappbaren Paravent versteckt ist; auf dem Sims stehen die Töpfe, Pfannen und Papiertüten mit Einkäufen. Beim Kartoffelschälen sitzt Mike, eine Spülschüssel im Schoß, vorne an einem Tisch und plaudert mit den ersten Gästen. Bei McSorley’s gibt es gute Hausmannskost zu günstigen Preisen. Mikes Spezialität ist Gulasch, Würstchen mit Sauerkraut und Hamburger, die unter einem Berg Röstzwiebeln begraben sind. Er kritzelt das Speisenangebot mit Kreide auf eine Tafel, die im Schankraum hängt, wobei er sich grund-sätzlich bei vier von fünf Gerichten verschreibt. Es gibt keinen Kellner, der das Essen serviert. Während der Mittagszeit, wenn Mike dafür keine Zeit hat, nehmen sich die Gäste einen Teller und bedienen sich selbst an den Töpfen.
Die Kneipe öffnet um acht. Mike wischt einmal kurz über den Boden und verteilt sauberes Sägemehl. Er füllt die Tabletts mit dem Käse und den Zwiebeln, die es zu Mittag kostenlos gibt, und legt die kalten hartgekochten Eier zu fünf Cent das Stück in eine Schüssel. Dann kommt Kelly. Der Ale-Lastwagen macht seine Lieferung. Vormittags schlurfen die ersten Alten herein. Kelly nennt sie »die Festen«. Die Mehrzahl sind ehemalige Arbeiter und kleine Geschäftsleute. Sie gehen lieber ins McSorley’s, als zu Hause herumzusitzen. Einige wohnen in der Nachbarschaft, aber viele kommen auch von weiter her. Ein Mann, der einmal mehrere Absteigen auf der Bowery besaß, kommt beinahe täglich von Sheepshead Bay hierher. An seinem letzten Arbeitstag erklärte er: »Wenn meine Ersparnisse reichen, werde ich nie wieder einen nüchternen Atemzug tun.« Er sagt, dass er trinkt, um das Elend zu vergessen, das er in den Absteigen gesehen hat; es muss eine Menge gewesen sein, weil er oft fünfundzwanzig Krüge an einem Tag trinkt, und das Ale hier hat es in sich. Kelly versorgt die Alten mit Bier. Meist bestellen sie zwei Krüge auf einmal, um ihm einen Weg zu ersparen. Viele sind ruhige, gesetzte Herrschaften, aber es sind auch einige Exzentriker darunter. Vor ein paar Jahren musste sich einer einmal mit einem Hechtsprung vor einem die Third Avenue herunterrasenden Automobil retten, worüber er sich noch immer aufregt. Ständig grummelt er in seinen Bart hinein. Als er einmal gefragt wurde, was er da vor sich hinschimpfe, antwortete er: »Dass ich mir eine Schrotflinte kauf, mich auf die Third Avenue stell und auf die Autos schieß.« »Wirst du auf die Reifen zielen?«, wurde er gefragt. »Warum das denn?«, sagte er. »Ich schieß natürlich auf die Fahrer. Bestimmt erwisch ich vier oder fünf von denen, bevor sie mich verhaften. Könnten mehr werden, wenn ich schnell genug nachlade.«
Nur ein paar von den alten Männern interessieren sich noch genug für die Gegenwart, um Zeitung zu lesen. Sie sitzen ganz vorne, wo das Licht von draußen durch die schmutzigen Scheiben fällt. Wenn sie des Lesens müde sind, starren sie stundenlang auf die Straße. Auf der Seventh Street gibt es immer etwas zu sehen. Es ist eine der Straßen der East Side, die sich fest in der Hand von Kindern befinden. Sie spielen dort Stickball und machen im Rinnstein große Feuer aus Pappkartons, in denen sie manchmal Mäuse grillen. Die Tabletts mit dem kostenlosen Mittagessen stehen stets an dem Ende des Tresens, das der Tür zur Straße näher liegt, und nachmittags schlüpfen immer wieder Kinder hinein, schnappen sich eine Handvoll Käse und ein paar Zwiebelscheiben und flitzen, die Tür hinter sich zuschlagend, wieder hinaus. Darüber können sich die Alten jedes Mal vor Lachen ausschütten.
Der Ofen bollert, im Raum ist es einschläfernd warm und einige der Alten halten auf ihren Stühlen ausgedehnte Nickerchen. Gelegentlich fängt einer an zu schnarchen, den weckt Kelly dann mit den Worten: »Bei dem Radau wachen ja die Toten auf.« Einmal maß Kelly aus purer Neugier bei einem der Schläfer die Zeit. Nach zwei Stunden und vierzig Minuten wurde Kelly unruhig – »Vielleicht ist er gestorben«, sagte er – und schüttelte ihn, um ihn zu wecken. »Wie lange hab ich geschlafen?«, fragte der Mann. »Seit der Parade«, antwortete Kelly. »Welche Parade?« »Die Paddy’s-Day-Parade vor zwei Wochen«, sagte Kelly spöttisch. »Himmel!«, sagte der Mann. Dann gähnte er und schlief wieder ein. Kelly macht gerne Witze über die Beständigkeit der Alten. »He, Eddie«, rief er eines Morgens, »der alte Ryan muss gestorben sein.« »Wie kommst du denn darauf?«, fragte Mullins. »Na ja«, sagte Kelly, »er ist schon seit einer Woche nicht mehr da gewesen.« Im Sommer sitzen sie im Hinterzimmer, wo es so kalt ist wie in einem Kellerverlies. Im Winter rangeln sie darum, wer dem Ofen am nächsten sitzt, und verharren dort reglos wie Entenmuscheln, bis es sechs Uhr wird, dann gähnen sie, strecken sich und machen sich auf den Heimweg, mit ausreichend Ale gegen die trostlose Einsamkeit des Alters gewappnet. »Gott sei mit euch«, sagt Kelly, wenn sie zur Tür hinausgehen.
(1940)
MAZIE
Mazie P. Gordon, eine resolute, kluge, blonde Frau, ist auf der Bowery so etwas wie eine Berühmtheit. In den Trinkhallen und den rund um die Uhr geöffneten Speiselokalen, die als preiswerte Spezialität gekochte Schweineschnauze mit Kohl anbieten, kennt man sie nur unter ihrem Vornamen. Beinahe jeden Abend dreht sie eine Runde durch diese Lokale. Manchmal schleicht sich dabei ein Betrunkener von hinten an sie heran, gibt ihr einen Klaps auf den Po und nennt sie Schätzchen. Das macht ihr nichts aus. Sie hat eigenartigerweise die Stadtstreicher und Trinker ins Herz geschlossen und kennt vermutlich mehr von ihnen als sonst jemand in New York. Jeden Tag verteilt sie zwischen fünf und fünfzehn Dollar in kleinen Münzen unter ihnen, was auf der Bowery eine Menge Geld ist. »Zu meiner Zeit war ich so freigiebig mit der Penunze wie der alte John D. Rockefeller persönlich«, sagt sie. Seit einundzwanzig Jahren sitzt Mazie im Kassenhäuschen des Venice Theater in der Park Row Nr. 209, etwas westlich des Chatham Square, wo die Bowery beginnt, und verkauft Eintrittskarten.
Das Venice ist ein kleines, heruntergekommenes Lichtspielhaus, das morgens um acht Uhr öffnet und um Mitternacht schließt. Es ist ein Dime House, in dem man für zehn Cent zwei Spielfilme, eine Wochenschau, einen Zeichentrickfilm, einen Kurzfilm und die Episode eines Fortsetzungsfilms zu sehen bekommt. Es ist jedoch keine »Krätzhütte«. Im Gegenteil, die Gäste schätzen es auch deshalb, weil die Sitze wenigstens einmal in der Woche gründlich gereinigt werden. Mazie behauptet stolz, das Venice sei so sauber wie das Paramount. »Hier hat sich noch keiner Läuse geholt«, sagt sie. Als eine Form von Flucht rangieren billige Filme auf der Bowery gleich hinter billigem Alkohol, und viele Stadtstreicher sind leidenschaftliche Kinogänger. Unter den Besuchern des Venice sind sie zahlreich vertreten. Ins Venice kommen außerdem die Bewohner der Mietskasernen rund um den Chatham Square, etwa aus Chinatown, von der unteren Mulberry Street aus Little Italy und aus dem spanischen Teil der Cherry Street. Die Kinobesucher sind zu zwei Dritteln Männer. Die Kinder und die meisten Frauen sitzen unter dem wachsamen Blick einer Aufseherin in einem abgetrennten Bereich. Einmal, in einem Anflug von Koketterie, hat Mazie behauptet, sie lasse keine Betrunkenen ins Haus. Auf die Frage, wann ihrer Meinung nach jemand betrunken wäre, antwortete sie kichernd: »Wer nur noch auf allen vieren krabbelt!« Jedenfalls sitzen in nahezu allen Vorstellungen des Venice Betrunkene. Wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt, werden sie zwar nörgelig und brabbeln vor sich hin und bei Liebesfilmen pöbeln sie die Schauspieler auf der Leinwand laut an, aber im Großen und Ganzen stören sie weniger als eine bestimmte Sorte Stadtstreicher, die Mazie »ihre Pennbrüder« nennt. Sie sind besonders apathisch, stieren mit leerem Blick vor sich hin und bewegen sich wie in Zeitlupe. Ihr einziges echtes Bedürfnis ist es, zu schlafen. Manche von ihnen können sogar bei eisigen Temperaturen an Hausmauern gelehnt dösen. Viele Pennbrüder gehen häufig früh am Tag ins Venice und schlafen, bis sie um Mitternacht hinausgeworfen werden. »Manchmal weiß ich gar nicht mehr, ob wir ein Kino oder ein Hotel sind«, meinte Mazie einmal. »Neulich hab ich zum Geschäftsführer gesagt, dass Streifen, in denen geschossen wird, schlecht fürs Geschäft sind, weil unsere Besucher dabei aufwachen.«
Die meisten Lichtspielhäuser auf der Bowery beschäftigen Rausschmeißer. Im Venice übernimmt Mazie diese Aufgabe. Gegenüber guten Bekannten räumt sie zwar ein, dass sich Raufereien für Damen nicht gehören, aber sie hält es für ihre Pflicht, wenigstens einmal am Tag jemanden aus dem Kino zu werfen. »Wenn ich nicht regelmäßig durchgreife, tanzen mir die Leute doch bald auf der Nase rum«, sagt sie. »Aber eigentlich machen mir solche Streitereien keinen Spaß. Ich verliere immer die Beherrschung, und wenn ich erst mal in Fahrt bin, kann ich nicht mehr aufhören. Manchmal bin ich richtig außer mir. Außerdem sind manche Männer so schwach, dass sie sich nicht wehren können, und dann komme ich mir vor wie ein Schuft.« Mazie ist klein, aber drahtig und furchtlos und hat ein gewaltiges Organ. Ihr Kassenhäuschen liegt in Hörweite der Hochbahn, die auf der Third Avenue zur City Hall fährt, und das zwei Jahrzehnte lange Anbrüllen gegen quietschende Züge haben sie einen dröhnenden Bass ausbilden lassen, mit dem sie selbst doppelt so große Männer übertönen kann. Im Venice kippt einem Pennbruder bisweilen der Kopf in den Nacken, und er fängt so laut zu schnarchen an, dass es im ganzen Kinosaal zu hören ist, vor allem bei spannenden Filmszenen. Wenn das passiert, oder wenn ein Betrunkener anfängt herumzukrakeelen, trampeln die Frauen und Kinder aus dem abgetrennten Bereich auf den Boden und rufen »Mazie, Mazie, wir woll’n Mazie!«. Sobald der Sprechchor einsetzt, stürzt die Aufseherin ins Foyer hinaus und pocht an Mazies Kabuff. Daraufhin verschließt Mazie die Geldschublade, packt einen Knüppel, den sie sich aus mehreren, von einem Gummiband zusammengehaltenen True-Romances-Heftchen gerollt hat, und marschiert in den Vorführsaal. Während sie den Gang hinabschreitet und nach links und rechts blickt, springen die Frauen und Kinder auf, deuten in Richtung des Übeltäters und rufen: »Da ist er, Mazie! Da!« Mazie verpasst dem Mann einen Schlag mit dem Papierknüppel, dass es klatscht, und prügelt dann so lange auf ihn ein, bis er verspricht, sich besser zu benehmen. Zwischen den einzelnen Hieben droht sie ihm noch schlimmere Prügel an. Ihre Drohungen sind wüst, wenngleich nicht immer ganz verständlich. »Raus mit dir auf einer Bahre!«, brüllt sie. »Ich schlag dir die Augen aus! Riesenaffe! Die Zähne im Kopf! Knochen aus dem Leib!« Die Frauen und Kinder haben ihren Spaß daran, vor allem wenn Mazie den Falschen erwischt, was ihr manchmal passiert. Ist Mazie erst einmal in Fahrt, sieht sie furchterregend aus. Sie läuft rot an, ihr Haar sträubt sich in alle Richtungen, und manchmal kann man sogar ihren Schlüpfer sehen. Fällt es dem Opfer gar ein, sich zur Wehr zu setzen oder irgendwie zu verteidigen, zerrt sie ihn aus dem Sitz und scheucht ihn aus dem Kino. Taumelt er schließlich den Gang hinauf, dicht gefolgt von der fleißig weiter prügelnden Mazie, klatschen Frauen und Kinder Beifall.
Meistens hält Mazies Erbitterung so lange an, bis sie den Störenfried auf den Bürgersteig gejagt hat. Dort schlägt ihre Grobheit unweigerlich in Zerknirschung um, und sie entschuldigt sich. »Hör mal, Kumpel, entschuldige bitte«, sagte sie jüngst zu einem Betrunkenen, den sie am Nachmittag hinausgeworfen hatte, weil er während eines Gefängnisfilms mit dem Titel Todesangst bei jeder Dämmerung dem Schauspieler George Raft »Schlappschwanz! Schlappschwanz!« zugerufen hatte. »Wenn du das Programm noch nicht ganz kennst, kannst du wieder reingehen.« »Nein, nein, Mazie«, antwortete der Mann. »Das hab ich doch schon drei Mal gesehen.« »Da«, sagte sie darauf und gab ihm ein bisschen Geld, »dann kauf dir eben was zu trinken.« Obwohl seine Ohren von Mazies Hieben knallrot waren, grinste der Mann. »Du hast wirklich ein gutes Herz, Mazie«, sagte er. »Du bist echt ein Schatz!« »Na, von mir aus«, sagte Mazie und ging zu ihrem Kassenhäuschen zurück. »Wenn du dich nicht mehr wie ein Volltrottel benimmst, darfst du mich auch Schatz nennen.«
Das Venice ist ein Familienunternehmen und gehört Mazie und ihren Schwestern Rose – ihr verstorbener Mann wettete auf Pferde – und Jeanie, einer Kunsttänzerin. Die beiden lassen Mazie völlig freie Hand. Im Grunde hat Mazie an Filmen kein Interesse und sieht sich nur selten einen von Anfang bis Ende an. »Davon wird mir übel«, behauptet sie. Folglich hat sie einen Geschäftsführer eingestellt, dem sie bei der Auswahl und Bestellung von Filmen freie Hand lässt. Für ein Lichtspielhaus dieser Art läuft das Venice sehr gut, und Mazie könnte es sich eigentlich leisten, eine Kassendame einzustellen und nicht selbst da zu sitzen. Aber ihr macht die Arbeit Spaß, und sie möchte sie nicht missen, obwohl ihre Schwestern sie immer wieder drängen, es sein zu lassen. Von ihrem Kabuff hat Mazie einen guten Blick auf den Chatham Square, der die Lieblingspromenade der Saufbolde und Sonderlinge auf der Bowery ist. »Was ich da zu sehen bekomme, glaubt mir kein Mensch«, sagt sie nicht ohne Stolz. Wenn sie unter den Passanten einen Bekannten entdeckt, reckt sie den Kopf ganz nah zum Sprechloch ihres Fensters hin und ruft einen Gruß hinaus. Manchmal redet sie mit Leuten auf dem Gehsteig sogar über höchst persönliche Dinge: »He, Squatty«, rief sie eines Nachmittags einem verträumt blickenden Mann zu. »Ich dachte, du bist im Bellevue.« »War ich auch, Mazie«, entgegnete der Mann. »Aber gestern haben sie mich rausgelassen.« »Wo warst du denn dieses Mal? Bei den Säufern oder bei den Irren?« »Diesmal bei den Säufern.« »Und, wie war’s?« »Ganz okay, denk ich mal.« »Da hattest du gestern wohl einen sitzen?« »Na klar.« »Gab ja auch was zu feiern, was?« »Aber sicher.« »Na dann, pass gut auf dich auf.« »Danke, Mazie. Du auch.«
Mazie, die wie eine Boulevardkönigin in ihrem Kassenhäuschen thront, ist einer der wenigen angenehmen Anblicke auf der Bowery. Sie ist eine kleine, vollbusige Person Mitte vierzig. Manche behaupten, sie habe eine entfernte Ähnlichkeit mit Mae West. Ihr Haar ist beinahe schwefelgelb, ihr Gesicht blass, bis auf den kreisrunden, silberdollargroßen Rougefleck auf jeder Wange. Durch die hängenden Augenlider hat ihr Blick etwas Schläfriges. Während der Arbeit trägt sie häufig einen Augenschirm aus grünem Zelluloid. Beinahe immer hat sie eine Zigarette im Mundwinkel stecken, was ihr ein leicht hochmütiges Aussehen verleiht. Wie ein Croupier im Film kann sie eine Zigarette fast ganz zu Ende rauchen, ohne sie ein einziges Mal aus dem Mund zu nehmen, selbst wenn sie redet. Ihren rasselnden Raucherhusten hat sie den dreieinhalb Schachteln, die sie täglich wegqualmt, zu verdanken, und sie sagt, dass der Tabak sie eines Tages umbringen wird. An der rechten Hand trägt sie vier Diamantringe. Sie mag knallige Farben, und ihre Kleidung, die sie in Läden an der Division Street kauft, sticht ins Auge. Die Touristenbusse mit Glasdach, die zur Bowery und nach Chinatown kommen, parken oft vor dem Venice, und ab und zu steht auch eine Reisegruppe auf dem Bürgersteig und starrt Mazie an. Sie verachtet Touristen und sagt, sie passen zur Bowery wie die Faust aufs Auge. Manchmal dreht sie ihnen eine lange Nase. Allerdings stört es sie gar nicht, dass man sie ansieht. »Die Leute kommen nur wegen mir hierher«, hat sie einmal sogar gesagt. »Ich habe ein eigenes Publikum, genau wie ein Filmstar.«