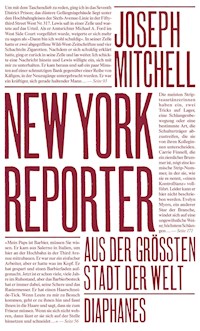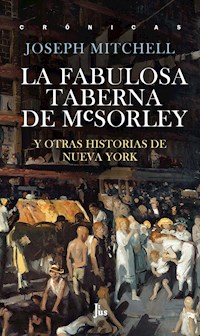14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Joseph Mitchells sechs lange Reportagen über New York und seine Hafengegend sind längst legendär. Auf seinen Wegen zwischen Hudson River und East River, Staten Island, Fischmarkt und Fährhafen begegnet er Außenseitern und Exzentrikern und lässt sich von den Gerüchen und den Geschmäckern des Hafens faszinieren. Umgetrieben von den Nischen und Lücken der allgemeinen Geschichtsschreibung, schreibt er von einem leerstehenden Hotel über einem geschäftigen Fischrestaurant, vom Leben der Ratten, die von den Schiffen in den Hafen strömen, vom Kapitän der größten Fischereiflotte der Region und von anderen Menschen, die auf die eine oder andere Weise alle mit dem New Yorker Hafenviertel verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Ähnliche
Zwischen den Flüssen
Joseph Mitchell
Zwischen den Flüssen
Joseph Mitchell
New Yorker Hafengeschichten
Aus dem amerikanischen Englisch von Sven Koch und Andrea Stumpf
diaphanes
Titel der englischen Ausgabe:The Bottom of the Harbor © 1944, 1947, 1951, 1952, 1956, 1959 by Joseph Mitchell
1. Auflage © diaphanes, Zürich 2012 / 2021www.diaphanes.net Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-0358-0412-6
Umschlag und Layout: Bonbon, Zürich Satz: 2edit, Zürich Druck: Steinmeier, Deiningen
INHALTSVERZEICHNIS
Im alten Hotel
Der Hafengrund
Ratten am Wasser
Mr. Hunters Grab
Schleppnetzfischer
Am Fluss
Nachbemerkung
IM ALTEN HOTEL
Wenn ich die trostlose Stimmung, die mich hin und wieder erfasst, abschütteln will, stehe ich in aller Frühe auf und gehe zum Fulton Fish Market. Meistens bin ich gegen halb sechs dort und spaziere dann durch die beiden riesigen offenen Markthallen, den Old Market und den New Market, deren Vorderfronten auf der South Street stehen, während der rückwärtige Teil auf Pfählen im East River ruht. Zu dieser Tageszeit, kurz vor Handelsbeginn, türmen sich auf den Ständen in den Hallen vierzig bis sechzig Sorten Fisch und Schalentiere von der Ostküste, der Westküste, der Golfküste und aus einem halben Dutzend fremder Länder. Der morgendliche Dunst am Flussufer, die Rufe der Fischhändler, der Geruch nach Tang und der Anblick der überbordenden Fülle heitern mich stets auf, manchmal versetzen sie mich sogar in Hochstimmung. Eine Stunde wandere ich so zwischen den Ständen herum. Dann suche ich ein lärmendes Marktlokal namens Sloppy Louie’s auf und bestelle mir ein großes, preiswertes, deftiges Frühstück – etwa Räucherhering und Rührei oder ein Omelett mit Maifischrogen, Jakobsmuschelhälften mit Speck oder eine andere Frühstücksspezialität des Lokals.
Sloppy Louie’s nimmt das gesamte Erdgeschoss eines alten Hauses in der South Street Nummer 92 schräg gegenüber der Markthallen ein. Das Haus steht am Fluss und sieht hinaus auf die Slipanlage zwischen dem Fischereianleger an der Fulton Street und dem alten Anleger der Porto Rico Line. Es hat sechs Geschosse mit jeweils zwei Fenstern. Wie die meisten älteren Gebäude des Marktviertels ist es aus Hudson-River-Handstrichziegeln gebaut, einer rosaroten, recht schmalen Art, die in Haverstraw und anderen Ziegeleistandorten am Hudson gebrannt und auf Frachtkähnen nach New York City geschafft wurden. Mit seinem Schmuckgesims aus verzinntem Blech und dem schiefergedeckten Mansarddach ist es eines jener schönen, wohlproportionierten alten Häuser am East River, die dem Verfall preisgegeben wurden. Die Fenster der vier oberen Stockwerke sind schon seit Jahren vernagelt, die Regenrinne an der Fassade ist voller Rostlöcher und auf dem Dach sieht man hier und da Lücken, wo Schieferschindeln heruntergefallen sind. Gegen zwei, drei Uhr nachmittags, wenn der Markt schließt und die Stände leergeräumt werden, hocken sich einige fette, schmuddelige Möwen, die den Markt nach Fischabfällen durchstöbern, mit aufgeplustertem Gefieder auf das Sims und schielen nach unten.
Ich gehe seit neun oder zehn Jahren regelmäßig ins Sloppy Louie’s, und der Besitzer und ich kennen uns gut. Er heißt Louie Morino und ist ein nachdenklicher und großherziger, weltkluger Mann Mitte sechzig. Louie ist Norditaliener. Er stammt aus Recco, einem Fischerstädtchen und Badeort zwanzig Kilometer südöstlich von Genua an der italienischen Riviera. Recco ist alt, es lässt sich auf das dritte Jahrhundert nach Christus datieren. Familien aus Genua, Mailand und Turin besitzen dort ihre Sommerresidenzen. In der Reisezeit tauchen gelegentlich auch Amerikaner oder Engländer auf. Den kolorierten Postkarten nach zu urteilen, die mit Klebestreifen an dem Wandspiegel hinter Louies Registrierkasse befestigt sind, ist Recco ein Städtchen mit steilen Gassen und schlichten, weiß getünchten hohen Steinhäusern. Auf die Fassaden hat man mit Schablonen Bilder aufgetragen – Madonnen, Engel, Blumen, Früchte und Fische. Fische sieht man besonders über den Türen und Fenstern, sie sollen vor dem bösen Blick schützen. In fast jedem Garten stehen große, sattgrüne Feigenbäume. Auf dem Markt im Stadtkern bieten Fischer und Bauern ihre Waren auf einfachen Tischen aus aufgebockten Brettern feil. Louies Vater war Fischer. Er hieß Giuseppe Morino, aber man rief ihn nur Beppe du Russu, was im Genueser Dialekt so viel wie Sepp Rotschopf heißt. »Meine Familie ist eine der alten Fischerfamilien in Recco, von denen der Pfarrer gerne sagte, sie würden dort seit den alten Römern fischen«, erzählt Louie. »Wir haben in einer Straße namens Vico Saporito gewohnt, die mit zerstoßenen Muschelschalen gepflastert war und sich bis zum Wasser hinunterwand. Mein Vater hat nach einer Methode gefischt, die hierzulande Wadenfischen genannt wird, und er setzte Hummerfallen und fing mit Ködern und Haken Kalmare und Kraken. Bei gutem Wetter ruderte er zu einer Unterwasserhöhle hinaus, ankerte davor und nahm eine Fangleine, die aus einer langen Schnur bestand, von der alle zwanzig Zentimeter ein Fetzen rohes Fleisch hing und an deren Ende ein Stein geknotet war, und die warf er in die Öffnung der Höhle. Die Kraken schossen aus der Dunkelheit nach oben und schluckten die Fleischfetzen, von denen sie nicht mehr loskamen, und dann zog mein Vater die Schnur mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen nach oben, nahm einen Kraken nach dem anderen von den Fleischfetzen und warf sie in eine Wanne im Boot. In wenigen Stunden fing er genug Kraken, um den Markt von Recco damit zu überschwemmen. Die Höhle war voll von ihnen, sie wimmelte geradezu von den Viechern. Da er die Höhle entdeckt hatte, war es seine. Die anderen Fischer näherten sich ihr nicht mal auf zehn Meter und nannten sie immer nur Beppe du Russus Höhle. Neben der Fischerei betrieb er für die Sommerfrischler ein wackliges altes Badehaus am Strand. Es stand auf Pfählen und hatte um die fünfzig, sechzig Kabinen. Wir nannten es Bagni Margherita. Meine Mutter hat daneben einen kleinen Imbiss geführt.«
1905 verließ Louie mit nicht ganz achtzehn seine Heimatstadt. »Ich hab meine Familie geliebt«, sagt er, »und es tat mir im Herzen weh, sie verlassen zu müssen, aber ich habe fünf Brüder und zwei Schwestern, und alle Brüder sind jünger als ich, und schon damals gab es mehr als genug Fischer in Recco. Das Badehaus brachte gerade genug ein, aber ich hatte immer Angst, dass es irgendwann nicht reichen könnte, also besorgte ich mir eine Überfahrt von Genua nach New York und schrubbte Töpfe in der Kombüse eines Dampfschiffs. Vom Hafen ging ich direkt zu einem Steakhaus in der Bronx, auf der 138th Street East. Es wurde von einem Mann namens Capurro geführt, der stammte ursprünglich aus Recco und kannte meinen Vater aus Kindertagen.« Capurro gab Louie Arbeit als Tellerwäscher und brachte ihm das Kellnern bei. Er blieb zwei Jahre bei ihm. In den nächsten dreiundzwanzig Jahren kellnerte er in verschiedenen Lokalen in Manhattan und Brooklyn. Die genaue Zahl hat er vergessen und er erinnert sich nur an die Namen von dreizehn. Es waren überwiegend Restaurants mittlerer Größe, die sich ihrer Steaks und Koteletts oder ihrer Fische und Meeresfrüchte rühmten oder mit Damentischen warben. Im Winter 1930 beschloss er, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, nahm seine gesamten Ersparnisse und eröffnete ein eigenes Lokal. »Der Börsenkrach«, sagt er, »hatte das Unterste zuoberst gekehrt, und mit der Wirtschaft ging es immer mehr bergab. Ich wusste von einigen Lokalen in Midtown, die man für wenig Geld kriegen konnte – inklusive Pacht, Einrichtung und Stammkundschaft. Es waren alles schicke, moderne Läden. Zufällig lief ich einem Kellner über den Weg, mit dem ich mal zusammengearbeitet hatte, und der erzählte mir von einem alten, runtergekommenen Lokal in einem alten, runtergekommenen Gebäude am Fischmarkt, das zum Verkauf stünde, und ich ging hin, sah es mir an und nahm es. Der Fulton Fish Market erinnert mich nämlich an Recco. Natürlich besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen beiden, aber sie sind sich in manchen Dingen auch ähnlich – der Fischgeruch, der verlotterte Eindruck von allem, die Marktstände auf der Straße, die über die Bürgersteige reichenden Dächer, die an den Fischköpfen nagenden Katzen an jeder Ecke, die Möwen auf den Dachrinnen, dass jeder ständig jeden auf dem Kieker hat, das Geschrei, die Streitereien. Da ist zum Beispiel ein Fischhändler, einer der ganz großen, ein alter italienischer Sturkopf, der eine Million Dollar auf der Bank liegen hat und in Kleidern rumläuft, als würde er von der Fürsorge leben, der also spaziert den Fischereianleger auf und ab, zieht die Fische an den Köpfen oder Schwänzen aus den Fässern, wiegt sie in seinen Händen und überschlägt bis auf zwei Stellen hinterm Komma, wie viel sie kosten dürfen, und die ganze Zeit über schreit und singt er und genießt das Leben. Seine Miene und sein ganzes Gehabe erinnern mich so sehr an meinen Vater, dass ich manchmal allein bei seinem Anblick gute Laune bekomme, aber manchmal bricht es mir auch das Herz.«
Louie ist knapp einen Meter siebzig groß und untersetzt. Mit der Hakennase, den buschigen Augenbrauen und den wachsamen großen, braunen Augen sieht er wie eine Eule aus. Er hat weiße Haare. Sein rotes Gesicht und die Handrücken sind mit Sommersprossen und Leberflecken übersät. Er trägt eine Brille mit fleischfarbenem Gestell. Er hat krumme Beine und seine linke Schulter hängt ein wenig herab, dazu hat er den lendenlahmen, schlurfenden Gang mit vorgerecktem Kopf, wie er typisch für einen alten Kellner ist. Gekleidet ist er stets tadellos. Seine Anzüge lässt er bei einem teuren Schneider im benachbarten Versicherungsdistrikt machen. Jeden Morgen streift er zu Arbeitsbeginn eine frische Schürze und eine frische braune Leinenjacke über. Selbst wenn er nur hinter der Kasse steht, liegt über seinem linken Arm eine gefaltete Serviette. Er ist ein stolzer Mann und vom Wesen her etwas steif und förmlich, aber er geht schnell aus sich heraus, ist sehr neugierig und weiß die Leute zu nehmen. Selbst bei Hochbetrieb lacht und witzelt er mit seinen Gästen, erläutert wortreich die Tagesgerichte und ist immer gut für den neuesten Tratsch vom Fischmarkt. Wenn er bei einer Tasse Kaffee an einem der hinteren Tische verschnauft, wird er ernst.
Louie ist verwitwet. Seine Frau, Mrs. Victoria Piazza Morino, kam aus einem Dorf namens Ruta, das nur vier Kilometer von Recco entfernt liegt, aber sie haben sich erst in Brooklyn kennengelernt. 1928 heirateten die beiden, und er hing sehr an ihr. 1949 starb sie. Er hat zwei Töchter – die zweiundzwanzigjährige Jacqueline, die kürzlich ihren Abschluss auf dem Mills College of Education gemacht hat, einer Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen unten an der Fifth Avenue, und die siebzehnjährige Lois, die gerade die von den Schwestern von St. Joseph geführte Fontbonne-Hall-Highschool auf der Shore Road in Brooklyn abgeschlossen hat. Es sind kluge und aufgeweckte Mädchen mit dunklen Augen und gertenschlank. Louie muss beizeiten im Restaurant sein, so dass er für gewöhnlich zwischen vier und fünf in der Früh aufsteht, aber bevor er geht, presst er jeden Morgen für seine Töchter ein paar Orangen aus und stellt einen Kaffee auf den Herd. Meist kommt er vor ihnen nach Hause und kocht dann zu Abend.
Das Haus, in dem sie wohnen, gehört Louie, ein zweistöckiges Backsteinhaus an einer mit Ahornbäumen gesäumten Straße in dem überwiegend norwegischen Teil von Bay Ridge in Brooklyn. In Recco heißt es, dass Menschen und Feigenbäume sich am Salzwasser am wohlsten fühlen, und Louies Haus ist nur ein paar Blocks von den Narrows entfernt. Vor fünfzehn Jahren bestellte er in einer Baumschule in Virginia drei kleine Feigenbäume und setzte sie in seinen Garten, wo sie seither prächtig gedeihen. Im Spätherbst wickelt er die Stämme und Äste in ausgemusterte Anzüge, Kleider, Pullover, Laken und Decken. »Immer wenn ich im Winter aus dem Fenster zum Garten hinausschaue«, sagt er, »sieht es so aus, als stünden dort drei Mumien.« Bei den ersten Anzeichen des Frühlings wickelt er die Bäume wieder aus. Mitte Juli fangen sie an zu tragen und im August hängen sie voller Früchte. Ein Baum trägt kleine grüne Feigen, die anderen beiden die dicken blauen, deren Haut an der Seite aufplatzt, wenn sie reif sind, so dass man das rosafarbene und violette Fleisch sieht. Louie sammelt die Früchte am liebsten in der Abenddämmerung ein, wenn sie noch warm von der Hitze des Tages sind. Manchmal beugt er sich vor und steckt sein Gesicht in die Blätter und atmet tief den schweren Duft der reifenden Früchte ein, der Erinnerungen an das hochsommerliche Recco weckt.
Louie hält nicht viel von dem Namen seines Lokals. Es ist ein altes Lokal mit alter Einrichtung, das schon viele Wirte und Namen hatte. Unter Louies Vorgänger John Barbagelata hieß es Fulton Restaurant, wurde gelegentlich aber Sloppy John’s genannt. Als Louie es übernahm, taufte er es Louie’s Restaurant. Einer der Fischhändler fing prompt an, es Sloppy Louie’s zu nennen, und Louie beging den Fehler, Protest dagegen zu erheben. Das machte er ein paar Mal. Sobald die Marktleute mitbekamen, dass Louie sich darüber ärgerte, sagten die meisten es erst recht. So bürgerte sich der Name ein. Drei Jahre lang brütete Louie über die Angelegenheit, bis er schließlich über dem Eingang ein Schild anbrachte, auf dem in großen roten Lettern SLOPPY LOUIE’S RESTAURANT stand. Er ließ sogar den Eintrag ins Telefonbuch ändern. »Nachdem ich nicht gegen sie ankam«, sagt er, »musste ich wohl oder übel mitspielen.«
Sloppy Louie’s läuft gut. Das kleine Lokal fasst achtzig Gäste und sechs, sieben Mal am Tag ist es bis auf den letzten Platz besetzt. Morgens um fünf öffnet und abends um halb neun schließt es. Zu beiden Seiten der Doppeltür am Eingang sind Schaufenster. In einem sind drei Buddelschiffe zu sehen, eine mit Augen und Mund bemalte riesige Hummerschere, eine mächtige Austernschale und ein kleiner Schädel. Neben der Austernschale steht ein Kärtchen, auf das Louie mit akkurater Schrift geschrieben hat: »Schale einer Auster aus der Great South Bay. Wog zwei und ein viertel Pfund. Zirka fünfzehn Jahre alt. Angeblich die größte, die je aus der G.S.B. geholt wurde.« Eine ähnliche Karte steht neben dem Schädel, auf der zu lesen ist: »Schädel eines Schweinswals, den ein Schleppnetzfischer vor Long Beach auf Long Island aus dem Wasser gezogen hat.« In dem anderen Schaufenster befindet sich eine alte gläserne Kuchentheke. Links vom Eingang steht eine Zigarrenvitrine, die gleichzeitig als Verkaufstheke dient, und ein eiserner Safe mit einer Registrierkasse darauf. Überall an den Wänden hängen Spiegel. Von der mit geprägten verzinnten Paneelen verkleideten Decke hängen vier Lampen und drei elektrische Ventilatoren mit propellerähnlichen Holzblättern. Im Louie’s gibt es nur Gemeinschaftstische, und zwar genau ein Dutzend. Jeweils sechs ragen von den beiden Längswänden in den Raum und sind durch einen breiten Gang getrennt. Es sind lange Tische, schlicht und alt und für die Ewigkeit gebaut. Sie bestehen aus Schwarznussholz; einmal tauschte Louie ein Bein an einem der Tische aus und sagte, es sei ihm vorgekommen, als hätte er einen Nagel in ein Stück Eisen zu schlagen versucht. Die Tischplatten sind imprägniert von Myriaden tropfender, überschwappender Teller mit gekochtem Fisch, und ihre Kanten sind schartig von den Beilen und Ballenhaken, die an den Werkzeuggürteln der Fischhändler hängen. Sie sind alle gleich groß; an einigen haben sechs Gäste Platz, an anderen steht ein Stuhl an der Seite zum Gang, so dass sieben daran Platz haben. Im rückwärtigen Teil des Raums gibt es einen großen, bis zum Boden reichenden Spiegel, der die Küchentür verbirgt und auf den Louie jeden Morgen mit einem Stück angefeuchteter Kreide die Tagesgerichte schreibt. Gelegentlich fällt die Speisekarte recht lang aus. Das Louie’s bietet viele Gerichte, die in anderen Restaurants nur selten auf der Karte stehen. So gab es an einem Tag, eingestreut zwischen den für ein Fischlokal üblichen Speisen, noch Dorschbäckchen, Lachsbäckchen, Dorschzunge, Störleber, Steak vom Blauhai, Thunfischsteak, Tintenfischragout und fünf Arten von Rogen – vom Maifisch, Dorsch, Makrele, Hering und Glasaugenbarsch. Bäckchen sind köstliche Fischfleischhappen, die man im Kopf einiger Fischarten findet, auf jeder Seite eins, gut versteckt zwischen Knochen und Knorpeln. Die Männer, die die Fische in den Filetierhäusern zurechtmachen, schneiden, so sie Zeit haben, ein paar Pfund Bäckchen heraus und verkaufen sie Louie. Auch vom Boston Fish Pier kommen gelegentlich kleinere Lieferungen, und das meiste davon überlassen die Fischhändler Louie, aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. Für die Fischhändler ist das Louie’s eine Art Testküche. Wenn etwas Ungewöhnliches an den Markt geliefert wird, wird es zu Louie gebracht und dort getestet. Im Laufe eines Jahres serviert Louie bestimmt mehr unterschiedliche Fisch- und Meeresfrüchtegerichte als jedes andere Restaurant im Land.
Wenn ich ins Sloppy Louie’s zum Frühstücken gehe, versuche ich einen Platz an einem der vorderen Tische zu ergattern, und meist kommt Louie hinter seiner Registrierkasse vor und empfiehlt mir etwas. Ist der erste morgendliche Ansturm vorüber, holt er sich gelegentlich auch eine Tasse Kaffee und setzt sich zu mir. Eines Morgens, es ist schon eine Weile her, kam er zu mir und ich erkundigte mich nach seinem Befinden, und er sagte, er könne nicht klagen, er habe alle Hände voll zu tun. »Zum Frühstück kommen nach wie vor fast ausschließlich Fischhändler und Fischkäufer«, sagte er, »aber mittags, da hat sich das geändert. Seit den letzten Jahren gehen regelmäßig Leute aus den Vierteln um den Markt herum hierher zum Essen – aus dem Versicherungsdistrikt, dem Finanzdistrikt und dem Kaffeerösterdistrikt. Zwischen zwölf und drei sind es sogar mehr als Fischhändler. Mir war gar nicht bewusst, wie sehr sich das geändert hat, bis ich kürzlich zufällig mitbekommen habe, was für eine bunte Gesellschaft sich an einem der Tische versammelt hatte. Sie plauderten miteinander wie Leute, die sich nicht kennen, und reichten sich gegenseitig das Ketchup. Ich will Ihnen sagen, wer sie waren. Auf der einen Seite saß ein Versicherungsmakler von der Maiden Lane, neben ihm ein Fischhändler namens Frank Wilkisson, dessen Familie schon seit drei Generationen einen Stand auf dem Old Market betreibt, und neben ihm wiederum saß ein Junge aus dem Süden, bei dem man von Glück reden kann, wenn man die Hälfte von dem, was er sagt, versteht, und der einen dieser riesengroßen Kühllaster fährt, mit dem er alle vier, fünf Tage mit einer Ladung Garnelen von den kleinen Häfen in Florida und Georgia zum Markt kommt. Auf der anderen Seite hatte eine Dame Platz genommen, die einen verantwortungsvollen Posten in der Continental Casualty oben auf der William Street innehat und die wegen der Bouillabaisse herkommt, nur nennen wir die hier ciuppin di pesce und kochen sie nach Art der Fischerfamilien in Recco. Ihr zur Seite saß ein alter Herr, der bei J.P. Morgan & Company arbeitet, und von dem man annehmen möchte, er bestellt etwas Teures wie Pompano, aber er bestellt immer Dorschbäckchen, und wenn die Dorschbäckchen aus sind, dann bestellt er Dorschrogen, und wenn der aus ist, dann bestellt er gebratenen Dorsch, und der ist bei Gott nie aus. Neben dem saß einer der Bosse der Mooney’s Kaffeerösterei auf der Fulton und Front. An dem Tischende zum Gang hin saß ein Mann, den alle nur Cowhide Charlie nennen und der in den Schlachthäusern unbehandelte Rinderhäute kauft, um damit die Kapitäne der Fischerboote zu versorgen, die mit ihnen die Unterseiten ihrer Schleppnetze ausrüsten, damit sie nicht vom Meeresboden aufgerieben und von den Felsen aufgeschlitzt werden. Er brüstet sich gerne damit, dass gerade jetzt, in diesem Moment, seine Häute über jeden Fischgrund von den Nantucket Shoals bis zu den Virginia Capes scheuern.«
Louie berichtete, dass an einigen Tagen, besonders freitags, der Laden gegen eins rammelvoll sei und die Zuspätgekommenen sich drinnen an der Tür sammelten und dastünden und warteten und guckten, was ihn immer ganz nervös mache. Er habe daher beschlossen, sich in sein Schicksal zu fügen und einige Tische im ersten Stock aufzustellen.
»Ich hätte das schon längst gemacht«, sagte er, »wenn ich den ersten Stock nicht anderweitig bräuchte. Dieses Haus hat keinen Keller. Die South Street liegt auf aufgeschüttetem Neuland, und die paar wenigen Keller hier in der Gegend laufen bei jedem Hochwasser des East River voll. Mein Keller ist deshalb im ersten Stock. Dort oben bewahre ich meine Vorräte auf und das Tiefkühlgerät steht da und die Kellner ziehen sich dort um. Ich hab keine Ahnung, was ich ohne ihn machen soll, aber irgendwo werde ich schon ein Plätzchen finden.«
»Das kann doch nicht so schwer sein«, sagte ich. »Über dem ersten stehen ja noch vier Stockwerke leer.«
»Sie meinen die vernagelten«, sagte Louie. Er zögerte. »Habe ich Ihnen nie davon erzählt?«, fragte er. »Habe ich Ihnen nie von den vernagelten Stockwerken erzählt?«
»Nein«, sagte ich.
»Sie stehen nicht leer«, sagte er.
»Was ist denn dort?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht«, sagte er. »Mir sind die verschiedensten Dinge zu Ohren gekommen, aber wissen tu ich es nicht. Ich wünschte bei Gott, dass ich es täte. Wie oft hab ich mich das schon gefragt. Vor zweiundzwanzig Jahren habe ich das Haus gemietet und bin nie über das erste Stockwerk hinausgelangt. Das liegt daran, dass die Treppe nur bis zum ersten Stock führt. Danach muss man in einen merkwürdigen alten Fahrstuhl steigen und sich selbst hochziehen. Es ist ein altmodischer handbetriebener Fahrstuhl, früher nannte man die Dinger Handwindenaufzug. Es würde mich nicht wundern, wenn er der letzte seiner Art in New York ist. Ich hab keine Ahnung, wie er funktioniert, die Gegengewichte und die Seile und das ganze Zeug, aber wie man ihn benutzt, das weiß ich. Oben im Schacht befindet sich ein großes Eisenrad mit einer Nut; von einer Seite der Kabine hängt ein Seil, mit dem man die Kabine hochzieht, und wenn man an dem Seilstück an der anderen Seite zieht, fährt man runter. Das ist wie bei einem Speisenaufzug. Früher ist er vom Erdgeschoss bis unters Dach gefahren, aber irgendein Mieter muss vor langer Zeit beschlossen haben, dass er keine Verwendung für ihn hat und ihn loswerden möchte, und da hat er den Schacht vom Erdgeschoss und ersten Stock entfernen lassen. Er hat ihn bis zur Decke im ersten Stock zumachen lassen. Anders gesagt, momentan schließt der Boden des Schachts mit der Decke des ersten Stocks bündig ab – der Boden der Fahrstuhlkabine stellt also einen Teil der Decke dar. Um in den Fahrstuhl zu gelangen, muss man eine Leiter hochklettern, die zu einer in den Kabinenboden geschnittenen Falltür führt. Es ist eine große, geräumige Kabine, größer als die heutzutage, aber sie hat kein Dach – nur den Holzboden und an den Seiten Eisengitter. Manchmal steige ich auf die Leiter, stoße die Falltür auf, stecke Kopf und Schultern in die Kabine und leuchte mit einer Taschenlampe den Schacht hinauf, aber weiter geh ich nicht. Meine Güte, da drin ist es vielleicht dunkel und staubig. Die Kabine ist mit einer dicken Staubschicht überzogen und die Wände des Schachts sind modrig und schimmelig, so dass man kaum Luft kriegt.
Als ich das erste Mal in dieses Haus kam, wäre ich am liebsten sofort in den Fahrstuhl gestiegen und in die oberen Stockwerke gefahren, um dort herumzustöbern, vielleicht gab es ja was zu sehen, aber ich war nicht allein, mein Vormieter führte mich herum, und der warnte mich davor. Er traute dem Fahrstuhl nicht. Er sagte, er würde nicht mal für viel Geld in das Ding steigen. ›Lassen Sie bloß die Finger davon‹, sagte er. ›Das kann schiefgehen. Das Seil könnte reißen oder das große Eisenrad oben im Schacht könnte sich lockern und Ihnen auf den Kopf fallen, es ist nämlich komplett verrostet und wurde seit Jahrzehnten nicht mehr geschmiert.‹ Also habe ich nie auch nur an dem Seil gezogen. Um an dem Seil zu ziehen, muss man in die Kabine steigen und sich aufrichten. Sonst erreicht man es nicht. Oft genug stand ich kurz davor, es mal zu versuchen. Es ist ein dickes Hanfseil. Dick wie ein Ankertau. Kann gut sein, dass es morsch ist, aber eigentlich sieht es nicht danach aus. Der Lage der Kabine nach zu urteilen muss man wahrscheinlich nur ein paar Mal ziehen und das Rad ein paar Mal drehen, und schon ist man weit genug oben, um die Fahrstuhltür zu öffnen und im zweiten Stock auszusteigen. Momentan lässt sich die Tür nicht öffnen; dazu müsste man die Kabine erst ein Stück hochziehen. Nur ein paar Zentimeter. Einmal hab ich meinen Arm in die Kabine gestreckt und versucht, mit einem Bootshaken, den ich mir von einem der Fischerboote geborgt hatte, die Tür zu öffnen, aber sie gab nicht nach. Die ganze Sache lässt mir keine Ruhe. Ich möchte endlich wissen, was dort oben ist. Manchmal vergeht ein Jahr, ohne dass ich daran denke, aber dann fällt es mir wieder ein und geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ein alter Kämpe vom Markt erzählte mir mal, dass sich vor Jahren einer der hiesigen Fischhändler in den Kopf gesetzt hatte, eine retournierbare, mit Zink verkleidete Fischbox patentieren zu lassen, mit der man auf Eis gelegten Fisch verschicken konnte. Er ließ Hunderte von diesen Boxen bauen, steckte jeden Penny rein, und dann blieb er darauf sitzen. Schließlich bekam er die Erlaubnis, die Dinger im zweiten und dritten Stock dieses Gebäudes zu lagern, bis er wusste, was er damit anstellen sollte. Das war, bevor sie den Fahrstuhl umgebaut haben. Nur fiel ihm nie etwas ein, und dann starb er irgendwann. Der Alte meinte, die Fischboxen würden bestimmt noch dort oben stehen. Mein Vorgänger wiederum erzählte eine ganz andere Geschichte. Er war auch nie über das erste Stockwerk hinausgekommen, berichtete aber, einer der Leute, die das Haus vor ihm gemietet hatten, habe ihm erzählt, er glaube, dort oben lagere eine Menge alter Hotelkram ein – Betten und Schreibtische, Waschgeschirr, Nachttöpfe, Spiegel, Messingspucknäpfe, irgendwelches Kleinzeug und alte Hotelregister, von Ratten angenagt, die Papier für ihre Nester brauchen, und weiß Gott was noch alles. Das hat er gesagt. Ich weiß es nicht. Unter anderem deshalb habe ich einmal Nachforschungen angestellt über das Gebäude und bin in mühevoller Kleinarbeit seiner Geschichte nachgegangen, aber da ist noch vieles, das ich nicht weiß. Was ich weiß, ist, dass es vor Jahren einmal ein Hotel war. Es war eines dieser alten Passagierschiffhotels, die früher einmal die ganze South Street entlang gegenüber von den Anlegern standen.«
»Warum holen Sie keinen Mechaniker, damit der sich den Fahrstuhl ansieht?«, fragte ich. »Vielleicht fehlt dem Fahrstuhl ja überhaupt nichts.«
»Das würde was kosten«, sagte Louie. »Ich mag ja neugierig sein, aber so neugierig bin ich auch wieder nicht. Ehrlich gesagt, will ich nur nicht allein in diese Kabine. Ich hab ein komisches Gefühl, schlicht und einfach. Schon bei dem Gedanken krieg ich Beklemmungen – so eingesperrt zu sein und dazu der viele Staub. Da muss ich an einen Sarg denken, und zwar einen Sarg von innen. Entweder das oder an eine Höhle, den Eingang einer Höhle. Wenn mich jemand begleiten würde, jemand, mit dem ich reden könnte, damit ich da drin nicht allein wäre, dann würde ich es machen, dann würde ich sofort reinklettern. Ein paarmal war es fast so weit. Das erste Mal war im Jahr 1938. Die Herbststürme in dem Jahr hatten die Dächer vieler alter Häuser auf der South Street abgedeckt und die Hausverwaltung, von der ich das Haus gemietet habe, schickte einen Mann her, der sich das Dach ansehen sollte. Ich hab ihn gefragt, warum er nicht den Fahrstuhl zum Speicher nimmt, von wo wahrscheinlich eine Tür zum Dach hinausführt. Ich würde ihn auch begleiten. Er warf einen Blick in die Kabine und meinte, das wär ihm zu mühsam. Was macht er also? Er geht einfach aufs Dach des Nachbarhauses und springt rüber. Hat keine Schäden festgestellt. Vor sechs, sieben Monaten dann dasselbe noch mal. Ich unterhalte mich mit einem Gast, einem Bauunternehmer, der hier freitags immer Fisch zu Mittag isst, und durch Zufall komme ich auf die oberen Stockwerke zu sprechen, und er sagt, er könne meine Neugier gut nachvollziehen. Er selbst ginge nur selten an einem zugenagelten alten Haus vorbei, ohne sich zu fragen, wie es da drin aussehen mag – ganz leer und verlassen und dunkel und still, kein einziges Geräusch, außer vielleicht von ein paar Ratten, die in der Dunkelheit rumflitzen, oder von einem Spatz, der durch die verlassenen Räume flattert, denn die kommen immer durch eine Ritze zwischen den Brettern vor einer zerbrochenen Fensterscheibe herein, eine Ritze oder ein Astloch, und manchmal finden sie dann den Weg hinaus nicht mehr und hüpfen und flattern so lange herum, bis sie hungers sterben. Im Zuge seiner Arbeit sei er in vielen solchen Gebäuden gewesen und dabei seien ihm einige seltsame Dinge untergekommen. Als er das nächste Mal zum Mittagessen kam, brachte er zwei von den Helmen mit, die man auf Baustellen trägt, diese orangefarbenen Helme, und sagte zu mir: ›Dann mal los, Louie. Setz einen von den Dingern auf, und ab in den Fahrstuhl. Wenn, was ich nicht glaube, das Seil reißt – was soll’s, ist gut für die Leber, mal ein bisschen durchgeschüttelt zu werden. Und wenn das Rad abfällt, werden uns schon die Helme retten.‹ Nur ist er ein großer, dicker Mann und ein wenig bequem geworden. Er steigt also zuerst auf die Leiter und als er oben ankommt, macht er sofort wieder kehrt. Er hätte am Nachmittag eine geschäftliche Verabredung, sagt er, und wolle nicht völlig verstaubt und verdreckt erscheinen. Die Helme behielt ich. Er wollte sie wiederhaben, aber ich habe sie nicht mehr rausgerückt. Dieser Fahrstuhl soll mir nicht mehr im Weg rumstehen. Irgendwann werde ich mich hinter eine Flasche Strega klemmen und dann werde ich mir einen dieser Helme auf den Kopf setzen, in die Kabine klettern und das verdammte Ding wieder zum Laufen bringen. Wenigstens will ich an dem Seil ziehen und sehen, was passiert. Ich wünschte, ich würde jemanden finden, der neugierig genug ist, mich zu begleiten. Ich habe schon meine Kellner gefragt und bei ein paar Marktleuten angeklopft, aber immer kriege ich dieselbe Antwort: ›Ich bin doch nicht blöd‹, sagen sie.«
Louie beugte sich plötzlich vor. »Wie steht es eigentlich mit Ihnen?«, fragte er. »Vielleicht kann ich Sie ja überreden.«
Ich überlegte kurz und wollte vorschlagen, dass wir zumindest hochgehen und in die Kabine steigen könnten, um uns den Fahrstuhl anzusehen, aber gerade in dem Moment hatte ein Fischhändler sein Frühstück beendet und wollte zahlen, wozu er herrisch mit einer Münze auf dem Glasdeckel der Zigarrenvitrine herumklapperte. »Wenn sie das nur lassen würden«, sagte Louie und stand auf. »Dieses Geklapper geht mir durch Mark und Bein.«
Louie ging hinüber, kassierte und gab dem Mann sein Wechselgeld. An der Besteckkommode im hinteren Teil des Lokals standen zwei Kellner und füllten Salzstreuer auf. Louie winkte einen herbei, damit er die Kasse übernahm. Dann holte er sich eine weitere Tasse Kaffee, setzte sich wieder und fuhr fort. »Ich war nicht besonders angetan von dem Haus, als ich mich hier einkaufte«, sagte er. »Ich nahm mir vor, das Restaurant zum Laufen zu bringen und dann ein anderes Lokal am Markt zu suchen, die Kundschaft würde schon mitgehen. Aber nein, es dauerte nicht lang und mir war das Haus ans Herz gewachsen. Wie es dazu kam, ist schwer zu erklären. Es hat mit dem Namen einer Straße in Brooklyn zu tun und dem letzten Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, bevor ich hierherkam. Das war das Joe’s in Brooklyn, das alte Joe’s in der Nevins Street, um die Ecke von der Flatbush Avenue Extension. Ich war dort sieben Jahre Kellner, und es war das beste Restaurant, in dem ich jemals gearbeitet habe. Mittlerweile gehört das Joe’s zu einer Kette, der Brass Rail. Zu meiner Zeit wurde es von Joe Sartori geführt, einem dieser italienischen Nobelwirte, und war eins der größten Brooklyner Steakhäuser – fünfzig Kellner, riesiger Speisesaal, Balkon, Extraspeisezimmer für Damen und Atrium. Joe’s war Treffpunkt der Brooklyner Parteibonzen und Würdenträger, und dann war da noch eine ganz spezielle Kundschaft, die alten Brooklyner Familien, reiche alte Familien, die allesamt miteinander verwandt oder verschwägert waren und ihr Geld mit Brooklyner Immobilien, Brooklyner Hafenanlagen, Brooklyner Straßenbahnen und Brooklyner Gaswerken gemacht hatten. Ihr ganzes Geld steckte tief im Brooklyner Grund und Boden. Ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht sind sie ja alle in Apartments gezogen, aber damals wohnten viele in herrschaftlichen Häusern mit hoher Eingangstreppe und Buntglasfenstern, die gravitätisch wie Banken auf den Brooklyn Heights und der Park Slope und drüben am Fort Greene Park thronten. Sie waren gute Esser und treue Gäste der gepflegten Brooklyner Restaurants. Man begegnete ihnen im Joe’s und im Gage & Tollner’s, Lundy’s, Tappen’s und Villepigue’s. Viele reiche, alte unabhängige Frauen waren darunter, Witwen, Geschiedene und solche, die nie geheiratet hatten. Die waren eine Gruppe für sich. Sie trugen Kleider, die schon seit Jahren aus der Mode waren, und die größten Hüte, die ich je gesehen habe, und dazu die hässlichsten. Sie schienen sich sämtlich von Kindesbeinen an zu kennen und eine jede hatte ihre Eigenheiten. Alle standen schon mit einem Fuß im Grab und hatten einen gesegneten Appetit. Sie hatten die Welt gesehen, kannten sich mit Essen aus und wussten, was sie wollten. Einige waren rechte Gewitterziegen, und das ist noch milde ausgedrückt, andere herzensgut. Alles in allem mochte ich sie, sie waren mal eine Abwechslung. Unter ihnen waren welche, die stets zu einem meiner Tische kamen, und wenn die besetzt waren, setzten sie sich auf einen der Ledersessel, die Mr. Sartori im Eingangsbereich aufgestellt hatte, und warteten. Da war eine Witwe namens Mrs. Frelinghuysen. Sie war sehr alt und klein und zierlich und haute rein wie ein Scheunendrescher. Sie aß so, als könnte jede Mahlzeit ihre letzte sein. Das Rheuma hatte sie ein wenig lahm gemacht und sie benutzte einen Spazierstock mit einem Schlangenkopf aus Elfenbein als Griff. Sie besaß eine angenehme, schöne Stimme und einen Humor, den man ihr nicht zugetraut hätte. Derb, aber sehr lustig. Hin und wieder fragte ich mich, ob ich recht gehört hatte, wenn sie eine ihrer Bemerkungen losließ. Alle mochten sie und bemühten sich um sie, weil sie so lebenslustig war. Ich erinnere mich, wie Mr. Sartori eines Abends in den Regen hinausging, um ein Taxi für sie zu rufen. ›Sie ist so ein kleines dünnes Dingelchen‹, sagte er bei seiner Rückkehr. ›An ihr ist nicht viel mehr dran‹, sagte er, ›als eine Handvoll Knochen, ein Bauch, ein Gebiss und ein großer Hut mit einem Vogel drauf.‹ Sie hatte stets ihr eigenes Besteck dabei, das war so eine Schrulle von ihr. Es war altes Familiensilber. Sie brachte es eingewickelt in eine Leinenserviette mit, zog es aus der Handtasche und deckte den Platz ein. Wenn sie mit dem Essen fertig war, nahm ich es mit in die Küche und spülte es ab, und sie verstaute es wieder in der Handtasche. Im Winter fing sie stets mit einem Dutzend Austern an, im Sommer mit einem Dutzend großer Venusmuscheln, die sie zur Vorspeise verputzte. Niemand sonst weidete einen Hummer so gründlich aus wie sie. Wenn man dachte, jetzt wäre wirklich kein Fitzelchen mehr daran, brach sie noch die kleinen Beinchen ab, die andere keines Blickes würdigen, und saugte sie aus. Hatte ich an ruhigen Abenden nichts zu tun, rief sie mich zu sich und unterhielt sich während des Essens mit mir. Sie erzählte von Bekannten und von früheren Zeiten. Sie wusste viel; sie ist immer mit offenen Augen durchs Leben gegangen.
Meine Schicht im Joe’s dauerte von zehn Uhr morgens bis neun Uhr abends. Nachmittags hatte ich von drei bis halb fünf Pause. Ich sah so viel gutes, schweres Essen, dass ich meistens nicht zu Mittag essen wollte, aber so geht es den meisten alten Kellnern – nur einen Kanten Brot oder ein wenig Obst. Bei schönem Wetter ging ich rüber zum Albee Square in ein altes Fruchthaus namens Ecklebe & Guyer’s, wo ich mir etwas Obst holte – ein, zwei Orangen, ein paar Weintrauben oder einen dieser großen roten Granatäpfel, die wie Feigen aufbrechen, wenn sie reif sind, und deren kräftiger roter Saft das Blut reinigt. Dann ging ich weiter zur Schermerhorn Street. Die Schermerhorn liegt anderthalb Blocks westlich vom Joe’s. Da standen einige Bänke unter Bäumen. Junge Frauen saßen dort mit ihren Säuglingen, und alte Männer brachten ganze Tage auf den Bänken zu, lasen Zeitung, spielten Dame und debattierten. Dort ruhte ich in meinem bisschen Freizeit meine müden Füße aus, aß Obst und las die New York Times – die New York Times las ich, weil ich mein Englisch verbessern wollte. Die Schermerhorn Street war eine friedliche alte Nebenstraße, ganz ruhig und verschlafen, wie ich es mochte. Es tat mir gut, dazusitzen und mich zu erholen. Eines Tages fragte ich mich, wer Schermerhorn eigentlich war. Zufällig war an diesem Abend Mrs. Frelinghuysen da und ich erkundigte mich bei ihr nach diesem Schermerhorn, nach dem die Straße benannt worden war. Sie wusste es natürlich. Ach, sie wusste mehr als das! Da sie merkte, dass ich mich dafür interessierte, war das fortan eins ihrer Lieblingsthemen – die Straßennamen des alten New York und die Viertel des alten New York, das alte New York hier und das alte New York da. Von ihrer Mutter und Großmutter und den Tanten kannte sie jede Menge Fakten und Zahlen und wusste genug über all die Leichen, die die alten holländischstämmigen New Yorker Familien im Keller liegen hatten. Man nennt sie auch die Knickerbockers – Familien, die prassten und ihr ganzes Vermögen verschleuderten, ausstarben und verschwanden, und Familien, die es noch gibt. Die Holländer, nicht die Deutschen, mit denen ich sie früher verwechselt habe. Die Schermerhorns sind laut Mrs. Frelinghuysen eine der ältesten der alten holländischen Familien, und eine der bedeutendsten dazu. Als New York noch holländisch war, gehörte ihnen viel Land und das ist noch heute so, und sie sind derart tief verwurzelt im alten New York, dass man nichts außer Indianern und Knochen und Bären fände, wenn man tiefer graben würde. Mrs. Frelinghuysen war mit den Schermerhorns gut bekannt. Sie ging zu Schermerhorn’schen Hochzeiten und auf Schermerhorn’sche Beerdigungen. Ich weiß noch, dass sie einmal von einem Schermerhorn-Mädchen erzählte, mit dem sie zur Schule gegangen war. Das Mädchen gehörte, wenn ich mich recht erinnere, der achten Generation an und stammte in direkter Linie vom alten Jacob Schermerhorn ab, der in den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts aus dem holländischen Schermerhorn hierherkam. Dieses Mädchen starb und wurde im Familiengrab der Schermerhorns auf dem Trinity-Church-Friedhof in Washington Heights beigesetzt, und viele Jahre später musste Mrs. Frelinghuysen auf der Fahrt von Connecticut plötzlich an ihre Jugendfreundin denken und sie hielt am Friedhof, suchte ihr Grab, und als sie es gefunden hatte, legte sie ein paar Osterglocken darauf.«
In dem Moment steckte ein Fischhändler den Kopf durch die Tür des Lokals und unterbrach Louie. »Hey Louie«, rief er, »war Little Joe heute schon hier?«
»Little Joe, der Packer vom Pier?«, fragte Louie, »oder Little Joe von Chesebro, Robbins?«
»Der Packer«, sagte der Fischhändler.
»Der ist vor einer Stunde hier aufgekreuzt«, sagte Louie. »Er hat kurz reingeschaut, einen Kaffee getrunken und ist wieder verschwunden.«
»Wenn du ihn siehst«, sagte der Fischhändler, »richte ihm aus, dass sie ihn am Pier suchen. Ein paar Schlepper sind gerade eingelaufen – die Felicia aus New Bedford und die Positive aus Gloucester – und die Ann Elizabeth Kristin aus Stonington ist schon auf dem Fluss auf dem Weg in den Hafen.«
Louie nickte und der Fischhändler ging. »Um mit Mrs. Frelinghuysen fortzufahren«, sagte Louie, »sie starb 1927. Im Jahr darauf heiratete ich. Wieder ein Jahr später war der Börsenkrach. Im folgenden Jahr kündigte ich bei Joe’s, kaufte das Lokal hier und mietete das Haus. Ich mietete es von einer Immobilienfirma, der Charles F. Noyes Company, an die ich auch die Miete zahle, und ich dachte daher, dass es ihnen gehört. Vier Jahre später, Anfang 1934, es muss im März gewesen sein, stand ich nachmittags hinter der Kasse, als eine lange, schwarze Limousine vorfuhr und parkte. Ein Chauffeur in Uniform stieg aus, kam rein und sagte, Mrs. Schermerhorn wolle mit mir reden, und ich sah ihn an und erwiderte: ›Was meinen Sie damit – Mrs. Schermerhorn?‹ Worauf er sagte: ›Mrs. Schermerhorn ist die Besitzerin dieses Gebäudes.‹ Ich ging also raus auf den Bürgersteig und da saß eine wunderschöne Dame in der Limousine und sagte, sie sei Mrs. Arthur F. Schermerhorn und ihr Mann sei letzten September gestorben und deshalb sehe sie sich einige der Häuser an, die sich im Schermerhorn’schen Besitz befänden und die die Firma Noyes verwalte. Sie stellte mir ein paar Fragen über den Zustand des Hauses und dergleichen. Ich beantwortete sie, so gut ich konnte. Dann sagte ich, ich sei aus vielerlei Gründen überrascht, dass dies Schermerhorn-Besitz ist. Ich sagte zu ihr: ›Offen gestanden‹, sagte ich, ›das erstaunt mich.‹ Dann fragte ich sie, ob sie etwas über die Geschichte des Hauses wisse, wie alt es sei, und sie sagte, nein, das tue sie nicht, sie habe es auch noch nie gesehen, es gehöre zu einer Reihe von Immobilien, die ihr Schwiegervater ihrem Mann vererbt habe. Sie zweifle, ob selbst ihr Mann viel von dem Gebäude gewusst habe. Mir schwirrten tausend Fragen durch den Kopf, und ich schlug ihr vor, auszusteigen und hereinzukommen, einen Kaffee zu trinken und sich umzusehen, aber vermutlich dachte sie, dass das Restaurant nicht umsonst Sloppy Louie’s heißt und es hier furchtbar schmuddelig ist. Sie dankte mir also und erklärte, sie müsse weiter, nannte dem Chauffeur eine Adresse, und sie fuhren davon. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen hab.