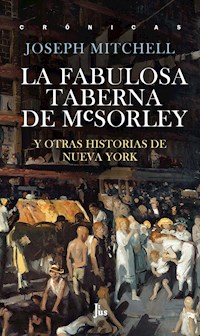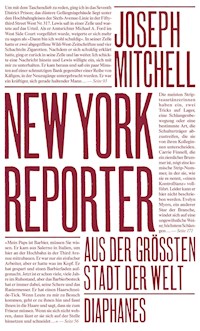
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
Am Tag des großen Börsenkrachs 1929 trifft Joseph Mitchell in New York ein. Er ist ganze einundzwanzig Jahre alt. Als Reporter für The Herald Tribune und The World-Telegram berichtet er bald über Sportereignisse, Mordprozesse, Unfälle, Trivialitäten – und über seine Lieblingsthemen: Randexistenzen, Spinner, Exzentriker. Ob es eine Preisboxerin ist, ein hochintelligenter Gangster oder ein Voodoo-Zauberer, die Ausläufer der italienischen Anarchistenbewegung, der Lindbergh-Prozess oder Burlesque-Clubs: Sie alle schildert Joseph Mitchell mit Enthusiasmus, Empathie, einer ordentlichen Portion Humor und großer Detailfreude. So entsteht ein vielstimmiges Panorama des New Yorker Stadtlebens aus der Zeit der Großen Depression.
In den frühen Kurzreportagen und Kolumnen der Reporterlegende Joseph Mitchell zeigt sich »die größte Stadt der Welt« en miniature. Ein weiterer Band mit schnurgerader Prosa von »Amerikas größtem Reporter« (WDR 5).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
New York Reporter
Joseph Mitchell
New York Reporter
Joseph Mitchell
Aus der größten Stadt der Welt
Aus dem amerikanischen Englisch von Sven Koch und Andrea Stumpf
diaphanes
Titel der englischen Ausgabe:My Ears are Bent © 1938, 1966, 2001 by The Estate of Joseph Mitchell
1. Auflage © diaphanes, Zürich 2013/2021www.diaphanes.net Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-0358-0413-3
Umschlag: Bonbon, Zürich Satz: 2edit, Zürich Druck: Steinmeier, Deiningen
INHALT
Ich bin ganz Ohr
Trunkenbolde
Bar and Grill
Das Jahr des Herrn 1936 oder Hau mich, William
Cheese-cake
Ein paar Jungfrauen, keine Professionellen
Nackt, komplett nackt
Tanya
Fast schon heilig
Sally Rand und ein Spanferkel
Der Einfluss Mr. L. Sittenbergs auf den Fächertanz
Kommt zu Jesus
Streiter gegen Schnaps, liederliche Weiber, Spielautomaten und Sprücheklopfen, oder: Wo verbringst du die Ewigkeit?
Bitte Ruhe, wenn die rote Lampe leuchtet
Abgesehen davon, dass sie raucht, trinkt und flucht, ist Miss Mazie eine Nonne
Sportteil
»Sonst meint noch wer, ich bin ein Ringer«
Die Faustkämpferin
Ein alter Baseballspieler in Winterunterwäsche
»Da hat wer wohl was Schlechtes gegessen«
Joe ist, wie er ist, aber mit Louis hatte er Recht
Zum Kampf ist Harlem gerammelt voll
Die größte Stadt der Welt
Eine kalte Nacht in Downtown
Die Marihuana-Raucher
Voodoo in New York
Einen Dollar fürs Baden
»Sie sehen heute schon besser aus«
Die Bäuerin in Red Hook
Davon weiß ich rein gar nichts
Es waren heiße Nachmittage in Manhattan
Hinrichtung
Existenzen
Der gelbe Zettel verzeichnet dreiundfünfzig Verhaftungen
Die Tretmühle
Stadtbekannter Anarchist genießt Ruf als Schurke
ASCAP-Kontrolleur
Salzwasserfarmer
Neue Folgen der Witzzeichnung
Bühnenleben
George Bernard Shaw
Gene Krupa möchte afrikanisch swingen
George M. Cohan
ICH BIN GANZ OHR
Bis auf eine kurze Zeit im Jahr 1931, als ich des ganzen Betriebs überdrüssig wurde und auf einem Frachter anheuerte, der Baumaschinen nach Leningrad beförderte und sowjetisches Papierholz zurückbrachte, war ich während der vergangenen acht Jahre Zeitungsreporter in New York City. In dem Sommer nach meinem Abschluss an der University of North Carolina wurde ich am Blinddarm operiert, und während ich genas, las ich James Bryce’* Buch Amerika als Staat und Gesellschaft, das in mir den Wunsch weckte, politischer Reporter zu werden. Mit diesem Vorsatz ging ich nach New York City. Soweit ich weiß, war meine erste eigene Geschichte ein Bericht über einen Jack-the-Ripper-Mord in einem Apartmenthaus in Brooklyn; eine alte Frau war in ihrem Schlafzimmer, dessen Wände fast ganz mit großen unzüchtigen Fotografien bedeckt waren, mit einem Seidenstrumpf erdrosselt und erstochen worden.
Ich war als Nachtreporter bei der Herald Tribune für einen Distrikt zuständig. Stundenlang saß ich in einem alten Mietshaus gegenüber dem Polizeipräsidium von Brooklyn in einem verlausten Sessel und wartete darauf, dass etwas Schlimmes passierte. Alle Zeitungen hatten ihre Vertretungen in diesem Haus. Sobald etwas geschah, gab uns der Mann am Empfang des Präsidiums Bescheid, und wir alle verließen das Mietshaus und eilten zum Schauplatz des Mordes oder des Überfalls oder des Unfalls oder der Schlägerei oder des Feuers oder des Was-auch-immer. Dann übermittelten wir die Nachricht telefonisch an einen Tischredakteur. Vier Monate lang arbeitete ich in verschiedenen Distrikten. Ich berichtete aus Brooklyn, aus der West Side von Manhattan und Harlem. Harlem mochte ich am liebsten.
In Harlem hatten die Reporter ihre Bude – so nannten wir in den Distrikten unsere Büros – im Erdgeschoss des größten Harlemer Hotels, des Hotel Theresa, und davor saßen wir immer in Drehstühlen auf dem Gang und beobachteten die Leute, die auf der Seventh Avenue, Harlems Hauptstraße, vorbeigingen. Es gab vier Nachtreporter in Harlem, drei von den Morgenzeitungen und einen von der City News Association. Meine Kollegen waren alte Hasen. Was sie an einem Reporter am meisten verabscheuten, war Begeisterung, und ich war stets mit Feuereifer bei der Sache. Jedes Mal wenn ich meiner Redaktion am Telefon einen Bericht durchgab – in der Telefonzelle versuchte ich immer, den Hörer wie sie nur auf der linken Schulter zu balancieren, aber das klappte nie –, standen sie vor der Telefonzelle, tippten sich an die Stirn und machten mit dem Zeigefinger kleine Kreise in der Luft, um mir zu bedeuten, ich sei plemplem. Abwechselnd klapperten wir die Polizeiwachen ab. Dabei besuchten wir auch gern mal eine Flüsterkneipe, ein Nachtlokal oder eine Spielhölle und versuchten, eine Story daraus zu stricken. So lernte ich ein paar Gestalten aus der Unterwelt kennen, denen ich damals gerne zuhörte.
Eine war Gilligan Holton, ein Neger, der eine Kneipe der »persönlichen« Art führte – sie befand sich in einem Keller – und die Broken Leg and Busted hieß; einen besseren Namen hatte nur das etwas später eröffnete Heat Wave Bar & Grill. Als ich in Harlem arbeitete, betranken sich dort jeden Abend viele wohlhabende Männer und Frauen aus Downtown, und Holton wusste über alle etwas zu berichten, auch manches, wovon einem die Ohren schlackerten. Ich erinnere mich an eine gutbetuchte Frau, die regelmäßig in Holtons Kellerkneipe kam; sie ließ Neger – meist Stepptänzer – immer ärztlich untersuchen, bevor sie ihre Affären mit ihnen begann. Sie hatte auch eine erwachsene Tochter. Jeden Abend sah ich diese feine Dame und ihre Tochter in den Bars von Harlem scharwenzeln. Ehe ich nach New York City kam, hatte ich noch nie in einer Stadt mit mehr als 2.699 Einwohnern gelebt, daher war ich abwechselnd entzückt und entsetzt über das, was ich in Harlem zu Gesicht bekam. Um drei Uhr nachts hatte ich Dienstschluss. Danach spazierte ich durch die Straßen, sah mich um und entdeckte, was die große Wirtschaftskrise und die Geilheit der Weißen einem Volk antaten, das stets zuletzt geheuert und immer zuerst gefeuert wird. Wenn ich genug gesehen hatte, was meist bei Tagesanbruch der Fall war, stieg ich in die Untergrundbahn und fuhr nach Greenwich Village zu meinem möblierten Zimmer für neun Dollar die Woche. Sobald ich am Sheridan Square aus der Bahn ausgestiegen war, besorgte ich mir eine Herald Tribune, um nachzusehen, was der Tischredakteur aus den Berichten gemacht hatte, die ich vor Stunden am Telefon durchgegeben hatte. Ich besaß einen Polizeireporterausweis, ich war einundzwanzig Jahre alt und alles war neu für mich. Am Ende meiner Zeit in Harlem war ich so fasziniert von dem allnächtlichen Melodram der Metropole, dass ich mein Ziel, politischer Reporter zu werden, vergaß.
Harlem war mein letzter Distrikt als Reporter. Danach kam ich in die Lokalredaktion und durfte selbst Artikel schreiben. Mein Vorgesetzter war Stanley Walker, ein schmaler, ruhiger, aber unberechenbarer Texaner und zu jener Zeit der berühmteste Lokalchef. Ich war im Ressort Vermischtes und bekam meist Kriminalfälle. Die einzigen Kriminalnachrichten, die ich mochte, waren die über Gangster-Beerdigungen, und in jenem Jahr gab es davon ziemlich viele von der großen Sorte. Berichte über Verbrechen, insbesondere über Mord, waren in der Herald Tribune schwierig, da wir angewiesen waren, das Wort »Blut« zu vermeiden. Einer der Besitzer mochte es nicht. In manchen Fällen war diese Form von Takt ein Ding der Unmöglichkeit. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Gang in eine Flüsterkneipe in der Elizabeth Street, um darüber zu berichten, dass man einen kleinen Ganoven erstochen hatte. Es war die Art Kneipe, in der sich künstliche Weinreben um Sitznischen rankten. Nachdem man dem Gangster die Kehle durchgeschnitten hatte, war er aus seiner Nische gekrochen und durch das ganze Lokal getaumelt, und mit jedem Schritt hatte er mehr Blut verloren. Der kleine Laden sah aus, als wäre er mit Blut ausgespritzt worden …
Ich wurde es leid, diesen Dutzendmorden hinterherzuhecheln – in jenem Jahr schien die eine Hälfte der Leute im Großraum New York die andere umbringen zu wollen –, und so ging ich eines Morgens nach Downtown und heuerte auf einem heruntergekommenen Hog-Island-Frachter*, der City of Fairbury, als Decksjunge an. Für vierzehn Tage machten wir in Leningrad fest. Ein Kamerad und ich lernten ein paar sommersprossige braunäugige Frauen kennen, die in den Kaianlagen arbeiteten – sogar die Kranführer waren Frauen –, und gingen mit ihnen in einem Kino am Prospekt des 25. Oktober* in einen Charlie-Chaplin-Film. Jedes Mal, wenn Chaplin auf die Nase fiel – es war einer der Filme, in denen er Rollschuh lief –, rammte mir die Frau, mit der ich dort war, johlend den Ellbogen in die Seite. Am nächsten Tag besorgten die beiden Frauen Fahrkarten für den Zug nach Detskoie Selo* und zur ehemaligen Sommerresidenz der Zarenfamilie, die mittlerweile ein Erholungsheim für Arbeiter und ihre Kinder ist. Es liegt südlich von Leningrad, und das flache, sumpfige Land erinnerte mich an North Carolina. Irgendwo auf dem gewaltigen Anwesen sammelten die Frauen wilde Erdbeeren, und am Abend buken sie Törtchen mit einer wilden russischen Erdbeere auf jedem davon. Wir aßen sie und uns wurde schlecht. Ich weiß noch gut, wie stolz sie waren, als sie uns mit einem Lächeln die Törtchen auftischten, und wie sehr wir uns schämten, als uns ungefähr eine Stunde später schlecht wurde. Wir vermuteten, dass das für uns ungewohnte Wasser Schuld war, aber das konnten wir ihnen nicht erklären, da wir kein Russisch sprachen. In Leningrad schwammen wir jeden Tag unter der milden russischen Sonne nackt in der Newa. Eines Nachmittags versammelten sich die Seeleute aller amerikanischen Schiffe im Hafen und wir marschierten gemeinsam mit den Russen bei einer alljährlichen Demonstration gegen den imperialistischen Krieg. Eines Abends lud mich eine junge Frau zu sich nach Hause ein, und ich aß mit ihrer Familie zusammen dicke Kohlsuppe und ein Schwarzbrot, das nach feuchtem Korn roch. Nach dem Essen sang die Familie. Die junge Frau sprach ein wenig Englisch und bat mich, ein amerikanisches Lied zu singen. Ihr zuliebe sang ich das einzige, das mir einfiel und das bei meiner Abfahrt aus New York City sehr beliebt gewesen war, »Body and Soul«*. Es schien sie etwas zu überraschen.
Ich verließ den Frachter, als er im Hafen von Albany festmachte und seine Ladung Papierholz löschte. Von dort nahm ich einen Bus nach New York City und wenige Wochen später trat ich eine Stelle bei The World-Telegram an, einer Nachmittagszeitung, für die ich noch immer arbeite. Bislang wurden mir überwiegend Reportagen und Interviews übertragen, und dabei haben mich einige der fabelhaftesten Vielredner der Welt gequält – darunter George Bernard Shaw und der bekannte, überaus redselige Pädagoge Nicholas Murray Butler* –, so dass ich schon vor geraumer Zeit mein Gespür für Wahnsinn verloren habe. Manchmal muss ich für einen Artikel eine psychiatrische Station besuchen und stelle nie einen Unterschied fest. In einer Zeitungsredaktion gleicht kein Tag dem anderen, und der, den ich gleich beschreibe, ist um nichts wirrer als hundert andere.
Als ich eines Morgens um neun Uhr ins Büro kam, erhielt ich den Auftrag, einen italienischen Maurer zu suchen und zu interviewen, der dem Prince of Wales ähnlich sah; jemand hatte angerufen und gesagt, dass man ihm eine Stelle in Hollywood angeboten hatte. Ich fand ihn im Keller einer Matzen-Bäckerei in der East Side, wo er einen Ofen reparierte; ich geriet mit dem Betreiber der Bäckerei in Streit, weil er mich für einen Inspektor des Gesundheitsamtes hielt. Schließlich drang ich zu dem Maurer vor, doch der wollte nicht über sich sprechen und sagte immer nur: »Ich will keine Scherereien.« Ich ging zurück ins Büro und schrieb den Artikel, und dann sollte ich ein Interview mit einer Boxerin führen, die im St. Moritz Hotel logierte. Sie hatte ihre gesamte Boxausrüstung im Hotelzimmer. Das Zimmer roch nach Schweiß und feuchtem Leder und ließ mich an die Umkleideräume in der Trainingshalle von Philadelphia Jack O’Brien* an einem Regentag denken. Sie erzählte mir, dass sie nicht nur ein weiblicher Boxer, sondern auch eine Gräfin war. Dann zog sie die Handschuhe an und führte mir ihre Kampftechnik vor, und wenn ich nicht unter das Bett geflüchtet wäre, hätte sie mich vermutlich niedergeschlagen. »Ich bin ein Wirbelwind«, schrie sie. Ich ging zurück ins Büro und schrieb den Artikel, und dann sollte ich Samuel J. Burger interviewen, der in der Redaktion angerufen und damit angegeben hatte, dass er höheren Herrschaften Rennkakerlaken zu fünfundsiebzig Cent das Paar verkaufte. Mr. Burger ist Theateragent, der Attraktionen wie den Vater von John Dillinger*, Nackttänzerinnen und Mrs. Jack (Legs) Diamond* unter Vertrag hatte. Einmal wollte er sogar sämtliche Geschworenen im Lindbergh-Prozess engagieren. Ich traf ihn in einem Feinkostladen am Broadway, wo er für einige Stripteasetänzerinnen Schinken-Käse-Sandwiches besorgte. Er zog einen auf seinen Namen ausgestellten Scheck hervor, der belegte, dass er an eine Dame der Gesellschaft, die als gute Gastgeberin Schwung in ihre Party bringen wollte, Kakerlaken geliefert und sie bezahlt bekommen hatte. Mr. Burger sagte, er habe ein Unternehmen gegründet, Ballyhoo Associates, das Tiere an Menschen vermietet. »Ich vermiete viele Affen«, erzählte er mir. »Wenn sich jemand einsam fühlt, ruft er mich an, damit ich ihm einen Affen als Gesellschaft schicke. So ein Affe ist schließlich auch ein Säugetier, genau wie wir.« Ich schrieb den Artikel und ging dann nach Hause. Wieder was geschafft.
Glauben Sie aber nur nicht, Vielredner können mich aufregen. Die einzigen Menschen, denen ich nicht gerne zuhöre, sind Damen der besseren Gesellschaft, Wirtschaftskapitäne, berühmte Schriftsteller, Priester, Filmschauspieler (mit Ausnahme von W. C. Fields* und Stepin Fetchit*) und alle Schauspielerinnen unter fünfunddreißig. Die interessantesten Menschen sind für mich, jedenfalls was Gespräche betrifft, Ethnologen, Bauern, Prostituierte, Psychiater und ab und zu ein Barmann. Die besten Gespräche sind ungekünstelt, Gespräche von Menschen, die sich Mut zusprechen oder einander trösten, von Frauen, die in der Sonne um Kinderwagen herum stehen und sich über ihre Zeit im Krankhaus oder über die steigenden Fleischpreise unterhalten, oder von Männern, die in Kneipen gegen die uns alle befallende Einsamkeit anreden. Die Gespräche für ein Zeitungsinterview sind normalerweise im Voraus abgesprochen und gestellt.
Ab und zu allerdings sagt jemand etwas so Unerwartetes, dass es großartig ist. Einmal arbeitete ich an einer Artikelfolge über Voodoo und Schwarze Magie in New York City. Zusammen mit einem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt führte ich ein langes Gespräch mit einer schwarzen Prostituierten. Aus der etwas rätselhaften Geschichte, die sie dem Beamten von der Sitte, der sie ins Kittchen gesteckt hatte, erzählte, schloss der Bezirksstaatsanwalt, dass sie in einer Schwarzen Messe als Altar gedient hatte. Da sie das Ganze nicht für besonders ungewöhnlich hielt, war sie keine große Hilfe. Mit seinem Latein am Ende, fragte sie der Bezirksstaatsanwalt zuletzt, wie sie überhaupt Prostituierte geworden sei, und sie sagte: »Ich wollte eben entgegenkommend sein.«
Wenn man zu einem Interview geschickt wird, weiß man selten, wonach man fragen soll. In der Redaktion heißt es: »Wir brauchen ein Interview mit dem und dem.« Daraufhin trifft man sich mit der jeweiligen Person und fängt das Gespräch an. Dabei muss es schnell gehen, auch wenn die wenigsten Menschen einfach den Mund aufmachen und etwas von sich geben, das den Abdruck in einer Zeitung lohnt. Die beste Eröffnung eines Interviews mit einer bekannten Persönlichkeit ist für gewöhnlich, sich das Schlimmste ins Gedächtnis zu rufen, das man über sie gehört hat, und dann zu fragen, ob es wahr ist. Man muss sein Gegenüber wütend machen, aber nicht zu wütend. Ich erinnere mich noch gut an das eisige Funkeln, das in die Augen von Aimee Semple McPherson* trat, als ich sie fragte, ob es stimmte, dass sie ihren Ehemann, den stämmigen Schlagersänger David L. Hutton, zum Priester geweiht habe, damit er umsonst Eisenbahn fahren konnte. Das ist aber nicht in jedem Fall klug. Immer wenn ich Mrs. Ella A. Boole*, die Gesamtvorsitzende der Woman’s Christian Temperance Union, interviewen soll, versuche ich den Eindruck zu erwecken, ich sei ein noch entschiedenerer Gegner des Alkohols als sie.
Manche Menschen – zum Beispiel Gertrude Stein*, Emma Goldman*, Gilda Gray*, Eleanor Holm* und Peter J. McGuinness*, der Sheriff von Brooklyn – schütteln zu jeder Tages- und Nachtzeit mehr als genug zitatreife Sprüche aus dem Ärmel. (Gilda Gray, die polnische Shimmy-Tänzerin, ist ganz wunderbar. Einmal besuchte ich sie wegen des Gerüchts, sie habe sich mit einem dieser reichen Erben verlobt. Sie spürte, dass sich daraus keine gute Geschichte machen ließ, und erzählte mir stattdessen von einem Besuch in ihrer ehemaligen Klosterschule in Milwaukee. Sie war dort zum Mittagessen mit den Nonnen gewesen, doch ehe sie sich zu Tisch begeben hatte, zeigte sie ihnen ein paar Schritte des Black Bottom, eines Tanzes aus den zwanziger Jahren*. »Um der alten Zeiten willen hab ich ein bisschen mit dem Hintern gewackelt«, sagte Miss Gray. »Das hat ihnen ziemlich gut gefallen.«) Die zwei Arten Mensch, deren Sprüche immer unterhaltsam sind, sind enttäuschte, bissige alte Schauspielerinnen, die ihre beste Zeit hinter sich haben, und Menschen mit Phobien, insbesondere Weltuntergangspropheten. (Draußen auf Long Island lebte einmal ein schwermütiger Mann namens Robert Reidt, der mit seiner ganzen Familie immer auf einen Hügel in der Nähe von East Patchogue stieg und dort auf den Untergang wartete. Er sagte zwanghaft das Weltende voraus. Eines trüben Tages rief ich ihn an, um mich zu erkundigen, ob’s schon was Neues zum nahen Weltuntergang gäbe, als das Fräulein vom Amt sagte: »Der Anschluss von Herrn Reidt ist stillgelegt.«) Eine Frau, mit der sich die Gespräche überhaupt nicht planen ließen, war die verstorbene Mary Louise Cecilia (Texas) Guinan*. Einmal fuhr ich mit ihr nach Flushing, wo sie und ihre »Gang of the Twenty Beautiful Guinan Girls« in einem Vaudeville auftraten. Die Fahrt unternahmen wir in ihrem kugelsicheren Wagen, ein Auto, das früher dem Halsabschneider Larry Fay* gehört hatte. Irgendwer wollte ein Stück über das Leben von Aimee Semple McPherson auf die Bühne bringen, und Miss Guinan sollte die Hauptrolle übernehmen. Ich merkte an, dass Mrs. McPherson den Produzenten sicher verklagen würde. »Das«, sagte Miss Guinan, »juckt mich doch nicht die Bohne.«
Ich mag es sehr, wenn ein Interview so anfängt. Ich bewundere die Bildlichkeit vulgärer Sprache. Ich fände es schön, wenn die Zeitungen den Mut hätten, Gespräche öfter so zu drucken, wie sie wirklich ablaufen, einschließlich der Obszönitäten. Zum Beispiel können einige der passendsten Bonmots von Bürgermeister La Guardia* in keiner New Yorker Zeitung abgedruckt werden. Lässt ein Reporter etwas ungewöhnlich Saftiges in eine Geschichte einfließen, dann kürzt es irgendein Schlussredakteur heraus. Es gibt dutzende hervorragender Schlussredakteure bei den New Yorker Zeitungen, aber die meisten scheinen so gelangweilt, dass ihnen alles egal ist. Man muss sie gar nicht zensieren; sie zensieren sich selbst. Offenbar ist ihnen eine scheußliche Wohlanständigkeit lieber als der exakte Wortlaut; sie streichen einem das Wort »Wampe« aus dem Manuskript und ersetzen es durch das Brechreiz erregende »Bäuchlein«. Ich habe selbst gelesen, wie ein Zuhälter als »ein Vertreter des Sündenkartells« bezeichnet wurde. In der Zeitung, für die ich arbeite, schreiben die Reporter »vergewaltigt« und aus der Druckerpresse kommt unweigerlich »schändlich angegriffen« heraus. Schlussredakteure scheinen auch Wortflitter wie »zierlich« zu mögen. In einer Zeitung sah ich, wie Lottie Coll* tagelang als »zierliche Kanonen-Puppe« bezeichnet wurde, obwohl Lottie so groß ist wie Jack Dempsey* und doppelt so abgebrüht. Ein guter Schlussredakteur würde ein Wort wie »zierlich« schon aus Prinzip von jeder Manuskriptseite verbannen. Einmal schrieb ich über eine politische Versammlung, in der ein beschwipster Staatsmann seinen Gegner fünfzehn heftige Minuten lang beschimpfte. Er spuckte so viel Gift und Galle, dass ich befürchtete, er würde sich selbst die Zunge verätzen. Einige der weniger anstößigen Worte habe ich dann in meiner Geschichte verwendet, aber der Schlussredakteur strich sie heraus und fügte stattdessen ein: »Commissioner XY erklärte, sein Gegenüber sei nicht mit der Thematik vertraut.« Kein Zorn gleicht der blinden Wut*, die ein Reporter verspürt, wenn er seinen Namen unter einem Artikel sieht, der von einem Schlussredakteur oder jemandem aus der Chefetage kastriert wurde. Die für ein Zeitungsinterview uninteressantesten Menschen sind diejenigen, die eigentlich am interessantesten sein sollten: Wirtschaftskapitäne, Autofabrikanten, Finanzmogule, Öl- und Stahlbarone und dergleichen. Entweder quatschen sie einem das Ohr voll mit dem Unsinn über ihre bescheidenen Anfänge (»Als ich hier in diesem Land ankam, hatte ich bloß siebzehn Cent und ein Mohnbrötchen, und jetzt bin ich Generaldirektor«), oder sie sitzen nur rum und gucken griesgrämig. Nach einem drögen Interview mit einem dieser Herrschaften fährt man mit dem Fahrstuhl nach unten und tritt auf die Straße und sieht die hübschen Mädchen, die hübschen Arbeitermädchen, unter deren Kleidern fröhliche Brüste auf und ab wippen, und ein Stein fällt einem vom Herzen; man hat das Gefühl, als wäre man einem Grab entstiegen, in dem sich die Würmer schon an die Arbeit machen wollten; man hat das Gefühl, betrügen, lügen, stehlen, Läden ausrauben oder völlig betrunken im Rinnstein zu liegen wäre besser als wie so ein Wirtschaftsführer mit einem Gesicht wie ein Napf kalten Haferschleims zu enden. Kaum angenehmer sind die Damen der besseren Gesellschaft. Für mich sind Sie so wichtig wie der Stechapfel und der Wurmfortsatz des Blinddarms; ich weiß überhaupt nicht, warum es sie gibt. Außerdem haben sie schlechte Manieren. Im Zuge meiner Arbeit hatte ich mit dutzenden betrunkenen Witwen und dämlichen, lüsternen Debütantinnen zu tun, und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Damen der besseren Gesellschaft der Vereinigten Staaten die schlechtesten Manieren aller Frauen weltweit haben; im Vergleich zu ihnen sind Kaffeehausbedienungen die Freundlichkeit in Person.
Politiker machen es einem Reporter in der Regel leicht. Manche sind so unterhaltsam, dass man eigentlich nur mitschreiben muss. (Herbert Hoover* gehört nicht zu ihnen. Er ist eher von der trübseligen Sorte. Ich habe ihn zweimal interviewt und jedes Mal hat mich sein Gesicht an das eines feisten Säuglings mit Blähungen erinnert.) Möglicherweise wirft es ein schlechtes Licht auf die amerikanische Presse, aber in den meisten Zeitungen sollen Interviews nicht informieren, sondern unterhalten. Aus diesem Grund sind Männer wie Huey Long* und Hyman Schorenstein*– ein Bezirksvorsitzender der Demokraten in Brooklyn, dem man nachsagt, nicht lesen und schreiben zu können – wie dafür geschaffen. Ein Interviewer beurteilt öffentliche Personen ziemlich bald nach ihrem Unterhaltungswert, ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche Bedeutung. Es ist recht schwer, in einer Redaktion ein Interview mit Professor Franz Boas, dem berühmtesten Ethnologen der Welt, durchzubekommen, dafür wird ein beliebiges Interview mit Oom the Omnipotent* mit einer zweizeiligen Überschrift als großer Aufmacher erscheinen. Auch wird die amerikanische Presse stets den Hanswursten nachlaufen und nur auf den Schwachen und Exzentrischen rumhacken. In Nicholas Murray Butlers Dutzend-Verlautbarungen sind sogar die Strichpunkte bombastisch, aber die Zeitungen bringen sie trotzdem an beinahe jedem Montagmorgen des Jahres auf dem Titel. Wenn Nicholas Murray Butler und Peter J. McGuinness genau dasselbe sagen würden, dann brächten die Zeitungen Mr. Butler allerhöchsten Respekt entgegen, während sie Peter zum Faselhans machten, der besser den Mund hielte. An die Wahrheit kann man sich nur halten, wenn man über Verrückte und Nichtsnutze schreibt. Erst wenn eine öffentliche Person etwas Lächerliches tut, dürfen Reporter wahrheitsgemäß über sie berichten. J. P. Morgan wurde immer mit großer Achtung behandelt, bis er mit einer Liliputanerin Hoppe-Hoppe-Reiter spielte*; danach hatten die Zeitungen keine Angst mehr vor ihm.
Huey Long ist, wie erwähnt, für Interviews wie geschaffen. Selbst ein Reporter, der kaum einen Stift halten kann, könnte einen Roman über ihn schreiben. Als ich ihn das letzte Mal sah, saß er mit einem Brummschädel im Waldorf-Astoria im Bett. Er hatte einen zweiteiligen, hellblauen Schlafanzug an und gähnte und kratzte sich an den Zehen. Drei Reporter waren bei ihm im Zimmer und stellten ihm Fragen. Auf jede antwortete er: »Das ist eine Lüge«, und lachte heiser. Dann setzte er sich auf die Bettkante und erzählte eine lange wirre Geschichte von einem Verwandten, der eine Kneipe betrieb. Der Politiker, der am generösesten wirre Zitate lieferte, war allerdings der frühere Bürgermeister von New York City, John P. O’Brien*. Für seine Reden hätte er auch Eintritt verlangen können. Einmal hörte ich ihn vor einer Versammlung von Frauen sprechen und da sagte er: » Unter der Woche lasten gewichtige Aufgaben auf mir. Ich treffe großartige Persönlichkeiten und muss hierhin und dorthin, um den Pflichten nachzukommen, die mit meinem Amt als Bürgermeister einhergehen. Deswegen bin ich, wenn ich hier vor diese große Versammlung trete und die Blüten und Knospen sehe, die Frauen, Mädchen und Witwen, tief bewegt und meine Gefühle schlagen hoch.« Ein anderes Mal erhob er sich und sagte: »Lieber Herr Vorstandsvorsitzender und, wenn Sie erlauben, liebe Brüder! Jedes Mal, wenn ich in einen Raum so voller hervorragender Männer komme, fühle ich mich als einer der ihren.« Einmal sprach er vor der Ohio Society und trug ein Gedicht vor, seufzte und sagte: »Hin und wieder sehne ich mich nach einem guten alten Fluss oder nach irgendeinem Böhmen, wo man der ganzen Hektik entfliehen kann.« Ich habe mehr als einmal erlebt, wie ihn ein verdutztes Publikum anstarrte und sich fragte, worauf er hinauswollte. Eines Abends hörte ich ihn davon erzählen, wie er beinahe von der Ladekante eines Möbelwagens abgerutscht sei, und ich war so fasziniert, wie die Worte aus seinem Mund purzelten, dass ich das Mitschreiben vergaß. Nach der Rede ging ich zu einem Stenographen, den er selbst mitgebracht hatte, und überredete ihn, mir diesen Teil der Rede vorzulesen. Am nächsten Tag brachten wir die Sache in der Zeitung, worauf zwei seiner Wahlkampfleute vorbeikamen und behaupteten, ich hätte mir das alles ausgedacht, und mit einer Klage über 150.000 Dollar drohten.
Kein Reporter kann auf Dauer Interviews machen, ohne ein wenig meschugge zu werden; früher oder später fängt man an, Stimmen zu hören. Ich finde, die Journalistengewerkschaft American Newspaper Guild, deren Mitglied ich bin und an deren Ziele ich glaube, sollte sich, sobald sie ein paar wichtigere Dinge durchbekommen hat, dieses Problems wirklich annehmen. Wenn der verantwortliche Redakteur bemerkt, dass du mit zerfurchter Stirn auf deine Notizen starrst und dem maulfaulen Püppchen, das du gerade interviewt hast, die Pest an den Hals wünschst, ist er manchmal so nett und schickt dich für ein paar Stunden auf die Straße oder in die Schlussredaktion, oder vielleicht kommt auch eine Sensationsnachricht daher und rettet dich vorm drohenden Wahnsinn. Gerade wenn man drauf und dran ist, einer der Berufskrankheiten des Reporters zu erliegen – wozu Verstopfung, Alkoholismus, Zynismus und Nicholas Murray Butler gehören –, platzt für gewöhnlich eine wichtige Nachricht herein, ein Knüller, der einen aus dem Büro treibt.
Mich hat einmal der Lindbergh-Prozess gerettet. Ich hatte kurz nacheinander einen Schlagersänger bei seinem Comeback, einen verletzten Trapezkünstler, den Besitzer einer Heiratsvermittlung, einen Erdbebenforscher, eine Bestatterin, einen Mann, der die Fächer für Fächertänzerinnen herstellt, einen Rekord-Blutspender und Samuel Goldwyn* interviewt und ich fing schon zu winseln an, sobald ich nur in die Nähe einer Schreibmaschine kam. Da wurde ich nach Flemington in New Jersey geschickt, um über das Verfahren gegen Hauptmann*, den mutmaßlichen Entführer des Lindbergh-Babys, zu berichten. Für die meisten dorthin beorderten Reporter war das Verfahren ein Alptraum, und noch ehe es vorüber war, hatte ich selbst angefangen, in Zungen zu reden, aber anfangs war es sehr angenehm, keine Fragen stellen zu müssen, sondern nur still dazusitzen und jenen des Staatsanwalts von New Jersey zuzuhören. Im Vergleich zu vielen anderen Zeitungsarbeiten sind Gerichtsreportagen leicht – das heißt zumindest, wenn es sich um Mordanklagen handelt; ein Verfahren wie das gegen die Bank of United States* ist etwas ganz anderes. Finanzstrafsachen sind eine Tortur. Bei einer Mordanklage sitzt man einfach da und schreibt mit. Hat ein Reporter eine Weile nur Reportagen geschrieben, gibt es nichts Besseres als ein flottes Mordverfahren, um ihn wieder auf Trab zu bringen. Es bringt ihn davon ab, aus jeder kleinen 08/15-Geschichte Literatur machen zu wollen; für Zeitungen gibt es nichts Ärgerlicheres als einen Reporter, der immerzu literarisch schreiben möchte.
In diesen so konfusen Wochen des Verfahrens gegen Hauptmann hatte meine Redaktion wenigstens zehn Reporter nach Flemington entsandt – im Vergleich zu unseren Konkurrenten waren wir unterbesetzt – und unsere Berichterstattung war besser als die jeder anderen Nachmittagszeitung. Das lag daran, dass wir jeden Abend, wenn das Gericht sich vertagte, die fiebrige Atmosphäre Flemingtons, wo sich die Reporter zwangsläufig drängten wie Würmer in einem Anglereimer, verließen und erst am nächsten Morgen, wenn die neue Sitzung begann, wiederkamen.
Während des gesamten Verfahrens lebten wir etwa fünfzehn Kilometer von Flemington entfernt in einem kleinen Hotel in Stockton, New Jersey, dem 1832 gegründeten Stockton, das für seine herzhafte amerikanische Küche mit Gerichten wie Hähnchenbrust mit dicken Scheiben Honigschinken berühmt ist. Wir mieteten das ganze Haus und richteten im Erdgeschoss eine Nachttelegrafenleitung ein. Das Hotel wird von fünf Brüdern und ihrer Mutter betrieben, den Colligans. Einer der Brüder hat eine Tochter, die einmal bei den Irish Sweepstakes* gewonnen hat. Das Hotel ist einen Block vom Delaware River entfernt, und das Treibeis auf dem Fluss ist eines der aufregendsten Schauspiele, die ich je erlebt habe. Das weckt religiöse oder patriotische oder sonstwelche Gefühle in einem. Abends gingen wir immer zum Fluss hinunter und sahen zu, wie sich vor den Brückenpfeilern eisenbahnwaggongroße Eisschollen übereinanderschoben; nachts standen wir auf der Hotelveranda und hörten das Eis auf dem Fluss krachen. An beiden Ufern hatte der Delaware Seitenarme, die vollständig zufroren, und wir gingen mit zwei kleinen Schlitten des Hotels dorthin und schlidderten bäuchlings auf ihnen liegend über das Eis. Am nächsten Morgen aßen wir dann Stapel von Pfannkuchen und Philadelphia Scrapple* und knusprig gebratene Streifen von Mrs. Colligans Schinken. Das Schlittenfahren in Stockton hat mir viel Spaß gemacht; es war meine letzte sportliche Betätigung bis zum nächsten Winter, als das Flugzeug, mit dem ich das überschwemmte Flusstal des Ohio River überflogen hatte, bei Cleveland abstürzte.
Das Hotel lagerte seine Vorräte in einem in eine Hügelflanke geschlagenen Keller. Darin lag auch ein großes Fass mit einhundertachtzig rotbeinigen Wasserschildkröten, die William Colligan, der älteste der Brüder, in einem Gebirgsbach in Sussex County gefangen hatte. Eine Woche lang gab es allabendlich Schildkrötenragout, einen mit Sherry zubereiteten Eintopf. Danach haben wir nur noch mit den Schildkröten gespielt. Jeden Abend brachte einer von uns eine Handvoll von ihnen mit in die Bar. Wir hatten viel Besuch in Stockton. Am Wochenende kamen unsere Frauen. In einer Sturmnacht stieß der Maler Thomas Benton* zu uns. Er war von meiner Zeitung als Gerichtszeichner dorthin geschickt worden. Als er die Eichenscheite in unserem Feuer sah, zog er die Schuhe aus, setzte sich davor und sprach bis Mitternacht von der Schönheit der Vereinigten Staaten.
Jeden Abend nach dem Essen mussten wir die Gäste in der Bar verlassen – im Hotel gab es zwei Bars; eine für die ansässigen Farmer, die andere für die Hotelgäste – und in den ersten Stock hinaufgehen und unsere Nachtartikel schreiben, die nur solange Bestand hatten, bis das Verfahren am nächsten Tag weiterging. Das heißt, sie würden nur in der Morgen- und Mittagsausgabe erscheinen und in der Abendausgabe wieder rausfliegen. Wir alle nutzten ein und dasselbe Zimmer, einen großen Raum mit offenem Kamin, und um zehn Uhr abends war dieser voller fluchender Reporter, die auf Reiseschreibmaschinen Unsinn tippten. Wesley Price, der während des Prozesses so etwas wie ein ambulanter Lokalchef war, ging von Schreibmaschine zu Schreibmaschine und stibitzte sich Teile der Texte. Er sah sich die Sachen an, stöhnte und schickte sie Blatt für Blatt hinunter zu der schläfrigen Telegraphistin, die er im Büro des Hotels postiert hatte. Aus Trenton und Philadelphia kamen Mädchen für den Abend nach Stockton und standen in der Tür und gingen uns mit der Frage, ob wir Hauptmann für schuldig hielten, auf die Nerven. Einer unserer Photographen schraubte Blitzlichtlampen in die Fassungen der Badezimmerlampen, und wenn so ein Trentoner Trampel hineinging, hörten wir sie, wenn sie das Licht anschaltete und ihr das grelle Licht direkt in die Augen blitzte, schreien. Einer unserer Reporter, Sutherland Denlinger, sang bei der Arbeit gerne Kirchen- und Soldatenlieder. Zuletzt schaffte er es sogar, beim Tippen eines Kommentars zu den Zeugenaussagen vom Vortag »Tiddly Winks God Damn« zu singen.
Manchmal klapperten wir bis drei Uhr nachts auf den Schreibmaschinen und traten in den Pausen auf die Veranda im ersten Stock hinaus, um dem Schnee dabei zuzusehen, wie er sich in der friedlichen verlassenen Dorfstraße anhäufte. Am Morgen waren die Aschenbecher voller Stummel und in den Abfalleimern stapelten sich zerknitterte Blätter und leere Applejack-Flaschen.* Jedes Mal wenn ich eine Flasche Applejack sehe, muss ich an den Lindbergh-Prozess denken. Das Ganze war schrecklich. Ich habe die Hinrichtung von sechs Menschen auf dem elektrischen Stuhl erlebt, und einmal starb eine junge Frau, der in den Hals gestochen worden war, während ich versuchte, sie zum Stillliegen zu bringen, und eines Nachts sah ich, wie ein weißhaariger irischer Polizist mit einem freundlichen Gesicht einen schwarzen Dieb verschärft verhörte, indem er ihm langsam den frischen Verband von einer Wunde am Rücken zog, aber ich glaube, nichts von alldem übertraf das Verfahren gegen Hauptmann an sinnloser Unmenschlichkeit – zum Beispiel Mrs. Lindbergh, die im Zeugenstand den Schlafanzug ihres ermordeten Babys identifizieren musste, oder Mrs. Hauptmann an dem Abend, als die Geschworenen hereinkamen, an dem Abend, als sie erfuhr, dass ihr Mann auf den elektrischen Stuhl kommen würde. Je älter ich werde, desto weniger möchte ich solche Dinge erleben. Ich bin aber abgebrüht genug, mich zu erinnern, dass mir der Lindbergh-Prozess eine Verschnaufpause von der Arbeit in der Stadt und viel frische Landluft und herzhaftes Essen beschert hat. Es war schrecklich, aber ich hatte Spaß, darüber zu berichten, und so Gott will, wird es nie wieder etwas Derartiges geben. Dasselbe empfinde ich bei vielen meiner Geschichten.
_______________
* Der Asteriskus verweist auf Erläuterungen im angehängten Glossar.
TRUNKENBOLDE
BAR AND GRILL
Im Umkreis von wenigen Blocks praktisch jeder größeren amerikanischen Zeitung, außer dem Christian Science Monitor, befindet sich eine Kneipe, die von Reportern frequentiert wird und die gleichzeitig als Bank, Sanatorium, Sportstätte und manchmal auch als Zuhause dient. Dick’s Bar and Grill ist eine solche Kneipe. Manchmal – besonders an den Abenden, wenn Jim Howard, der Tischredakteur, Schwierigkeiten hat, mit einem Wurf etwas anderes als fünf Einsen zu werfen, oder wenn der Lokalredakteur der größten Abendzeitung der Vereinigten Staaten einen Baumfrosch nachmacht, oder wenn Louie, der Barmann mit einer Vorliebe für chinesisches Essen, seine letzte anständige Mahlzeit im Tingyatsak beschreibt, oder wenn Elmer Roessner, der Geschichtenschreiber, sich auf alle viere begibt, um einen Würfel zu suchen, der in das Sammelsurium an Unrat hinter der Bar gerollt ist – sieht man im Dick’s innerhalb von fünfzehn Minuten mehr Erstaunliches als während der ganzen Vorführung des Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus*.
Ich trinke zwar nie etwas Stärkeres als Moxie*, gehe aber dennoch oft ins Dick’s, um das Treiben um mich herum zu beobachten, etwas, das ich von Kindesbeinen an gerne mache. Das Lokal liegt in einer schmalen Straße unweit der Brooklyn Bridge; es ist eine jener Kneipen mit einem flackernden Neonschild, einem Tresen, der hier und da durchhängt, was vielleicht daran liegt, dass er während der Prohibitionszeit von Flüsterkneipe zu Flüsterkneipe verfrachtet wurde, und einem blinden Fenster, das gepflastert ist mit schmierigen Pappschildern, auf denen die Tagesgerichte angezeigt werden, beispielsweise: »Tagesgericht. Hühnerpastete, Brot & Butter. 35C.« Auf dem Tresen steht eine große Schüssel mit frisch gerösteten Erdnüssen und eine Flasche Mulligan*, und der Fliesenboden ist übersät mit Erdnussschalen, Zigarettenkippen und Wurstpelle vom kostenlosen Mittagessen. Der Koch brät mit Olivenöl und im Laufe eines Tages verbraucht er eine Menge davon. Bei feuchtem Wetter riecht es in der Kneipe wie in einem Stall, und in der Nachbarschaft geht das Gerücht, dass Fuhrknechte auf der Straße ihre Pferde davon abhalten müssen, hereinzukommen.
Der Wirt namens Dick ist ein Italiener mit traurigen Augen und einem breiten Lächeln, der oft seine riesigen behaarten Fäuste schüttelt und zur fleckigen Decke reckt und schreit: »Ihr bringt mich noch ins Grab!« Er hasst seine Gäste, gibt aber großzügig Kredit und die Zigarrenkiste unter dem Tresen ist voll mit Rechnungen auf Bierdeckeln. Wenn er gute Laune hat, dann schiebt er dem Gast bei jedem dritten Drink die Flasche hin und sagt: »Der geht aufs Haus.«
Einmal nahm Dorothy Hall von der Gesellschaftsspalte Dick mit zu einem Kostümball. Das Motto lautete »Orient«, und sie besorgte ihm ein Eunuchenkostüm. Sie sagte, er solle ausschließlich Italienisch sprechen, und stellte ihn als bedeutenden neapolitanischen Adligen vor. Er tanzte mit Elsa Maxwell*, die als Obereunuch verkleidet war.
»Die weiß sich wirklich zu benehmen«, sagte er später.
Wenn er eine Zeitung kauft, breitet er sie auf dem Tresen aus und sucht nach Mädchen in Badeanzügen. Entdeckt er eines, das ihm gefällt, dann sagt er: »Mein Gott! Sieh dir die Kleine an. Mein Gott! Die hat alles, was man sich wünschen kann. Mein Gott! Für die würd ich glatt sterben.«
Die Gäste nennen ihn nur ganz selten bei seinem richtigen Namen, sondern nur »Das Haus«. So sagt ein Gast zu einem der Barmänner: »Frag doch mal Das Haus, ob er mir einen Scheck einlöst.« Immer wenn er würfelt, singt er. Er ist überzeugt, eine gute Stimme zu haben, und sein Lieblingslied ist »Love in Bloom«. Sobald er zur Arbeit kommt, bindet er sich seine Schürze um und sieht den Tresen entlang die Gäste an. Dann schüttelt er den Kopf und sagt: »Die müssen in der Irrenanstalt vergessen haben, die Türen zu verriegeln.« Dennoch ist er überzeugt, dass er einen erstklassigen Laden führt. Stolz verkündet er: »Das letzte Mal, als Mr. Heywood Broun da war, hat er gesagt, ich mach den besten Gin Rickey, den er je getrunken hat.« Einmal stahl jemand ein Ladenschild von der Chock Full o’ Nuts Company* und hängte es über die Kneipentür, und Dick war tagelang sauer deswegen.
Das Dick’s war einmal eine Flüsterkneipe und zwanzig Minuten nach Aufhebung der Prohibition hatte Das Haus alle 1117 frisch eingeführten Alkoholvorschriften gebrochen. In den meisten neuen Kneipen steht den Barmännern Diensteifer quer über die Stirn geschrieben und sie behandeln die Gäste mit Respekt, aber hier hassen sie sie auch. Dieser Hass beruht auf Gegenseitigkeit und der Tresen trennt Abend für Abend zwei verfeindete Lager. Ein Gast, der mit einem Kater kommt, kann vom Barmann weder Mitleid noch Schmerzmittel erwarten.
»Hoffentlich geht’s dir richtig mies«, sagt Das Haus oft. »So wie du dich gestern Abend aufgeführt hast, sollten sie dich aus der Stadt jagen.«
Es gibt zwei feste Kellner, und auch die hassen die Gäste. Einer von ihnen heißt Horace. Er ist Italiener und leidet unter Nasenpolypen, so dass sein Mund immer offensteht. Bezüglich seines Kopfes hat er eine fixe Idee. Während des Krieges gehörte er der italienischen Armee an, und seither glaubt er, dass sein Kopf weggeschossen wurde und die Ärzte den Kopf eines Österreichers genommen und ihm auf den Halsstumpf genäht haben. Er behauptet, sein neuer Kopf ließe zu wünschen übrig, weil er der eines jungen Mannes sei und ihn oft zu Abenteuern dränge, auf die der Rest seines Körpers eigentlich keine Lust habe.
»Mein anderer Kopf hatte einen großen Schnurrbart«, erzählte er eines Abends.
Der andere Kellner, Eddie, ist ein Norweger mit wehen Füßen. Wenn man etwas bei ihm bestellt hat, kommt er nach einer Viertelstunde zurück und sagt: »Was wollten Sie noch mal?« Auf dem Deckel des Eiskastens hat er eine Gin-Flasche deponiert, aus der er alle halbe Stunde einen Schluck nimmt. Wenn samstagabends der schlimmste Ansturm vorüber ist, zieht er einen Regenmantel über seine Kellnerjacke und geht nach draußen, um die Feinde zu erkunden. Nach solchen Gängen lässt er sich manchmal mehrere Tage nicht blicken, und wenn ein Gast nach ihm fragt, sagt Das Haus: »Er ist im Bellevue*. Der bringt mich noch ins Grab.«
Der Koch ist ein übellauniger Mann. Eines Tages kam ein Gast herein und warf einen Blick auf die hektographierte Speisekarte.
»Wie ist das London Broil*?«, fragte er Eddie.
»Ich werd mal fragen«, erwiderte er.
Gleich darauf kehrte Eddie zurück.
»Der Koch meint, es taugt nichts«, sagte er.
»Dann fragen Sie ihn, was er empfehlen kann«, befahl der Gast.
Ein paar Minuten später kam Eddie wieder.
»Der Koch sagt, heute taugt nichts was«, sagte er.
Unter den Gästen befinden sich vier Mitarbeiter einer staatlichen Prüfstelle, die hier als die Government Men oder »G-men«* bekannt sind. Wenn einer von ihnen einen Anruf erhält, dann rennt er nach hinten in die Telefonzelle und haut die Tür hinter sich zu. Das ist das Signal für die anderen, ihm nachzulaufen und mit Telefonbüchern gegen die Holzwände der Zelle zu schlagen. Eines Abends haben sie auf diese Weise eine Telefonzelle zerlegt. Dabei schreien sie: »Hört die Trommeln aus dem Dschungel.« Sie schlagen so lange gegen die Holzwände, bis ihr Kollege wütend herausstürzt, und dann packen sie ihn. Sie werfen ihn zu Boden und setzen sich auf ihn drauf. Wenn er sich vor Erschöpfung nicht mehr rührt, nehmen sie abwechselnd den Telefonhörer und brabbeln irgendetwas hinein, bis der Anrufer aufhängt. Dieser Kampf wiederholt sich jeden Abend dreimal, wobei immer ein anderer G-Man das Opfer ist. Die anderen Gäste achten gar nicht mehr auf das Gerangel.
Zu den Gästen gehören auch zwei Südstaatler. Einer kommt aus einem Staat, der sich nach wie vor mindestens alle vierzehn Tage von der Union lossagt, und er spricht gerne mit einem blasierten Südstaatenakzent, so dass die Leute ihn fragen: »Stammen Sie aus dem Süden?« Nachts hat er wegen der Yankees Angst, auf die Straße zu gehen, und er hat stets eine Pfeife dabei, die er einem betrunkenen Polizisten geklaut hat. Wenn er sich gelegentlich auf dem Nachhauseweg von einem Yankee verfolgt fühlt, bläst er in die Pfeife, womit er Polizisten aus der ganzen Umgebung herbeiruft. Früher hat er immer gesagt, dass man nur Corn-Whiskey trinken könne, und sich bitterlich beklagt, dass Das Haus keinen auf der Karte hat. Eines Abends fuhr einer der Barmänner nach Harlem und kaufte eine große Flasche, und als der Südstaatler wieder anfing zu jammern, dass man nirgends mehr richtigen Corn-Whiskey bekäme, zog er sie hervor. Der Südstaatler fühlte sich gezwungen, mehrere Gläser davon zu trinken, woraufhin ihm vier Tage lang übel war. Als Das Haus davon hörte, sagte er: »Wir sind stets auf das Wohl unserer Gäste bedacht.«
Der andere Südstaatler wird in der Kneipe Jeeter Lester* gerufen. Er mag den Süden nicht, weil es ihm dort unten nie zum Leben gereicht hat, und jetzt behauptet er, dass er an der Nordostecke von Broadway und Forty-second Street geboren wurde. Die kleine, von Wald umgebene Südstaatenstadt, aus der er stammt, war so ruhig, dass er ein krankhaftes Vergnügen an Lärm hat. Hin und wieder kauft er dem Barmann das Bierglas ab, das er gerade geleert hat, und schmeißt es auf den Boden. Es kommt vor, dass er knöcheltief in Scherben steht. Ein umherziehender Erweckungsprediger hat ihn vor langer Zeit zum Baptistentum bekehrt, und wenn er traurig ist, singt er Kirchenlieder. Sein liebstes ist »Jesu Kreuz, Leiden und Pein«.
»Ich bete zu Gott, dass du uns heut Abend keins deiner Kirchenlieder angedeihen lässt«, sagt Das Haus, kaum dass er das Dick’s betritt.
Jeeter ist ein wahrer Fachmann darin, eine zwischen seinen Fingern verborgene Münze gegen ein Longdrink-Glas zu schlagen, sobald es seine Lippen berührt, was klingt, als bisse er ein Stück vom Glas ab. Dann schreit er auf und spuckt einen Mund voll Eis aus, das genau aussieht wie Glasscherben, wenn es durch die Luft fliegt. Das jagt neuen Gästen einen gehörigen Schrecken ein.
»Du meine Güte«, sagen sie, »haben Sie sich verletzt?«
»Ich verblute«, wimmert Jeeter mit der Hand vor dem Mund und sieht sie mit schmerzverzerrtem Gesicht an.
Zu den Stammgästen gehören auch einige Frauen. Etwa einmal im Monat kommt die beleibte Buchhalterin eines Devotionalienhandels in der Barclay Street herüber. Früher war sie Vaudeville-Sängerin. Sie ist recht gesetzt und erzählt, dass sie als Kind rachitisch gewesen sei und deswegen eine Nervenschwäche habe. Links und rechts im Gesicht hat sie Narben von einer Windschutzscheibe, aber befangen ist sie deswegen nicht. Vielmehr deutet sie öfter mal darauf und sagt: »Ich bin stromlinienförmig.« Wenn sie genügend Bier intus hat, klettert sie auf den Tresen und tut so, als würde sie auf einem Klavier sitzen.
»Ich hab Fröschchen im Höschen«, singt sie dann mit ihrem schönen Sopran. »Und ’n Schnabeltier im Bustier.«
»Die bringt mich noch ins Grab«, schreit Das Haus und schubst sie vom Tresen.
Der einzige Mensch, der jemals in dieser Spelunke starb, war ein Mr. Friedman. Er war außerordentlich dick. Er hatte einen Zeitungsstand an der West Street und verkaufte Zeitungen an die Pendler, die mit der Fähre von New Jersey übersetzten. Während der Prohibitionszeit, als ein Glas Bier einen Vierteldollar kostete, musste er schwer schuften, aber als nach der Aufhebung des Alkoholverbots der Preis auf zehn Cent sank, ließ er oft mitten am Tag alles stehen und liegen und eilte ins Dick’s. Er starb am Abend des Tages, an dem Wiley Post und Will Rogers* bei einem Flugzeugabsturz in Alaska ums Leben kamen. Jeder, der an diesem Tag an seinem Stand vorbeilief, kaufte eine Zeitung, und gegen drei Uhr nachmittags glaubte er genug Geld in seiner Geldschürze beisammen zu haben, um einen Abend lang damit durchzukommen. Jedes Mal wenn Mr. Friedman ein Glas Bier ausgetrunken hatte, grunzte er und sagte: »Also das nimmt mir niemand mehr.« Oft beklagte er sich über die Steaks.
»Das Steak ist nicht lange genug abgehangen«, brüllte er dann und fuchtelte mit der Gabel durch die rauchgeschwängerte Luft. »Solches Frischfleisch ess ich nicht. Ich bin doch kein Kannibale.«
Im Sommer schlief er im City Hall Park. Wenn ich durch den Park zur Hochbahn auf der Third Avenue ging, sah ich ihn oft auf einer Bank liegen und den Mond anschnarchen. An dem Abend, als er starb, war die Kneipe voll. Er fiel vom Barhocker und fing an zu japsen. Das Haus lief zur Telefonzelle und rief die Polizei. Ein Notarzt untersuchte den auf dem Fliesenboden liegenden Mr. Friedman.
»Mensch kann man den kaum nennen«, sagte der junge Arzt. »Im Grunde ist er ein lebendes Bierfass.«
Kurz bevor er starb, blickte er zu den Gästen hoch, die sich mit ihren Gläsern in der Hand um ihn versammelt hatten, und sagte: »Heut Abend hatte ich zweiunddreißig Bier.« Das waren seine letzten Worte.
»Ich schätze mal, jetzt ist Mr. Friedman ein totes Bierfass«, sagte Das Haus, als eine Abordnung von Gästen den trinkfreudigen Zeitungshändler in zwei Tischdecken wickelte und hinaustrug.
Ein alter Drucker verbringt ganze Tage und Nächte in der Kneipe, mit der einen Hand hält er sich am Tresen fest, mit der anderen gestikuliert er wie ein Redner. Er kommt mit seiner Rede nie zu einem Ende und murmelt unablässig vor sich hin, ohne dass man weiß, worum es geht, außer dass er über etwas schimpft.
»Was ist denn mit dem los?«, fragen neue Gäste und glotzen ihn an.
»Hab nie rausgekriegt, von was er redet«, erwidert Das Haus. »Hey, Jimmy, sag dem Mann, um was es geht. Mein Gott, Jimmy, spuck’s endlich aus.«
Ein in England gebürtiger Taxifahrer taucht regelmäßig hier auf. Er wird nur Liverpool gerufen. Wahrscheinlich ist er der einzige Taxifahrer New Yorks, der seinen Fahrgästen Kredit gewährt. Er verkauft sogar Lose der Irish Sweepstakes*