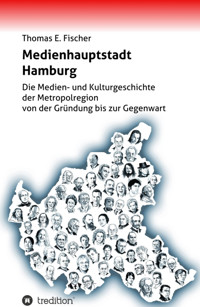
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die erste vollständige Übersichtsdarstellung der Hamburger Mediengeschichte von der Stadtgründung bis zur Gegenwart. Die zentralen Sektoren der Medienbranche - Presse, Radio, Fernsehen, Internet - werden ebenso beschrieben wie die medial wirkenden Künste und der Umgang mit der Vergangenheit. Vor allem für die Geschichte der Werbe- und Computer-Wirtschaft der Metropolregion gibt es keine vergleichbare Darstellung. Dieses Buch zeigt nicht nur die Glanzzeiten und Höhepunkte, sondern auch die Schattenseiten und Krisen. Und auf einige zentrale Fragen werden Antworten gegeben: Wie viel verdankt die Hamburger Medienwelt den Engländern? Welche Wechselwirkungen gab und gibt es zwischen Hafenstadt und Medienmetropole? Warum liegt den Hanseaten das Missionieren? Warum sind die Hamburger so nüchtern und so verspielt? Hamburg ist eine Stadt der Kaufleute, offen für Neues, international, kreativ, liberal und gierig nach Informationen. Schließlich hängt der Profit im Handelsgeschäft auch vom Wissensvorsprung ab. Und sie ist eine Stadt der Brücken, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Eine Medienstadt also.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Thomas E. Fischer
Medienhauptstadt Hamburg
Die Medien- und Kulturgeschichte der Metropolregion
von der Gründung bis zur Gegenwart
© 2014 Thomas E. Fischer
Alle Fotos und Abbildungen vom Verfasser
Website zum Buch: www.hh-medien.info
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7323-0599-5
Hardcover
978-3-7323-0600-8
e-Book
978-3-7323-0601-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Kurzes Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zeitungen und Zeitschriften
Verlage, Literatur, Theater
Musik und Musiktheater
Die Bildenden Künste
Werbung
Film, Funk und Fernsehen
Museen und Geschichtskultur
Computer und Internet
Sieben Thesen zur Hamburger Mediengeschichte
Ist Hamburg die „Hauptstadt“ der Medien?
Personenverzeichnis
Langes Inhaltsverzeichnis
Vorwort
oder Warum die meisten an Hamburg denken, wenn es um Medien geht
Der berüchtigtste Medienmogul Hamburgs herrschte weltweit über Zeitungen, Fernsehsender und Softwarefirmen. Um die Auflage zu steigern und den chinesischen Massenmarkt zu erobern, provozierte er sogar fast einen Krieg im südchinesischen Meer. Erst in letzter Minute konnte er vom britischen Geheimagenten James Bond gestoppt werden. So fiktiv die Figur des Eliot Carver auch war (und so verzeihlich die Verlegung des Hotels „Atlantic“ an die Mönckebergstraße), hatte der Film „Der Morgen stirbt nie“ (1999) doch eine bezeichnende Wahl getroffen und einen geeigneten Schauplatz für das Wirken dieses Bösewichts und Medienmachers gefunden.
Hamburg gilt vielen – national und international – als Inbegriff der Medien- und Werbewelt. Und es gibt gute Gründe dafür: Aus Hamburg kommen Deutschlands wichtigste Zeitungen und Zeitschriften („Zeit“, „Spiegel“, „Stern“, „Hörzu“) und die „Tagesschau“ der ARD. Die Metropolregion ist Sitz großer Verlage wie Hoffmann und Campe, Rowohlt, Oetinger und Carlsen, bedeutender Software- und Internet-Firmen wie Dermalog, Bigpoint und Xing und der größten deutschen Buchhandelsketten Thalia und Valora. Google, Facebook und Twitter haben hier ihre Deutschlandzentralen. Von Hamburg aus entdeckte Deutschland den Swing, die „Beatles“ und Andrew Lloyd Webber, das Taschenbuch und Harry Potter. „Der 90. Geburtstag“ wurde hier gedreht und die alten Edgar-Wallace-Filme (statt in London), die Filme von Jürgen Roland, Otto Waalkes und Fatih Akin, das „Großstadtrevier“ und „Panorama“. Die kreativsten Werbeagenturen Deutschlands sitzen in Hamburg, und folgerichtig werden auch die wichtigsten Auszeichnungen der Medienbranche, die „LeadAwards“, in Hamburg verliehen. Die Stadt beherbergt Schlagerstars und Popgrößen von Freddy Quinn und James Last bis Sasha und Ina Müller. Sie hat insbesondere die deutsche Spaßmusik der 70er, die Neue Deutsche Welle der 80er, den HipHop der 90er und das Swing-Revival der 2000er maßgeblich geprägt und besitzt auch auf dem Gebiet der klassischen und Neuen Musik einen ausgezeichneten Ruf. Und nicht zuletzt kommen seit Heinz Erhardt und Heidi Kabel einige der witzigsten und bekanntesten deutschen Comedians von der Elbe. Rund 21.000 Medienunternehmen mit rund 110.000 Beschäftigten sind hier tätig (2010). Und auch schon vor 1945 besaß die Hansestadt eine Spitzenstellung in der deutschen Medienlandschaft.
Vom 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert galt Hamburg als zeitungsreichste Stadt Deutschlands und besaß ein mindestens genauso vielfältiges Kultur- und Unterhaltungsangebot wie das doppelt so große Berlin. Hamburg war die Hochburg der deutschen Sozialdemokratie und der linken Presse und – zusammen mit Altona, das damals noch zu Schleswig-Holstein gehörte – ein Vorreiter der deutschen Werbewirtschaft. Der Malstil des Impressionismus fand hier seine ersten bedeutenden Anhänger, der Expressionismus der 1920er Jahre seine wichtigsten Vertreter und der Tonfilm seine ersten Stars: Paul Wegener, Hans Albers, Peter Lorre. Das erste ortsfeste und das seinerzeit größte Kino Deutschlands wurden in Hamburg gebaut.
Die Hansestadt war schon vorher ein Mittelpunkt der deutschen Aufklärung: Hier wirkten die Gelehrten des Akademischen Gymnasiums, die Schriftsteller Barthold Hinrich Brockes, Gotthold Ephraim Lessing und Matthias Claudius, der Verleger Justus Perthes, der Publizist Johann von Archenholtz und der Schauspieler Friedrich Ludwig Schröder. Die ersten Moralischen Wochenschriften Deutschlands wurden an der Elbe gedruckt, aber auch der „Hamburgische Correspondent“, die auflagenstärkste Zeitung Europas. Einzelne Reformer und gerade auch die Patriotische Gesellschaft sorgten für eine Hebung des Bildungsniveaus der Hanseaten. Und noch in der Phase der monarchischen Restauration im frühen 19. Jahrhundert hielten die Stadt und insbesondere der Verlag Hoffmann und Campe die deutsche Freiheitsbewegung am Leben.
In der Barockzeit galt Hamburg als musikalisches Zentrum mit zahllosen Lieddichtern, Musikanten und Komponisten, beispielsweise Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel, sowie dem Orgelbauer Arp Schnitger. Weiterhin dominierten die Hanseaten den Kunsthandel in Nordeuropa und spielten auch bei der Entwicklung des frühen deutschen Zeitungswesens eine erhebliche Rolle.
Im 16. Jahrhundert bedeutete der Aufstieg zur größten deutschen Hafenstadt nicht nur wirtschaftliche Macht, sondern auch – wie bei jeder anderen Messe- und Handelsstadt – einen enormen Austausch von Wissen und Nachrichten, deren Handelswert jedoch erst langsam erkannt wurde. Immerhin florierten die Produktion von Reformationsschriften und deren Vertrieb im skandinavischen Raum. Auch schon im Spätmittelalter verkauften die Hamburger nicht nur Fisch und Bier, sondern auch Kirchenkunst im Bereich der Hanse.
Damit endet der Schnelldurchlauf durch die Mediengeschichte, denn im Hochmittelalter und davor war das Städtchen zu klein und abgelegen, um irgendeine bedeutende Rolle zu spielen.
Wie man sieht, darf man nicht nur Presse, Rundfunk, Fernsehen und Internet betrachten, wenn man ein zutreffendes, vollständiges Bild der Hamburger Mediengeschichte erhalten will. Auch das Verlagswesen, die Literatur, Theater, Musik, Kunst, Werbung und Geschichtsdarstellungen gehören dazu. Dem Wörterbuch zufolge sind Medien „Mittel, die der Vermittlung von Informationen, Unterhaltung und Belehrung dienen“. Insofern sollten eigentlich auch Schulbücher, Kirchenpredigten, Briefmarken usw. angesprochen werden (doch das würde den Rahmen dieses Buches sprengen). Zur „Nacht der Medien“, der seit 2004 stattfindenden Jahresfeier des Hamburger Presseclubs auf dem Süllberg, werden jedenfalls nicht nur Journalisten eingeladen, sondern auch Filmproduzenten, Schriftsteller und Künstler.
Kurz: Die heutige Stellung Hamburgs als wichtigste Medienmetropole in Deutschland hat sich durch die Jahrhunderte entwickelt. Es gab eine Vielzahl glanzvoller Momente und prägender Persönlichkeiten. Und es gab Schattenseiten und Rückschläge. Davon will dieses Buch erzählen. Und am Ende einen Ausblick wagen, ob diese bemerkenswerte Vergangenheit auch eine Zukunft hat.
Zeitungen und Zeitschriften
Die große Zeit Hamburgs als Pressestadt begann zwar nicht erst 1945/46, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zum ersten Mal und für lange Zeit keine mächtige Konkurrenz mehr, wie es früher Leipzig und Berlin gewesen waren. Immerhin war Hamburg bereits seit dem 17. Jahrhundert eine bedeutende und im 18. Jahrhundert sogar die wichtigste Zeitungsstadt Deutschlands gewesen. Dies lag vor allem an der internationalen Orientierung der Handelsstadt und ihren guten Beziehungen zu England.
Futter für den Informationshunger der Kaufleute
Die Zeitung war ursprünglich eine deutsche Erfindung von Kaufleuten für Kaufleute gewesen, um über die Entwicklungen und den Tratsch auf den Handelsmessen zu informieren (die sog. „Messrelationen“). Denn erstens sind die meisten Reisenden vom Wesen her neugierig und zweitens hängt der Profit im Handelsgeschäft wesentlich vom Wissensvorsprung ab.
Kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges war die europäische Welt von vielen Unsicherheiten und Kriegssorgen geprägt, und gerade die Gruppe der international handelnden Kaufleute gierte nach Nachrichten, um ihr Geschäftsrisiko zu minimieren. Also bezahlten sie Agenten, die Augen und Ohren offen hielten und Briefe schrieben, welche dann wiederum abgeschrieben, zusammengefasst und weitergeleitet wurden.
Einer dieser Informationshändler, Johann Carolus aus der damals deutschen Reichsstadt Straßburg, begann 1605 solche Zusammenfassungen in wöchentlicher Folge zu drucken und für eine Jahresgebühr zu verkaufen – die Geburtsstunde der Zeitung. Die Idee verbreitete sich in Windeseile, denn zum ersten Mal waren die Menschen in der Lage, leidlich aktuelle Kunde von anderen Ländern und Fürsten, fernen und nahen Ereignissen zu erhalten. Und so wurde die Zeitung, die oft nicht umfangreicher war als eine eng bedruckte Seite, schnell zum beliebtesten weltlichen Lesestoff.
Wichtigster Ort des deutschen Zeitungswesens war Leipzig, die Stadt der pausenlos brodelnden Messen und der hochwohlberühmten Universität. Hier entstanden auch 1650 die erste Tageszeitung und 1682 die ersten gelehrten Zeitschriften. Die zweitwichtigste Pressestadt Deutschlands war Hamburg.
Der erste Zeitungsverleger der Hansestadt war hauptberuflich Fuhrunternehmer und Gastwirt. 1618 begann Johann Meyer mit der Herausgabe der „Wöchentlichen Zeitung auß mehrerley Örther“, die jeden Freitag das, was Meyers Kunden und Korrespondenten so zum Besten gaben, in gedruckter Form feilbot. 1630 folgte eine ergänzende „Post-Zeitung“. Doch die Konkurrenz schlief nicht: 1631 ließ der Thurn und Taxissche Postmeister zu Hamburg, Hans Jacob Kleinhaus, seine „Ordentliche Post-Zeitung“ erstmals in Wandsbek drucken. Und 1663 gab der Pfarrer und Schriftsteller Johann Rist, einer der wichtigsten Vertreter der norddeutschen Barockliteratur, seine „Monatsunterredungen“ heraus als Sprachrohr seines Dichterbundes „Elbschwanenorden“.
Ebenfalls ein Mitglied des „Elbschwanenordens“ war Georg Greflinger. Geboren um 1620 nahe Regensburg, war Greflinger während des Dreißigjährigen Krieges überall in Deutschland herumgekommen und hatte dabei sein Handwerk als Zeitungsschreiber und Gelegenheitsdichter gelernt, vielen gilt er sogar als der erste deutsche Berufsjournalist. 1646 kam er nach Hamburg, um als Notar zu arbeiten, verlegte sich aber bald wieder aufs Schreiben und gründete 1664 die Zeitung „Nordischer Mercurius“. Sie war zwar teuer, denn Greflinger verfügte über keine eigene Druckerei, dafür bot sie Qualität: Der Autor schrieb in einer leicht lesbaren Sprache, erklärte Fremdwörter, streute Anekdoten ein und ließ bisweilen auch sein Mitgefühl durchblicken. Weiterhin erfand er die Fortsetzungsgeschichte. Sie handelte von einem Engländer, der mit vier Frauen einen Schiffbruch überlebt, sie retten sich auf eine einsame Insel, erleben diverse Liebes- und andere Abenteuer, und am Ende bevölkern über 11.000 Einwohner die Insel. Greflinger, der 1677 starb, hatte mit seiner Zeitung, die noch bis 1730 bestand, Maßstäbe gesetzt.
Seither entstanden und verschwanden immer wieder neue Blätter, am bedeutendsten und langlebigsten waren Thomas von Wierings „Relations Courier“ (1675 – 1811), welcher erstmals politische Nachrichten mit lokalen Anzeigen und Inseraten kombinierte, und Christian Reiners’ „Altonaischer Mercurius“ (1687 – 1875), dessen Motto lautete: „Was mir wird zu See und Land / angebracht, mach ich bekannt.“ Die von Eberhard Happel herausgegebenen „Relationes Curiosae“ schilderten die verschiedensten „Denkwürdigkeiten der Welt“ und waren damit die erste populärwissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands; die Politik war anfangs eher nebensächlich.
1697 erschien in Hamburg die erste deutsche Gebrauchsanweisung für Zeitungen, Caspar von Stielers „Zeitungs Lust und Nutz“, mit der – schon damals nicht durchsetzbaren – Regel, Zeitungen sollten nur Nachrichten verbreiten, keine Meinungen.
Um 1700 gab es in Deutschland rund 60 Zeitungen mit einer durchschnittlichen Auflage von 300 bis 400 Exemplaren. Man erhielt sie in Buchläden, in Kiosken, die damals „Avisenbuden“ hießen, oder von herumlaufenden Zeitungsjungen (auch eine Erfindung Greflingers). Der „Relations Courier“ etwa kostete einen Sechsling, so viel wie ein Viertelpfund Honig. Wer ihn nur las und wieder zurückgab, bezahlte die Hälfte.
Bald erlebten die Hanseaten auch den ersten handfesten Zeitungsskandal: Die beiden mächtigsten Männer der Stadt, Hauptpastor Christian Krumbholtz und Posamentenschneider Balthasar Stielcke erregten sich nicht nur über den frechen, aber erfolgreichen Schriftsteller Menantes mit seinem „Satyrischen Roman“ (siehe das Kapitel über die Literatur), sondern auch 1707 über Barthold Feind, den damals 29jährigen Rechtsanwalt und kritischen Herausgeber der Wochenschrift „Relationes Curiosae“. Als Feind sich auf eine Auslandsreise begab, ließen Krumbholtz und Stielcke kurzerhand seine Schriften öffentlich verbrennen und ihn in Abwesenheit zum Tode verurteilen. Erst als die beiden 1708 von Reichstruppen und einer kaiserlichen Kommission abgesetzt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren, kehrte Feind aus seinem Zufluchtsort Stade zurück und wurde 1717 sogar Vikar am Dom. Er starb 1721.
Seitdem es den Buchdruck gab, gab es auch die Zensurbemühungen der Obrigkeit. Hamburg war interessanterweise auch in dieser Hinsicht ein Vorreiter mit der städtischen Censurverfügung von 1562, die verlangte, jedes zu druckende Schriftstück oder Buch vorher behördlich zuzulassen. Die Hamburger Buchdruckerordnung von 1651 verschärfte diese Vorschrift um das Verbot von Schmähschriften. Entscheidend war jedoch, wie stets, nicht der Buchstabe des Rechts, sondern dessen praktische Durchsetzung. Und hierbei war der städtische Zensor oft zahnlos, denn einige Teile des Stadtgebiets unterstanden nicht der Rechtsgewalt des Rates, und überhaupt hegten die eher nüchternen Kaufleute ein starkes Bedürfnis nach ungefilterten Informationen und klaren Worten.
Dieses liberale Klima änderte sich nur während der französischen Besatzung um 1810, als die Zensur auch mit Hilfe von Soldaten durchgesetzt werden konnte. Nach der Vertreibung der Franzosen setzte sich die liberale Phase fort, weil die Zensurbemühungen des Deutschen Bundes wiederum in Hamburg kaum polizeilich durchsetzbar waren. Lediglich unmittelbar nach der Niederschlagung der 1848er Revolution zeigte der Staat ein ausgesprochen restriktives Gesicht. So bestimmte das Hamburger Preßgesetz von 1849, dass alle Zeitungen und Flugschriften innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Ausgabe der Zensurbehörde vorgelegt werden mussten.
Das Pressezentrum der Aufklärung
Auch im 18. Jahrhundert kamen drei Neuerungen des Pressewesens aus Hamburg: das sog. Intelligenzblatt, das vor allem amtliche Verlautbarungen, offizielle Verkaufsangebote und Adresslisten enthielt (1724 die „Wöchentlichen Hamburger Frag- und Anzeigungsnachrichten“), die erste Heiratsannonce (1792 im „Hamburgischen Correspondenten“) und vor allem die moralische Wochenschrift, das wichtigste Medium der bürgerlichen Aufklärung.
Wieder einmal war es ein Import aus England, wo das bürgerliche Selbstbewusstsein sich früher und stärker entwickelt hatte als in Deutschland und wo zuerst 1709 Zeitschriften erschienen waren, in denen weniger politische und militärische Ereignisse im Vordergrund standen, sondern Fragen des täglichen Lebens, sittliche und ästhetische Themen, Kindererziehung, Frauenbildung, Literatur, stets meinungsstark vorgetragen und geschliffen formuliert.
Die erste moralische Wochenschrift Deutschlands war 1713/14 „Der Vernünfftler“, herausgegeben von dem im Dienst des englischen Gesandten stehenden Komponisten Johann Mattheson, der die englischen Vorbilder aufgriff, um Sitten und Geschmack seiner Landsleute zu heben. Unter anderem kritisierte er das Prügeln von Kindern und das Aussehen der Hamburger Frauen, woraufhin eine Dame diesem „Unfug“ heftig widersprach – der erste Leserbrief der deutschen Pressegeschichte.
Es folgte 1724 – 26 „Der Patriot“, herausgegeben von dem Dichter und Ratsherrn Barthold Hinrich Brockes, welcher wöchentlich in einer Auflage von 4000 Exemplaren erschien und „von den französischen Grenzen bis nach Moskau hochgeschätzt“ wurde, wie der Leipziger Schriftsteller Johann Gottsched meinte.
In Hamburgs unmittelbarer Nachbarschaft erschien von 1771 bis 1775 der „Wandsbecker Bothe“. Diese moralische Wochenschrift ragte zwar wegen ihrer literarischen Qualität und ihres originellen Text-Bild-Layouts heraus, war aber nicht bissig genug, um länger als ein paar Jahre zu überleben.
Als Herausgeber wirkte der Dichter Matthias Claudius. Er war 1740 als Sohn eines holsteinischen Pastors zur Welt gekommen, hatte in Jena Theologie und Jura studiert, dann eine Zeitlang in dänischen Diensten gearbeitet und 1768 die Redaktion der „Hamburgischen Adreß-Comtoir-Nachrichten“, einer der ersten reinen Handelszeitungen, übernommen. Der „Wandsbecker Bothe“ unterstützte die Aufklärung in Dänemark und bot eine Mischung aus Belehrung und vielfältiger Unterhaltung. Hier erschienen auch die berühmten Verse des „Abendlieds“: „Der Mond ist aufgegangen…“ Aber der „Bothe“ hatte mit seiner geringen Auflage (rund 400) und seinem braven Anspruch gegen die etablierten Hamburger Blätter wenig Aussicht auf Erfolg.
Nach dem Ende seiner journalistischen Tätigkeit 1775 lebte Claudius in bescheidenen Verhältnissen vor allem von Zuwendungen seiner adligen Gönner. Vor allem widmete er sich nun seiner Familie, erfand Spiele und schrieb Kindergedichte. Obwohl er früher der Aufklärung zugetan war, verwirrten ihn die Ereignisse der Französischen Revolution, er verurteilte deren Gewalt und wandte sich der Gegenaufklärung zu, floh dann vor den napoleonischen Truppen und starb 1815 im Hause seines Schwiegersohns Friedrich Perthes.
Einer der einflussreichsten Publizisten seiner Zeit war der 1743 nahe Danzig geborene Johann Wilhelm von Archenholtz. Mit 14 Jahren wurde er Kadett im Dienste Friedrichs II. von Preußen, den er zeit seines Lebens bewunderte und dessen Nachbild als „Großer“ er entscheidend geprägt hat. Nach der Entlassung aus dem Militärdienst 1763 reiste er durch Europa und hielt sich zehn Jahre lang in England auf, wo er zum Anhänger der Aufklärung wurde. Als er 1780 in Rom vom Pferd stürzte und sich eine lebenslange Gehbehinderung zuzog, kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Journalist in Dresden. Außerdem schrieb er 1788 einen Bestseller über die „Geschichte des siebenjährigen Krieges“, der schon zu seinen Lebzeiten zum meistverkauften Geschichtsbuch Deutschlands wurde und noch im 19. Jahrhundert zahllose Neuauflagen erfuhr.
Nach einer kurzen Schwärmerei für die Französische Revolution ließ er sich 1793 in Hamburg nieder, wo er weiterhin mit großem Erfolg historische Sachbücher schrieb und die liberale politische Zeitschrift „Minerva“ herausgab. Diese enthielt vor allem Reportagen und Berichte aus dem englischen, französischen und deutschen Ausland, geschrieben von Augenzeugen, sprachgewandten Korrespondenten und namhaften Autoren wie Konrad Oelsner, Carl von Clausewitz, Johann Gleim und Louis-Sébastien Mercier.
1812 starb Archenholtz auf seinem Gut in Öjendorf vor den Toren der Stadt Hamburg. Die Zeitschrift „Minerva“ bestand noch bis 1858.
Moralische Wochenschriften waren in der Regel kurzlebige Geschöpfe, denn ihre Herstellung nahm viel Zeit und Energie in Anspruch, zumal die Herausgeber auch selbst die meisten Artikel schrieben, kurz: Die Blätter brachten mehr Ehre als Geld. Ende des 18. Jahrhunderts verschwanden sie wieder und fanden ihre Nachfolger in den Musenalmanachen sowie speziellen Erziehungs- und Familienzeitschriften.
Auch die Zeitungen besaßen in der Regel keine lange Lebensdauer, was jedoch nicht immer finanzielle Gründe hatte. Die „Altonaische Staats- und Gelehrten Zeitung“ etwa hielt 1759 nur sieben Monate durch, weil sich der Herausgeber und Gelegenheitslyriker Johann Dreyer in einigen Versen über Frankreich lustig gemacht hatte. Der Gesandte in Kopenhagen protestierte, das Blatt wurde eingestellt.
In den Jahrzehnten um 1800 war Hamburg die führende Zeitungsstadt Deutschlands. Ein Gutteil der rund 200 Blätter, die es damals in Deutschland gab, erschien hier, darunter die „Wieringsche Zeitung“ (der ehemalige „Relations Courier“), der „Altonaische Mercurius“, die „Adreß-Comtoir-Nachrichten“ und vor allem der „Hamburgische Correspondent“.
1731 als „Stats- und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten“ gegründet, enthielt das Blatt ausführliche Handels- und Schiffahrtsnachrichten, Neuigkeiten aus dem In- und Ausland, vor allem aus London, wo es einen eigenen Berichterstatter unterhielt, sowie Artikel zu literarischen und moralischen Themen. Lessing und Goeze trugen hier ihren theologischen Streit aus, Friedrich II. von Preußen nutzte es als Sprachrohr. Mit bis zu 30.000 verkauften Exemplaren war der „Correspondent“ mit Abstand die auflagenstärkste Zeitung Europas. Die nächstgrößere deutsche Zeitung war die Erlanger „Real-Zeitung“ mit bis zu 5000 Exemplaren. Selbst die englische „Times“ erreichte nur eine 8000er Auflage.
Neben den Zeitungen gab es auch einige bedeutende Zeitschriften: die sich vor allem dem lokalen Kultur- und Theaterleben widmende moralische Wochenschrift „Hamburg und Altona“ (1801 – 06), die patriotisch-liberale „Minerva“ (1792 – 1812) und das eher reaktionäre „Hamburger Politische Journal“ (1781 – 1839). Außerdem waren alle großen englischen Zeitungen hier erhältlich, und in Altona erschien bis 1805 die Zeitschrift „Frankreich“, für die direkt aus Paris Carl Cramer schrieb, ein glühender Anhänger der französischen Aufklärung, während die vor der Revolution geflohenen Emigranten eher das Hamburger Blatt „Spectateur du Nord“ lasen.
Herausgeber, einziger Redakteur und Vertriebsleiter des „Spectateur“ war Georg Kerner, eine schillernde, aber nicht untypische Gestalt jener Zeit. Geboren 1770 im württembergischen Ludwigsburg, floh er gleich nach seinem Medizinstudium vor den absolutistischen Verhältnissen seiner Heimat ins revolutionäre Paris, schrieb als Korrespondent für verschiedene, auch Hamburger Blätter, fiel mehrfach in Ungnade und gelangte 1795 als Sekretär des französischen Gesandten in die Hansestadt, wo er die demokratische „Philanthropische Gesellschaft“ gründete. Kurz darauf beteiligte er sich am Krieg Frankreichs in Italien, amtierte kurze Zeit sogar als französischer Außenminister, bevor er sich mit Napoleon überwarf, 1801 wieder nach Hamburg zurückkehrte und den napoleonkritischen „Spectateur“ herausgab, bis dieser auf Druck des französischen Gesandten verboten wurde. Kerner eröffnete daraufhin 1803 eine Arztpraxis am Großen Burstah, heiratete und schrieb weiterhin ab und zu politische Artikel. Nach der Besetzung Hamburgs 1806 war er ein gefragter Vermittler zwischen der Stadt und den Franzosen. Er starb als eines der Opfer der Typhusepidemie von 1812.
Diese Vielfalt an Meinungen und Informationsquellen war ungewöhnlich für das damalige Deutschland, das eher von Kleinstaaterei und spätabsolutistischer Zensur geprägt war. Hamburg hingegen war zwar politisch machtlos, aber ökonomisch stark und in geistiger Hinsicht ausgesprochen liberal. In den Worten des Stadthistorikers Jonas von Heß 1796:
„Um die auswärtigen Welthändel kümmerte sich der Hamburger immer sehr viel, nicht aus Anecdotenfischerei, wie in Residenzen, nicht aus Mangel an Unterhaltung und einheimischen Vorgängen, sondern aus Hoffnung, Furcht und steter Bedenklichkeit, was doch dieses oder jenes Ereigniß für Einfluß auf das Thätigkeits-System seiner Vaterstadt haben würde.“
Das Ende für die Pressevielfalt kam mit der deutschen Niederlage gegen Frankreich, der Besetzung Hamburgs und mit der napoleonischen Zensur ab 1810. Von diesem Schlag erholte sich die Stadt zwar nach und nach, konnte aber ihre führende Stellung nach 1815 nicht mehr zurückgewinnen.
Zeitungsvielfalt zwischen Freiheit und Zensur
Der relative Bedeutungsverlust Hamburgs als Pressestadt im 19. Jahrhundert hatte vor allem zwei Gründe: Zum einen drückte das schärfere politische Klima auf den Absatz der Hamburger Publikationen in den anderen deutschen Ländern und zum anderen verlagerte sich der Schwerpunkt des politischen Lebens und damit auch der Presselandschaft in Deutschland zunehmend nach Berlin. Aus dem bunten Flickenteppich des Alten Reiches wurde allmählich ein Staatenbund unter preußischer Führung. Die Leitmedien des 19. Jahrhunderts waren die „Frankfurter“ und die „Kölnische Zeitung“, das „Berliner Tageblatt“ und die „Neue Preußische Zeitung / Kreuzzeitung“. Auch die wichtigsten Zeitschriften kamen nicht mehr aus Hamburg, sondern aus Berlin („Kladderadatsch“, „Preußische Jahrbücher“) und Leipzig („Gartenlaube“, „Leipziger Illustrirte Zeitung“). Gleichwohl blieb Hamburg im 19. Jahrhundert eine bedeutende Pressestadt, die mehr Redaktionen beherbergte als jede andere deutsche Stadt.
In der Zeit des „Vormärz“, als Deutschland gleichermaßen von demokratischen Aufbruchsversuchen wie von reaktionärer Unterdrückung geprägt war, war Hamburg eine liberale Hochburg mit dem Verlag Hoffmann und Campe und Zeitungen wie Karl Gutzkows „Telegraph“, Ambrosius Hartmeyers „Wöchentlichen gemeinnützigen Nachrichten“ und der erst 1848 gegründeten „Reform“.
Ein wichtiger Vertreter der Judenemanzipation war Gabriel Riesser, der viele Jahre für seine Anerkennung als Anwalt kämpfen musste, ab 1832 die programmatische Zeitschrift „Der Jude“ herausgab und 1848 liberales Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche wurde.
Natürlich erschienen an der Elbe auch zahlreiche Blätter, die weniger Wert auf Politik denn auf Unterhaltung legten, beispielsweise Amalie Schoppes „Neue Pariser Modeblätter“ (1827 – 46), in denen unter anderem die Gedichte des jungen Friedrich Hebbel abgedruckt wurden. Schoppe, die auch als Autorin von Romanen, Reiseberichten und Jugendschriften hervortrat, emigrierte 1851 in die USA.
Die große Hoffnung des liberalen Bürgertums war die Revolution von 1848, doch nach nur einem Jahr scheiterte diese an der Uneinigkeit der Revolutionäre und an der brutalen Gegenwehr der Monarchen. Es folgte ein Jahrzehnt scharfer Pressezensur, in dem viele kritische Geister aus Deutschland auswanderten und die Zeitungen zahm wurden.
Der „Hamburger Correspondent“ stieg zwar 1852 zum offiziellen städtischen Amtsblatt auf, verlor aber wegen seines altväterlichen Stils und einer Aufmachung ohne Bild und Farbe zunehmend an Bedeutung. Weiterhin erfolgreich waren die großformatige, reich illustrierte und eher freisinnige „Reform“ (1892 eingestellt), die gemäßigt-liberalen „Hamburger Nachrichten“, ab 1850 eine der ersten deutschen Zeitungen mit einem Feuilleton, und das eher konservative „Hamburger Fremdenblatt“. Die „Hamburger Illustrierte Zeitung“ enthielt vorwiegend unterhaltsame Geschichten und wurde bald in „Illustrierte Criminal Zeitung / Illustriertes Weltblatt“ umbenannt.
Außerdem begann der Aufstieg der Regionalblätter, der „Harburger Anzeigen und Nachrichten“ (gegründet 1844) und der „Bergedorfer Zeitung“ (1870), die beide noch heute bestehen. 1903 gründete Johann Bauer die „Rotenburgsorter und Hammerbrooker Zeitung“, das erste Blatt des späteren Bauer-Großverlags. An speziellere Zielgruppen richteten sich das Schifffahrerblatt „Hansa“ (1864), das Wassersport-Magazin „Yacht“ (1904) und die niederdeutsche Zeitschrift „Quickborn“ (1907), die bis heute in Hamburg erscheinen.
Allmählich machte sich die industrielle Revolution im Pressewesen bemerkbar. Es entstanden neue Techniken wie Dampfschnellpressen, Tiefdruckmaschinen und die Fotografie. Unter maßgeblicher Hamburger Beteiligung wuchs die „Lesezirkel“-Bewegung, mit der auch weniger Betuchte in den Genuss bunter Zeitschriften kamen. Und vor allem entwickelte sich mit den Industriearbeitern eine neue Art von Kundschaft, die soziale Forderungen stellte und nach einer handfesteren, weniger geschniegelten Sprache verlangte. Dem trug zum Beispiel der 1888 gegründete „General-Anzeiger für Hamburg-Altona“ Rechnung, der mit kurzen Berichten, linksliberaler Ausrichtung und einem niedrigen Preis schnell zur auflagestärksten Zeitung der Hansestadt wurde.
Vor allem aber organisierten sich die Arbeiter selber in Gewerkschaften und Parteien und lasen dort lieber ihre eigenen Zeitungen. 1875 hatten sich die verschiedenen sozialistischen Gruppierungen zur Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) vereinigt und Hamburg zum Sitz des Parteivorstands bestimmt. Hier gründeten sie im gleichen Jahr eine Genossenschafts-Buchdruckerei und das „Hamburg-Altonaer Volksblatt“ unter dem Motto „Alles durch das Volk – Alles für das Volk“. Ihr wichtigster Redakteur war Jakob Audorf, der 1864 die „Arbeiter-Marseillaise“ geschrieben hatte, eines der verbreitetsten Arbeiterlieder.
Drei Jahre später begann die Reichsregierung unter Otto von Bismarck mit dem Kampf gegen die Sozialdemokratie. Die Partei, die Gewerkschaften, ihre Publikationen und Versammlungen wurden verboten. Doch die Unterdrückung schweißte die Arbeiter nur noch mehr zusammen. Aus der Genossenschafts- wurde eine private Druckerei (offiziell im Besitz von Johann Heinrich Wilhelm Dietz), die nicht mehr beschlagnahmt werden konnte. Das „Volksblatt“ verschwand, dafür gab es nun die vom Titel her harmlose „Gerichtszeitung“, später die „Bürgerzeitung“ und schließlich ab 1887 das „Hamburger Echo“. Zusätzlich gründete Dietz 1879 das satirische Monatsblatt „Der wahre Jacob“, das schon 1881 wieder verboten wurde, ab 1884 in Stuttgart erschien und zu einer der beliebtesten Unterhaltungszeitschriften der Jahrhundertwende wurde.
1890 wurden die Sozialistengesetze aufgehoben, die SAP wurde als SPD neu gegründet, Dietz überschrieb „sein“ Druckhaus dem Reichstagsabgeordneten Ignaz Auer, und das „Hamburger Echo“ bekam einen Kulturteil.
Bismarck, der ebenfalls 1890 entlassen wurde, erhielt eine Zeitlang freie Hand und freien Platz in den „Hamburger Nachrichten“. Ihr Herausgeber Emil Hartmeyer konnte seiner Zeitung dadurch über mehrere Jahre hinweg internationale Aufmerksamkeit verschaffen.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs machte Carl von Ossietzky seine ersten journalistischen Gehversuche. Hauptberuflich Schreiber am Amtsgericht, verfasste der junge Hamburger pazifistische Artikel für „Das freie Volk“ und hielt Vorträge gegen den Krieg. 1919 holte ihn die Deutsche Friedensgesellschaft nach Berlin, wo er zu einem der bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik wurde und später die Nazis bekämpfte. 1936 erhielt er den Friedensnobelpreis.
Das „Jahrhundert der Massenmedien“ beginnt
In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts änderte sich in der Hamburger Presselandschaft wenig, auch der Erste Weltkrieg stellte keine Zäsur dar. Es gab eine große Anzahl bürgerlicher Blätter, überwiegend Stadtteilgazetten. Und es gab das sozialdemokratische „Hamburger Echo“ und die kommunistische „Hamburger Volkszeitung“ (1918 gegründet).
Die Hafenstadt war eine Stadt der Kaufleute, aber auch eine Hochburg der Arbeiterbewegung: Der SPD-Vorsitzende August Bebel vertrat im Reichstag den Hamburger Wahlkreis I, bei der Reichstagswahl 1912 holten die Sozialdemokraten in Hamburg 62 Prozent der Stimmen. Jede zweite Gewerkschaft Deutschlands hatte ihre Zentrale an der Elbe. Als 1906 das neue Gebäude am Besenbinderhof eingeweiht wurde, nannte Bebel es „die geistige Waffenschmiede des Proletariats“. Und die Führungspersönlichkeiten der Arbeiterbewegung waren immer auch journalistisch tätig.
Dies galt auch für die Kommunisten in der Weimarer Zeit, zum Beispiel für Ernst Thälmann, der in Eilbek und im damals roten Eppendorf aufgewachsen war und es bis zum KPD-Chef gebracht hatte.
Einer der bedeutendsten kommunistischen Journalisten war der 1901 in Hamburg gebürtige Willi Bredel. Ursprünglich gelernter Dreher, arbeitete er von 1928 bis 1930 für die „Hamburger Volkszeitung“, floh nach einer kurzen KZ-Haft 1934 ins Exil, wo er seine ersten Romane schrieb und zusammen mit Bertolt Brecht und Lion Feuchtwanger die Moskauer Emigrantenzeitschrift „Das Wort“ herausgab. Später wurde er zu einem der wichtigsten Literaturfunktionäre der DDR, verfasste auch ein Werk zur Hamburgischen Geschichte („Unter Türmen und Masten“, 1960) und starb 1964 in Ostberlin.
Ansonsten berichtete die Hamburger Presse jener Jahre über die noch heute üblichen Themen: Ereignisse in Politik, Kultur und Sport, sowie, deutlich stärker als heute, über die Kriminalität in der Hansestadt. Besonders der Berufsverbrecher Julius Petersen, der „Lord von Barmbek“, hatte es ihr angetan, und dieser beschwerte sich später über die Unart, „mich für alle besonders großen Diebstähle als Täter zu verschreiben… Je regierungsfreundlicher die Zeitung, je mehr war die Sache ins Häßliche verzerrt.“
Die Presselandschaft der 20er Jahre war so bunt wie eh und je. Insbesondere das sozialdemokratische „Echo“ und der liberale „Hamburger Anzeiger“ genossen einen hohen Ruf im Lande. Demgegenüber verbandelte sich der „Correspondent“ mit der konservativen DVP und verlor stark an Auflage. Das am meisten gelesene Blatt, der Altonaer „General-Anzeiger“, vereinigte sich 1922 mit der „Neuen Hamburger Zeitung“ zum „Hamburger Anzeiger“, der seine linksliberale Ausrichtung beibehielt und auch mit seinen hochwertigen Wochenendausgaben weite Leserschichten erreichte. Der Bauer-Verlag stieg mit der Sportzeitung „Extrablatt“ und der Zeitschrift „Rundfunkkritik“ (später „Funkwoche“) noch stärker in den Pressemarkt ein. Der Broschek-Verlag, der das nationalliberale „Fremdenblatt“ herausgab, konnte 1926 in der Neustadt am Heuberg ein neues repräsentatives Geschäftshaus errichten.
Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme änderte sich das Bild schlagartig: Schon 1933 wurden das „Echo“ und andere linke Zeitungen verboten, die Maschinen von Auer-Druck beschlagnahmt und später für die eigene Presse verwendet. Das „Fremdenblatt“ schwenkte in kürzester Zeit auf die NS-Parteilinie um, der „Anzeiger“ wurde mit staatlichem Druck auf Kurs gebracht. 1934 wurde der „Correspondent“ den konservativen „Hamburger Nachrichten“ einverleibt, welche wiederum fünf Jahre später vom „Hamburger Tageblatt“, der regionalen NSDAP-Zeitung, übernommen wurden. Für das „Tageblatt“ wurde 1938 das Pressehaus am Speersort errichtet, in dem heute die „Zeit“ ihren Sitz hat. Um sich historischen Glanz zu erschwindeln, erhielt das Gebäude Arkaden und das „Tageblatt“ als Wahrzeichen eine Kogge.
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Versorgungslage in Deutschland immer schwieriger. 1944 verfügte Propagandaminister Goebbels, dass ab sofort keine Tageszeitung mehr als vier Seiten haben dürfe. Das „Tageblatt“ wurde mit dem altehrwürdigen „Fremdenblatt“ und dem „Hamburger Anzeiger“ zur „Hamburger Zeitung“ zwangsvereinigt. Mit der Niederlage 1945 endete diese traurigste Phase der Hamburger Pressegeschichte.
Neuanfang unter britischer Besatzungshoheit
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das vordringlichste Ziel der vier Besatzungsmächte in Deutschland der Wiederaufbau einer demokratischen Gesellschaft. Nach dem Prinzip des „indirect rule“ wollten die Besatzungsmächte nicht herrschen, sondern im Wesentlichen nur den Rahmen vorgeben. Dazu gehörte nach dem Selbstverständnis der Westalliierten vor allem eine freie Presse. Schon Ende 1945 wurden die ersten deutschen Zeitungen wieder zugelassen, darunter die „Hamburger Anzeigen und Nachrichten“, allerdings zunächst noch als reines Kleinanzeigenblatt.
Unter der Leitung von Sefton Delmer installierten die Briten im August 1945 den „German News Service“ in Hamburg. Delmer hatte zuvor den „Soldatensender Calais“ geleitet. Aus London kamen die Redakteure, aus Flensburg die Funker, Dolmetscher und Hilfskräfte. Die Meldungen wurden per Kabel nach London geschickt und von dort an die in der britischen Zone zugelassenen Zeitungen gefunkt. 1947 wurde der GNS unter dem Namen „Deutscher Pressedienst“ in eine Genossenschaft der Zeitungsverleger und Rundfunkbetreiber in der britischen Zone umgewandelt. Chefredakteur wurde Fritz Sänger. Dieser hatte während der NS-Zeit für die liberale „Frankfurter Zeitung“ geschrieben, nach dem Krieg als Journalist und SPD-Mitglied das politische Leben in Niedersachsen mit aufgebaut.
1946 erfolgte der eigentliche Startschuss. In kurzer Folge erhielten die Parteizeitungen „Hamburger Echo“ (SPD), „Hamburger Allgemeine Zeitung“ (CDU), „Hamburger Freie Presse“ (FDP) und „Hamburger Volkszeitung“ (KPD) eine Veröffentlichungslizenz, ebenso die überparteilichen und überregionalen Blätter „Die Welt“ und „Die Zeit“. Im Verlag von Axel Springer erschienen die Rundfunkzeitschriften „Nordwestdeutsche Hefte“ und „Hör Zu!“, in der Europäischen Verlagsanstalt, die von Mitgliedern des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes gegründet und im Pressehaus untergebracht war, die Hefte von „Geist und Tat“, die die „europäische Gesinnung“ fördern wollten. Und dann gab es noch diverse Fachblätter wie die „Deutsche Schlachter Zeitung“, die „Deutsche Verkehrs-Zeitung“ usw.
Während die „Welt“ offiziell im britischen Auftrag erschien und von dem sehr eigenwilligen Schotten Steele McRichie geleitet wurde, wurden die Lizenzen ansonsten stets an anerkannte und geprüfte Persönlichkeiten vergeben. Die so beauftragten Lizenzträger waren dadurch zwar sehr abhängig vom britischen Wohlwollen und von der Zahlungsbereitschaft des Publikums, jedoch ausgesprochen unabhängig gegenüber ihren deutschen Mitarbeitern und auch gegenüber den Parteien, die sie jeweils als Lizenzträger vorgeschlagen hatten. Wenn sie ihre Sache gut machten, war die Lizenz für sie bares Geld wert und sie erwarben eine nicht zu unterschätzende Machtposition. Vor allem drei dieser Lizenzträger prägten das Hamburger Zeitungswesen weit über die Nachkriegszeit hinaus: Axel Springer, Gerd Bucerius und John Jahr senior. Der erfolgreichste von ihnen war sicherlich Axel Caesar Springer.
Der Sohn des liberalen Altonaer Verlegers Hinrich Springer (Verlag Hammerich & Lesser) hatte zunächst eine Ausbildung zum Drucker absolviert und als Journalist gearbeitet, ehe er 1945, mit 33 Jahren, seinen eigenen Verlag gründete. Den Engländern empfahl er sich durch Eloquenz, Charme und die Fürsprache des späteren CDU-Landesvorsitzenden Erik Blumenfeld. „Axel Springer is the most atypical German I have ever met“, so der israelische Politiker Meyer Weisgal. In seinem eigenen Verlag arbeitete Springer bis zur Erschöpfung für seine Projekte und packte auch eigenhändig mit an, vom Kleben des Layouts bis zur Justierung der Druckmaschinen. Sehr schnell trafen seine Blätter den Geschmack der Zeit, insbesondere die „Hörzu“, das „Hamburger Abendblatt“ und später die „Bild“-Zeitung, welche er (wortwörtlich) eigenhändig konzipiert und gegen das Unverständnis seiner Direktoren auf den Markt geworfen hatte. Springers Kommentar 1959: „Ich war mir seit Kriegsende darüber klar, daß der deutsche Leser eines auf keinen Fall wollte, nämlich nachdenken. Und darauf habe ich meine Zeitungen eingestellt.“
Gerd Bucerius, geboren 1906 im westfälischen Hamm, machte 1924 sein Abitur in Hamburg, studierte dann Rechtswissenschaften und arbeitete ab 1933 als Rechtsanwalt in der Kanzlei seines Vaters in Altona. 1945 übernahm er im britischen Auftrag die Abwicklung des Hamburger Zeitungskonzerns der NSDAP. 1946 wurde er Bausenator, trat der CDU bei und gründete nach dem Vorbild der britischen „Times“ die Wochenzeitung „Die Zeit“, die er noch viele Jahre lang aus eigener Tasche und mit Hilfe seiner Beteiligung am „Stern“ finanziell unterstützen musste, bis sie erstmals 1975 Gewinn machte. An der „Zeit“ genoss Bucerius vor allem die intensive Debattenkultur, und auch wenn ihm der politische Kurs der Redaktion oder eines Leitartikels missfiel – was nicht selten der Fall war –, bestand seine Reaktion allenfalls darin, im Innenteil des Blattes einen kritischen Kommentar zu schreiben. 1947 heiratete er seine zweite Frau Gertrud Ebel, genannt Ebelin, und wurde Mitglied des Zonenbeirats der britischen Besatzungszone, 1948 Mitglied des Wirtschaftsrates der Bizone und 1949 Mitglied des Bundestages. 1961/62 legte er sein Mandat nieder und trat aus der CDU aus, weil es wegen eines kirchenkritischen Artikels im „Stern“ zu innerparteilichen Auseinandersetzungen gekommen war.
John Jahr senior hatte in den 20er Jahren als Sportjournalist angefangen und sich später auf Reiseliteratur und Frauenzeitschriften spezialisiert, sein Spektrum reichte von dem kommunistischen Blatt „Weg der Frau“ bis zu dem unpolitischen Magazin „Die junge Dame“. Nach Kriegsende kehrte er in seine Heimatstadt Hamburg zurück und gründete mit Springer 1947 die „Constanze“, die zur erfolgreichsten Frauenzeitschrift der 50er Jahre wurde. Später folgten „Brigitte“ und „Schöner Wohnen“. 1971 zog er sich aus dem aktiven Verlagsgeschäft zurück.
Im Allgemeinen achteten die Besatzungsbehörden darauf, an die Spitze dieser Blätter nur NS-unbelastete Männer zu setzen. Gerd Bucerius hatten die Nazis wegen seiner Zivilcourage als „wehrunwürdig“ bezeichnet, Springers Vater hatte Beziehungen zur Bekennenden Kirche, Axel Eggebrecht, Mitherausgeber der „Nordwestdeutschen Hefte“, hatte im KZ gesessen.
Aber schon ab der zweiten Reihe dominierten Journalisten, die ihr Handwerk im Dienste des NS-Staates gelernt und ausgeübt hatten, beispielsweise Axel Springer, Rolf Seutter von Loetzen („Hamburger Allgemeine Zeitung“), Lovis Lorenz und Ernst Samhaber („Die Zeit“), Jürgen Schüddekopf („Die Welt“), Alois Winbauer („Hamburger Freie Presse“) und Henri Nannen („Stern“). Erster Chefredakteur der „Welt“ war ausgerechnet Hans Zehrer, der in der Weimarer Republik das antidemokratische Blatt „Die Tat“ herausgegeben hatte. Auch einige frühere SS-Offiziere tauchten bei Hamburger Blättern unter, etwa Horst Mahnke, Ferdinand Simoneit und Georg Wolff beim „Spiegel“ oder Erwin Ettel / Ernst Krüger und Klaus Volkmann / Peter Grubbe bei der „Zeit“. Relativ wenige NS-belastete Journalisten schafften es nicht wieder zurück in die Zeitungsredaktionen, in erster Linie die leitenden Mitarbeiter des „Tageblatts“. Rudolf Michael, Leitartikler des „Fremdenblatts“ und NSDAP-Mitglied, musste lediglich bis 1949 warten, ehe er zum Kompagnon Axel Springers werden konnte.
Diese ausgesprochen freundliche Behandlung ehemaliger NS-Propagandisten war auch deshalb möglich, weil die Briten, verglichen mit den anderen Besatzungsmächten, bei der Entnazifizierung am pragmatischsten verfuhren und das Verfahren in Hamburg schon im Mai 1947 wieder in deutsche Hände gelegt hatten. Einen sehr liberalen Kurs fuhren auch die für die Zeitungslandschaft in der britischen Zone zuständigen Presseoffiziere Michael Thomas und John Chaloner, der 1945 gerade erst 20 Jahre alt war.
Auf Initiative Chaloners entwickelte der ein Jahr ältere Rudolf Augstein, Sohn eines Fotokaufmanns, 1946 in Hannover „Die Woche“, ein Magazin nach dem Vorbild des amerikanischen „Time Magazine“ mit selbstbewusstem Auftreten und investigativem Ansatz. Anders als bislang in Deutschland üblich, sollte die Zeitschrift vor allem Nachrichten bringen, weniger Meinungen bilden (das geschah dann zwischen den Zeilen und mittels einer zuweilen recht flapsigen Sprache). Am 4. Januar 1947 wurde das Blatt unter dem Namen „Der Spiegel“ ganz in deutsche, also Augsteins Hände gelegt. Erst 1952 holte John Jahr sr. als Miteigentümer den „Spiegel“ nach Hamburg.
Ein weiterer Gründervater der Pressestadt Hamburg in der Nachkriegszeit war Erich Lüth. Der streitbare Journalist und Schriftsteller war 1902 als Sohn eines Kolonialwarenhändlers in Harvestehude geboren worden und hatte auf sein Abitur verzichtet, um als Redakteur für Ullstein und später beim „Hamburger Anzeiger“ zu arbeiten. 1928/29 vertrat er die Deutsche Demokratische Partei in der Bürgerschaft. Anschließend wirkte er als Geschäftsführer des Verbands der Nähmaschinenhersteller und arbeitete in der NS-Zeit bei Pfaff in Kaiserslautern. 1946 wurde er Direktor der Staatlichen Pressestelle in Hamburg. Um den Wiederaufbau der Stadt in Wort und Bild zu dokumentieren, gab er von 1947 bis 1965 die Reihe „Neues Hamburg“ heraus, außerdem engagierte er sich für die Verständigung mit Frankreich und Israel. Über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus bekannt wurde er mit seinen Protesten gegen den erneuten Erfolg des NS-Filmregisseurs Veit Harlan. Nach einem langen, heftigen Rechtsstreit entschied 1958 das Bundesverfassungsgericht, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit habe Vorrang vor privatrechtlichen Vorschriften, und gab damit Lüths Verfassungsbeschwerde statt. Dieses „Lüth-Urteil“ wurde zu einem Pfeiler der bundesdeutschen Pressefreiheit und Verfassungsordnung. Nach seiner Pensionierung schrieb Lüth noch zahlreiche Artikel und Bücher, ehe er 1989 starb.
Nicht zu vergessen ist auch Ilse Elsner, 1910 in Berlin geboren, die vor dem Krieg als Chefsekretärin bei der Deutsch-Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft (später Esso) in Hamburg arbeitete und nebenher Wirtschaftswissenschaften studierte. 1946 wurde sie Wirtschaftsredakteurin beim „Hamburger Echo“ und trat der SPD bei, um damit einen Beitrag zu leisten, ihre eigene Generation zur „politischen Intelligenz“ zu erziehen. 1950 wechselte sie in die politische Redaktion der „Welt“, wo sie bis 1961 blieb und über sozialpolitische Themen schrieb. Danach vertrat sie die SPD im Bundestag und im Europa-Parlament und wirkte 1970 – 74 als Senatorin in Hamburg, wo sie 1996 starb.
In jenen frühen Jahren herrschte Mangel an allem. So kam es, dass die Zeitungen oft auf dem Schwarzmarkt einen höheren Preis erzielten als im Kioskverkauf, unabhängig von ihrem Inhalt, einfach weil sie aus Papier bestanden. So war denn die Papierzuteilung auch ein wirksames Druckmittel der Besatzungsbehörden gegen allzu eigenmächtige Redaktionen. Henri Nannen beispielsweise musste einmal, um seine journalistische Karriere fortsetzen zu können, illegal nach Ostberlin reisen, um Waren gegen Papier zu tauschen.
Auf dem Weg zur Pressemetropole
1948 gaben die Briten das Recht zur Lizenzvergabe an die Deutschen zurück, und es kam zu einer erneuten Gründungswelle von Zeitungen und Zeitschriften: In diesem Jahr erschienen erstmals Springers „Hamburger Abendblatt“, das „Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt“ des hannoverschen Landesbischofs Hanns Lilje, die Reisezeitschrift „Merian“ aus dem Verlag Hoffmann und Campe und die Schifffahrtszeitung „Täglicher Hafenbericht“. 1949 folgte die „Morgenpost“, die erste Boulevardzeitung der Bundesrepublik und das zweite SPD-Blatt neben dem „Echo“ (welches 1966 endgültig vom Markt verschwand), 1952 der „Hamburger Anzeiger“ (der sich jedoch gegen das „Abendblatt“ nicht behaupten konnte und nach fünf Jahren wieder eingestellt wurde), 1953 die Jugendzeitschrift „Rasselbande“ (mit der der Heinrich-Bauer-Verlag in den Pressemarkt zurückkehrte). Nun also begann der Siegeszug der Pressestadt Hamburg.
Die Währungsreform von 1948 hatte paradoxerweise zwei gegensätzliche Wirkungen auf den Zeitungsmarkt: Einerseits sorgte sie für eine größere Sparsamkeit der Käufer, in deren Folge zahlreiche kleinere Blätter (und das waren damals eigentlich fast alle) teils eingingen oder fusionierten oder sich auf ihre Stärken konzentrierten und dadurch mit neuer Kraft aus der Krise hervorgingen. Andererseits erweiterte die Reform den Absatzmarkt auf alle westdeutschen Länder.
Zu einem der erfolgreichsten Blätter entwickelte sich der „Stern“, der vor allem mit seiner „Wundertüte“ aus Boulevard und Unterhaltung, Nachrichten aus Politik und Wissenschaft sowie opulenten Fotoreportagen Furore machte. Das Gespür für den Massengeschmack und die Stärke im Visuellen verdankte sich dem Gründer und Chefredakteur des „Stern“, Henri Nannen.
Dieser hatte 1937 im Alter von 24 Jahren bei der Zeitschrift „Die Kunst“ angefangen und später als Kriegsberichterstatter gearbeitet. Nach Kriegsende leitete er 1946 – 47 die „Hannoverschen Neuen Nachrichten“ und 1947 – 49 die FDP-nahe „Abendpost“, ehe er 1948 den „Stern“ gründete, den er bis 1980 als Chefredakteur und bis 1983 als Herausgeber steuerte. Name und Konzept des „Sterns“ stammten von einer Illustrierten der 30er Jahre, das Signet von der Jugendzeitschrift „Zickzack“, einem anderen seiner Hannoveraner Projekte. Außerdem war Nannen ein engagierter Sammler expressionistischer Kunst, für die er 1986 in seiner Geburtsstadt Emden ein Kunstmuseum errichtete.
Im September 1949 entstand in Hamburg aus den Pressediensten der drei westlichen Besatzungszonen die „Deutsche Presse-Agentur“ (dpa), die bald zur führenden Nachrichtenagentur der Bundesrepublik wurde und Tageszeitungen und Rundfunkanstalten über Funk mit Nachrichten und später auch Bildern versorgte.
Chefredakteur der dpa blieb der Sozialdemokrat Fritz Sänger, obwohl CDU-Chef Konrad Adenauer von Anfang an gegen ihn wetterte und die dpa auch in den folgenden Jahren immer wieder der Parteilichkeit bezichtigte. Schließlich wurde Sänger 1959 zum Rücktritt gezwungen. Von 1961 bis 1969 saß er für die SPD im Bundestag und zog sich danach nach Wedel zurück. Er starb 1984 in München.
So attraktiv war der Standort Hamburg, dass auch andere Verlage und Redaktionen hierherzogen: 1949 der „Jahreszeiten-Verlag“ aus Hannover, der mit den Zeitschriften „Film und Frau“ (später „Die moderne Frau“) und „Stimme der Frau“ (später „Für Sie“) die Mode der frühen Bundesrepublik erheblich mitbestimmte, 1952 der „Spiegel“, 1954 die „Brigitte“.
Am erfolgreichsten in den 50er Jahren waren die Blätter aus dem Hause Axel Springer. Das „Abendblatt“ mit seiner Devise „Seid nett zueinander“ pflegte die „menschliche Ansprache“ und erreichte dadurch gerade auch die weibliche Leserschaft. Die Zeitschrift „Kristall“, Nachfolgerin der „Nordwestdeutschen Hefte“, bot in erster Linie lockere Unterhaltung. Eine ausgesprochen erfolgreiche Serie war die „Geschichte der Menschheit, berichtet im Stil einer Zeitung“ aus der Feder von Gerhard Prause.
Unter ihrem Chefredakteur Eduard Rhein wandelte sich die „Hörzu“ von einer reinen Rundfunk- zu einer Familienzeitschrift mit Lebenshilfe-Rubriken, Rezepten, Fortsetzungsromanen, Berichten über Kinofilme und Stars und einem Comic um den Igel „Mecki“. 1950 betrug ihre Auflage schon eine Million Exemplare pro Woche. 1959 kündigte die „Hörzu“ eine Gutenachtsendung des SFB speziell für Kinder an und löste damit die „Sandmännchen“-Konkurrenz zwischen West- und DDR-Fernsehen aus.
1952 erschien erstmals die Boulevardzeitung „Bild“, die auch ohne Abonnementsvertrieb wegen ihrer schlagkräftigen Aufmacher, einer frischen, pointierten Sprache, brandheißen Artikeln über Prominente und Sportereignisse und nicht zuletzt auch wegen ihres unschlagbaren Preises zur bis heute mit Abstand größten deutschen Tageszeitung wurde. Entstanden nach dem Vorbild der britischen „Daily Mirror“, profitierte „Bild“ stets vor allem von Katastrophen, Skandalen und sonstigen großen Ereignissen, knickte aber auch immer dann regelmäßig in der Auflage ein, wenn sie versuchte, kampagnenartig Politik zu machen. Der Erfolg zog bald Ableger nach sich: 1956 „Bild am Sonntag“ (entstanden aus der Sonntagsausgabe des „Abendblatts“), 1983 „Bild der Frau“, 1986 „Auto-Bild“, 1988 „Sport-Bild“.
1953 erwarb Springer mit Unterstützung Adenauers von den Briten den Zeitungsverlag „Die Welt“, wozu auch „Das neue Blatt“ und diverse Immobilien gehörten. Als Adenauer später gestürzt wurde, bot Springer ihm die „Welt“ als Forum an, doch der Alte von Rhöndorf lehnte ab. Mit der „Welt“ hatte Axel Springer stets den Wunsch verbunden, vom Image eines reinen Boulevard-Machers wegzukommen. 1954 bezog der Verlag das neue Pressehochhaus in der Neustadt am heutigen Axel-Springer-Platz.
Alles andere als gut ging es demgegenüber zunächst dem „Stern“ und der „Zeit“. Beide litten 1950/51 unter schweren Finanzproblemen, die „Zeit“-Mitherausgeber Bucerius unter Rückgriff auf sein eigenes Vermögen behob und in diesem Zusammenhang auch zum neuen Eigentümer des „Stern“ wurde.
Kaum jedoch hatte Bucerius diese Krise überstanden, kam es in seinem Lieblingsblatt, der „Zeit“, zu einer heftigen Auseinandersetzung um die politische Ausrichtung des Blattes. Schon von Beginn an hatten der Redaktion sowohl Nationalkonservative angehört wie Chefredakteur Richard Tüngel und der bereits genannte, für die Außenpolitik zuständige Erwin Ettel / Ernst Krüger als auch Liberale wie Marion Gräfin Dönhoff, Josef Müller-Marein und Ernst Friedlaender. Als Tüngel 1954 einen Artikel des NS-Juristen Carl Schmitt veröffentlichte, kündigte Dönhoff. Gleichzeitig zerstritten sich die Eigentümer der „Zeit“, aus sowohl inhaltlichen wie persönlichen Gründen. Nach einigen heißen Monaten konnte Bucerius sich durchsetzen. 1955 erhielt Tüngel Hausverbot, Müller-Marein wurde neuer Chefredakteur und Dönhoff kehrte zurück vom britischen „Observer“. 1957 machte ein Schiedsgericht Bucerius zum Alleineigentümer. Fortan prägte die kühle Freundschaft zwischen Bucerius und Dönhoff die „Zeit“, der es gelang, ein deutliches liberales Profil zu entwickeln.
Marion Gräfin Dönhoff, oft auch nur „die Gräfin“ genannt, war vermutlich die bedeutendste deutsche Journalistin des vergangenen Jahrhunderts. Geboren 1909 auf dem väterlichen Schloss Friedrichstein in Ostpreußen, studierte sie Volkswirtschaft in Frankfurt am Main und Basel (Promotion 1935) und bewirtschaftete anschließend die Familiengüter. Dabei kam sie mit der Widerstandsgruppe des Kreisauer Kreises in Kontakt. Im Januar 1945 floh sie zu Pferde nach Westen und begann im Jahr darauf als Mitarbeiterin der „Zeit“, der sie fortan treu blieb, auch wenn sie 1954 – 55 vorübergehend das Blatt verließ und 1959 sogar als deutsche Botschafterin in Indien im Gespräch war.
Mit disziplinierter Arbeit, klarer Sprache und profilierten Positionen – zum Beispiel hinsichtlich des Widerstands im Dritten Reich oder als Befürworterin von Brandts Ostpolitik – prägte sie das Gesicht des Blattes, das sie von 1968 bis 1973 als Chefredakteurin und anschließend als Mitherausgeberin leitete. 1971 erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1999 die Ehrenbürgerwürde der Hansestadt.
Nach der Wiedervereinigung setzte sie sich mit großem Engagement für gute Beziehungen zwischen Deutschland und Osteuropa ein und schrieb Bestseller wie „Eine Kindheit in Ostpreußen“ oder „Namen, die keiner mehr nennt“. 2003, ein Jahr nach ihrem Tod, wurde zum ersten Mal der „Marion-Dönhoff-Preis“ verliehen, er kommt Persönlichkeiten und Projekten zugute, die sich „für internationale Verständigung und Versöhnung“ einsetzen.
Hamburgs Blätter beziehen Position
Im Richtungsstreit der „Zeit“ hatten die liberalen Stimmen gesiegt, und die „Zeit“ wurde daraufhin zu einem der führenden Meinungsblätter der Bundesrepublik. Zahlreiche markante und prominente Autoren arbeiteten für sie, zum Beispiel die Kulturredakteure Marcel Reich-Ranicki und Uwe Nettelbeck, die Wissenschaftsjournalisten Robert Jungk und Thomas von Randow, der Kolumnist Ben Witter, der Zeichner Paul Flora, als Fernsehkritiker Walter Jens („Momos“) sowie als gelegentliche Autoren etwa Carl Friedrich und Richard von Weizsäcker, Ralf Dahrendorf oder Theodor Eschenburg. Bei besonders kontroversen Themen, über die auch in der Redaktion heftig diskutiert wurde, hob man oftmals zwei Artikel nebeneinander ins Blatt, die zum Für und Wider der jeweiligen Streitfrage Stellung bezogen.
Eine der größten Leistungen der frühen Jahre der „Zeit“ war ihr Beitrag zur internationalen Verständigung: Bereits 1949 hatte Ernst Friedlaender ein erstes Treffen von Adenauer mit dem französischen Außenminister Robert Schuman herbeigeführt. 1952 gründeten Friedlaender und Dönhoff zusammen mit dem aus Hamburg stammenden US-Offizier Eric Warburg, den Politikern Erik Blumenfeld und Helmut Schmidt und anderen die Organisation „Transatlantikbrücke“ (die sich ab 1956 „Atlantik-Brücke“ nannte und 1983 nach Bonn umzog).
Im gleichen Gebäude wie die „Zeit“, dem Pressehaus am Speersort, residierte bis 1967 auch der „Spiegel“, die zweite kräftige liberale Stimme aus Hamburg. Schon oft war dieser mit den Mächtigen aneinandergeraten, zuerst 1948 mit dem holländischen Königshaus, 1950 wegen des nie bewiesenen und nie widerlegten Vorwurfs, die Entscheidung für Bonn als Bundeshauptstadt sei nur durch Bestechung zustandegekommen, 1952 wegen der Behauptung, Adenauers Berater Blankenhorn habe Bestechungsgelder vom französischen Geheimdienst erhalten. 1953 verhinderte der „Spiegel“ ein demokratisch fragwürdiges Bundespressegesetz. 1958 gerieten die zweifelhaften Methoden des Verfassungsschutzes in seinen Blick, woraufhin es sogar zu einer Ermittlung wegen Landesverrats kam.
Rudolf Augstein, Herausgeber und Mitautor, verstand sein Blatt als „Sturmgeschütz der Demokratie“ und neigte nicht dazu, sich zu verstecken. So war er auch der Hauptleidtragende der „Spiegel-Affäre“ von 1962. Im Winter 1972/73 saß er kurzzeitig für die FDP im Bundestag, war jedoch im Hinblick auf seine persönliche Einstellung zu Fragen der jüngeren deutschen Geschichte und der Wiedervereinigung eher dem nationalliberalen Lager zuzurechnen.
Das große Thema der 50er Jahre war die Deutschlandpolitik. Adenauer zog die Westintegration der Wiedervereinigung vor und wurde dafür auch von Hamburger Blättern heftig angegriffen, obgleich sie dessen Abneigung gegenüber dem Sowjetsystem teilten. Rudolf Augstein forderte unter dem Pseudonym Jens Daniel, das Ziel der Wiedervereinigung nicht aufzugeben und bezeichnete die Bundeswehr als „Symbol der Spaltung“.
Axel Springer, ursprünglich eher der SPD zuneigend, änderte in der zweiten Hälfte der 50er seine Haltung. Nach einem Moskau-Besuch und dem Chruschtschow-Ultimatum gegen Berlin 1958 wurde er zu einem unbedingten Anhänger Adenauers. Der Kern seines politischen Kurses, in den er auch seine Zeitungen „Bild“ und „Welt“ einspannte, war die Nichtanerkennung der DDR, die er zeit seines Lebens in Anführungsstrichen schreiben ließ.
Auch aus dieser Motivation heraus erwarb Springer 1959 die Mehrheit am Berliner Ullstein-Verlag und damit die Zeitungen „Berliner Morgenpost“ und „BZ“, wodurch er zum mächtigsten Verleger der geteilten Stadt wurde. Kurz darauf wurde in unmittelbarer Nähe zur Grenze mit dem Bau eines neuen Verlagsgebäudes begonnen, das auch weit jenseits der Mauer gut zu sehen war. Nach dessen Fertigstellung zog der Springer-Verlag 1966/67 an die Spree um. Die Redaktion der „Welt“ folgte allerdings erst 1975, die Redaktion der „Bild“-Zeitung 2008. Umgekehrt versuchte die DDR, den Springer-Verlag durch Stasi-Mitarbeiter zu unterwandern und in der Öffentlichkeit zu diffamieren.
Nachdem mit der Betonierung der innerdeutschen Grenze 1961 die deutsche Frage vorübergehend beantwortet worden war, verschob sich die politische Debatte auf das Gebiet der Ostpolitik. Hierbei gehörte die „Zeit“ zu den wichtigsten Befürwortern eines neuen, entspannteren Verhältnisses zu Osteuropa. Immer mal wieder wurden ostdeutsche und osteuropäische Intellektuelle nach Hamburg eingeladen: 1961 Vertreter des Ostberliner PEN-Zentrums, 1963 der russische Dichter Jewgenij Jewtuschenko.
Auf dem Feld der Innenpolitik gab es ebenfalls zahlreiche kontroverse Themen. Am umstrittensten waren seinerzeit die Gründung und der Aufbau der Bundeswehr, nicht zuletzt weil dafür auch der Sachverstand ehemaliger Wehrmachtoffiziere benötigt wurde. Während beispielsweise der „Spiegel“ gegen deren Rehabilitation wetterte und die Springer-Blätter sie bejahten, plädierte Marion Dönhoff für eine differenzierte Haltung.
Einig waren sich hingegen fast alle Blätter der Hansestadt, auch die „Bild“-Zeitung, in der Ablehnung von Atomwaffen, und so fand denn auch die größte Demonstration der Bewegung „Kampf dem Atomtod“ im Frühjahr 1958 nicht zufällig in Hamburg statt.
Ein Lieblingsgegner des „Spiegel“ war ab 1957 der Verteidigungsminister und spätere CSU-Chef Franz Josef Strauß, den zu beobachten sogar ein eigener Redakteur abgestellt wurde. Der „Spiegel“ deckte verschiedene Affären auf, Strauß antwortete zunächst mit Verleumdungsklagen, dann mit einem Paukenschlag.
In der Ausgabe vom 10. Oktober 1962 war unter dem Titel „Bedingt abwehrbereit“ eine Titelgeschichte über das Nato-Herbstmanöver „Fallex 62“ erschienen mit dem Fazit, „dass die Vorbereitungen der Bundesregierung für den Verteidigungsfall völlig ungenügend sind“. Der Verfasser Conrad Ahlers hatte vorher nochmal beim SPD-Wehrexperten Helmut Schmidt um Bestätigung nachgefragt und war dann in den Urlaub nach Spanien gefahren.
Strauß jedoch tobte und setzte alle seine Zügel in Bewegung. Am Abend des 26. Oktober ließ er die Redaktion des „Spiegel“ von der Polizei besetzen, verdächtig scheinende Artikel wurden beschlagnahmt, Augstein, Ahlers, die beiden Chefredakteure und einige andere Journalisten festgenommen. Anfang November sprach Adenauer im Bundestag von einem „Abgrund an Landesverrat“. Aber es gab auch eine Welle der Solidarität für Augstein, vor allem unter den Journalisten und Studenten. Die FDP drohte mit dem Bruch der Koalition.
Nach vier Wochen endete die Besetzung der Redaktion, aber erst nach 103 Tagen Haft wurde Augstein in die Freiheit entlassen. Strauß musste zurücktreten, ein Gericht bescheinigte ihm Amtsmissbrauch, und Innenminister Hermann Höcherl (CSU) meinte, er habe wohl „etwas außerhalb der Legalität“ gehandelt. Die „Spiegel-Affäre“ von 1962 führte so letzten Endes wiederum zu einer Stärkung der Demokratie und Pressefreiheit in Deutschland.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die junge Journalisten-Generation, die von den britischen und amerikanischen Presseoffizieren gezielt aufgebaut worden war, es in den 50er bis 60er Jahren geschafft hatte, ein kritisches, tolerantes Meinungsklima in der Bundesrepublik herzustellen. Die Kämpfe auf dem Weg dorthin waren nicht bloß Theaterdonner, sondern für manchen Beteiligten mit erheblichen Wagnissen und Risiken verbunden. Und es bleibt ebenfalls festzuhalten, dass Hamburg diesen Prozess der Entstehung einer pluralistischen Mediendemokratie maßgeblich mitbestimmt hat. Dies war angesichts der traditionellen Toleranz in der Hansestadt kein Wunder. Und sie strahlte auch auf andere Bereiche aus: 1961 gründete der Erfinder und Stifter Kurt Körber den „Bergedorfer Gesprächskreis“, in dem Politiker, Unternehmer, Medienleute und Intellektuelle hinter verschlossenen Türen über die verschiedensten politischen Themen debattierten und Ideen sondierten.
In Rückblicken auf die 40er bis 60er Jahre ist immer wieder von der „Hamburger Kumpanei“ die Rede. Damit gemeint ist die merkwürdige Beziehung zwischen den Zeitschriftenmachern Augstein, Bucerius, Jahr, Nannen und Springer, die sich in einer Mischung aus Freundschaft, Kollegialität und Konkurrenz verbunden waren und einander manchmal auch vor Gericht bekriegten. Jahr und Augstein waren privat Nachbarn, viele Redakteure wurden zwischen den Blättern ausgetauscht (bestes Beispiel: Claus Jacobi, der nacheinander für „Spiegel“, „Stern“, „Welt“ und „Bild“ arbeitete), und alle besaßen Firmenanteile der anderen. Anfang der 60er wollten Bucerius und Augstein zeitweilig ihre Verlage zusammenlegen, dann wiederum plante Augstein eine konkurrierende Wochenzeitung, schließlich schied man im Streit. Die „Zeit“ rümpfte über den populären „Stern“ die Nase, obwohl sie von dessen Gewinnen abhängig war. Der „Spiegel“ giftete gegen „Bild“, ließ aber bei Springer in Ahrensburg drucken.
Begleitet wurde das Blätterrauschen von rauschenden Festen, auf denen insbesondere Augstein und Nannen immer wieder für Gesprächsstoff sorgten, und von diversen Affären und Seitensprüngen der Beteiligten. So war beispielsweise der 1967 geborene Journalist Jakob Augstein der leibliche Sohn von Käthe Augstein und dem Schriftsteller Martin Walser.
Es war die große Zeit der bunten Publikumszeitschriften. Nannens „Stern“ berichtete in langen und opulent bebilderten Reportagen von den Skandälchen der Republik und den Prominenten und Wundern der Welt. Jahrs „Constanze“ und „Brigitte“ brachten internationale Mode ins deutsche Wohnzimmer. Springers „Hörzu“ feierte die deutschen Fernseh- und Filmstars, insbesondere mit der „Goldenen Kamera“ (seit 1965), und sein „Kristall“ (1966 eingestellt) schilderte den harten, tapferen Krieg im russischen Osten.
In den 60ern betrat ein neuer und doch auch alter Spieler das Hamburger Parkett: die Bauer-Verlagsgruppe. Nachdem Heinz Bauer die Verlagsleitung übernommen hatte, wurde zunächst das Segment der Frauen- und Modezeitschriften verstärkt, dann begann der Verlag immer stärker zu expandieren. 1962 gründete Bauer in direkter Konkurrenz zu Springers „Hörzu“ die Programmzeitschriften „TV“ und „Hören und Sehen“. 1966 kaufte er für 68 Millionen Mark gleich mehrere Titel ein, darunter „Quick“, „(Neue) Revue“, „Neue Post“, „Kicker“, „Twen“. 1968 kamen die Jugendzeitschrift „Bravo“, „Das Neue Blatt“ und der Kölner DuMont-Verlag hinzu. Innerhalb nur eines Jahrzehnts war aus einem Regionalverlag der größte deutsche Zeitschriftenkonzern geworden.
Unter dem Eindruck der doppelten Konkurrenz von Bauer und Springer legten im Sommer 1965 der Druckereibesitzer Richard Gruner und die Verleger Jahr („Constanze“, „Brigitte“, „Capital“) und Bucerius („Stern“, „Zeit“) ihre Geschäfte zusammen und gründeten den Verlag Gruner + Jahr. Lange hielt der Männerbund allerdings nicht. 1969 zog sich Gruner wieder zurück, verkaufte seine Anteile an den Bertelsmann-Konzern und ging in die Schweiz. Auch Bucerius löste 1969 seine „Zeit“ ebenfalls wieder aus dem Verlag und stieg 1973 ganz aus. Fortan bestimmte die Familie Jahr maßgeblich die Erfolgsgeschichte von Gruner + Jahr.
Dem „Spiegel“ wiederum ging es finanziell ausgezeichnet. Augstein erwarb von Bucerius und Gruner deren Firmenanteile und wurde dadurch zum Alleineigentümer. In Folge der Entfremdung zwischen ihm und Bucerius sowie zunehmender Platznot drängte es ihn, das Pressehaus am Speersort, wo „Zeit“ und „Spiegel“ Tür an Tür arbeiteten, zu verlassen, und so wurden der Architekt Werner Kallmorgen und der Designer Verner Panton mit dem Bau eines eigenen Domizils an der Brandstwiete beauftragt.
1969 zog der „Spiegel“ in das neue, zwölfstöckige Gebäude um. Außen sachlich und streng, war das Innere quietschbunt, die Etage der Kulturredaktion komplett lila, das Redaktions-Schwimmbad hellblau, die Kantine orange mit kreisrunden Tischen und Wandornamenten, braunen Kreisen auf dem Fußboden und orangenen Kugellampen an der Decke – eine Perle der Popkultur, die seit 2013 im Museum für Kunst und Gewerbe zu besichtigen ist. Bis zur Ölkrise leuchtete das Gebäude nachts außerdem in allen Farben des Regenbogens.
Die APO polarisiert
Es begann die Zeit der Studentenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition. Die jungen Akademiker experimentierten mit anderen Lebensweisen, lasen sozialistische Autoren, forderten mehr Demokratie, protestierten gegen alte Nazis und stießen mit all dem ihre Eltern gehörig vor den Kopf.
Dem versuchten vor allem die Zeitungen aus dem Axel-Springer-Verlag Einhalt zu gebieten. Als in Folge einer Kampagne der „Bild“-Zeitung 1968 der Studentenführer Rudi Dutschke fast erschossen wurde, kam es zu massiven Protesten gegen Gebäude und Mitarbeiter des Verlages. Seither war „Bild“ für die linke Opposition das meistgehasste Presseerzeugnis. 1972 wurde auf das Springer-Hochhaus in Hamburg sogar ein Bombenanschlag verübt, bei dem 36 Menschen verletzt wurden. 1974 schrieb Heinrich Böll den Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, in dem eine unbescholtene Haushälterin zum Opfer einer Boulevardzeitung wird und schließlich den verantwortlichen Journalisten erschießt. 1977 erschien Günter Wallraffs Enthüllungsbuch „Der Aufmacher“ über die zum Teil verwerflichen Arbeitsmethoden in der „Bild“-Redaktion.
Axel Springer selbst fühlte sich von den Vorwürfen übrigens auch persönlich schwer getroffen, zumal er sich sehr für die Aussöhnung mit Israel eingesetzt hatte. Und so warfen seine Blätter den Studenten ihrerseits faschistische Methoden vor. 2009 entschuldigte sich der Springer-Verlag für die damaligen Hetzartikel.
Demgegenüber verfolgten „Spiegel“ und „Zeit“ das Aufbegehren der Studenten weitgehend mit Wohlwollen, zumindest solange es gewaltfrei blieb. Das von Rudolf Walter Leonhardt geleitete Feuilleton der „Zeit“ sympathisierte ohnehin mit den Antiautoritären, „Zeit“-Redakteur Hans Gresmann war ein gern gesehener Moderator bei Podiumsdiskussionen, und bei einer Diskussion mit Dutschke und anderen Studentenführern in den Hamburger Redaktionsräumen sprang der über 60jährige Bucerius einmal auf und rief: „Sie haben ja so recht, die Jungen, sie haben ja so recht!“ Als jedoch bei den Demonstrationen Steine flogen, wurde dies von Gresmann und der gerade zur Chefredakteurin ernannten Marion Dönhoff entschieden verurteilt.
Augstein und Bucerius unterstützten die Studentenbewegung 1967/68 auch mit Geldspenden. Dabei ging es ihnen nicht nur um den liberalen Idealismus der studentischen Jugend, sondern auch – recht eigennützig – darum, die wachsende mediale und politische Macht von Axel Springer zu begrenzen. „Wir sahen unsere gewichtige Position im Zeitschriftengeschäft erheblich gefährdet“, begründete Bucerius 1969 seine Zahlungen. Und auch Augstein sorgte sich, dass „ein einzelner Mann 40 Prozent der gedruckten Nachrichten und Meinungen kontrolliert“.
Das bedeutendste meinungsbildende Blatt der linken Studentenschaft war die Hamburger „konkret“. 1957 hatten sie der Journalist Klaus Rainer Röhl und der Schriftsteller Peter Rühmkorf gegründet, wobei das notorisch defizitäre Blatt von Anfang an heimlich von der DDR mitfinanziert wurde. Zahlreiche wortmächtige Autoren schrieben für „konkret“, unter anderem Erich Fried, Sebastian Haffner und Arno Schmidt. Eine der wichtigsten Redakteurinnen war Ulrike Meinhof.
Die Tochter eines Kunsthistorikers aus dem niedersächsischen Oldenburg hatte schon früh ihre Eltern verloren. 1939, als Meinhof fünf Jahre alt war, starb der Vater, acht Jahre später die Mutter, sie wuchs auf bei der Historikerin Renate Riemeck. 1958 lernte sie Klaus Rainer Röhl kennen, der ihr anbot, bei seiner gerade gegründeten „konkret“ mitzuarbeiten. Sie brach ihr Studium ab, heiratete Röhl 1961, wurde Mutter von Zwillingen und sogar Chefredakteurin von „konkret“. Aus der Stipendiatin der Studienstiftung wurde eine scharfsinnige, aber auch herrische Weltverbesserin, die kritische Artikel schrieb und in der Hamburger Gesellschaft Anerkennung genoss.
Von Röhl, der sie immer wieder mit anderen Frauen betrog, trennte sie sich schließlich und zog nach Berlin, wo sie die gewaltbereite Clique um Andreas Baader und Gudrun Ensslin kennenlernte, den Kern der späteren „Rote Armee Fraktion“. Nachdem sie eine letzte journalistische Arbeit fertiggestellt hatte, ein Fernsehfeature über ein Berliner Fürsorgeheim unter dem Titel „Bambule“, half sie 1970 Baader aus der Polizeihaft zu befreien und ging in den Untergrund, verübte Banküberfälle und Bombenanschläge. 1972 wurde sie in Hannover festgenommen. 1976 beging sie im Stuttgarter Gefängnis Selbstmord.
Eine Episode jener bewegten Zeit betrifft das Schicksal ihrer Zwillingstöchter Bettina und Regine Röhl. Als Meinhof 1970 das Land verließ, um in einem jordanischen Palästinenserlager zur Terroristin ausgebildet zu werden, wurden die Töchter vorübergehend in einem Hippie-Camp auf Sizilien untergebracht. Dies erfuhr der damals 24jährige Journalist Stefan Aust, der Meinhof aus der gemeinsamen Zeit bei „konkret“ kannte. Einem spontanen Impuls folgend, fuhr er kurzerhand nach Süditalien und brachte unter einem Vorwand die Mädchen zu ihrem Vater zurück. „Ich fand das spannend“, so Aust später zu seiner Motivation.
Auch in den 70ern begleitete „konkret“ die akademische Linke. Peggy Parnass berichtete über NS-Prozesse, Karlheinz Deschner über dunkle Seiten der Kirchengeschichte, und der neue Herausgeber Hermann Gremliza verstand das Blatt grundsätzlich als „publizistische Speerspitze einer seriösen Linken“, die das schreibe, „was andere nicht wissen wollen“. Röhl verließ die Zeitschrift 1974 und schloss sich in den 90ern dem nationalkonservativen Flügel der FDP an.
Gern lasen die links orientierten Studenten auch „Das Argument“, eine in Eppendorf erscheinende Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. In dem gleichnamigen Verlag erschienen bald auch Bücher, vor allem zur Geschichte des Marxismus und zum Feminismus, ab den 80ern auch Unterhaltungsliteratur, zum Beispiel die ersten deutschen Frauenkrimis.
Ein Nebeneffekt der Studentenbewegung war eine deutliche sexuelle Enthemmung, die auch und gerade auf dem Hamburger Pressemarkt gerne aufgegriffen wurde: „Bild“ und „Stern“ schmückten ihre Titelseiten zunehmend mit nackter Haut, der Bauer-Verlag ergänzte seine erotisch gewürzten Blätter „Neue Revue“, „Praline“ und „Wochenend“ 1972 um die deutsche Ausgabe des „Playboy“.
Im April 1968 erschienen zum ersten Mal die „St. Pauli Nachrichten“, zuerst zum Preis von 10 Pfennigen für vier Seiten, 1970 schon mit einer Auflage von weit über einer Million. Mitglieder der Redaktion waren unter anderem Henryk M. Broder und Stefan Aust, die beide später für den „Spiegel“ arbeiteten. Die Wochenzeitung enthielt linke bis linksradikale Texte, freche Satiren, von den Lesern getextete und fotografierte Pornografie und eine große Menge ausgesprochen beliebter Heiratsannoncen. Im Laufe der 70er ging der politische Anspruch verloren, und das Blatt wandelte sich zu einer eher biederen Erotikzeitschrift.
Der Streit um die APO setzte sich später in der Auseinandersetzung um Willy Brandt und dessen Ostpolitik





























