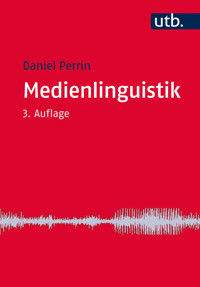
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Lehrbuch führt in zentrale Fragen, Methoden und Befunde der Sprachwissenschaft ein und bezieht sie systematisch auf den Sprachgebrauch in den Medien. Der Schwerpunkt gilt dabei der journalistischen Textproduktion. Daniel Perrin erklärt, wie Medientexte entstehen, wie solche Prozesse erforscht werden und wie ein medienlinguistischer Ansatz dazu beiträgt, medienvermittelte öffentliche Kommunikation zu verstehen und zu gestalten. Fallbeispiele, Übungen und Lösungen aus Theorie und Medienpraxis ergänzen die Einführung. Auf der Website zum Buch wird das Angebot laufend ausgebaut: https://www.medienlinguistik.net.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
utb 2503
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
A. Francke Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK/Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
Waxmann · Münster · New York
Daniel Perrin
Medienlinguistik
3., aktualisierte Auflage
UVK Verlagsgesellschaft mbH · Konstanz
mit UVK / Lucius · München
Professor Dr. Daniel Perrin lehrt Medienlinguistik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de. Zusätzliche Materialien zum Buch befinden sich unter www.medienlinguistik.net
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2006
2. Auflage 2011
3. Auflage 2015
© UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2015
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
UVK Verlagsgesellschaft mbH • Deutschland
Schützenstr. 24 • 78462 Konstanz
Tel. 07531-9053-0 • Fax 07531-9053-98
www.uvk.de
UTB-Nr. 2503
ISBN (print) 978-3-8252-4362-3 ISBN (epub) 978-3-8463-4362-3
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Inhalt
Die schnelle Tour – Zum Schmökern vor dem Lesen
Fall RÄTSELTITEL: Auf den ersten Blick
Aufsatz EKSTRÖM: Interviewantworten rekontextualisieren
Originale!
Die fünf Teile des Buchs
A
Einleitung: Entdecken, arbeiten und lernen mit diesem Buch
B
Medienlinguistik als linguistische Teildisziplin
C
Systematik medienlinguistischen Wissens
D
Medienlinguistische Projektpraxis in Forschung und Transfer
E
Intermezzo: Daten zum Buch und Daten im Netz
A
Einleitung: Entdecken, arbeiten und lernen mit diesem Buch
1
Zum Beispiel der Fall RISIKEN
2
Zum Beispiel der Begriff Rekontextualisieren
Fall RISIKEN: Hinter die Oberfläche
Fall WAHLKAMPF: Bruchstück einkopiert
Fall FLUGHAFEN: Vorweg werten
Fall RÄTSELTITEL: Auf den ersten Blick
3
Noch mehr Aufgaben – Das didaktische Konzept
4
Und die Lösungen? – Das Lehrmittel im Medienverbund
5
Die Ausrichtung im Diskurs
B
Medienlinguistik als linguistische Teildisziplin
Streiflicht WISSENSCHAFTSTHEORIE: Wie man Wissen schafft
1
Medienlinguistik im Wissenschaftsbetrieb
1.1
Disziplinen ausprägen
Nicht-Linguistik, Linguistik, Angewandte Linguistik, Medienlinguistik
1.2
Disziplingrenzen überwinden
Multidisziplinäre, interdisziplinäreund transdisziplinäre Aspekte
2
Das Erkenntnisinteresse der Medienlinguistik
Aufsatz CHOI: Zwei Perspektiven
2.1
Der Gegenstand
Aufsatz STÖCKL: Ein A ist ein A ist ein ASprache, SprachgebrauchKommunikation und Medium, Publizistisches MediumStreiflicht MEDIENKONVERGENZ, Fall RISIKEN: Nachbessern
2.2
Die Fragestellungen
Synchron und diachron, Rezeption und Produktion
3
Forschungsmethoden in der Medienlinguistik
Streiflicht METHODOLOGIE: Wo stehen Sie?
3.1
Sprachprodukte untersuchen mit der Versionenanalyse
Die Leistung der Versionenanalyse: Fokus auf intertextuelle Ketten
3.2
Kognitive Praktiken untersuchen mit der Progressionsanalyse
Die Leistung der Progressionsanalyse: Fokus auf Schreibprozesse
3.3
Soziale Praktiken untersuchen mit der Variationsanalyse
Streiflicht SELBSTANSPRUCH: Was Redaktionen wollenDie Leistung der Variationsanalyse: Fokus auf Audience Design
3.4
Kognitiv-soziale Praktiken untersuchen mit der Metadiskursanalyse
Fall RÄTSELTITEL: ÄtschDie Leistung der Metadiskursanalyse: Fokus auf Language Awareness
3.5
Die Methoden ergänzen sich
Streiflicht KORPORA, Streiflicht TRANSKRIPTION
4
Fazit zur Medienlinguistik als linguistischer Teildisziplin
Transdisziplinär nützlich, Interdisziplinär anschlussfähig, Disziplinär eigenständig, Aufsatz Perrin: Zwei Perspektiven, Streiflicht PRODUKTIONSMODELL: Neun Messpunkte
C
Systematik medienlinguistischen Wissens
1
Die Umweltperspektive der Medienlinguistik
1.1
Begegnungen: Interviewte herausfordern vs. Publika informieren
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
1.2
Herstellung: Produkt vollenden vs. Prozess optimieren
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
1.3
Diskurszusammenhang: Diskurs vermitteln vs. Storys zuspitzen
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
1.4
Zeichenvielfalt: Texten vs. vertonen, bebildern und verlinken
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, sechs Aufgaben dazu
2
Die Funktionsperspektive der Medienlinguistik
2.1
Benennen: Bekanntes weiterziehen vs. Neues erklären
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
2.2
Denken: Gemeintes sagen vs. Ergänzbares auslassen
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
2.3
Handeln: Öffentlichkeit informieren vs. Medien verkaufen
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
2.4
Verbinden: Zielpublika ansprechen vs. der Sache gerecht werden
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, sechs Aufgaben dazu
3
Die Strukturperspektive der Medienlinguistik
3.1
Lautebene: Spontan wirken vs. Nutzer führen
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
3.2
Wortebene: Wortschatz beschränken vs. Schlagwörter setzen
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
3.3
Satzebene: Äußerungen portionieren vs. Information verdichten
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, fünf Aufgaben dazu
3.4
Textebene: Routinen nutzen vs. Muster aufbrechen
Theorie- und praxisgeleitete Fragestellung, sechs Aufgaben dazu
4
Fazit zur Systematik medienlinguistischen Wissens
Weiter üben im WWW
D
Medienlinguistische Projektpraxis in Forschung und Transfer
1
Forschungsprojekt: IDÉE SUISSE
1.1
Forschungsziel
Problem, FragestellungErwartbare Ergebnisse, Wissenschaftliche BedeutungWissenstransformation
1.2
Forschungsstand
Theoriebildung und MethodikPolitischer Bezugsrahmen, Ökonomischer BezugsrahmenOrganisationsperspektive, Gesellschaftsperspektive
1.3
Forschungsplan
Modul A: Externe AnforderungenModul B: Interne LeitvorstellungModul C: Redaktionelle TextproduktionModul D: Redaktioneller Metadiskurs
1.4
Fazit zum Forschungsprojekt IDÉE SUISSE
2
Transferprojekt: TEXTBERATUNG TA
2.1
Textberatung als kunterbunter Markt
Domänenspezifische Unterschiede
2.2
Professionelle Textberatung
Von der Zuständigkeit der Angewandten Linguistik
2.3
Textberatung am Beispiel Redaktionscoaching
Den Konfliktraum absteckenIm Leitbild Qualität festlegen, Zum Beispiel Inland und KulturIm Schreibcoaching die Repertoires erweiternDie Textprogression aufzeichnenRepertoires erschließenMit Interventionen arbeitenMit der Sprachkritik die Produkte und den Maßstab überprüfen
2.4
Fazit zum Transferprojekt TEXTBERATUNG TA
3
Forschungsrahmen für medienlinguistische Projekte
Streiflichter CDAund ETHNOGRAFIEStreiflichter GROUNDED THEORY, TD, RSTund DST, Fall LEBANON
3.1
Fazit zu den Forschungsrahmen
E
Intermezzo: Daten zum Buch und Daten im Netz
Originale!
1
Datenkorpora
Korpus 1: Quellen und Versionen einer Online-NachrichtKorpus 2: Textproduktionsprozesse zu RadiobeiträgenKorpus 3: Sprachproben aus FernsehnachrichtenKorpus 4: Leitbild und Sprachkritik einer ZeitungsredaktionKorpus 5: Sprachpolitik, -norm und -praxis im öffentlichen Rundfunk
2
Transkriptionssystem GAT
Die Partiturdarstellung: Spuren und ZeilenZeichen für Rollen und QuellenZeichen für die SequenzierungZeichen für prosod is che MerkmaleZeichen für Merkmale jenseits gesprochener Sprache
3
Verzeichnis der Aufgaben
4
Verzeichnis der Fachbegriffe
5
Verzeichnis der Namen und Quellen
Dank
Die Idee mit dem Schmökerverzeichnis vor dem Inhaltsverzeichnis stammt von Aleksandra Gnach, die kräftig mitgeholfen hat, dieses Buch zu Papier zu bringen. Inhaltliche Anregungen verdanke ich auch Kirsten Adamzik, Jannis Androutsopoulos, Harald Burger, Marcel Burger, Christa Dürscheid, Jürg Häusermann, Werner Holly, Petra Jörg, Michael Klemm, Martin Luginbühl, Patrick Tschirky, Iwar Werlen und Toni Zwyssig. Beim Gestalten, Überprüfen und Vernetzen des Lehrmittels mitgearbeitet haben Christine Albrecht Perrin (Coaching), Heike Burkard (Korrektorat), Barbara Buri (Transkription), Maureen Ehrensberger-Dow (Proofreading), Willy Federer (htm), Mathias Fürer (Abstracts), Thomas Gantenbein und Karin Grob (Verzeichnisse), Daniel Hanimann (Kontakt zu EUROPE BY SATELLITE), Christian Irgl (Webauthoring), Sarah King (Lösungsdatenbank), Liliane Krauthammer (Typografie), Luzius Meyer Kurmann (Projektfinanzierung SWISS VIRTUAL CAMPUS), Sibylla Laemmel (Lektorat Spanisch), Hannah Müller (Verlagslektorat), Alexandra Novkovic (Abstracts Korpus 3), Heimo Paffhausen (Quicktime), Anna-Katharina Pantli (Terminologie), Maria-Noemi Rossetto-Giallella (Korrektorat Website), Michael Ruppen (Datenbanken), Michael Schanne (Projekt IDÉE SUISSE), Marcel Sennhauser (Prozessdaten Korpus 1), Rüdiger Steiner (Geduld), Harry Straehl (Videostreams), Simon Vögtli (Scans Korpus 4), Marlies Whitehouse (Korrektorat), Vinzenz Wyss (Schnittstelle zur Kommunikationswissenschaft), Peter Zschunke (Quellenrecherche Korpus 1). Das Lehrmittelprojekt wurde im Rahmen des Bundesprogramms SWISS VIRTUAL CAMPUS maßgeblich gefördert. Das Arbeiten mit empirischen Daten ermöglichten und ermöglichen die Praxispartner AGENCE FRANCE PRESSE, ASSOCIATED PRESS, DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR, REUTERS, SCHWEIZERISCHE DEPESCHENAGENTUR, TAMEDIA und SRG SSR IDÉE SUISSE. Zum Feinschliff dieser dritten Auflage beigetragen haben die vielen Nutzerinnen und Nutzer des Buchs, die mir von ihren Erfahrungen berichtet haben. Ihnen allen großen Dank!
A
Einleitung: Entdecken, arbeiten und lernen mit diesem Buch
Wofür sich Medienlinguistik interessiert, wie sie vorgeht, zu welchen Ergebnissen sie gelangt und was dies der Wissenschaft und der Praxis bringt – damit befasst sich dieses Buch. Das Lehrmittel verortet die Medienlinguistik als eine Teildisziplin der Linguistik, erfasst systematisch das Besondere des Sprachgebrauchs im Umfeld publizistischer Medien und schlägt die Brücke zum medienlinguistischen Wissenschaftsbetrieb. In seinen fünf Teilen führt das Buch ein in das Vorgehen, den Gegenstand und den Fachdiskurs der Medienlinguistik:
Der Teil A umreißt das Thema und erklärt die Logik des Buchs. Wer diesen kurzen Teil ganz durcharbeitet, kann später zum Beispiel die Querbezüge zwischen Theorie und Praxisfällen besser nutzen.
Der Teil B beschreibt Medienlinguistik als wissenschaftliche Teildisziplin mit eigenem Gegenstand, eigenen Erkenntnisinteressen und typischer Methodik.
Der Teil C erklärt den Sprachgebrauch in medienvermittelter öffentlicher Kommunikation systematisch aus drei Blickwinkeln: Sprachumwelt, Sprachfunktion, Sprachstruktur.
Der Teil D schlägt die Brücke vom gedruckten Einführungsbuch zu exemplarischen Projekten und zum laufenden Fachdiskurs, greifbar im Internet >> www.medienlinguistik.net und darüber hinaus.
Der Serviceteil E zeigt, wie die Sprachdaten dieses Buchs transkribiert wurden, beschreibt die Datenkorpora und verzeichnet die Fachbegriffe und Quellen.
Der Bogen spannt sich also vom Profil über den Gegenstand bis zum Nutzen der Medienlinguistik, zur Anwendung medienlinguistischen Wissens in den forschenden Disziplinen und der beforschten Berufspraxis. Während das Buch so das Hauptthema Medienlinguistik möglichst weit fasst, stellt es beim Teilthema Mediensprache scharf auf journalistische Textproduktion. Diese Produktionsperspektive wird in den anderen Einführungen kaum bezogen. Bislang wenig diskutiert wurden auch das wissenschaftliche Profil der Medienlinguistik und ihre Bedeutung für die Kommunikationspraxis und den Forschungsbetrieb.
Die MEDIENLINGUISTIK richtet sich an Studierende der Linguistik und der Kommunikations- und Medienwissenschaft, die sich interessieren für Theorie und Praxis des sprachgebrauchs in medialer öffentlicher Kommunikation – weil sie zum Beispiel eine reflektierte Tätigkeit in Kommunikationsberufen anstreben.
Das Buch eignet sich zur Vor- und Nachbereitung von Lehre an der Hochschule, aber auch zum Selbststudium. Die Lehr-/Lernziele umfassen • Wissen, • Methoden und • Haltungen – also auch die Fähigkeiten, medienlinguistisches Wissen anzuwenden und einzuschätzen:
Wissen: Sie verstehen den Sprachgebrauch im Zusammenhang mit publizistischen Medien als Schnittstelle kognitiver und sozialer Praktiken.
Methoden: Sie können Werkzeuge der Medienlinguistik anwenden, um Kommunikation zu analysieren, zu reflektieren und zu optimieren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























