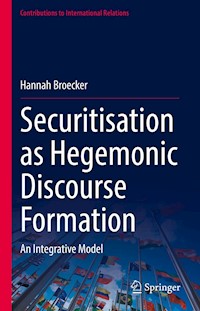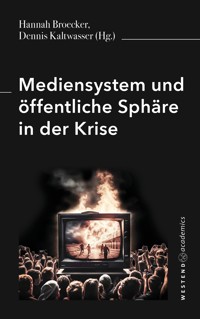
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend academics
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratie und Medien sind in der Massengesellschaft nicht voneinander zu trennen, denn es liegt in der Verantwortung der Medien, den Bürgern eine Orientierung in der komplexen Realität der Gesellschaft zu ermöglichen. Im Kontext der verstetigten Krisendiskurse der vergangenen Jahre wurden sowohl die Grundlagen für demokratische Debattenräume als auch deren gesellschaftliche Anwendung infrage gestellt. In diesem Band soll daher zunächst der Zustand des öffentlichen Debattenraumes untersucht werden. Ziel der Beiträge ist es, den gegenwärtigen Zustand und die Herausforderungen unserer (Medien-)Demokratie zu bewerten sowie Chancen und Impulse, die aus dieser Analyse erwachsen können, zu diskutieren. Im Fokus steht dabei sowohl der politische Diskurs über Demokratie als auch die demokratische Verfasstheit der öffentlichen Sphäre selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Inhalt
Cover
Mediensystem und öffentliche Sphäre in der Krise
Eine Skizze zur Einführung
Literatur
Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit
Die offene Gesellschaft und ihr öffentlicher Raum
Die real existierende Postmoderne
Auf der Suche nach den Ursachen
Ein Ausweg
Rechtsordnung und offene Gesellschaft
Literatur
Inversion demokratischer Normen:
Einleitung
Grundlagen der demokratischen Öffentlichkeit
Die Inversion demokratischer Normen
Die Inversion der Bedeutung des Bürgers
Die Unmündigkeit des Bürgers
Staatlich-mediales Informationsmonopol
Verbindung des feindlichen Außen mit dem Innen
Die Inversion der Meinungsfreiheit
Wissenschaftlichkeit und gefährliche Verhaltensweisen
Der Schutz der Schwachen
Inversion der Bedeutung von Demokratie
Delegitimierung von demokratischen Institutionen
Verwirrung, Spaltung und Polarisierung
Fazit
Literatur
Transparenz
Eine Kategorie als Projektionsfläche für Hoffnungen und Sorgen
Von links nach rechts? Eine Begriffswanderung
Transparenz vs. Öffentlichkeit
Transparenz im Journalismus
Überwachungskapitalismus und das metrische Wir
Fazit: Schlüsselbegriff mit Ambivalenzen
Literatur
Wider die Repräsentationsinsel
Einleitung
Repräsentationssysteme produzieren endogen Repräsentationskrisen
Metaphorische Unschärfe der Repräsentationslücke zweiter Art
Ideengeschichte und Konstituierung des Repräsentativsystems in der BRD
Zur repräsentativen Abbildung der Wählerschaft
Determinanten der Repräsentationsinsel
Materielle Ausstattung
Vertrauen in die Institutionen
Zur Funktionsweise der Repräsentationsinsel
Vom Beobachter zum Akteur
Abschreckende Abhängigkeiten
Fazit: Per Systemfehler aus der Sackgasse
Literatur
Modell für eine selbstorganisierte Öffentlichkeit
Einleitung
Leitmedien, Gegenöffentlichkeit und zwei Beispiele
Öffentlichkeit und herrschende Meinung
Krise der Medien und allgemeine Krisentendenzen
Definitionen von Gegenöffentlichkeit
Gegenöffentlichkeit und ihre Grenzen
Selbstorganisierte Öffentlichkeit
Literatur
Illiberale Zeitenwende
Meinungsfreiheit unter dem Läuterungsrad
Meinungsfreiheit second, »Klimarettung« first
Meinungsfreiheit als Gesundheitsbedrohung
Transformation des Freiheitsbegriffs: von der individuellen zur agenda- und machtkonformen Freiheit
Literatur
Die Wiederkehr der Apokalypse. Religiöse Elemente im Katastropheniskurs
Einleitung
Geschichte und Gegenwart der Apokalypse
Furchterzeugung als Mittel der Politik
Das Sicherheitsdispositiv zwischen Politik und Medien
Souveränität und nackter Körper
Die Macht der Staatsmaschine
Medizinische Moralisierung statt kapitalistischem Hedonismus
McCarthyisierung von Medien und Wissenschaften
Literatur
Gibt es einen »Extremismus der Mitte«?
Positionsbestimmung
Extremismus der Mitte in den Covidjahren
Die autoritäre Persönlichkeit
Wo die politische Peilung versagt: Im Bermudadreieck aus Programmatik, Projektion und Praxis
Intransigenz der Haltungen
Cancel Culture
Offene Diskurse als Ventil
Sicherheit
Die Bewegungen des Extremisten der Mitte
Verhältnis zu den Leitmedien
Gestörter Bezug zur Geschichte und Eurozentrismus
Zusammenfassung
Literatur
Unter Feuer
Einleitung: Unerhörte Begebenheiten
Fragen und Erklärungsversuche
Trickser und Täuscher: das Handwerk der Denunzianten
Redaktionelle Entscheidungen: Ein Blick in die Blackbox
Individuelle Prädispositionen: Die Psychopathologie der Denunziationskampagne
Die Ökonomie der Kampagne: Von der Information zum Ressentiment
Machteliten und Satrapen – wie politische Verfolgung orchestriert wird
Ergebnisse
Literatur
War Propaganda Today – The Outsourcing of Propaganda and the Consequences for Democratic Accountability44
Abstract
Introduction
Concepts: Propaganda and Outsourcing Propaganda
Outsourcing
The 2011-Present War in Syria
Outsourcing Pro War Narratives
Alleged Chemical Weapons Attacks
Shaping the Information Space on Chemical Weapons
Hamish de Bretton-Gordon
Bellingcat
The White Helmets
Opaque Vested Interests
Discussion and Conclusion
Literatur
Kriegspropaganda damals und heute. Von den Techniken der Creel-Commission im Ersten Weltkrieg bis zum Cognitive Warfare der Nato seit 2020
Einleitung
Propaganda aus psychologischer Perspektive
Das Konzept der Soft Power
Kriegspropaganda damals: Die Arbeit der Creel-Kommission
Gräuelpropaganda
Dämonisierung und Entmenschlichung des (alleine schuldigen) Gegners
Der Cognitive Warfare der Nato heute
Gräuelpropaganda
Dämonisierung und Entmenschlichung des Gegners
Schluss
Literatur
Siglen Quellenverzeichnis
Vernunft und Hybris: Rationalistisches Gesellschaftsmanagement als ideologisch-historische Konstante
Zwei Schlüsseldokumente der Frühen Neuzeit
Demokratische Traditionen in der Krise
Materialistischer Utilitarismus als antidemokratische Triebfeder
Rückblende: Platons Politeia
Nachhaltigkeit und Bevölkerungskontrolle
Das Gespenst der Überbevölkerung
Von der Eugenik in den transhumanistischen Wahn
Propaganda und Informationskontrolle im 20. und 21. Jahrhundert
Fazit: Menschen- und Gesellschaftsbilder im Konflikt
Literatur
Quellen
Orienterungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Mediensystem und öffentliche Sphäre in der Krise
Herausgegeben von Hannah Broecker und Dennis Kaltwasser
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendacademics.com
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0; weitere Informationen finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.
Print-ISBN: 978-3-949925-20-7
E-Pub-ISBN 978-3-949925-21-4
https://doi.org/10.53291/9783949925214
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg, 2024
Umschlaggestaltung: Westend Verlag, Neu-Isenburg und Dennis Kaltwasser, erstellt mit dem KI-Tool Stable Diffusion
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Printed in Germany
Hannah Broecker ist promovierte Politikwissenschaftlerin mit einem Fokus auf politische Sicherheitsdiskurse. Derzeit arbeitet sie am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität München zu Themen demokratischer Öffentlichkeit, der Qualität in der Berichterstattung und insbesondere des Aufbaus neuer Zensurregime.
Dennis Kaltwasser ist Sprachwissenschaftler und Habilitand am Institut für Germanistik der Universität Gießen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Sprachtheorie, der Medienlinguistik und des politischen Sprachgebrauchs.
Mediensystem und öffentliche Sphäre in der Krise
Hannah Broecker, Dennis Kaltwasser, Michael Meyen
Eine Skizze zur Einführung
»In unserem Land ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört«: Dieser erste Satz aus dem Gründungsaufruf des Neuen Forums vom 10. September 1989 wird gerade aus dem Museum geholt. Dies gilt in gewisser Weise auch für den zweiten Satz, der die These unterfüttern soll: »Belege dafür sind die weit verbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private Nische oder zur massenhaften Auswanderung.«
Natürlich: Der Exodus aus der DDR ab dem Sommer 1989 ist in der jüngeren Geschichte nach wie vor beispiellos. Allein im Juli und August, den beiden Monaten vor der Gründung des Neuen Forums, verließen rund 54 000 Menschen via Ausreisegenehmigung oder Flucht das kleine Land. Im September und Oktober kamen noch einmal 133 000 dazu (Hertle 2019). In der sehr viel größeren Bundesrepublik lag die Zahl der deutschen Auswanderer seit den frühen 1990er Jahren stabil im niedrigen sechsstelligen Bereich. Für 2014 und 2015 meldete das Statistische Bundesamt hier jeweils knapp unter 150 000. Danach macht die Kurve einen Sprung nach oben und ist dort von 2016 (281 411) bis 2023 (291 924) geblieben.
Über zwei Millionen Deutsche, die in den letzten acht Jahren ihre Heimat verlassen haben: Das ist genauso ein Symptom für die Krise der öffentlichen Kommunikation wie die wachsende Gruppe von Menschen, die es ablehnen, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen (2022: rund sieben Prozent der Haushalte) oder sich ganz vom traditionellen Journalismus abwenden. 38,5 Prozent der Schweizer, sagt eine Studie der Universität Zürich vom Oktober 2022, verweigern sich den Nachrichtenmedien, fast doppelt so viele wie 2009 (FÖG 2023: 19). Eine letzte Zahl: Nur 40 Prozent der Deutschen über 16 hatten 2023 »das Gefühl«, ihre »politische Meinung frei sagen« zu können – ein Wert, der in dieser Allensbach-Langzeitstudie bis in die frühen Nullerjahre stabil über 70 Prozent lag (Schatz et al. 2023: 73).
»In unserem Land ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört«: Diese Diagnose zielt in das Herz von Regierungssystemen, die in ihrer Selbstbeschreibung versprechen, dass alle mitreden können oder wenigstens gehört werden, wenn es um die »politische Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse« geht (Lessenich 2019: 18). Demokratie braucht Öffentlichkeit. Demokratie braucht einen Ort, der es erlaubt, alle Themen und alle Perspektiven vor dem Horizont aller zu diskutieren. Öffentlichkeit: Das ist ein Ort der Begegnung, der für die Politik ganz ähnlich funktioniert wie der Markt für die Wirtschaft (vgl. Gerhards/Neidhardt 1990). Was immer der Staat sich ausdenkt, muss vor der Bürgerschaft bestehen. Das heißt auch: Wir müssen darüber sprechen können. Rede und Gegenrede. Alles auf den Tisch. Keiner der Zugänge zum Thema Qualität im Journalismus kommt an der Kategorie publizistische Vielfalt vorbei (vgl. Arnold 2016, Geuß 2018). Die Forderung, Öffentlichkeit herzustellen, wurzelt im Pluralismusmodell. In der Gesellschaft gibt es viele und zum Teil gegensätzliche Meinungen und Interessen, die zunächst gleichberechtigt sind (die Interessen von Einzelpersonen und Außenseitern genauso wie die Interessen, die in Parteien oder Verbänden organisiert sind). Feld der Verständigung ist die Öffentlichkeit. »Prinzipiell darf keine soziale Gruppe, ja nicht einmal ein Individuum, aber auch kein Gegenstand, kein Thema, kein Problem von ihr ausgeschlossen sein« (Pöttker 1999: 219 f.).
Wir schreiben diese Zeilen im späten Februar 2024. Die Medienbranche diskutiert wieder einmal über den Umgang mit der AfD. Mike Beuster, Vorsitzender der größten Standesorganisation des Berufs, fordert bei entsprechenden Berichten Warnhinweise wie auf Zigarettenschachteln. Auf der Plattform Goodimpact, die sich als Speerspitze eines konstruktiven Journalismus versteht, wird angeregt, ganz ähnlich wie in Luxemburg und Wallonien einen »cordon sanitaire médiatique« zu errichten und »Menschen, die rassistischen, demokratiefeindlichen Gruppen nahestehen«, nicht mehr zu Live-Interviews und Talkshows einzuladen (Petzold 2024). Dass eine »offene Gesellschaft« »Feinde« hat, die es zu bekämpfen gilt, ist seit Karl Popper (1945) kein Paradox mehr, sondern ein Glaubenssatz, der vor allem dort heruntergebetet wird, wo man etwas zu verlieren hat. »Die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus«, hat Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung am 15. Dezember 2021 gesagt und damit den Takt der Vernichtung genauso vorgegeben wie ihre Sprache. »Unsere Demokratie«, bedroht von »rechts«. Genauer wird es nicht. Genauer darf es nicht werden. »Die Geschichte aller bisherigen Demokratie«, sagt Stephan Lessenich (2019: 20), ist »im Kern eine Geschichte der Klassenkämpfe«. Wenn Regierungspolitiker in einem Konzernstaat von »unserer Demokratie« sprechen, dann ist das wörtlich zu nehmen. Lessenich (2019: 38): »›Die da oben‹ wehren sich dagegen, dass ›die da unten‹ meinen, sich auf eine Stufe mit ihnen stellen zu können.«
»In unserem Land ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört«: Der Klassenkampf von oben zerstört ähnlich wie in der DDR die öffentliche Sphäre und damit den Ort, an dem Verständnis für die Interessen der anderen entstehen könnte und damit so etwas wie innerer Frieden (vgl. Mausfeld 2023). Der Gründungsaufruf des Neuen Forums spricht ganz im Geist von Demokratie- und Öffentlichkeitstheorie von einem »Interessenausgleich zwischen den Gruppen und Schichten« und fordert einen »demokratischen Dialog über die Aufgaben des Rechtsstaates, der Wirtschaft und der Kultur«. Weiter im Text: »Über diese Fragen müssen wir in aller Öffentlichkeit, gemeinsam im ganzen Land, nachdenken und miteinander sprechen.« Eine Einleitung wie diese ist nicht der Ort, das Propaganda- und Zensurregime zu analysieren, das den Journalismus der Leitmedien seit den späten Nullerjahren wie in einem Sandwich zerquetscht und ihren vorläufigen Höhepunkt im Digital Services Act der Europäischen Union erreicht hat (vgl. Hofbauer 2022, Meyen 2024). Wichtig ist hier das Ergebnis, das in der Medieninhaltsforschung als Gleichklang nachhallt – von der »Flüchtlingskrise« (Haller 2017) über Corona (vgl. Maurer et al. 2021, Rieg 2023) bis zum Ukraine-Krieg (vgl. Maurer et al. 2023). In Kurzform: Es dominiert die Regierungssicht, unterfüttert mit Stimmen von handverlesenen Experten, die als »die« Wissenschaft präsentiert werden, als ob es weder Streit noch Zweifel geben würde und damit auch keine legitimen Gegenpositionen (vgl. Lütge/Esfeld 2021).
Zu einem Problem wird dies auch deshalb, weil alle anderen Kanäle der Öffentlichkeit (etwa: Demonstrationen, Versammlungen, Sachbücher, Konzerte, Vorträge) Leitmedienpräsenz voraussetzen, um allgemeine Sichtbarkeit zu erreichen. Nur hier können und müssen wir unterstellen, dass alle anderen das Gleiche gelesen, gesehen, gehört haben. Niklas Luhmann (1996: 43, 120–122) sagt, dass das »System Massenmedien« Information »so breit« streue, »dass man im nächsten Moment unterstellen muss, dass sie allen bekannt ist (oder dass es mit Ansehensverlust verbunden wäre und daher nicht zugegeben wird, wenn sie nicht bekannt war)«. Auf diese Weise entstehe eine »zweite, nicht konsenspflichtige Realität« – ein »Hintergrundwissen«, von dem man bei jeder Kommunikation ausgehen könne. Zu diesem Hintergrundwissen gehört die Moral, die man öffentlich zeigen muss, um nicht isoliert zu werden (vgl. Noelle-Neumann 1980). Wenn die Leitmedien Demonstrationen, die einen Kurswechsel fordern, ausblenden, kleinreden oder verdammen und dieses Prinzip auch auf die Plattformen des Gegendiskurses anwenden, die im Internet entstanden sind, dann bereiten sie nicht nur Polizeieinsätzen und Zensurgesetzen den Boden, sondern blockieren auch den Austausch zwischen den Öffentlichkeitsebenen, wie er zum Beispiel im Arenamodell beschrieben wird (vgl. Gerhards/Neidhardt 1990), und verhindern, dass die Bevölkerungsgruppen, die sich nicht repräsentiert fühlen, ihre Sicht der Dinge in den politischen Prozess einspeisen können (vgl. Patzelt 2015).
Der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit, der an dieser Stelle nur skizziert werden kann, erfasst auch die Universitäten, die im Wahrheitsregime der Gegenwart dazu auserkoren sind, politische Entscheidungen zu legitimieren, und deshalb mit Geld, Leitmedienaufmerksamkeit und offizieller Wertschätzung geködert und »manipuliert« werden (vgl. Kreiß 2020, Lütge/Esfeld 2021, Meyen 2023). Um dies nur mit einem Beispiel zu illustrieren: Am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München, Austragungsort der Tagung, die in diesem Buch dokumentiert wird, ist in den letzten Jahren ein Wildwuchs an Projekten entstanden, die sich um Hatespeech, Fake News und überhaupt alles kümmern, was aus den Tiefen des Internets die Demokratie bedrohen soll (vgl. Mirbach 2021). Gefördert wird dies von Unternehmensstiftungen (etwa: Volkswagen), EU, Ministerien in Bund und Ländern, Bundesbehörden (etwa: Bundeskriminalamt, Robert Koch Institut), Parteien, Parteistiftungen sowie politischen Apparaten wie den Landesmedienanstalten. Die Gunst solcher Sponsoren und eine regierungs- und gesellschaftskritische Wissenschaft schließen sich aus. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Institutsdirektor bei der Abrechnung der Reisekosten intervenierte, die Teilnahme von Sprechern kritisierte, die im Herbst 2021 bei der Aktion #allesaufdentisch dabei waren oder für Plattformen wie Rubikon (seit April Manova) schreiben, und den Verdacht äußerte, dass es sich eher um eine Sektengründung gehandelt habe als um eine akademische Tagung.
Jede Krise birgt auch Chancen. In diesem Buch kann jeder lesen, was vom 22. bis zum 24. Juni 2023 in den heiligen Institutshallen besprochen wurde, in denen bis in die frühen 1990er Jahre das US-Sprachrohr Radio Free Europe residierte. Während sich die Kommunikationswissenschaft, qua Arbeitsteilung eigentlich »zuständig« für Öffentlichkeit, Medien und Journalismus, in Richtung affirmative Forschung bewegt, haben wir Kollegen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen sowie aus der Praxis zusammengebracht und durch dieses Aufeinandertreffen hoffentlich einen Erkenntnisgewinn produziert, der die Möglichkeiten inter- und transdisziplinären Arbeitens verdeutlicht und zugleich skizziert, in welche Richtung das Bildungssystem zu reformieren wäre. Jenseits von Status- und Hierarchiedenken, das die Lehre und den Tagungsbetrieb prägt, wurde jeder Vortrag intensiv diskutiert – getragen von Neugier und Offenheit. Dass wir dies hier genauso betonen wie die ausnahmslos positiven Reaktionen auf die Anfrage mitzumachen, sagt viel über den universitären Alltag. Nicht im Band enthalten sind die Beiträge von Juri Kilian, Sozialpädagoge an der Universität Kassel, der einen ethnografischen und reich bebilderten Blick auf die Grundrechtsdemonstrationen der Coronajahre und ihre Stigmatisierung in den Leitmedien geworfen hat, sowie von Hauke Ritz, Geschichtsphilosoph aus Berlin, der in München »Überlegungen zur Wechselwirkung zwischen Geostrategie, Kulturpolitik und Informationskriegsführung« präsentierte, die demnächst in Buchform erscheinen (vgl. Ritz 2024). Wie die Tagung beginnt auch das Buch mit einem Beitrag von Michael Esfeld, seit 2002 Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne und seit 2009 Mitglied der Leopoldina. Der Titel »Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit« verspricht nicht zu viel. Esfeld sagt, dass »die Machtkonzentration in der Hand der Staatsgewalt« zu Missbrauch einlädt und die Zerstörung des »öffentlichen Raums« durch weite Teile von Wissenschaft und Leitmedien erklärt. Sein Vorschlag: Auflösung der Machtkonzentration.
Hannah Broecker, promovierte Politikwissenschaftlerin und derzeit Postdoc am Münchner Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, legt die diskursive Basis der Phänomene frei, die Esfeld beschreibt. Ihr Beitrag zeigt, wie die Norm »freie Meinungsäußerung« in den Kontext Sicherheit gerückt und so ausgehöhlt wurde. Anders formuliert: Die Versicherheitlichung von Normen demokratischer Öffentlichkeit bereitet den Boden für den Aufbau eines Zensurregimes und verändert die Bedeutung von Konzepten wie Demokratie und der Rolle des Bürgers.
Michael Meyen, seit 2002 Professor am gleichen Institut, analysiert in seinem Beitrag »Transparenz« einen Aspekt dieses Diskurses – einen Begriff, der ein Versprechen transportiert, aber zugleich in das »Panoptikum des Überwachungskapitalismus« führt.
Lukas Friedrich, seit 2022 Doktorand bei Michael Meyen, bewegt sich auf diesem Pfad einen Schritt weiter, wenn er vorschlägt, das Konzept »Repräsentationslücke« (Patzelt 2015) zu erweitern, künftig von einer »Repräsentationsinsel« zu sprechen und so den Widerspruch zwischen der Realität der Leitmedien und dem Spektrum an Perspektiven zu thematisieren, die in der Bevölkerung zu beobachten sind.
Helge Buttkereit, Historiker, Journalist und Publizist, bleibt in seiner Studie zu Alternativmedien und Gegenöffentlichkeit nicht bei der Gegenwart stehen, sondern entwickelt auf der Basis von Erfahrungen und Literatur ein »Modell für eine selbstorganisierte Öffentlichkeit«, das genau wie der Beitrag von Michael Esfeld Analyse, Kritik und Zukunft verbindet.
Ganz im Hier und Jetzt bleibt Sandra Kostner, Geschäftsführerin im Masterstudiengang »Migration, Diversität und Teilhabe« an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Ähnlich wie bei Hannah Broecker geht es auch Kostner um eine Diskursverschiebung. Die Forderung, »Freiheit neu zu denken«, fördert, das zeigt Sandra Kostner eindrucksvoll anhand der Felder Identitätspolitik, Corona und Klimawandel, eine »illiberale Zeitenwende«.
Hans-Martin Schönherr-Mann, politischer Philosoph an der LMU, konzentriert sich auf eins dieser Reizthemen und sucht im »Katastrophen-Diskurs« Corona nach »religiösen Elementen«. Schlagworte aus seinem Beitrag: Machiavelli, Erziehung durch Erschrecken und Furchterzeugen, McCarthy-Panik, platonische Expertenherrschaft.
Matthias Fechner, promovierter Literaturwissenschaftler, Lehrer und Research Associate der DFG-Forschungsgruppe »Lyrik in Transition« an der Universität Trier, nähert sich diesem Thema von einer anderen Seite. Fechner beobachtet, dass politisch bislang unauffällige Menschen in den Coronajahren plötzlich Positionen vertreten haben, die man vorher eher dem Rechts- oder Linkextremismus zugeschrieben hätte – von der Missachtung von Grundrechten über ein Lob auf das Kollektiv bis zur Ausgrenzung von Minderheiten. Als Antwort definiert er einen »Extremismus der Mitte«.
Der Journalist Patrik Baab hat dieses Phänomen am eigenen Leib zu spüren bekommen – in einer Medienkampagne, die eine Recherchereise in ukrainische Kriegsgebiete infrage stellte und nicht nur auf seine Reputation als Investigativreporter, gesammelt in unzähligen Berufsjahren, zielte, sondern auch auf seine Position als Lehrbeauftragter im akademischen Kontext. Baabs Erfahrungsbericht bringt einen Journalismus zum Vorschein, der fest in der Hand von Propaganda, Narzissmus und Aufmerksamkeitsökonomie ist.
Um Propaganda und Krieg geht es auch bei Piers Robinson und Jonas Tögel. Robinson, britischer Medienforscher und einer der Gründer der Arbeitsgruppe SPM (Syria, Propaganda and Media), belegt im Detail und über persönliche Verquickungen, wie Geheimdienste, Militärs und andere staatliche Stellen das öffentliche Bild des Syrienkrieges geprägt haben. Tögel wiederum, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitand am Institut für Psychologie der Universität Regensburg, zeichnet auf der Suche nach den Wirkungen solcher Bilder eine lange Linie von der Creel-Commission im Ersten Weltkrieg bis zur kognitiven Kriegsführung der Nato.
Es ist kein Zufall, dass der Beitrag von Dennis Kaltwasser, Habilitand an der Professur für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Gießen, dieses Buch abrundet. Vernunft und Hybris: Der Kampf zwischen der Freiheit des Individuums und dem Streben nach Allmacht im Namen einer überlegenen Rationalität oder unabdingbarer Notwendigkeiten tobt seit der Antike. Dennis Kaltwasser zerlegt den breiten Strom expertokratischer Ideologie, verweist damit auf eine totalitäre historische Konstante im gesellschaftstheoretischen Denken und liefert so gleichsam eine Quintessenz von Tagung und Buch. Die Krise von Mediensystem und öffentlicher Sphäre ist auch und vor allem eine Krise der Begriffe, mit denen wir gesellschaftliche Wirklichkeit beschreiben. Hier liegt die vornehmste Aufgabe kritischer Wissenschaft. Ohne Klarheit bei den Begriffen lässt sich nicht sagen, was ist.
Literatur
Arnold, Klaus (2016): Qualität des Journalismus. In: Martin Löffelholz, Liane Rothenberger (Hrsg.): Handbuch Journalismustheorien. Wiesbaden: Springer VS, S. 551–563.
Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (2023): Jahrbuch Qualität der Medien 22. Zürich: Schwabe.
Gerhards, Jürgen; Neidhardt, Friedhelm (1990): Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit. Fragestellungen und Ansätze. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin.
Geuß, Annika (2018): Qualität im Journalismus. Eine Synopse zum aktuellen Forschungsstand. Bamberg: University of Bamberg Press.
Haller, Michael (2017): Die »Flüchtlingskrise« in den Medien. Frankfurt am Main: Otto-Brenner-Stiftung.
Hertle, Hans-Hermann (2019): Sofort, unverzüglich. Die Chronik des Mauerfalls. Berlin: Ch. Links.
Hofbauer, Hannes (2022): Zensur. Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte. Vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Wien: Promedia.
Kreiß, Christian (2020): Gekaufte Wissenschaft. Wie uns manipulierte Hochschulforschung schadet und was wir dagegen tun können. Hamburg: tredition.
Lessenich, Stephan (2019): Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem. Stuttgart: Philipp Reclam.
Lütge, Christoph; Esfeld, Michael (2021): Und die Freiheit? Wie die Corona-Politik und der Missbrauch der Wissenschaft unsere offene Gesellschaft bedrohen. München: riva.
Maurer, Marcus; Haßler, Jörg; Jost, Pablo (2023): Die Qualität der Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg. Frankfurt am Main: Otto-Brenner-Stiftung.
Maurer, Marcus; Reinemann, Carsten; Kruschinski, Simon (2021): Einseitig, unkritisch, regierungsnah? Berlin: Rudolf-Augstein-Stiftung.
Mausfeld, Rainer (2023): Hybris und Nemesis. Wie uns die Entzivilisierung von Macht an den Abgrund führt – Einsichten aus 5000 Jahren. Frankfurt am Main: Westend.
Meyen, Michael (2023): Wie ich meine Uni verlor. Dreißig Jahre Bildungskrieg. Bilanz eines Ostdeutschen. Berlin: edition ost.
Meyen, Michael (2024): Cancel Culture. Wie Propaganda und Zensur Demokratie und Gesellschaft zerstören. Berlin: Hintergrund.
Mirbach, Alexis von (2021): Jenseits von Gut und Böse. In: Alexis von Mirbach, Michael Meyen: Das Elend der Medien. Köln: Herbert von Halem, S. 12–51.
Noelle-Neumann, Elisabeth (1980): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut. München: Piper.
Patzelt, Werner (2015): Repräsentationslücken im politischen System Deutschlands? Der Fall PEGIDA. In: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 13. Jg., Nr. 1, S. 99–126.
Petzold, Miriam (2024): Kein Recht auf Sendezeit. In: goodimpact.eu (28. Februar 2024).
Popper, Karl (1945): Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. London: Routledge.
Pöttker, Horst (1999): Öffentlichkeit als gesellschaftlicher Auftrag. Zum Verhältnis von Berufsethos und universaler Moral im Journalismus. In: Rüdiger Funiok, Udo Schmälzle, Christoph Werth (Hrsg.): Medienethik – die Frage der Verantwortung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 215–232.
Rieg, Timo (2023): Qualitätsdefizite im Corona-Journalismus. Eine kommentierte Fallsammlung. In: Research Gate (28. Februar 2024).
Ritz, Hauke (2024): Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas. Wien: Promedia.
Schatz, Roland; Petersen, Thomas; Schmidt, Ralph Erich (2023): Bricht die Mauer des Schweigens? Freiheitsindex 2023 – das Forschungsprojekt des Instituts für Demoskopie Allensbach und Media Tenor International. Zürich: InnoVatio.
Open Access
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz:CC BY-NC-ND 4.0; weitere Informationen finden Sie unter:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.
Broecker, Hannah, Dennis Kaltwasser und Michael Meyen (2024): Mediensystem und öffentliche Sphäre in der Krise. Eine Skizze zur Einführung. In: Mediensystem und öffentliche Sphäre in der Krise, herausgegeben von Hannah Broecker und Dennis Kaltwasser, S. 9–16. Neu-Isenburg: Westend.
https://doi.org/10.53291/9783949925214_1
Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit
Michael Esfeld
Die offene Gesellschaft und ihr öffentlicher Raum
Eine offene Gesellschaft im Sinne von Karl Popper (1945) ist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Lebensformen, Kulturen, Religionen usw. auf einem Gebiet friedlich miteinander zusammenleben können und sich durch wechselseitigen Austausch sowohl wirtschaftlich (Arbeitsteilung) als auch kulturell bereichern. Eine solche Gesellschaft ist auf einen öffentlichen Raum angewiesen, sodass jeder seine Fähigkeiten und Talente einbringen kann. Dieser öffentliche Raum ist durch keine allgemein geteilte Vorstellung von einem öffentlichen Gut strukturiert. Denn die offene Gesellschaft ermöglicht den genannten Pluralismus gerade dadurch, dass sie nicht durch eine inhaltliche Konzeption eines allgemein geteilten, öffentlichen Gutes zusammengehalten wird – sei dieses Gut religiös, wissenschaftlich oder ökonomisch begründet. Die Abwesenheit eines solchen Gutes ist das Kriterium, das die offene von der geschlossenen Gesellschaft abgrenzt. Letztere ist dadurch geschlossen, dass sie auf eine allgemein geteilte Vorstellung von einem inhaltlichen, öffentlichen Gut ausgerichtet ist.
Wie Popper (1945, 1957) und andere gezeigt haben, beruht die Konzeption eines solchen allgemeinen Gutes immer auf ungerechtfertigten Wissensansprüchen: Durch die Naturwissenschaften erlangen wir Kenntnis von Tatsachen. Aber aus Tatsachen folgen keine Normen. Es gibt allerdings auch normative Erkenntnisse. Aber die beziehen sich auf moralische Grundwerte wie Nichtangriff auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen. Einen Erkenntnisanspruch auf ein inhaltliches allgemeines Gut zu erheben heißt immer, die eigenen Werte absolut zu setzen und damit den Pluralismus der offenen Gesellschaft abzulehnen. Diejenigen, welche solche Wissensansprüche erheben und sie unter Einsatz von Androhung und gegebenenfalls Anwendung von Zwang durchsetzen wollen, sind daher gemäß Popper (1945) die Feinde der offenen Gesellschaft. Aufklärung im Sinne von Immanuel Kant (1784) – nämlich der Mut, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen – führt zur offenen Gesellschaft.
Mit dem Ziel, die weltanschauliche Neutralität des öffentlichen Raumes zu gewährleisten, organisieren in nahezu allen heute bestehenden offenen Gesellschaften die staatlichen Organe den öffentlichen Raum. Diese Organisation betrifft zumindest in Europa nicht nur die Durchsetzung einer Rechtsordnung mit der Gewährleistung von Sicherheit vor Übergriffen gegen Leib, Leben und Eigentum. In unseren Gesellschaften organisiert und finanziert der Staat auch öffentlich-rechtliche Medien, organisiert und finanziert das Bildungswesen, die Wissenschaft und weite Teile der Kultur schaffenden Tätigkeiten wie Kunst, Musik, Theater, Film usw. und reguliert die Wirtschaft. Dadurch erhalten die staatlichen Organe jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Medienlandschaft und nahezu eine Monopolstellung in den Bereichen von Bildung, Wissenschaft und Kulturschaffen sowie eine Monopolstellung in Bezug auf das Geldwesen und dessen Gestaltung.
Die Rechtfertigung für diese herausragende Stellung der Staatsorgane ist diese: Wenn die einflussreichsten Medien, die Finanzierung der Kultur schaffenden Tätigkeiten, das Bildungswesen und die Wissenschaft weitgehend in der Hand der Staatsgewalt sind, dann wird dadurch verhindert, dass partikuläre Interessen diese Bereiche dominieren können und damit dem freien Austausch in der offenen Gesellschaft Schaden zugefügt wird. Solche partikulären Interessen sind nicht nur direkte wirtschaftliche Interessen einiger Unternehmer. Es geht auch um die Dominanz bestimmter Weltanschauungen, Moralvorstellungen usw. – kurz, bestimmter inhaltlicher Vorstellungen allgemeiner Güter, die alle akzeptieren sollen.
Diese Organisation des öffentlichen Raumes durch die Staatsorgane bringt eine erhebliche Konzentration von Macht in deren Händen mit sich. Machtkonzentration lädt aber zu Missbrauch ein. Die Krise von Medien und Öffentlichkeit, die der Titel dieses Buches anspricht, ist eine Krise, die durch die Machtkonzentration in der Hand der Staatsgewalt verursacht ist. Entsprechend besteht der Ausweg aus dieser Krise in der Auflösung dieser Machtkonzentration. Diese These versuche ich in diesem Beitrag zu begründen. Die nächsten beiden Abschnitte enthalten eine Diagnose des Machtmissbrauchs und eine Suche nach den Gründen. In Abschnitt 4 lege ich dann meinen Vorschlag für einen Ausweg dar und gehe in Abschnitt 5 abschließend auf den Zusammenhang von Rechtsordnung und offener Gesellschaft ein. Ich stütze mich in diesem Aufsatz auf die Ausführungen in meinem Buch (Esfeld 2023) und erweitere diese in mehreren Aspekten.
Die real existierende Postmoderne
Das Problem, das mit der Machtkonzentration in den Händen der Staatsgewalt verbunden ist, lässt sich am besten im Bereich der Wirtschaft illustrieren und von dort auf Medien, Bildung, Wissenschaft und Kultur übertragen. Am 15. August 1971 setzte US-Präsident Richard Nixon die Bindung des US-Dollars an Gold – die Definition eines US-Dollars als 1/35 einer Feinunze Gold – aus. Durch die damals bestehende Bindung aller anderen Devisen an den US-Dollar wurde damit auch deren Bindung an Gold aufgehoben. Es war somit niemandem mehr möglich, bei einer Zentralbank Einheiten der von der betreffenden Bank herausgegebenen staatlichen Währung gegen einen Sachwert (wie Gold) einzutauschen, der der betreffenden staatlichen Währung zugrunde liegt. Der erste Präsident der europäischen Zentralbank, Willem Duisenberg (2002), lobte explizit den Euro als die erste Währung der Welt, die seit ihrer Einführung durch nichts gedeckt ist.
In den 1960er Jahren geriet die Bindung des US-Dollars an Gold aus den Fugen, weil die US-Regierung in der Innenpolitik immer mehr Wohlfahrtsansprüche befriedigen wollte, ohne Wohlstand zu schaffen (Johnsons »great society«), und in der Außenpolitik Machtansprüche mit militärischen Mitteln durchzusetzen versuchte (Vietnamkrieg). Die Geldmenge wurde ausgeweitet. Infolgedessen drohten die Goldbestände der US-Zentralbank wegzuschmelzen: Es wurden immer mehr Dollar in Umlauf gesetzt, ohne dass der zugrunde liegende Sachwert sich vergrößerte. Die Folge war, dass dieser Sachwert dahinschwand, weil ausländische Zentralbanken vermehrt bei der US-Zentralbank überschüssige Dollar in Gold zu tauschen suchten. Vor die Wahl gestellt, die Machtansprüche der US-Regierung an die Realität anzupassen, an die die Währung gebunden war, oder die Illusion einer Realität zu schaffen, um diese Machtansprüche zu befördern, entschied sich Präsident Nixon für Letzteres.
Seit 1971 ist es den USA und alle anderen Staaten möglich, beliebig Geld zu drucken und damit die Illusion einer Realität zu schaffen: Das Geld hat Kaufkraft für reale Güter und Dienstleistungen. Es selbst ist aber an nichts Reales gebunden, sondern wird per fiat geschaffen. Es ist lediglich die Machtkonzentration in den Händen der Staatsgewalt, die die Menschen zwingt, das, was diese Macht per Deklaration in die Welt setzt, als Tauschmittel gegen reale Güter und Dienstleistungen zu akzeptieren. Die sogenannte Modern monetary theory (siehe zum Beispiel Wray 2012 und Kelton 2020) ist der theoretische Überbau dieses realpolitischen Unterbaus: Gemäß dieser Theorie ist die Staatsgewalt der Ursprung des Geldes und dazu legitimiert, durch Schaffen von Geld, das an nichts gebunden ist, die Tätigkeiten der Menschen zu lenken.
Mit dem fiat-Geld kann der Staat alles finanzieren. Auch das Coronaregime wäre ohne fiat-Geld nicht möglich gewesen: Panik vor einem angeblich für die allgemeine Bevölkerung gefährlichen Virus zu schüren, zu suggerieren, Politik sei in der Lage, die Menschen vor diesem Virus zu schützen, und auf dieser Grundlage Menschen dazu zu zwingen, ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten einzustellen, setzt voraus, die Menschen mit beliebiger Menge von aus Nichts geschaffenem Geld versorgen zu können, damit die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns nicht sichtbar werden. Gleiches gilt für das Klimaregime: Panik vor einem angeblich gefährlichen Klimawandel zu schüren, zu suggerieren, Politik sei in der Lage, das Weltklima zu steuern, und auf dieser Grundlage Menschen dazu zu zwingen, in großem Umfang ineffiziente und wetterabhängige Energiequellen zu verwenden, setzt voraus, die Preisbildung am Markt durch freiwillige Interaktionen auszuschalten und politisch gewollte Energieträger mit beliebiger Menge von aus Nichts geschaffenem Geld subventionieren zu können.
Fiat-Geld hat weit mehr als nur eine ökonomische Bedeutung. Der 15. August 1971 ist der Beginn dessen, was man als die erste Phase der real existierenden Postmoderne bezeichnen kann. Es wird durch reine Macht eine ökonomische Realität geschaffen. Dies ist eine postfaktische Realität: Es gibt keine Tatsachen, die diese Realität bestimmen und damit begrenzen. Solange eine Währung hingegen an Gold, Silber oder einen Warenkorb gebunden ist, wird ihre Kaufkraft durch die Sachwerte gestützt, die ihr zugrunde liegen. Deren Verfügbarkeit ist begrenzt. Sie können nicht durch politische Entscheidungen vermehrt werden.
Die Postmoderne – ihre intellektuelle ebenso wie ihre real existierende Seite – ist dadurch gekennzeichnet, den Einsatz von Vernunft als Mittel zur Begrenzung von Macht abzulehnen: Der Einsatz von Vernunft ist selbst nur ein weiteres, wenn auch ausgeklügeltes Mittel, um Macht auszuüben, das von einer bestimmten Gruppe gebraucht wird (vorwiegend weiße Männer). Mit dem Fiat-Geld entfällt Vernunft als Mittel, um die Macht der Staatsorgane im Ausgeben von Geld zu beschränken. Guido Hülsmann (2007, 2013) und Thorsten Polleit (2020) beschreiben daher zu Recht das Fiat-Geld als das wesentliche Mittel zur Ausdehnung der staatlichen Kontrolle. Dass der Staat durch die oben beschriebenen, weitreichenden Befugnisse Garant der offenen Gesellschaft ist, hängt daran, dass seine Organe den Gebrauch von Vernunft als Mittel zur Begrenzung der Ausübung von Macht durchsetzen. So soll die staatliche Finanzierung von Medien, Bildung, Wissenschaft und Kultur Pluralismus gewährleisten und im wirtschaftlichen Bereich den Wettbewerb um die Entwicklung der besten Produkte ermöglichen. Wenn aber der Staat per fiat Realität schafft – Geld zum Beispiel ist das, was der Staat als Geld setzt –, dann stellt er nicht mehr die Rahmenbedingungen bereit, um durch den Gebrauch von Vernunft herauszufinden, was der Realität entspricht, sondern pervertiert die offene Gesellschaft.
Diese Perversion trat mit dem Coronaregime offen zutage; sie ist dabei, sich mit dem Klimaregime fortzusetzen. Mit dem Coronaregime trat die real existierende Postmoderne in die zweite, totalitäre Phase ein, in der die Staatsorgane die offene Gesellschaft in eine geschlossene Gesellschaft zu überführen versuchen – und dies unter dem Deckmantel, die offene Gesellschaft zu schützen. Die Staatsorgane setzen per fiat durch reinen Machtgebrauch fest, dass etwas ein für die allgemeine Bevölkerung gefährliches Virus ist und dass eine bestimmte medizinische Behandlung eine wirksame und sichere Impfung gegen dieses Virus darstellt. Sie setzen per fiat durch reinen Machtgebrauch fest, dass es einen menschengemachten, das Fortbestehen der Menschheit gefährdenden Klimawandel gibt und dass der Umstieg auf bestimmte Energiequellen ein probates Mittel ist, um diesen Klimawandel zu stoppen.
Auf der Grundlage dieser per fiat deklarierten Gefahren und Mittel zu ihrer Bekämpfung greifen die Staatsorgane zu verschiedenen Formen von Ausnahmezustand und Notrecht, die es ihnen ermöglichen, sich über die eigentlich in den Verfassungen garantierten Menschenrechte hinwegzusetzen und ein Regime unbegrenzter sozialer Kontrolle zu installieren: Mit dem Coronaregime wurden die sozialen Kontakte bis in den engsten Familienkreis hinein geregelt und Menschen am Ende ihres Lebens gegebenenfalls gezwungen, in Isolation und ohne direkten Kontakt zu ihren Angehörigen zu sterben. Durch die Impfanordnungen unterstand auch der eigene Körper der Verfügungsgewalt des Staates (siehe zum Leib in diesem Zusammenhang Brenner 2022, insbesondere Kapitel 9 und 10). Mit dem Klimaregime kann bis ins Detail geregelt werden, wie man sich fortbewegen, seine Wohnung heizen und sich ernähren darf.
Vernunft als Mittel, um diese Wissensbehauptungen zu überprüfen, wird ausgeschaltet. Die Staatsorgane tun dies über ihre Finanzierung von Medien, Wissenschaft und Kultur. Wie in totalitären Systemen gibt es eine Diskussion in einem von den Staatsorganen vorgegebenen Rahmen: Auch in der Planwirtschaft des real existierenden Sozialismus konnte man beispielsweise darüber diskutieren, ob man mehr Schuhe oder mehr Staubsauger produzieren soll. Aber man durfte nicht darüber diskutieren, ob eine Planwirtschaft überhaupt sinnvoll ist. So konnte man auch im Coronaregime zum Beispiel darüber diskutieren, ob man nur Geschäfte oder auch Schulen schließen soll. Im Klimaregime kann man zum Beispiel darüber diskutieren, ob man zuerst Verbrennungsmotoren oder zuerst Ölheizungen verbieten soll. Aber man durfte nicht darüber diskutieren, ob die Corona-Virenwellen überhaupt für die allgemeine Bevölkerung gefährlich sind, ob die Staatsorgane überhaupt den Verlauf von Virenwellen steuern können und ob sie das tun dürfen mittels Zwangsmaßnahmen und dem Aussetzen von Grundrechten. Ebenso darf man nicht darüber diskutieren, ob der Klimawandel überhaupt im Wesentlichen menschengemacht ist, ob die Staatsorgane überhaupt den Verlauf der Entwicklung des Weltklimas steuern können und ob sie das tun dürfen mittels Zwangsmaßnahmen und dem Aussetzen von Grundrechten. Wer Vernunft gebrauchen möchte, um dieses zu untersuchen, muss damit rechnen, gecancelt zu werden.1
Die neuzeitliche Wissenschaft hat sich als Befreiung von den weltlichen Erkenntnisansprüchen einer Staatsreligion und Staatskirche entwickelt. Wissenschaft generell ist dadurch gekennzeichnet, Vernunft als Mittel einzusetzen, um die Ausübung von Macht zu begrenzen. In der Wissenschaft muss man Evidenz und Argumente anführen, die sich in kritischer Prüfung bewähren müssen. Autorität hat in der Wissenschaft keinen Platz. Allein die Qualität der angeführten Daten und Argumente zählt. Bereits René Descartes entwickelt in seiner Abhandlung über die Methode (1637) disziplinierte Skepsis als das Kennzeichen von Wissenschaft. Im 20. Jahrhundert charakterisiert Robert Merton (1942) die institutionalisierte Wissenschaft als organisierten Skeptizismus.
In dem Corona- und dem Klimaregime setzen hingegen die staatlichen Organe über die von ihnen finanzierten Wissenschafts-Institutionen inhaltlich fest, was »die Wissenschaft« ist, und fixieren die so festgesetzte Wissenschaft als Norm, der man folgen muss, ausgedrückt in dem Slogan »Follow the science«. Die Absicht dahinter ist, die so festgesetzte Wissenschaft zur Legitimation politischer Zwangsmaßnahmen einschließlich weitgehender Einschränkungen von Grundrechten zu gebrauchen. So hat zum Beispiel die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am 9. Dezember 2020 im Deutschen Bundestag einen harten Lockdown über die Weihnachtsferien unter Bezugnahme auf eine Stellungnahme der Deutschen Nationalakademie Leopoldina begründet, die nur einen Tag zuvor, am 8. Dezember 2020, veröffentlicht wurde und einen harten Lockdown als »aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig« bezeichnete (siehe Merkel 2020 und Leopoldina 2020).
Damit wird auch der Gebrauch von Vernunft als Mittel zur Machtbegrenzung im Rechtsstaat abgeschafft. Alle Staatsorgane bis hin zu den höchsten Gerichten üben keine Kontrollfunktion mehr aus, sondern sind den von »der Wissenschaft« festgesetzten Zielvorgaben untergeordnet. Die Gerichtsurteile beziehen sich einfach auf die staatlichen Anordnungen und auf das, was von den staatlichen Behörden als angebliche Wissenschaft dargestellt wird, um diese Anordnungen zu legitimieren, statt selbst eine Prüfung der Sachlage und der Verhältnismäßigkeit der staatlichen Zwangsmaßnahmen vorzunehmen (siehe zum Beispiel Bundesverfassungsgericht 2022). Auf diese Weise werden die beiden Grundpfeiler der Moderne, Wissenschaft und Rechtsstaat, unterminiert. Die bisherige offene Gesellschaft droht in eine Gesellschaft abzugleiten, die durch eine weltliche Wissenschafts-Religion geschlossen ist (genauer gesagt handelt es sich um einen Wissenschafts-Aberglauben, der mit ernsthafter Religion nichts zu tun hat).
Auf der Suche nach den Ursachen
Wie konnte es so weit kommen? Gehen wir wiederum von Überlegungen zur Wirtschaft aus: Ohne Eingriffe einer Gewalt, die mit Zwang operiert – das heißt, der Androhung und gegebenenfalls auch Anwendung physischer Gewalt –, wird sich in freiwilligen sozialen Interaktionen ein arbeitsteiliges Wirtschaften entwickeln, in dem man andere von der Nützlichkeit seiner Fähigkeiten und Produkte überzeugen muss. Das heißt: In einem Wirtschaftsleben freiwilliger sozialer Interaktionen muss jeder Unternehmer Kunden von der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen überzeugen und für sein Handeln Verantwortung übernehmen, also für eventuelle Schäden seiner Produkte und Dienstleistungen haften. Gewinne sind privat, Risiken ebenso – wobei »privat« alle freiwilligen Wirtschaftsformen umfasst einschließlich Genossenschaften und dergleichen. Kein Unternehmen kann seine Produkte und Dienstleistungen Kunden aufzwingen oder sich aus der Haftungspflicht befreien, solange eine Rechtsordnung besteht.
Selbst wenn ein Unternehmen, das auch eine Genossenschaft sein kann, zu einer Zeit in einem Bereich eine monopolartige Stellung erlangen sollte, kann es seine Produkte und Dienstleistungen niemandem aufzwingen. Nur der Staat ist Monopolist, der mit Zwang operiert und dem man deshalb auf dem betreffenden Gebiet nicht ausweichen kann. Einen privaten Monopolisten kann man hingegen umgehen. Die betroffenen Konsumenten können sich untereinander und mit anderen zusammenschließen und so Wege finden, den Monopolisten zu meiden. Generell gilt: Wenn man meint, bestimmten privatwirtschaftlichen Akteuren ausgeliefert zu sein, dann ist die angemessene Reaktion, sich mit ebenfalls Betroffenen zusammenzuschließen, wie zum Beispiel Zusammenschlüsse von Arbeitnehmern zu Gewerkschaften, Zusammenschlüsse von Konsumenten zu Verbraucherverbänden usw. Man kann die Zusammenarbeit mit den Monopolisten verweigern, deren Produkte und Dienstleistungen nicht mehr kaufen und im Verbund mit anderen die benötigten Produkte und Dienstleistungen selbst herstellen.
Wenn hingegen die Staatsorgane in das freiwillige, arbeitsteilige Wirtschaften eingreifen, um unter Anwendung von Zwang ein angeblich allgemeines Gut durchzusetzen und angebliches Versagen des freiwilligen Austausches zu korrigieren, dann wird es für Unternehmer zweckrational, im Sinne ihrer Profitinteressen auf die Vertreter der Staatsorgane einzuwirken, ihre Produkte und Dienstleistungen als förderlich für das allgemeine Gut darzustellen und auf diese Weise Subventionen und andere Vergünstigungen von den Vertretern der Staatsorgane zu erhalten.
Damit geht ein auf freiwilligen Interaktionen beruhendes Wirtschaftsleben in den Staatskapitalismus über (im Englischen »crony capitalism«): Die Produktionsmittel bleiben in privater Hand, ebenso wie die unter Einsatz dieser Mittel erzielten Gewinne. Die Risiken werden auf den Staat abgewälzt und damit auf die Bürger, von denen die Staatsorgane Zwangsabgaben erheben können. Gegebenenfalls bewahren die Staatsorgane große Unternehmen sogar vor der Insolvenz unter dem Vorwand, sie seien so groß, dass der Allgemeinheit Schaden zugefügt würde, wenn sie die Risiken für ihr wirtschaftliches Handeln übernehmen müssten (»too big to fail«): private Gewinne, auf die Allgemeinheit abgewälzte Risiken. Dieser Staatskapitalismus kam zunächst in erster Linie im Finanzwesen zum Einsatz, seitdem die amerikanische Zentralbank 1998 den Hedgefonds »Long-Term Capital Management« vor dem Zusammenbruch rettete und dann in der Finanzkrise 2008/2009 und ihren Ausläufern die Eigentümer von Banken systematisch vor dem Verlust ihres Kapitaleinsatzes auf Kosten der Allgemeinheit bewahrte.
Die bisherige Spitze dieser Perversion freiwilligen wirtschaftlichen Austausches in einer offenen Gesellschaft sind die medizinischen Behandlungen, die als Impfungen gegen das Coronavirus angepriesen werden: Es besteht Abnahmegarantie für die Impfstoffe unter Einsatz der staatlichen Zwangsgewalt bis dahin, dass die Injektionen mit diesen Impfstoffen Menschen regelrecht aufgezwungen werden. Die Hersteller müssen für ihre Produkte nicht haften, also keine Entschädigung für Impfschäden bis hin zu Todesfällen leisten; sogar die Kosten eventueller Gerichtsverfahren übernehmen die Staatsorgane. Die Hersteller dieser Produkte erzielen mithin garantierte Profite ohne Risiko. Die entsprechenden Verträge werden nicht einmal offengelegt, obwohl die Bürger die Kosten über Zwangsabgaben tragen. Mit anderen Worten: freies Handeln, ohne für seine Handlungen verantwortlich zu sein. Gunter Frank bezeichnet diese und andere Vorgänge im Coronaregime zu Recht als Staatsverbrechen (siehe Frank 2023 mit ausführlichen Belegen).
Das ist das Ergebnis, wenn die Staatsorgane lenkend in die Wirtschaft eingreifen: Vertreter von Sonderinteressen, denen es gelingt, ihre Profitinteressen als für das allgemein Gute förderlich darzustellen, setzen sich unter Ausschaltung aller Kontrollmechanismen und elementarer Rechtsgrundsätze durch. Das ist wiederum ein Merkmal der real existierenden Postmoderne: Per fiat, durch reine Macht, wird etwas als ein allgemeines Gut festgesetzt und allen aufgezwungen unter Missachtung elementarer Menschenrechte wie des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Dass in dem betreffenden Fall von vornherein klar und offensichtlich war, dass die Impfstoffe bestenfalls zwar einen gewissen Selbstschutz vor schweren Verläufen einer Infektion mit dem Coronavirus für gefährdete Personen gewähren können, aber gar nicht in der Lage sind, die weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden, spielte keine Rolle (siehe dazu bereits Doshi 2020). Kritische, unabhängige Wissenschaft ist für die Staatsorgane und die mit ihnen verbundenen Vertreter von Sonderinteressen unerwünscht. Wiederum gilt: Vernunft als Mittel, um Machtausübung einzuschränken, wird ausgeschaltet.
Immanuel Kant sagt in seiner Vorlesung Naturrecht (1784): »Recht ist die Einschränkung der Freiheit, nach welcher sie mit jeder andrer Freiheit nach einer allgemeinen Regel bestehen kann. … Wäre aber jeder frei ohne Gesetz, so könnte nichts Schrecklicheres gedacht werden. Denn jeder machte mit dem anderen, was er wollte, und so wäre keiner frei.« (Kant 1979: 1320, Orthografie angepasst) Im Staatskapitalismus der real existierenden Postmoderne gilt hingegen: Einige – nämlich die Vertreter des Staatsapparates und die Vertreter der Sonderinteressen, die sich den Staatsapparat zunutze machen – sind frei ohne Gesetz und machen mit den anderen, was sie wollen. Von Recht und einer Rechtsordnung kann hier keine Rede mehr sein.
Unternehmen, die die Staatsorgane für ihre Profitinteressen einzuspannen versuchen, sind die eine Seite der Medaille. Die intrinsische Tendenz zur Machtausweitung der Funktionsträger der Staatsorgane ist die andere Seite. Die Organe des modernen Staates verfügen mit dem Monopol der Gesetzgebung (Legislative), der Gesetzesdurchsetzung (Exekutive) und der Rechtsprechung (Judikative) auf einem Territorium über eine gewaltige Machtballung. Diese Machtballung dient dem Schutz vor und der Ahndung von Übergriffen auf Leib, Leben und Eigentum der Menschen in dem betreffenden Gebiet durch andere Menschen. Aber wie weitgehend sollen die Staatsorgane ihre Machtballung einsetzen, um diesen Schutz zu gewährleisten? Um jede Person auf ihrem Gebiet wirkungsvoll vor gewaltsamen Übergriffen anderer Personen auf Leib, Leben und Eigentum zu schützen, müssten die Funktionsträger der Staatsgewalt von jedem zu jeder Zeit den Aufenthaltsort erfassen, alle Transaktionen kennen usw. Damit würde der Rahmen, den der Staat für die Entfaltung der offenen Gesellschaft setzt, jedoch in einen totalen Überwachungsstaat pervertieren. Wo liegt die Grenze, jenseits welcher der Staat von einer Gewalt, die die Freiheitsrechte jeder Person gegen Übergriffe seitens anderer Personen schützt, in eine Gewalt übergeht, die selbst übergriffig gegenüber den Personen auf ihrem Gebiet wird? Das können wiederum nur die Organe der Staatsgewalt festsetzen.
Das Problem ist: Wenn es einmal eine Staatsgewalt gibt, deren Vertreter die Macht des Monopols auf einem Gebiet haben, dann tendieren die Funktionsträger dieser Gewalt dazu, ihre Macht auszuweiten unter dem Vorwand, den Schutz jeder Person auf ihrem Gebiet vor Übergriffen durch andere Personen immer weiter zu verbessern. Aber die Vertreter der Staatsorgane haben von sich aus gar nicht das Wissen, welche Schutzansprüche sie konkret erfüllen sollen, wie sie diese Schutzansprüche gewichten sollen und welche Produkte zur Durchsetzung dieser Schutzansprüche verfügbar und geeignet sind. Sie laden daher Unternehmer geradezu dazu ein, ihnen Produkte zu unterbreiten, mit denen die Staatsorgane ihre Schutzansprüche ausweiten können und im Gegenzug von den wirtschaftlichen Risiken entlastet zu werden.
Meines Wissens hat zuerst Walter Lippmann (1925) diese Zusammenhänge aufgezeigt, das heißt die intrinsische Ausweitung des Staatsapparats im Zusammenspiel mit Unternehmen, die davon profitieren (siehe dazu auch Mosmann 2020). Aus dem Rechtsstaat, der eine Rechtsordnung durchsetzt mit gleichem Recht für alle, wird so der Wohlfahrtsstaat, der unter dem Vorwand des Schutzes vor allen möglichen Lebensrisiken Produkte vertreibt, von denen bestimmte Unternehmen profitieren. Das heißt: Unternehmen, die die Staatsorgane für ihre Profitinteressen nutzen wollen, und Staatsorgane, die auf solche Unternehmen zur Ausweitung ihrer Macht angewiesen sind, verstärken sich wechselseitig, bis aus dem Rechtsstaat ein totaler Überwachungs- und Regulierungsstaat wird. Das ist der realwirtschaftliche Unterbau der Entwicklung, die uns in die real existierende Postmoderne führt und die mit dem Corona- und Klimaregime offen zutage getreten ist.
Hinzu kommt ein intellektueller Überbau, dessen Funktionsweise analog ist. Wenn es einmal eine Staatsgewalt gibt, die die einflussreichsten Medien als sogenannte öffentlich-rechtliche Medien und die Bildung, die Wissenschaft und das Kulturschaffen mehr oder weniger als Monopol finanziert durch den Bürgern auferlegte Zwangsabgaben, dann ist es für die Vertreter von Sonderinteressen im Sinne bestimmter Weltanschauungen, Moralvorstellungen oder politischer Auffassungen zweckrational, den Marsch durch die vom Staat kontrollierten Institutionen anzutreten, um der Gesellschaft auf diese Weise ihre Vorstellungen aufzuzwingen. Das ist viel einfacher und wirksamer als zu versuchen, die Bürger durch Argumente – und damit auf der Basis von Freiwilligkeit statt Zwang – zu überzeugen. Wenn es einer ideologisch weitgehend homogenen Gruppe gelingt, diese Institutionen zu dominieren, dann tritt die Situation ein, die spätestens mit dem Coronaregime offensichtlich geworden ist und die sich mit dem Klimaregime fortsetzt.
Erneut gibt es hier zwei Seiten einer Medaille. Der Versuch ideologisch homogener Gruppen, durch Einflussnahme auf die Staatsorgane das Geistes- und Kulturleben in ihrem Sinne zu steuern, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Staatsorgane ihrerseits zur Rechtfertigung der Machtkonzentration in ihren Händen und deren Ausweitung auf Narrative angewiesen sind, also Intellektuelle und Künstler benötigen, die Narrative liefern, welche diese Machtkonzentration und deren Ausweitung in ihrem Schaffen in ein positives Licht rücken und als förderlich für das allgemein Gute darstellen.
Natürlich kann das Narrativ auch eines sein, welches die Werte der offenen Gesellschaft in den Vordergrund stellt, wie das Narrativ, das im Westen in den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dominierte und relativ gut funktionierende, freiheitlich-demokratische Rechtsstaaten stützte. Aber das Funktionieren dieser Staaten und die Überzeugungskraft dieses Narrativ waren auf die Abgrenzung der Rechtsordnung des Westens von dem kommunistischen Sowjetimperium ausgerichtet. Als letzteres mit dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 zusammenbrach, war die Folge nicht »das Ende der Geschichte« (Fukuyama 1989, 1992) in dem Sinne, dass sich die freiheitlich-demokratische, rechtsstaatliche Ordnung des Westens definitiv durchgesetzt hätte.
Das antikommunistische Narrativ des Westens war an einen staatlichen Apparat gebunden, der seine umfangreiche Macht durch die Gewährleistung von Sicherheit vor Übergriffen seitens des Sowjetimperiums rechtfertigte und dafür durchaus gute Gründe anführen konnte: Westberlin beispielsweise hätte es ohne die militärische Präsenz dieses Machtapparates nicht gegeben. Es gab keinen tatsächlichen, wohl aber einen sogenannten kalten Krieg. Mit dem Ende von letzterem wäre bei einem »Ende der Geschichte« auch der Umfang dieses Machtapparates infrage gestellt worden, insbesondere das militärisch-industrielle Konglomerat und die ausufernden Sicherheitsdienste. Das heißt: Um seinen Fortbestand zu gewährleisten, war der umfangreiche staatliche Machtapparat auf ein neues Narrativ angewiesen. Das ist der reale Unterbau der Entwicklung der letzten Jahrzehnte.
Es war eine Illusion zu glauben, dass wir bis zum Auftreten des Coronaregimes mit seinen totalitären Zügen im Frühjahr 2020 in einer gefestigten offenen Gesellschaft und einem gefestigten freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat gelebt haben. Dieses war nur deshalb so, weil das bis 1989 vorherrschende antikommunistische Narrativ eine relativ offene Gesellschaft und einen relativ gut funktionierenden Rechtsstaat erforderte. Mit dem Ende dieses Narratives infolge des Zusammenbruchs des Sowjetimperiums war daher zu erwarten, dass ein neues kollektivistisches Narrativ an seine Stelle treten würde und die Säulen der offenen Gesellschaft und des Rechtsstaats, die als Abgrenzung zum Sowjetkommunismus bestanden, hinwegfegen würde. Denn genau das war erforderlich, um den Fortbestand und den weiteren Ausbau des staatlichen Machtapparates zu gewährleisten.
Die Abfolge postmoderner Narrative, die jeweils ein partielles allgemeines Gut postulieren und die Gesellschaft durch konstruierte allgemeine Gefahren in Angst und Schrecken halten – wie das Corona- und das Klima-Narrativ –, leisten genau dies. Mit diesen Narrativen einher gehen mächtige wirtschaftliche Interessen, die auf den Einsatz des staatlichen Zwangsapparates angewiesen sind, um ihre Produkte den Menschen aufzuzwingen, wie die Pharmaindustrie, die Industrie der sogenannten erneuerbaren Energien und, wie inzwischen offensichtlich ist, auch der gesamte militärisch-industrielle Komplex mit der Rüstungsindustrie. Diese Narrative sind der intellektuelle Überbau zu dem genannten real existierenden Unterbau. Das Ergebnis ist das, was ich »real existierende Postmoderne« nenne. Dieses ist die beste Erklärung, weil in ihrem Lichte die Entwicklung, die seit Frühjahr 2020 offen zutage getreten ist, nicht erstaunlich ist, sondern – leider – schlicht und einfach das ist, was zu erwarten war. Diejenigen, die – wie ich – diese Entwicklung nicht erwartet hatten, unterlagen einer Illusion, nämlich der Illusion des Republikanismus (siehe dazu ausführlich Esfeld im Erscheinen).
Ein Ausweg
Die Menschen haben unterschiedliche Überzeugungen, Interessen, Werte, Fähigkeiten und Tugenden. Es wird immer Menschen geben, die totalitäre Ideen verbreiten, ebenso wie Weltuntergangs-Propheten, die andere in Angst und Schrecken versetzen. Ebenso wird es immer Wissenschaftler geben, die die Wissenschaft als weltliche Religion missverstehen und anderen eine angeblich wissenschaftliche Lebensweise aufzwingen wollen (»follow the science«). Es wird auch immer wirtschaftliche Interessen geben, die versuchen, von diesen Ideologien zu profitieren, wie die Pharmaindustrie im Coronaregime, die Industrie sogenannter erneuerbarer Energien im Klimaregime und die ESG-Aushängeschilder-Industrie im Wokeness-Regime. Es wird auch immer Absprachen zwischen diesen Gruppen geben (»Verschwörungen« im heute üblichen Jargon).
All diese Ideologien schicken sich an, einen neuen Menschen zu schaffen, und sind deshalb totalitär: im 20. Jahrhundert im Kommunismus der Mensch, der so lebt, dass, wenn jeder seine Fähigkeiten einbringt, die Bedürfnisse aller befriedigt sind; im Nationalsozialismus der Mensch, der »reinrassig« lebt; im Coronaregime der Mensch, der keine Viren mehr verbreitet (»Zero Covid«); im Klimaregime der Mensch, der Energie ohne Auswirkungen auf die Umwelt verbraucht (»Zero CO2«); im Wokeness-Regime der Mensch, der nur solche Gedanken hat und äußert, mit denen sich alle wohlfühlen. Allen diesen Ideologien ist gemeinsam, dass die entsprechende Konzeption eines neuen Menschen in sich widersprüchlich ist: Viren, Energieverbrauch, kontroverse Meinungen gehören zum menschlichen Leben. Deshalb führt die Umsetzung all dieser Ideologien stets nur zur Zerstörung der bisherigen Lebensweisen und endet in großem Leid einschließlich vieler Todesopfer.
Es kann daher nicht darum gehen, die Menschen zu ändern, damit sie irgendeinem Ideal von Tugendhaftigkeit näherkommen. Man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind. Ebenso wenig kann es darum gehen, Absprachen zu vermeiden. Das Problem mit sogenannten Verschwörungen oder Verschwörungstheorien ist nicht, dass sie falsch, unplausibel oder unbegründet sind. Das Problem ist, dass sie nichts erklären. Denn Verschwörungen gibt es immer. Zu erklären aber ist, wieso sie erfolgreich sind – wenn man meint, dass sie erfolgreich sind.
Konkret: Wenn man das Weltwirtschaftsforum, die Weltgesundheitsorganisation oder die Impfallianz Gavi auflöst und Klaus Schwab, Bill Gates oder wen auch immer man für die Drahtzieher entsprechender »Verschwörungen« hält auf eine einsame Insel verbannt, auf der sie von jeglicher Kommunikation mit dem Rest der Welt abgeschnitten sind, dann würde sich an Folgendem nichts ändern: Die Machtkonzentration beim staatlichen Zwangsapparat bliebe weiterhin bestehen. Damit bliebe auch das Streben der Funktionsträger dieses Apparates auf Erhalt und Erweiterung ihrer Macht bestehen (realer Unterbau). Dazu sind diese sowohl auf Unternehmen angewiesen, die Produkte herstellen, welche der Staatsapparat im Sinne des Erhalts und der Ausweitung seiner Macht einsetzen kann, als auch auf entsprechende Narrative, mit denen die Funktionsträger des Staatsapparates die Bevölkerung in ihren Bann ziehen können (intellektueller Überbau). Daraus folgt: Insofern »Verschwörungen« erfolgreich sind, haben sie Erfolg, weil sie den staatlichen Machtapparat nutzen können und dieser Machtapparat aus ihnen Nutzen zieht. Der Ausweg muss deshalb bei diesem Machtapparat ansetzen: Es geht darum, zu verhindern, dass eine Gruppe Zwang ausüben kann, um ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt: Es ist eine Entflechtung der Machtkonzentration beim staatlichen Zwangsapparat erforderlich.
Die Idee einer öffentlich-rechtlichen Organisation von Medien, Bildung, Wissenschaft und Kultur, finanziert durch Zwangsabgaben, ist gescheitert – und zwar definitiv gescheitert. Sie ist nicht an den üblen Absichten bestimmter Personen oder Personengruppen gescheitert, die diese öffentlich-rechtliche Struktur zur Beförderung ihrer – ideologischen oder wirtschaftlichen – Partikularinteressen gebrauchen (»Verschwörung«). Sie ist an dem strukturellen Problem gescheitert, dass sie die Machtkonzentration in den Händen der Vertreter des staatlichen Zwangsapparates impliziert und dadurch in die skizzierte verhängnisvolle Entwicklung hineinläuft, die heute offen zutage getreten ist. Diese Entwicklung mag durch günstige Umstände aufgehalten werden, wie in den Jahrzehnten zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Fall der Berliner Mauer; sie ist aber strukturell in der öffentlich-rechtlichen Konstruktion angelegt. Deshalb besteht der Weg zur offenen Gesellschaft darin, die Machtkonzentration in den Händen des staatlichen Zwangsapparates aufzulösen.
Dazu, wie dieses erreicht werden kann, gibt es zahlreiche Arbeiten sowohl zu den Grundlagen als auch zu konkreten Vorschlägen für die Gegenwart sowohl in der klassisch-liberalen und libertären Literatur (siehe zum Beispiel Gebauer 2021 und Krall 2023 für konkrete Vorschläge sowie Nozick 1974 und Rothbard 1982 zu den Grundlagen) ebenso wie zum Beispiel in der anthroposophischen Literatur mit der Idee der Dreigliederung des sozialen Lebens, die auf Rudolf Steiner (1961) zurückgeht (siehe zum Beispiel Mosmann 2020). Gemäß letzterer hat der Staat allenfalls eine Aufgabe im Rechtsleben, von dem das Wirtschaftsleben ebenso wie das Geistesleben mit Bildung, Wissenschaft und Kunst zu trennen sind.
Wenn Bildung, Wissenschaft und Kunst einschließlich der Medien vom Staatsapparat getrennt sind, dann kann es nicht mehr ihren jetzigen Gebrauch zu politischen Zwecken geben. Wie sich die Wissenschaft zu Beginn der Neuzeit von religiöser Einflussnahme befreit hat, so muss sie sich heute von staatlicher Einflussnahme befreien, um an Wahrheitsfindung orientierte Wissenschaft sein zu können. Paul Feyerabend forderte bereits 1975 (Kapitel 19), nach der Trennung von Staat und Kirche die Wissenschaft ebenfalls vom Staat zu trennen. Die Berechtigung dieser Forderung ist angesichts des politischen Gebrauchs der durch das Staatsmonopol organisierten Wissenschaft offensichtlich. Es wird dann weiterhin Universitäten geben, aber nicht als staatliche Organe. Im Bildungswesen wird es dann eine Pluralität von Schulen mit verschiedener pädagogischer, weltanschaulicher oder auch religiöser Orientierung geben, und Kunst kann sich frei von staatlichen Auftraggebern entfalten.
Diese Befreiung bedeutet allerdings auch den Verzicht auf staatliche Finanzierung durch Zwangsabgaben. Aber ein Geistesleben, das sich durch Zwang statt freiwillige Beiträge finanziert, kann kein freies Geistesleben sein. Die Menschen sind auch freiwillig bereit, je nach ihren finanziellen Verhältnissen für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Medien zu bezahlen. Denn die Menschen haben nicht nur materielle, sondern auch geistige Interessen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass wissenschaftliche Forschung in den Experimentalwissenschaften allein durch freiwillige soziale Gemeinschaften, Gebühren für die Nutzung der Bildungsangebote und Spenden finanziert werden kann. Eine vollständige Trennung zwischen Wirtschafts- und Geistesleben ist daher weder möglich noch sinnvoll. Das Geistesleben ist vielmehr Teil des Wirtschaftslebens in dem weiten Sinne, dass es bei beiden um arbeitsteilige soziale Interaktionen geht, die auf die Befriedigung der Interessen und Bedürfnisse der Mitmenschen ausgerichtet sind. Es gibt keine klare Trennlinie zwischen materiellen und geistigen Interessen. Ein guter Wein zum Beispiel, hergestellt von einem Winzer mit Hingabe zu seinem Beruf, ist sowohl ein materielles wie auch ein kulturelles Produkt, ebenso wie zum Beispiel ein ästhetisch ansprechendes Haus. Je besser es gelingt, die materiellen Grundbedürfnisse durch Arbeitsteilung, Kapitaleinsatz und damit einhergehendem Produktivitäts- und technologischen Fortschritt zu befriedigen, desto mehr Freiraum wird tendenziell für die Entfaltung des Geisteslebens geschaffen.
Es gibt auch offensichtliche wirtschaftliche Interessen an Forschung und der technischen Umsetzung von Forschungsergebnissen. Die Beteiligung von Unternehmen an Forschung und deren Finanzierung ist dann kein Problem, wenn es nicht zugleich eine Staatsgewalt gibt, auf deren Vertreter die Unternehmer einwirken können, um ihre Produkte den Menschen aufzuzwingen. Wenn es eine solche Staatsgewalt nicht gibt, dann müssen die Unternehmer die Kunden von ihren Produkten überzeugen, und sie müssen für eventuelle Schäden, die sie mit ihren Produkten anrichten, haften. Forschung, die nicht an den Interessen der Menschen orientiert ist und die nicht die Methode der kritischen Prüfung von Wissensansprüchen beachtet, hat dann kurze Beine. Lyssenko-Wissenschaft, das heißt, aus ideologischen Gründen beauftragte Wissenschaft, könnte es dann nicht geben. Der Versuch von Trofim Lyssenko, im Stalinismus Getreideproduktion auf der Basis einer Agrarwissenschaft kommunistischer Prägung durchzuführen (kurz: Pflanzen sind nicht durch Gene, sondern durch Umweltbedingungen bestimmt), endete in Hungersnöten. Auch das aktuelle Beispiel von Lyssenko-Wissenschaft, das ähnlich katastrophale Folgen einschließlich zahlreicher Todesopfer haben könnte wie das Original, nämlich die Entwicklung und der Vertrieb unzureichend geprüfter und in Verletzung aller wissenschaftlichen Standards zugelassener Impfstoffe zur Erfüllung eines politischen Planes, könnte es dann nicht geben.
Wie ein Unternehmen, das Flugzeuge herstellt, an der Erforschung der Wahrheit über die Gravitation interessiert sein wird, wenn es für seine Produkte haften muss, wird die Pharmaindustrie an medizinischer Forschung gemäß wissenschaftlichen Standards interessiert sein, wenn es keinen staatlich organisierten Gesundheitsapparat gibt, der ihre Produkte abnimmt und vertreibt und dabei sogar die Haftpflicht aussetzt. Das heißt auch: Wer riskante Forschung durchführen will, wie zum Beispiel die sogenannte Gain-of-function-Forschung, die auch in dem Institut für Virologie in Wuhan erfolgte, muss haften und eine Versicherung gegen mögliche Schäden abschließen – also erst einmal eine Versicherung finden, die die Risiken absichert. Es gibt dann keine Staatsgewalt, die bestimmte Unternehmen und Forschungsinstitutionen von ihrer Haftungspflicht im Namen eines angeblichen öffentlichen Interesses befreien kann. Kurz: Wenn die Wirtschaft vom Staatsapparat entflochten ist, Kunden von ihren Produkten überzeugen und gegenüber den Kunden für Schäden haften muss, dann hat sie ein Interesse daran, an Erkenntnisgewinn orientierte und deshalb mit methodischem Skeptizismus operierende Wissenschaft zu fördern; denn sie kann der Konfrontation mit der Realität, an der ihre Produkte scheitern können, dann nicht mehr ausweichen.
Allerdings ist davon auszugehen, dass auch weiterhin Produkte erforscht, entwickelt und vertrieben würden, die gesundheitsschädlich sind. Die Tabakindustrie muss seit einiger Zeit zumindest in den USA und Europa in gewissem Maße haften. Die Haftungspflicht hat aber nicht wirtschaftliche Profitabilität verhindert. Die Aktienkurse großer Tabakunternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht schlechter entwickelt als der Aktienmarkt insgesamt. Menschen fragen freiwillig und in Kenntnis der Risiken auch gesundheitsschädliche Produkte nach, weil sie unterschiedliche Präferenzen im Leben haben. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, sofern nicht Dritte gegen ihren Willen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie gesagt, der Ausweg aus der jetzigen Situation besteht nicht darin, einen neuen, tugendhafteren Menschen schaffen zu wollen, sondern zu verhindern, dass eine Gruppe Zwang ausüben kann, um ihre Interessen durchzusetzen.
Rechtsordnung und offene Gesellschaft
Ein naheliegendes Bedenken gegen die genannten Vorschläge ist: Wenn Bildung, Wissenschaft, Kultur und Medien von der Finanzierung und Lenkung durch die Staatsgewalt getrennt werden, dann organisiert der Staatsapparat nicht mehr den öffentlichen Raum. Besteht dann nicht die Gefahr, dass die Gesellschaft in verschiedene, sich selbst organisierende soziale Gemeinschaften zerfällt? Dieser Einwand ist unbegründet. Denn diese verschiedenen, sich selbst organisierenden Gemeinschaften leben auf demselben Territorium zusammen. Ihre Mitglieder tauschen sich wirtschaftlich durch Arbeitsteilung und kulturell aus.
Eine offene Gesellschaft benötigt keinen in irgendeiner Weise durch eine zentrale Gewalt organisierten öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum organisiert sich selbst durch freiwillige Interaktionen und Kooperationen statt durch Zwang, ausgeübt von einer zentralen Gewalt. Der Rahmen einer offenen Gesellschaft ist nicht ein von der Staatsgewalt gestalteter öffentlicher Raum, sondern eine Rechtsordnung, die gleiches Recht für alle durchsetzt – das heißt, die Verpflichtung für jeden, das Recht aller anderen auf die Gestaltung ihres Lebens zu respektieren und dementsprechend unerwünschte Eingriffe in die Lebensweise anderer zu unterlassen. Die Androhung und Anwendung von Zwang gegen eine Person oder Gruppe von Personen ist daher nur als Reaktion darauf gerechtfertigt, dass diese Person oder Personengruppe die Rechte anderer Personen verletzt, also übergriffig gegen deren Leib, Leben oder Eigentum wird.
Kommen wir auf Kants oben zitierte Definition von Recht aus der Vorlesung Naturrecht von 1784 zurück: »Recht ist die Einschränkung der Freiheit, nach welcher sie mit jeder andrer Freiheit nach einer allgemeinen Regel bestehen kann.« (Kant 1979: 1320, Orthografie angepasst) Wie der Titel der Vorlesung bereits angibt, meint Kant mit »Recht« hier das Naturrecht. Eine Rechtsordnung und Rechtsstaaten basieren immer auf dem natürlichen Recht. Wenn Recht gesetzt werden könnte, sodass lediglich das Einhalten einer bestimmten formalen Prozedur hinreichend dafür wäre, dass etwas Recht ist, dann wäre auch nahezu jedes diktatorische und jedes totalitäre Regime ein Rechtsstaat. Naturrecht ist das Recht, das aus der Würde des Menschen folgt, nämlich daraus, um es wiederum mit Kant zu formulieren, jeden Menschen stets als Zweck an sich selbst und nie als bloßes Mittel zu einem Zweck zu behandeln – und sei dieser Zweck ein angebliches allgemeines Gut (siehe zum Beispiel Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1785, zweiter Abschnitt, in Kant 1911: 429, und zur Begründung des Naturrechts ausführlicher Esfeld 2023, Kapitel 2.3 und 2.4).
Wenn, wie sich mit guten Gründen belegen lässt, das Coronaregime mit Zwangsmaßnahmen wie Lockdowns, Impfanweisungen usw. mit der Menschenwürde unvereinbar ist, dann wird dieses Regime nicht dadurch rechtmäßig, dass es gemäß geltenden formalen Prozeduren in Gesetze gegossen wird. Diese Gesetze sind dann vielmehr Unrecht. Genauso wie nur eine wahre Aussage Wissen sein kann und die Wahrheit der Aussage nicht von dem, der sie formuliert, und seiner sozialen Gemeinschaft abhängt, so kann auch nur etwas, das mit dem Naturrecht vereinbar ist, Recht sein. Wie beim Wissen und in der Wissenschaft, so geht es auch im Recht um Erkenntnis und nicht um Setzung. Ob man im Straßenverkehr links oder rechts fährt, ist eine Frage von Setzung (Konvention) und nicht von Erkenntnis (Kognition). Wenn einmal eine solche Konvention in Kraft gesetzt ist, dann sind alle, die die Infrastruktur des Straßenverkehrs benutzen wollen, verpflichtet, diese Konvention zu respektieren. Aber das Recht hat denselben Ursprung wie das Wissen, nämlich herauszufinden, was richtig ist (siehe dazu ausführlich Esfeld (2022–23)).