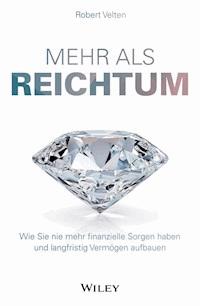
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wir alle wollen Vermögen. Aber wie setzen wir unsere Zeit, unsere Persönlichkeit und unser Geld am besten ein, um es aufzubauen, zu erhalten oder zu vermehren?
Die Finanzwelt ist in der Krise. Wozu Geld anlegen, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Aktien schießen hoch und fallen tief. Banken, Haushalte und ganze Staaten kämpfen mit Überschuldung. Wo noch Renditen locken, lauern kaum einschätzbare Risiken.
Wenn wir nicht verstehen, was Vermögen alles beinhaltet, können wir es nicht managen. Wir verpassen nicht nur täglich Chancen, es zu vermehren, sondern verarmen, ohne es zu wissen.
Um mit Vermögen glücklich und selbstbestimmt zu leben - dafür reicht Geld allein nicht aus. Geldbesitz ist eine Folge von Vermögen. Vermutlich besitzen Sie Erwerbsvermögen, also zum Beispiel Arbeitskraft. Oder Sie besitzen Zeitvermögen, also Zeit, die Sie nutzen können. Das Problem ist nur, dass unser Erwerbsvermögen im Laufe unseres Lebens abnimmt. Auch Zeit verrinnt. Unser materielles Vermögen hingegen wird aus Angst vor Krisen oft schlecht angelegt. Die Folge ist eine große Verschwendung - aus Unwissenheit.
Robert Velten - Philosoph, Portfoliomanager und Hochschuldozent für VWL - nimmt Sie mit auf eine Reise durch Ihre Möglichkeiten. Sie erfahren, wie Sie materielle und immaterielle Vermögensarten so zusammenarbeiten lassen, dass Sie ihr Leben ohne finanzielle Sorgen genießen und jeder Finanzkrise mit Gelassenheit begegnen können. "Mehr als Reichtum" liefert Ihnen viele anschauliche Instrumente für Ihre ganz persönliche Vermögenspraxis. Sie erfahren, wie die einzelnen Vermögensarten am besten ineinander greifen, so dass Sie Ihren Wohlstand erheblich steigern können.
"Mehr als Reichtum" ist ein Ratgeber, der sich an Menschen richtet, die mehr aus ihrem Geld und ihren Fähigkeiten machen wollen. In einem lockeren Schreibstil, der kein Fachwissen voraussetzt, werden dem Leser anhand von Grafiken und Anekdoten eine Fülle neuer Ideen und Anregungen präsentiert, die zusammen eine stimmige Strategie für ein Leben mit Vermögen ergeben.
"So macht es Spaß, sich nicht nur mit seinen Finanzen, sondern auch mit der eigenen Einstellung zum Geld und weit darüber hinaus zu beschäftigen. Ein Feuerwerk an Erkenntnisgewinnen für jeden Leser."
-- "Mr. Dax" Dirk Müller, Börsenexperte, Bestseller-Autor, Politikberater und Vortragsredner
"Robert Velten liefert in Mehr als Reichtum eine verblüffend andere Sicht auf die Vermögensanlage - aufklärend und provozierend. Mehr als lesenswert!"
-- Wieland Thyssen, Geschäftsführer der Agathon Capital
"Entweder Sie warten bis Andere Ihre Zukunft gestalten, oder Sie entdecken, dass Ihr eigenes Potenzial aus mehr als Reichtum besteht."
-- Marcel van Leeuwen, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Wertpapiertreuhand
"Eine rare Kombination von Philosophie, Wirtschaftswissenschaft und gesundem Menschenverstand - anschaulich, unterhaltsam, lehrreich und persönlichkeitsbildend."
-- Prof. Dr. Volker Eichener, Hochschule Düsseldorf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Impressum
Weihung
Vorwort
1. Kapitel: Reichen Sie noch oder Vermögen Sie schon?
Reichtum ist gut, Vermögen ist besser
Jetzt reicht's! – Warum wir zu viel konsumieren
Finanzkrisen sind nicht Ihr Problem
2. Kapitel: Immaterielles Vermögen bringt Sie weiter
Erwerbsvermögen – Viel größer als Sie denken
Zeitvermögen – Das vergessene Potenzial
Freiheit
Ein neues Zeit-Modell
Beatles-Zeit
Der Sinn des Nutzlosen
Vorbilder
Ihr individuelles Zeit-Portfolio
Zeit und Lebensalter
Zeit investieren
Zeit-Portfolio-Optimierung
Zeit kaufen
Wie teuer ist Zeit wirklich?
Mit Zeit rechnen
Nicht bloß denken, handeln!
Persönlichkeitsvermögen – Ihr größter Werttreiber
Investieren in die eigene Persönlichkeit
Sozialvermögen – Das Echte und das Falsche
3. Kapitel: Produktives Kapitalvermögen macht Sie von alleine reich
Bauen Sie mühelos freies Kapital auf
Wohin man investiert und wovon man besser die Finger lässt
Wachstum ohne Grenzen: Wie aus einem Pfennig ein Vermögen wird
Der Josephspfennig
Was Menschen können, wenn sie Kapital haben
Machen Zinsen die Produkte teurer?
Spekulanten als Wohltäter?
Mehr als 5 Prozent: Die Siegelsche Konstante
Kredite: Leihen Sie keinem Ihr Geld, auch nicht dem Staat
Wie Sie richtig diversifizieren
Wie viel Diversifizierung?
Immobilienzentrierte Unternehmungen
Keine Drittel-Regel
Ein Beispiel gegen die Drittel-Regel
Die fünf größten Fehler, die Sie mit Aktien machen können
Fehler 1: Zu spät oder gar nicht
Fehler 2: Zu viele Aktien einer Sorte
Fehler 3: Kaufen, wenn es alle tun
Fehler 4: Kauf der falschen Produkte
Fehler 5: Zu früher Verkauf
Aktien: Von falschen Zeitpunkten und richtigen Werten
Faire Preise für Immobilien
Immobilien oder Aktien?
4. Kapitel: Sonstiges Vermögen: Weniger ist mehr
Bargeld lacht
Wie viel soll es sein?
Wenn schon Geld, dann wenigstens…
Anti-Liquidität: Versicherungen und Co
Gold glänzt – steigt aber nicht im Wert
Gold und Rendite?
Warum Gold in und nach Krisen nicht im Wert steigen kann
Rohstoffe, Währungen und Hedge-Fonds
Währungen
Rohstoffe
Hedge-Fonds
Gebrauchsvermögen
Kunst und Luxus
5. Kapitel: So managen Sie Ihr persönliches Vermögensportfolio
Handeln wie ein Samurai
Denken wie ein Unternehmer
Millionär sein und Millionär werden: Das Vermögensportfolio in jedem Lebensalter
Bewahren Sie sich Ihre Freiheit!
Die Entscheidung des Herakles
Danksagung
Über den Autor
Stichwortverzeichnis
Wiley End User License Agreement
1. Auflage 2017
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
© 2017 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetrageneWarenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Gestaltung: pp030 - Produktionsbüro Heike Praetor, Berlin
Umschlaggestaltung: Torge Stoffers Graphik-Design, Leipzig
Coverfoto: Anatoly Maslennikov - fotolia.com
Satz: SPi Global, Chennai
Print ISBN: 978-3-527-50915-7
ePub ISBN: 978-3-527-81326-1
mobi ISBN: 978-3-527-81327-8
Meiner Familie
Vorwort
Die Finanzwelt ist in der Krise. Investoren wissen nicht mehr, wohin. Wozu Geld anlegen, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Aktien schießen hoch und fallen tief. Banken, Haushalte und ganze Staaten kämpfen mit Überschuldung. Wo noch Renditen locken, lauern Risiken, die kaum einer einschätzen kann.
Gleichzeitig stellt der globale Arbeitsmarkt immer mehr Anforderungen an den Einzelnen. Im Verdrängungswettbewerb kann nicht jeder mithalten. Zwischen arm und reich verausgaben sich Millionen im Hamsterrad einer mittelständischen Karriere. Sie leisten, leisten, leisten…und haben schließlich oft nicht einmal ein abbezahltes Haus.
Wer es in diesem Szenario zu Geld gebracht hat, muss vorsichtig sein, es nicht zu verlieren. Wer noch zu Geld kommen will, hat es noch schwerer. Und Geld ist nicht genug: Wir wollen Sicherheit, Wohlstand und Freiheit. Wir wollen die tollsten Dinge anstellen, anstatt bloß zu funktionieren.
Die Bedingungen in der Welt da draußen sind nicht gerade übersichtlich. Wie kommen wir da am besten klar? Der Schlüssel heißt Vermögen. Also einerseits Besitz, andererseits Fähigkeit. Beide gehen Hand in Hand.
Dieses Buch liefert Ihnen viele anschauliche Instrumente für Ihre ganz persönliche Vermögenspraxis. Sie erfahren, wie die einzelnen Vermögensarten am besten ineinander greifen, so dass Sie Ihren Wohlstand erheblich steigern können.
X Millionen in x Jahren? Darum geht es hier nicht. Aber darum, sich ab sofort als vermögend zu erkennen und in der Folge auch immer reicher zu werden. Wenn Sie Ihr Vermögen wahrnehmen, können Sie leicht reich sein. Aber der Reichtum wird Ihnen dann weniger bedeuten. Denn Vermögen ist mehr als Reichtum.
Aktien und Immobilien sind wichtig, aber zuerst geht es um Ihre Zeit und Ihre Persönlichkeit. Lesen Sie von neuen Möglichkeiten, Ihre eigenen Talente vermögenswirksam zu entwickeln und dabei das Beste aus Ihrem Geld zu machen. Was brauchen Sie und was brauchen Sie nicht? Und wo fangen Sie an? Werden Sie Manager Ihres ganz persönlichen Vermögensportfolios, mit allen Aspekten, die dazu gehören.
Zu Beginn eine einfache Frage: Reicht es Ihnen, reich zu sein? Oder wollen Sie mehr als Reichtum, das heißt Vermögen? Dazwischen liegt ein feiner Unterschied: Denn Reichtum, den Sie nicht einsetzen, nutzt Ihnen wenig. Er verbraucht sich. Es kostet sogar Kraft, ihm hinterherzurennen. Wenn Sie aber den Fokus auf den Einsatz Ihres Vermögens setzen, dann vermögen Sie jeden Tag mehr. Sie wachsen mit Leichtigkeit. Denn Vermögen wird durch Anwendung immer größer.
Reich und vermögend sind zwei Paar Schuhe. Mit der Zeit merken Sie, dass die einen zwar gut aussehen, aber noch lange nicht für die Wanderung durch das Leben geeignet sind. Sie machen sich zwar gut auf einem Meeting oder einer Party, aber mit den anderen kann man über alle Berge laufen wie auf Siebenmeilenstiefeln.
Warren Buffett und Bill Gates sind wahrscheinlich die reichsten Menschen der Welt. Sie werden wohl niemals so reich werden wie diese beiden … Da können Sie noch so viel arbeiten, noch so viel richtig machen, und noch so viele Bücher lesen … Das denken Sie vielleicht und damit haben Sie wahrscheinlich Recht. Aber Sie können – auch, wenn Sie sich jetzt nicht einmal reich fühlen – so vermögend werden wie diese reichsten Menschen der Welt es jetzt sind. Ich werde Ihnen zeigen, wie das geht.
Na schön, das war jetzt etwas übertrieben. Wie das genau geht, weiß ich nicht, aber ich habe eine Menge Anregungen für Sie, wie Sie Ihren persönlichen Weg gehen können, gleich, ob Sie gerade erst in den Beruf einsteigen, oder schon ziemlich erfahren und reich sind.
Erwarten Sie keine Esoterik oder Allerweltsweisheit…Eine wie die, man müsse nur verzichten und mit Wenigem zufrieden sein, dann sei alles gut. Das ist vielleicht auch ein Weg. Aber Menschen wie Sie und ich wollen mehr, und wenn wir ehrlich sind: Wir wollen viel mehr. Und wir wollen es immer wieder.
Wir wollen nicht als Einsiedler leben oder wie Mönche und Nonnen im Kloster unsere Zeit in friedlicher Beschaulichkeit verbringen. Wir wollen nicht immerzu in stiller Versenkung die Welt betrachten und allem Äußeren, dem Besitz, der Macht, dem Ansehen und dem Ruhm entsagen. Wir wollen nicht aufhören mit unserem Streben nach mehr Leben, mehr Können, mehr Gesellschaft und mehr Geld. Wenn doch, hätten wir es längst getan. Nichts wäre einfacher: Man braucht ja keine äußeren Voraussetzungen, um seinen Ehrgeiz aufzugeben. Aber wir wollen immer wieder weiter. Wir wollen auch da draußen erreichen, was wir uns innerlich wünschen. Aber wie fangen wir das an?
Reicher und toller werden! Wir haben jeden Tag Vorstellungen, wie das geht. Schließlich handeln wir danach, und das hat uns weitergebracht. Wir lernen jeden Tag dazu und wissen, dass uns andere auf den ein oder anderen nützlichen Gedanken bringen können. In der Praxis helfen gute Ideen.
Deshalb gibt es dieses Buch. Es enthält Schwert und Schild für eine wilde Welt, in der wir uns bewähren müssen. Denn ob wir wollen oder nicht: Die Herausforderungen des Lebens sind da. Meistern wir sie.
1
Reichen Sie noch oder Vermögen Sie schon?
Reichtum ist gut, Vermögen ist besser
Die meisten von uns versuchen, reich zu werden, und genügen den Anforderungen des bürgerlichen Lebens. Das heißt, sie reichen. Alle Rechnungen werden bezahlt, aber viel Spielraum ist nicht da. Vermögen ist etwas anderes. Man vermag etwas zu tun, wenn man die Freiheit dazu hat – und nicht bloß eine Pflicht erfüllt.
Geld bedeutet Freiheit. Deshalb ist gutes Investieren wichtig. Aber Sie brauchen mehr als Geld und Grundbesitz. Denn das bloße »Haben« führt noch nicht zu dem Gefühl, etwas zu vermögen.
Dafür braucht man beide Inhalte, die in dem Wort Vermögen angesprochen sind: das Materielle und die Fähigkeit. Von der bloßen Vorstellung eines Essens wird man nicht satt. Von Essen allein wird man aber auch noch nicht glücklich. Wer viel hat, es aber nicht genießen kann, dem geht es wie Tantalos, dem unermesslich reichen König aus den griechischen Sagen, dem die Götter eine furchtbare Strafe auferlegt haben: Er darf sich niemals erlaben an dem, was er vor sich sieht. Alles ist da. Ein Schlaraffenland! Aber nichts kommt bei ihm an. »Fruchtbare Bäume neigten um seine Scheitel die Zweige«, dichtet Homer. »Voll balsamischer Birnen, Granaten und grüner Oliven/Oder voll süßer Feigen und rötlich gesprenkelter Äpfel/Aber sobald sich der Greis aufreckte, der Früchte zu pflücken/wirbelte plötzlich der Sturm sie empor zu den schattigen Wolken«, so geht es uns modernen Menschen auch. Wir erreichen die Früchte zwar mit unseren Händen, Gabeln und Mündern – aber nicht mit unserem Bewusstsein.
Umgekehrt wollen wir gerne reicher werden und malen uns aus, wie wir später mehr Geld verdienen – nur unser Konto merkt davon nichts. Ein doppeltes Dilemma!
Was haben wir von den Früchten unserer Arbeit? Manche bewohnen ein eigenes Haus und sind doch in Sorge, es abzahlen zu können. Wie ein Korsett schnüren uns Gedanken an unsere Verantwortung und Pflichten ein. Wir begehren immer etwas, das in der Zukunft liegt. Das größere Unternehmen, das erledigte Projekt, das nächste erreichte Ziel. Was wir haben, genießen wir nicht mehr, und was wir genießen wollen, haben wir noch nicht! Und wenn wir einmal beides zugleich haben, zum Beispiel Geld und die Fähigkeit, uns damit eine Freude zu machen, dann fehlt uns oft die Zeit dazu. Wir müssen unser gesamtes Potenzial an Zeit, Geld und Fähigkeiten besser managen. Das ist unser Vermögen.
Insofern haben wir alle Vermögen. Damit einher geht die Verantwortung, dieses Potenzial zu entfalten. Es ist eine Verpflichtung, nicht anderen, sondern uns selbst gegenüber! Wenn wir uns selbst an unserem Vermögen erfreuen, wenn wir es pflegen und vergrößern, dann vermögen wir auch stärker für andere da zu sein. Wir geben ganz von allein mehr ab. Das ist die menschliche Natur. Aber unser eigenes Vermögen ist oft zu gering, um es zu verschenken. Dann verhindert das Gefühl des Mangels die eigene Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Ängstlich wird festgehalten, was gegeben gehört in den Kreislauf des Wirtschaftens und Zusammenlebens. Also muss zunächst das eigene Vermögen vergrößert werden. Mit allem, was dazugehört. Mit Selbstbewusstsein und Geld. Und genau darum geht es in diesem Buch.
Geld. Man darf ihm nicht hinterherrennen, meint der bekannte griechische Milliardär Aristoteles Onassis. Ausgerechnet ein Grieche sagt das! Und als solcher hat er auch gewissermaßen ein Vorrecht darauf. Denn Ähnliches verkündeten schon die antiken griechischen Philosophen, die sich nichts aus Geld machten, obwohl sie ganz viel davon hatten.
Auch Sie haben ganz viel! Wussten Sie, dass hundert Billionen Zellen jeden Tag für Sie arbeiten? Und dass schon ein durchschnittlicher Berufseinsteiger ein Erwerbsvermögen von über einer Million Euro hat? Wussten Sie, dass aus 30 000 Euro bereits nach 30 Jahren 800 000 Euro werden, wenn man sie in durchschnittliche Allerweltsunternehmen investiert?
Aus den eigenen Möglichkeiten viel zu machen ist Vermögenspraxis. Das fängt bei den eigenen Gewohnheiten an, bei der eigenen Persönlichkeit. Der Weg zu Ihrem Glück – und auch zu äußerem Reichtum – führt nicht über einen zufälligen Lottogewinn, sondern über das Vermögen, das jetzt schon in Ihnen selbst und in Ihrer unmittelbaren Umgebung vorhanden ist.
Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, fing als Zeitungsausträger an. Die Biografin Alice Schroeder erzählt in ihrem 1200-seitigen Buch über Buffett: Er hatte eine Methode entwickelt, wie er vom fahrenden Auto aus mit einer Hand die Zeitungen in die Briefkästen werfen konnte, während er mit der anderen Hand das Steuer hielt. (Seine Billionen Zellen arbeiteten also ziemlich gut zusammen!) So konnte er drei Zeitungsrouten in der Zeit von einer schaffen. Es war möglich, mehr Geld zu verdienen als er brauchte, und den Überschuss anzulegen, um irgendwann reich zu werden. Und das hat er dann auch getan.
Es erinnert auf verblüffende Weise an eine andere Geschichte, diesmal an eine erfundene: Dagobert Duck startet seinen Aufstieg zur reichsten Ente der Welt ebenfalls von ganz unten: als Schuhputzer. Er baut ein einfaches Gerät, mit dem er die Schuhe von drei Kunden gleichzeitig putzen kann. So stellen es sich jedenfalls Carl Barks und Don Rosa in ihrer »Biografie« Dagoberts vor. Dagobert denkt sich abends: Wie kann ich es schaffen, mehr aus meinem Putz-Job herauszuholen? Und das bringt ihn auf Ideen!
Beide Geschichten zeigen: Wer mehr will, wer sich Gedanken macht, wie er mit seinen Möglichkeiten mehr erreichen kann, und diese Gedanken dann konsequent in die Tat umsetzt, der kann sehr weit kommen!
»Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten«, sagt der berühmte John D. Rockefeller. Und er muss es wissen, denn auch er begann weit unten: als Lehrling bei einer Spedition. Von dieser Startposition aus machte er sich zu einem der reichsten Menschen der Neuzeit.
Ist das nicht ein bisschen zu weit weg? Sind das nicht alles Geschichten aus Amerika? Nein. Rockefellers Familie stammt aus dem Rheinland. Der Name Rockefeller, ein Symbol für Reichtum, heißt einfach »Roggen-Felder«. Der Weg zum Reichtum ist etwas ganz Alltägliches. Er liegt direkt vor unserer Haustür. Im Kornfeld um die Ecke geht es los.
»Du hast 300 Prozent Energie!«, sagt ein befreundeter Ingenieur. In Wirklichkeit hat natürlich jeder – gemessen an sich selbst – 100 Prozent. Wir sind auch keine Maschinen. Aber die Energie, die wir als Menschen haben, ist das Grund-Vermögen überhaupt. Wir können es einsetzen, wozu wir Lust haben.
Damit fängt alles an. Reichtum kann ein Anreiz sein, die eigene Energie voll auszuschöpfen. Reichtum kann auch ein Nebeneffekt davon sein. Aber die unumgängliche Grundlage für Reichtum (und für den Genuss des Reichtums) ist das Vermögen. Und dessen Höhe hängt vor allem davon ab, wie klug wir damit umgehen.
Wenn wir unsere Energie gut einsetzen – so wie Warren Buffett beim Zeitungsaustragen oder Dagobert Duck beim Schuhe putzen –, erreichen wir vielleicht ein Ergebnis, das 300 Prozent über der Norm liegt. Wir vermögen dann schon drei Mal so viel. Eine gute Ausgangsbasis – auch für Reichtum.
Die eigene Energie ist aber nur ein Teil des Persönlichkeitsvermögens. Das Persönlichkeitsvermögen wiederum ist ein Teil des noch größeren immateriellen Vermögens, das jedem Menschen zur Verfügung steht. Sie ahnen vielleicht das Potenzial, das darin steckt. Aber oft ist uns das gar nicht bewusst.
Als Student verlor ich durch ein »gewieftes« Börsenmanöver einmal 40 000 Euro an einem Tag (gewieft war natürlich die Gegenseite, nicht ich). Das hat mich zuerst ganz schön geschockt – schließlich brauchte ich das Geld für mein Studium. Ich überlegte den ganzen Abend, wie es zu diesem Fehler kommen konnte. In der Nacht schlief ich dennoch gut, weil ich mir klarmachte, dass das verlorene Geld nur einen geringen Teil meines Vermögens ausmachte. Zumindest, wenn man mit der Einschätzung seines immateriellen Vermögens großzügig ist. Geld ist nicht alles.
Abbildung 1: Bestandteile des eigenen Vermögens
Wenn wir die Vermögen, die wir bereits haben, gut nutzen, sie gut zusammenarbeiten lassen, wenn wir uns überhaupt bewusst sind, dass wir sie haben, dann sind wir vermögend. Als Vermögende können wir unser Vermögen täglich ausbauen, es täglich entwickeln und es auch täglich leben. Das materielle Vermögen, der Reichtum, ist eine Begleiterscheinung davon.
Aber auch das materielle Vermögen wird wichtig. Es hat eine eigene Dynamik und unterstützt – richtig eingesetzt – unsere Gesamtvermögensentwicklung auf eine sehr effektive Weise. Denn materielles Vermögen ist geronnenes immaterielles Vermögen – so wie Öl und Kohle, die über Jahrtausende hinweg letztlich aus Sonnenenergie entstanden sind. Mit einem Unterschied: Öl und Kohle können sich nicht aus sich selbst heraus vermehren. Materielles Vermögen hingegen kann das – wenn es in guten Händen liegt.
Wir schaffen Licht und Wärme aus fossiler Energie, wenn die Sonne mal längere Zeit nicht oder nur schwach scheint. Deshalb sind Kohle und Öl eine tolle Sache. Aber ganz ersetzen kann das schwarze Gold die Sonne nicht. So ist es auch mit Reichtum und Vermögen: Wir brauchen unsere Energie, unsere Persönlichkeit und unsere Zeit, um unseren Reichtum zu genießen, und auch, um ihn effektiv zu mehren. Wir brauchen mehr als Reichtum, um etwas zu erreichen. Der Milliardär Aristoteles Onassis drückte das so aus: »Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles kaufen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat.«
Das heißt aber nicht, dass bloßer Reichtum etwas Minderwertiges wäre. Etwas, dem man unbedingt etwas Höherwertiges entgegenhalten müsste. Warum denn auch? Wir wollen reich sein. Und das dürfen wir auch klarstellen. Wenn wir gerade Lust auf ein Erdbeereis haben, sagen wir ja auch nicht: »Aber eigentlich ist Zitroneneis besser, wenn ich's mir recht überlege. Erdbeereis will ich gar nicht.«
Seit Jahrtausenden haben Philosophen auf dem Reichtum herumgehackt, darum ist das Streben danach bis heute in manchen Kreisen verpönt. Platon wünschte sich eine Welt ohne Geld. Zumindest für (s)eine intellektuelle Elite. Cicero sah verächtlich auf Berufe herab, die auf Gelderwerb ausgerichtet waren. Durch die ganze Geschichte der europäischen Philosophie zieht sich diese Haltung hindurch bis heute. Es fehlt dabei nur eins: eine Begründung. Die liefern die Philosophen nicht. Dabei sind die meisten Philosophen – Cicero und Platon natürlich eingeschlossen – selbst sehr reich gewesen.
Abbildung 2: Immaterielles Vermögen als Ausgangsbasis
»Weißt du Robert, Geld ist mir gar nicht wichtig«, sagte mir einmal der Freund einer Freundin: »Ich muss das gar nicht haben, so wie du vielleicht.« Mich beeindruckte das im ersten Moment schon etwas. Später erfuhr ich von seiner inzwischen ehemaligen Freundin, dass er in ihrer gemeinsamen Wohnung sehr genau darauf achtete, wie lange sie seine Elektrogeräte benutzte, da er sich Sorgen um die Stromrechnung machte. Auch stritten sie sich häufiger darum, wie die Heizung zu regulieren sei: Sie wollte es warm haben, er lieber frieren – und Geld sparen.
Es gibt Wichtigeres und Besseres als Reichtum, aber deshalb ist Reichtum doch nicht ganz belanglos. Die meisten Menschen wollen gerne reich sein, auch, wenn nicht alle das zugeben. Es mag Menschen geben, die denken: »Porsche? Warum soll ich denn Porsche fahren. Ich bin mit meinem Trabi ganz zufrieden.« Das kann aber auch eine Strategie der Bequemlichkeit sein. Ein Gedanke, der im Weg steht, wenn es darum geht, das eigene Vermögen zu entwickeln.
Als der Fernseh-Entertainer Hape Kerkeling einmal einem ehemaligen DDR-Bürger einen Trabi aus seiner früheren Bestellung lieferte, hat dieser nicht gerade fröhlich ausgesehen. In der DDR dauerte es ziemlich lange, bis ein Wagen geliefert wurde, deshalb hatten manche Kunden für ihre Bestellung noch nach der Wende ein theoretisches Auslieferdatum vor sich. Für den Mann war es jetzt so weit. »Wir nehmen Ihren alten Wagen in Zahlung«, strahlte der verkleidete Kerkeling den Mann an. »Endlich ist Ihr nagelneuer Trabant da! Sie haben ihn damals bestellt, hier ist Ihre Unterschrift, sehen Sie?« »Ein bisschen unbequem«, raunzte der Mann bei der Probefahrt. Natürlich. Er weiß ja inzwischen, wie gut Benz und BMW sind. Wird er heute, wo er beides kennt, noch sagen: »Och, ich bin mit meinem Trabi ganz zufrieden«?
Der materielle Reichtum ermöglicht viel mehr als tolle Autos. Wer reich und vermögend ist, kann mehr Dinge tun und lassen. Er kann unliebsame Tätigkeiten delegieren und verliert das Gefühl der Sicherheit auch dann nicht, wenn er sozusagen frei Schnauze handelt. Er kann nach wie vor moralisch sein, muss sich aber nicht mehr so stark nach materiellen Zwängen richten.
Es gibt eine Fülle von Autoren, die behaupten, mit dem positiven Denken finge jeder Erfolg an: Joseph Murphy, Anthony Robbins, Napoleon Hill und viele weitere. Warum sollten wir einen so naheliegenden Gedanken ignorieren? Wenn ich etwas doof finde, werde ich es wahrscheinlich unbewusst meiden. Darum ist es ein guter Anfang, klar zu erkennen, dass Reichtum gerade für Sie persönlich sehr erstrebenswert ist!
Eine positive Einstellung zum Reichtum war auch für Warren Buffett und John D. Rockefeller die Voraussetzung für ihren Erfolg. Selbst John Lennon wollte unbedingt reich werden, damit er aus seiner kleinen Welt in Liverpool ausbrechen konnte. Eines der ersten Lieder, die die Beatles sangen, war: Money, that's what I want.
Ein Reicher schuldet der Gesellschaft nichts – im Gegenteil: Wer aus eigener Kraft reich geworden ist, hat oft viel geleistet. Warren Buffett hat durch seinen klugen Umgang mit Geld nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere reich gemacht und die Wirtschaft und den Wohlstand aller vorangebracht. Sein philanthropischer Einsatz kommt da hinzu. John Lennon ist reich geworden, weil er hunderten Millionen Menschen ihre Lieblingsmusik gegeben hat. Das zeigt: Reichtum muss nicht unmoralisch sein. Das reden wir uns nur gerne mal selbst ein, so wie wir auch einen Trabi akzeptieren können, wenn wir keine andere Möglichkeit haben. Lassen Sie sich nicht von dem Gedanken bremsen, Reichtum an sich sei verwerflich oder etwas, das nur die anderen bekommen können. Lassen Sie sich aber auch nicht bremsen von der Fixierung auf Reichtum, denn es gibt etwas, das Reichtum beinhaltet, aber weit darüber hinausgeht: etwas, das Reichtum erzeugt. »Reichtum ist gut, ist er ohne Schuld« heißt der Titel eines antiken Werkes von Clemens von Alexandria. Ich sage stattdessen: Reichtum ist gut, Vermögen ist besser.
Jetzt reicht's! – Warum wir zu viel konsumieren
Kaufen und konsumieren! Möglichst viel und von Jahr zu Jahr mehr! Das ist gut für die Wirtschaft! Wer spart oder, noch schlimmer, sein Geld hortet, der verhält sich unmoralisch, weil er die Wirtschaft sich selbst überlässt und nur an sich denkt. Mit Shopping aber tut man was für die Gesellschaft. Das ist heute die allgemeine Denkart. Aber stimmt das? Ist es wirklich so toll, wenn wir konsumieren, so viel wir können?
Es war kurz nach dem 11. September 2001. Viele haben sichgefragt: »Was können wir Gutes tun, jetzt in der Krise?« Das Fernsehen sendete die einfache Antwort: Kaufen! Kaufen! Kaufen! Bilder von jungen Frauen, die mit Papas Kreditkarte in New York »shoppten«, strahlten bis in deutsche Wohnzimmer hinein. Die jungen Damen sagten so etwas wie: »Wir retten jetzt die Nation.«
Dann folgte die Finanzkrise 2009. Diesmal kam die »Rettung« vor dem wirtschaftlichen Großeinbruch sogar in Gestalt eines ganzen Programms zur Belebung des Konsums: die Abwrackprämie. Der Staat gab Steuergelder für Autos aus. Genauer gesagt konfiszierte der Staat Geld in Form von Steuern von allen Bürgern und zahlte es dann nur an diejenigen Bürger aus, die im Besitz älterer Autos waren. Aber auch nur dann, wenn diese sich bitteschön ein neues Auto kauften. Abwrackprämie heißt übersetzt: »Wir nehmen dir Geld weg und geben es dir nur zurück, wenn… Ach, du willst dein Auto behalten? Noch schlimmer: Du hast gar kein Auto? Tja, Pech!«
Was hatte das für einen Sinn? Jedenfalls keinen ökologischen, denn ein neues Auto herzustellen, kostet wahrscheinlich mehr Energie, als das alte in seiner restlichen Nutzungszeit verbraucht hätte. Und wenn wir bei der Ökologie sind: Warum hat die Regierung das Geld nicht in Solarförderung oder direkt in staatliche Solaranlagen oder in Steuervergünstigung für Umwelttechnik-Forscher gesteckt? Antwort: Die Regierung wollte den allseits hofierten Konsum ankurbeln.
Wer in Krisen groß einkauft, so der Tenor, darf sich doppelt gut fühlen: nicht nur, weil er sich etwas Tolles kauft, sondern auch, weil er der Welt damit einen ganz besonderen wirtschaftlichen Dienst erweist. Es ist ganz leicht, sozial zu sein: Einfach tief in die Taschen greifen und sich möglichst alles kaufen, was irgendwie überhaupt geht, besonders das, was man nicht braucht – wie ein neues Auto. Was aber wäre gewesen, wenn das alte Auto wirklich schrottig und grottig gewesen wäre? Dann hätte man es sicher auch ohne staatliche Prämie »abgewrackt«, oder?
Aber stimmt das etwa nicht, das mit dem tollen Konsum? Es ist doch richtig, dass die Produzenten auf diese Weise mehr Geld bekommen? Davon können sie dann Löhne und Gehälter zahlen, neue Maschinen kaufen, die Wirtschaft wieder beleben, oder? Die Autohersteller zum Beispiel ordern dann mehr bei ihren Zulieferern, die Zulieferer wieder bei ihren Zulieferern, die wiederum können mehr Löhne zahlen und Arbeitsplätze schaffen. Das wiederum führt zu mehr Nachfrage, die Nachfrage führt zu mehr Aufträgen bei anderen Zulieferern und immer so weiter. Jeder hat dann mehr, zumindest nach dieser Logik der wundersamen Geldvermehrung durch Konsum.
Leider ist die Welt nicht so einfach. Wäre es so, könnte man einfach die Geldhähne öffnen und mit »Konjunkturprogrammen« jede Krise wegspülen. Dass so etwas langfristig eben nicht funktioniert, zeigt Japan seit 20 Jahren. In Japan ist Geld schon lange so billig wie bei uns heute. Konjunkturprogramme gibt es eines nach dem anderen. Die Wirtschaft aber stagniert.
Wäre die Welt einfach genug für diese Milchmädchenrechnung vom tollen Konsum, dann wären auch Griechenlands Probleme tatsächlich vom deutschen Spardiktat verursacht. Die »Rettungspolitik« wäre reiner Schwachsinn, denn Griechenland bräuchte dann nur zu konsumieren. In der Folge wüchse die Wirtschaft und alles wäre wieder gut…
Manche glauben das. Wenn etwas schiefläuft, ist es auch leicht zu sagen, dass »die da oben alles falsch« machen. Vielleicht machen sie nur nicht alles richtig. Und auch das ist Sache der Perspektive. »Man müsste Griechenland wieder mehr konsumieren lassen!«, hört man. »Schluss mit dem Spardiktat!« Aber so einfach ist es leider nicht. So fraglich die versuchte Griechenland-»Rettung« ist, im Kern zielt sie auf das Richtige, nämlich Reformen und Einschnitte im Konsum. In Wahrheit hat Griechenland nämlich bereits zu viel konsumiert. Die Krise ist sogar eine Folge des Konsums. Der viel zu hohe Konsum in der Vergangenheit hat nämlich die Schulden erst verursacht, ohne die Griechenland jetzt weniger Probleme hätte.
Was ist Konsum denn eigentlich? Auf den Punkt: Konsum ist jede Mittelverwendung, die keine Investition ist. Und Investition ist das, was die Produktionsbasis vergrößert oder verbessert, was also zukünftige Einkünfte steigert. Konsum ist einfach der Teil, der von der Wirtschaft hergestellten Güter und Leistungen, die nicht die Produktionsbasis vergrößern, sondern – eben ohne Nutzen für die Wirtschaft – verbraucht werden. Eine Wirtschaft produziert nicht wegen irgendwelcher Geldmengen oder Staatsausgaben mehr, sondern kann nur dann real wachsen (mehr Güter und Leistungen produzieren), wenn entweder mehr oder bessere Arbeit geleistet wird und/oder mehr reales Kapital eingesetzt wird.
Nehmen wir zum Beispiel einen Bauarbeiter. Das ist die Arbeitskraft. Und jetzt den Bagger, das ist das Kapital. Ein Bauarbeiter mit Bagger leistet mehr als ein Bauarbeiter ohne Bagger. Und zwei Bauarbeiter mit zwei Baggern leisten noch mehr. Ein Bauarbeiter ohne Bagger und dazu ein Stasi-Spitzel mit Abhörgerät leisten wiederum weniger. Es ist meistens sinnvoller, einen Bagger herzustellen als ein Abhörgerät. Kapital ist also nicht gleich Kapital. Aber Kapital an der richtigen Stelle erhöht die Produktionskapazitäten. Und dieses Kapital muss zuvor selbst produziert worden sein. Bagger kommen nicht aus dem Nichts.
Abbildung 3: Das Grundsystem der Produktion in der Wirtschaft
Die Wirtschaft kann nur so viel produzieren, wie an Faktoren Arbeit und Kapital »hineingesteckt« werden. Die Nachfrage, die bedient werden kann, kann nur so hoch sein, wie die Produktion von Gütern und Dienstleistungen ist. Dagegen sind die Bedürfnisse immer wesentlich höher und fast unbegrenzt. Wer fährt nicht gern ein tolles Auto, wer hätte nicht gerne ein Ferienhaus, wer liest nicht gerne neue Bücher, wer lehnt eine neue Küche oder ein zweites Paar Schuhe ab? Wir verzichten nicht auf Käufe, weil wir nicht genügend Bedürfnisse haben, sondern weil wir nicht genug Geld, also nicht genügend reale Kaufkraft haben. Und diese reale Kaufkraft ist wiederum deshalb begrenzt, weil die Fähigkeit einer Volkswirtschaft zu produzieren ebenfalls begrenzt ist.
Größen wie Importe, Exporte und Staatsausgaben, mit denen Volkswirte gerne rechnen, ändern nichts an dieser Logik: Es kann nur so viel konsumiert werden wie auch hergestellt wurde. Durch eine künstliche »Ankurbelung« des Konsums lässt sich langfristig nichts erreichen. Durch Konsum werden zwar durchaus die konsumnahen Industriezweige (zum Beispiel Handel, Konsumgüterproduzenten) gefördert, aber – und das ist der entscheidende Punkt – die konsumfernen Wirtschaftszweige (also jene, die Bildung, Forschung, produktive Maschinen und so weiter herstellen) werden gleichzeitig und in demselben Maße gebremst. Denn Geld, das für Konsum ausgegeben wird, fehlt für Investitionen. Die Begünstigung ist nur partiell. In der Summe ändert sich der Output nicht.
Im Gegenteil: Weil eben mehr konsumiert und folglich weniger investiert wurde, sinkt der Output in den Folgejahren dann sogar unter den Wert, der mit höheren Investitionen möglich gewesen wäre. Wenn der Bauer von Jahr zu Jahr weniger Saatgut einsetzt und weniger Land bebaut, weil er das Saatgut lieber sofort verbraucht (Konsum) und das Ackerland als Liegewiese benutzt (Kapitalakkumulation zu Konsumzwecken), hat er jedes Jahr weniger Ertrag. Zunächst aber hat er etwas mehr, denn er verbraucht ja einfach mehr Saatgut (die Konsumquote steigt). Nehmen wir an, er nutzt die Liegewiese ohnehin nur einmal im Jahr. Dann hätte er mehr davon gehabt, wenn er die Fläche als Ackerland genutzt hätte. Da er aber mehr Saatgut verbrauchen kann, weil er ja weniger davon aussät, merkt er zunächst gar keinen Rückgang in seinem Lebensstandard. Aber langfristig sinken seine Erträge immer mehr! Das Beispiel ist etwas vereinfacht, aber es illustriert: Kurzfristig überdeckt der in der Krise angekurbelte Konsum die zuvor erfolgten Fehlallokationen des Kapitals (in dem Beispiel die Liegewiesen). Langfristig aber vergrößert er das Problem, indem er die notwendigen Bereinigungen aufschiebt, die Güter- und Leistungsströme zum kurzfristigen Verbrauch lenkt und von langfristig sinnvollen Investitionen abzieht.
Ein Bäcker, der sich in der Nordsee eine Plattform errichten lässt, um dort Brötchen zu backen und an vorbeifahrende Schiffe zu verkaufen, investiert. Er investiert vermutlich falsch. Das nennt man Fehlallokation. Viel Kapital ist nötig, um auf dem Grund des Meeres seine Tragpfeiler zu verankern, eine Bäckerei auf See zu errichten und Verträge mit Lieferanten abzuschließen. Am Ende kaufen die Schiffe weiter in den Häfen, anstatt ihren Kurs für frische Brötchen zu ändern.
Nun könnte man natürlich argumentieren, man müsste mal mit dem Schiff zu dem Bäcker fahren und Brötchen kaufen, damit dieser seine aufwändige Meeresbäckerei nicht ganz umsonst gebaut hätte. Sonst verlöre er doch seine Arbeit und die waghalsige Bäckerei müsste abgeschrieben werden. Auch die Banken, die dem Bäcker Geld geliehen haben, verlören ihre Kredite und müssten »gerettet« werden. Da ist es doch einfacher, man kauft dem Bäcker hin und wieder Brötchen ab, oder? Das genau ist der Grundgedanke von konsumorientierten Konjunkturprogrammen! Künstliche Anreize für Konsumenten auf Schiffen zu schaffen, bei diesem Meeresbäcker zu kaufen, weil er nun schon mal da ist: Das ist ein Konjunkturprogramm. Aber die Nachfrage fehlt dann eben jenen Bäckern, die intelligent genug waren, ihre Bäckereien mit weniger Aufwand in Fußgängerzonen zu errichten. Oder sie fehlt bei den Herstellern von Solarmodulen, von Gleisen, von Brücken und so weiter.
Wer hat Interesse daran, dass Konsum gefördert wird? (Wohlgemerkt genau den Konsum, den die Menschen freiwillig und unbeeinflusst durch Geld-Lockmittel eben nicht vornehmen würden – denn wenn doch, bräuchte es ja kein Förderprogramm). Natürlich: Es sind diejenigen, die zuvor falsch investiert haben. Es sind die, die übermäßige Kapazitäten zur Herstellung von Konsumgütern aufgebaut haben. Wie beispielsweise unser Bäcker mitten in der Nordsee, der natürlich Interesse an einem Programm zur Förderung von Meeresbäckereien hätte.
Es gibt Sinnvolleres, als Menschen zum Autokauf zu motivieren. Autos gibt es genug in Deutschland. Was wir brauchen, ist Bildung, Bürokratieentlastung und bessere Infrastruktur. Es ist viel sinnvoller, in das zu investieren, was hinterher Ertrag bringt, als immer mehr für Konsum auszugeben, den man eigentlich gar nicht bezahlen kann. Der Konsum ist zwar der letztliche Zweck der Wirtschaft, aber die Wirtschaft kann sich umso besser entfalten, je länger man ihn hinauszögert und je mehr man ihn ganz vermeidet. So macht es der Bauer, der weniger isst, um mehr aussäen zu können. Je kleiner der Konsum, desto mehr wirtschaftlicher Output kann für Investitionen verwendet werden. Wenn wir klug investieren, zum Beispiel in Solaranlagen, Bildung, effizientere Abläufe und so weiter, haben wir infolge der Investitionen immer mehr Output und können…was tun? Wieder nur mehr konsumieren? Ja, aber billiger! Denn wir können pro Zeiteinheit und mit immer weniger Mitteleinsatz immer mehr produzieren. Wie der Bauarbeiter, der mit dem Bagger auf Dauer günstiger bauen kann als ohne.
Durch technischen Fortschritt gibt es immer mehr Möglichkeiten, die Arbeitsproduktivität durch mehr Kapital zu steigern. Außerdem nutzen sich die meisten Geräte mit der Zeit ab. Diese





























