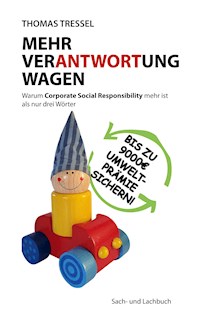
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der "Dieselskandal" hat eindrucksvoll gezeigt, wie verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln nicht geht. Die ehemals propagierte Maxime "Erhöhe den Profit, dann ergibt sich alles Gute wie von selbst" gilt nicht mehr. Unternehmen, die auch in Zukunft dauerhaft erfolgreich sein wollen, müssen sich ihrer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt bewusst sein bzw. werden. Worauf es dabei ankommt und wie dieser Paradigmenwechsel funktionieren kann, zeigt Thomas Tressel, ein profunder Kenner des politischen Geschäfts und Experte für "Corporate Social Responsibility", in diesem Buch. Auf unterhaltsame und amüsante Weise und gleichzeitig kenntnis- und faktenreich führt er die Leser durch die Abgründe des Dieselskandals und zeigt Wege und Möglichkeiten auf, wie unternehmerisches Handeln in Zukunft nicht nur ein Gewinn für die Unternehmen selbst, sondern auch für die Gesellschaft sein kann. Sein hoffnungsvoll stimmender Rat lautet: Mehr Verantwortung wagen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Früher war alles besser – sogar die Zukunft!
Kapitel 2
CSR – Typenbezeichnung oder doch ansteckende Krankheit?
Kapitel 3
Politikkontaktarbeit oder besser Public Affairs?
Kapitel 4
Kommunikation oder Greenwashing?
Kapitel 5
Shareholder vs. Stakeholder – einer gegen alle
Kapitel 6
Schon wieder ein englischer Begriff: Issues Management
Kapitel 7
Die Wertschöpfungskette – eine Schöpfungsgeschichte
Kapitel 8
Die Strategie
Kapitel 9
Die Moral der Geschichte
Anmerkungen
Über den Autor
Nicht die Taten sind es, die die Menschen bewegen, sondern die Worte über die Taten. (Epiktet)
Prolog
Die Idee zu diesem Buch hatte ich bereits in den Hochzeiten des „Dieselskandals“. Häufig fiel in der Berichterstattung damals auch der Begriff „Corporate Social Responsibility“. Was damit gemeint ist, werde ich in einem späteren Kapitel ausführlich erläutern. Dieses Buch soll aber weder eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Corporate Social Responsibility (CSR) noch eine fundamentale Aufarbeitung des Dieselskandals sein. Vielmehr versuche ich, anhand von aktuellen Beispielen die Kommunikation rund um Corporate Social Responsibility und die Beweggründe der Unternehmen für ihr Handeln zu entschlüsseln, um am Ende die Notwendigkeit einer strategischen Implementierung der unternehmerischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die über das gesetzlich geforderte Maß hinausgeht, entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzuzeigen. Langer Satz, aber der musste zu Beginn sein.
Speziell im sogenannten Dieselskandal, wie der Skandal um die Verbrauchertäuschung durch Automobilkonzerne in der Presse sehr häufig genannt wird, spielte sich vieles nur an der Oberfläche ab. Halbwahrheiten und Halbweisheiten wurden so lange in Talkshows, Tageszeitungen, Boulevardblättern mit vier oder weniger Buchstaben und an den Stammtischen der Nation1 ventiliert, bis daraus vermeintliche Tatsachen entstanden. Oftmals wurde die Kommunikation auch dahingehend gesteuert, dass am Ende nicht die Hersteller der Autos und somit die Verursacher des Skandals die Schuldigen waren, sondern „die Politiker“ und, weil es so schön zum Thema Umwelt- und Verbraucherschutz passt, die Grünen. Der Logik der Stammtische und des Boulevards folgend sollen nämlich die Grünen daran schuld sein, dass es drohende Fahrverbote in verschiedenen großen deutschen Städten gibt und dass der Diesel nicht mehr verkaufbar (oder je nach Sicht kaufbar) ist.
Wenn man aber einen Blick hinter die Nachrichten wirft und sich weiterführende Informationen in unabhängigen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Thema besorgt, kann man gerade hierbei bestimmte Muster der Kommunikation und Verhaltensweisen der PR-Abteilungen gut ablesen. Vielleicht ist es Ihnen auch so ergangen, dass Sie die plötzlich offerierte Umweltprämie der Autohändler als ein tolles, nachhaltiges Engagement der Automobilwirtschaft für die Umwelt angesehen haben. In großen Lettern stand da kurz nach Bekanntwerden der ersten Dieselmanipulationen in Zeitungsanzeigen und auf Litfaßsäulen: „Umweltprämie sichern!“ Meist versehen mit einer Aufforderung „JETZT“ zu handeln, um bis zu X Tausend Euro für den alten Diesel-Stinker zu erhalten, der wohlbemerkt vor ein paar Jahren als neueste Technologie verkauft wurde. Rein zufällig taucht in der Werbung dann auch noch die Farbe Grün auf, um auch dem letzten Zweifler zu signalisieren: Das ist alles nur für die Umwelt und nicht etwa eine Möglichkeit – steuerfinanziert – die Anzahl der Stinker in Deutschland zu verringern, den eigenen Absatz zu steigern und die Notwendigkeit von Nachbesserungen an bereits verkauften Fahrzeugen zu minimieren.
Die öffentliche Diskussion folgt klaren Regeln: Anfangs geht es um die Abgasskandale von VW und anderen deutschen Automobilherstellern, kurze Zeit später kommen noch die Kartellvorwürfe gegen die gesamte deutsche Automobilindustrie hinzu. Am Ende geht es in der Öffentlichkeit aber fast nur noch um die Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie, die nicht verloren gehen dürfen, und um den kleinen Handwerker, der mit seinem Transporter nicht mehr in die Städte reinkommt, weil die Grünen und die Deutsche Umwelthilfe es so wollen.
Keine Diskussion mehr über Konzerne, die eigentlich die Verbraucher betrogen und belogen und so diesen Skandal überhaupt erst verursacht und damit leichtfertig Arbeitsplätze und Vertrauen aufs Spiel gesetzt haben.
Clever ist es von den Automobilkonzernen allemal, die aufkommende Kritik vermeintlich aufzunehmen und durch geschicktes „Framing“2 der PR-Abteilungen den Diskurs zu verändern. Denn „Dieselskandal“ und „Schummel-Software“ hören sich in der Kommunikation doch wesentlich besser und geschmeidiger an als „VW-, BMW- oder Mercedesskandal“ oder gar „Schummel-Software zur Maximierung der Unternehmensgewinne“.
All das und meine Erfahrungen in persönlichen Gesprächen mit vielen Menschen haben mich dazu inspiriert, diese Gedanken niederzuschreiben, und zwar mit der Absicht das Phänomen Corporate Social Responsibility einfach und in einer lockeren Art und Weise einer breiteren Leserschaft zu präsentieren. Am Ende, oder im besten Fall schon während der Lektüre, sollten die Leser3 dann in der Lage sein, auch eigene Beispiele aus der Wirtschaft in Bezug auf soziale und ökologische Belange zu beleuchten und zu bewerten.
Erwarten Sie trotz einiger Anmerkungen und Verweise auf wissenschaftliche Schriften, die Sie im Endnotenapparat finden, bitte keine wissenschaftliche Abhandlung. Nichtsdestotrotz kann und will ich Ihnen den einen oder anderen Ausflug in die Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaft, ja selbst einen Rückblick in die jüngere Geschichte nicht ersparen. Und weil es chronologisch passt, fangen wir auch gleich in der Vergangenheit an. Denn bekanntlich war früher ja eh alles besser.
Kapitel 1
Früher war alles besser – sogar die Zukunft!
Früher war alles besser: Die Müslifresser und Langhaarigen sind in ihren buntbemalten VW-Bussen und selbstgestrickten Pullis zu Protestcamps gefahren und spätestens die „ATOMKRAFT? NEIN DANKE“- und die überdimensionalen „Peace“-Aufkleber verrieten die politische Gesinnung. Persil wusch unsere Wäsche weißer und wir besprühten unsere Haare mit „Drei Wetter Taft“ von Schwarzkopf, das bei jedem Wetter hielt, ob in Hamburg, München oder Mailand.4 Die Fronten waren klar absteckt: ein paar Ökospinner gegen den Rest der Republik. Es war damals einfach egal, wie viel Dreck aus dem Auspuff und den Industrieschornsteinen kam, wie viel petrochemische Tenside im Waschmittel waren, oder welches Gas in den Haarspraybehältern für das Ozonloch verantwortlich war – mal ganz abgesehen von den ökologischen Auswirkungen eines Privatfluges für eine toupierte Frau von Hamburg über München nach Mailand. Karl der Käfer wurde schneller nicht mehr gefragt, als es dem Liedermacher lieb war, und unser Freund der Baum, der eh schon tot war, geriet durch die Dauerberieselung mit seichter Unterhaltungsmusik langsam in Vergessenheit, denn plötzlich wurde nur noch der Nippel durch die Lasche gezogen und Matthias Reim verdammte uns zum Lieben – oder auch nicht. Der kollektive deutsche Einheitstaumel wurde durch die Scorpions und das Pfeifen des „Wind of Change“ unterstützt, die sterbenden Wälder von Helmut Kohls CDU mit der Aussicht auf blühende Landschaften überdeckt.
2006 folgte dann das Sommermärchen und der kollektive Jubel entflammte wieder. Und rückblickend muss man zugeben, dass alles super organisiert, aber, wie sich später herausstellte, nicht alles legal abgelaufen war. Parallelen zur deutschen Automobilindustrie sind nur rein zufällig. Aber nichtsdestotrotz schien da die Welt noch in Ordnung und sogar die Rente sicher!
Spätsommer 2017. Ein paar Wochen vor der Bundestagswahl in einem kleinen Bio-Laden, einem integrativen Betrieb mit Bioland-Zertifikat. Die Welt sieht mittlerweile hinsichtlich der Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Umwelt (und ganz nebenbei auch gegenüber der Rente) etwas anders aus. In den Bioläden kaufen schon längst nicht mehr nur die überzeugten Ökos mit Rastazöpfen und selbstgestrickten Pullis ein, sondern auch die Typen, die als LOHAS vor allem den Marketingexperten wohlbekannt sind.
LOHAS, die Abkürzung steht für „Lifestyle of Health and Sustainability“, das sind für alle Nicht-Marketingmanager übersetzt: „Personen, die einen Lebensstil pflegen, der von Gesundheitsbewusstsein und -vorsorge, sowie der Ausrichtung nach Prinzipien der Nachhaltigkeit geprägt ist.“5 Soweit auf jeden Fall die Erklärung auf Wikipedia.
Das stinkende Auto wurde zwischenzeitlich durch den SUV (Sport Utility Vehicle) ersetzt, der es dem Großstadtbürger durchaus ermöglichen würde, als Traktorersatz die Ernte auf dem Feld des Biohofes eigenständig einzubringen. Das ist aber nicht möglich, weil schon der 12-Stunden-Arbeitsalltag die zeitlichen Ressourcen auffrisst und somit die Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht geraten würde. Also dann lieber vor dem Workout im hippen Fitnessstudio noch schnell in den Bioladen. Denn ein paar gesunde Bioprodukte passen ins Lebensgefühl und beruhigen das gesunde und nachhaltige Gewissen. Echte LOHAS eben, deren nachhaltiger Lebensstil sich nicht durch Verzicht definiert, sondern durch guten und bewussten Konsum.
Aber zurück zum Wahlkampf 2017. Ein großes Thema aller Parteien: Mobilität. Aber nicht mehr die Mobilität der 70er und 80er, die mit dem stinkenden Mercedes /8 oder dem klapperigen VW Käfer. Nein! Heute geht es um nichts weniger als Verbrennungsmotoren versus alternative Antriebe. Es ist wohl zwei oder drei Wochen vor der Wahl. Eigentlich denke ich mir nichts Großartiges dabei, als ich beim Smalltalk über die aktuelle politische Großwetterlage an der Kasse in meinem Bioladen etwas Negatives über den Verbrennungsmotor sage und im Gespräch auf alternative Antriebe wie Strom oder Wasserstoff hinweise. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es eigentlich auch grundsätzlich vermieden, beim Einkauf an der Kasse stehend politische Diskussionen zu führen. Aber im Bioladen – und der kühnen Annahme folgend, dass ich mich unter Gleichgesinnten befinden und Zuspruch erfahren würde – behauptete ich jetzt, dass man eigentlich in diesem Punkt nur die Grünen wählen könne. Ich hatte zwar keinen frenetischen Applaus erwartet, aber mir eine gewisse Zustimmung schon erhofft. Ein wohlmeinendes Nicken hätte mir auch schon ausgereicht.
Aber weit gefehlt. Die Reaktionen reichten von „Das, was die Grünen wollen, ist doch auch nicht gut, die wollen uns das Dieselfahren verbieten …“, über „Der Verbrennungsmotor ist doch so effizient …, …und dann wollen die uns den Verbrennungsmotor auch noch irgendwann ganz verbieten…“ bis hin zu „Die mit ihren Fahrverboten, wie soll denn der klei





























