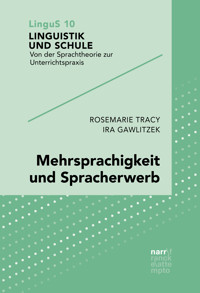
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Linguistik und Schule
- Sprache: Deutsch
Der Spracherwerb ist eine unserer komplexesten Leistungen und nicht auf nur eine Sprache beschränkt. Die Koexistenz unterschiedlicher Sprachen in Individuum und Gesellschaft ist weltweit normal. Aber diese Realität trifft in Bildungseinrichtungen, Öffentlichkeit und bei Mehrsprachigen selbst oft auf Skepsis und Verunsicherung. Auf Basis der aktuellen Forschung vermittelt dieses Lehrbuch Einblicke in sprachliche Fähigkeiten und in die Dynamik von Erwerbsprozessen bei Kindern und Erwachsenen. Verdeutlicht wird, wie Lehr- und pädagogische Fachkräfte auf der Grundlage sprachwissenschaftlicher Expertise erkennen können, welche Ressourcen sich Kinder und Erwachsene angeeignet haben und wie kreativ verfügbare Sprachen interagieren und kooperieren. Der Band vermittelt Grundlagenwissen, setzt sich mit gängigen Vorurteilen auseinander und plädiert durch konsequente Kompetenzorientierung für die Anerkennung und Förderung sprachlicher Fähigkeiten bei Menschen jeden Alters. Er kann als Lektüre im schulischen Unterricht und in Seminaren unterschiedlicher Studiengänge verwendet werden. Aufgaben (samt Lösungsvorschlägen) und Beispiele bieten Diskussionsstoff und Anregungen für kleinere Forschungsaufträge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosemarie Tracy / Ira Gawlitzek
Mehrsprachigkeit und Spracherwerb
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2566-8293
ISBN 978-3-8233-8276-8 (Print)
ISBN 978-3-8233-0507-1 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Schulen sind Orte, an denen Wissen und Können erkannt, gefördert und herausgefordert sowie bewusstes Lernen gelehrt und gelernt werden. Ohne Sprache – ob gesprochen, gebärdet, geschrieben – wäre dies unmöglich. Diese Feststellungen sind an sich trivial. Aber sind Lehrkräfte, die dies leisten sollen, hinreichend mit dem Wissen und Können ausgestattet, um die mit ihrem Bildungsauftrag verbundenen Herausforderungen zu meistern? Fallen ihnen an Äußerungen ihrer Schülerinnen und Schüler nicht nur die Abweichungen von zielsprachlichen Strukturen auf – typischerweise als „Fehler“ betrachtet –, sondern verfügen sie auch über den diagnostischen Blick, um bereits Erreichtes zu erkennen? Verstehen sie, warum einfach klingende Sätze wie Der Hund wird von der Katze gejagt oder Den Hund jagt die Katze von Lernerinnen und Lernern zeitweise anders interpretiert werden als von uns? Im Gegensatz zu unseren einleitenden Behauptungen ist keine dieser Fragen trivial. Um sie guten Gewissens mit einem selbstbewussten Ja zu beantworten, braucht man vor allem eines: Expertenwissen.
Anliegen unseres Buchs ist es, angehenden oder bereits in der Praxis tätigen Lehrkräften grundlegendes Wissen über Spracherwerb und Mehrsprachigkeit zu vermitteln. Wir möchten ihren Blick für die Systematik von Lernersprachen schärfen und ihnen Perspektiven auf die Fähigkeiten, aber auch auf den Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen beim Weg durch unsere Bildungseinrichtungen eröffnen, auch wenn es uns in diesem Buch hauptsächlich um den ungesteuerten Spracherwerb geht, also um den Spracherwerb außerhalb des Klassenzimmers. Aber da wir ja praktischerweise unsere Sprachen immer im Gepäck haben, werden sich manche der später angesprochenen Phänomene auch innerhalb von Klassenzimmern und Seminaren wiederfinden lassen bzw. viele Themen eignen sich bestens als Diskussionsstoff mit Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Dabei werden wir Leserinnen und Leser hin und wieder direkt ansprechen und sie in einen fiktiven Dialog verwickeln, wie gleich im nächsten Absatz.
Dank Ihrer eigenen sprachlichen Ressourcen verfügen Sie alle, die unseren Text lesen können, bereits über wichtige Voraussetzungen für die Unterstützung sprachlicher Lernprozesse anderer. Es bedarf allerdings noch weiterer Schritte. Der wohl wichtigste besteht darin, sich mit Sprache und den Formen, in denen sie uns begegnet, analytisch auseinanderzusetzen und sich die dafür benötigten konzeptuellen und terminologischen Grundlagen anzueignen. Um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Wahrnehmung entsprechend zu schulen, werden wir Ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf konkrete und oft sehr kleinteilige Lernerdaten lenken. Vielleicht ist es ja ein kleiner Trost, dass wir anderen Berufssparten für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche vergleichbares Expertenwissen abverlangen würden. Einiges an der Metasprache – also einer Fachsprache, um über Sprache zu reden –, die Sie im Folgenden erwartet, kennen Sie bereits aus Ihrer Schulzeit oder Ihrem Studium. Daher bedarf es vielleicht nur eines kleinen Anstoßes, um Sie daran zu erinnern. Als Optimistinnen nehmen wir auch an, dass Sie sich bei der Lektüre aufgrund des Kontextes und gezielter Steuerung und Wiederholung unsererseits bisher unbekannte Terminologie beiläufig aneignen können. Sie vollziehen damit hinsichtlich der für das Sprechen über Sprache benötigten Fachsprache auch eine Art von Spracherwerb.
Ein weiterer Schritt, den Sie hoffentlich nach der Lektüre und idealerweise mit Schwung inmitten eines Kollegiums Gleichgesinnter angehen können, besteht in der Erprobung und Umsetzung von Ideen in Ihrer pädagogischen Praxis. Ob dies gelingt, ist auch von den Bedingungen abhängig, die Sie in Ihrem beruflichen Umfeld vorfinden. Die Förderung sprachlicher Kompetenzen sollte sich auf die Schultern vieler Expertinnen und Experten innerhalb eines Kollegiums verteilen und nicht in die Zuständigkeit einzelner fallen. Um gut informiert über sprachliche Hürden, Förderbedarf und zielführende Maßnahmen entscheiden zu können, ist professionelles Wissen unverzichtbar, also der oben genannte erste Schritt, den wir hier gemeinsam gehen. Selbstverständlich hoffen wir auch, Sie mit unserer Begeisterung für die Architektur natürlicher Sprachen, die sich bereits in den allerersten Wortkombinationen von Kleinkindern zeigt, anstecken zu können.
Unsere positive Kernbotschaft am Ende des Buchs lässt sich folgendermaßen vorwegnehmen: Die allen Menschen in die Wiege gelegte Sprachbegabung und Kommunikationsfähigkeit sind eine gute Basis, um die Vermittlung und Förderung von Sprachen beherzt anzugehen. Das natürliche Interesse von Menschen jeden Alters an Sprache und nicht zuletzt die Emotionen, die durch die Art und Weise, wie man mit uns und über uns redet, in uns ausgelöst werden, bieten außerdem perfekte Anknüpfungspunkte, um sich im Unterricht oder im Studium mit dem Thema Sprache und mit der eigenen kommunikativen Praxis zu beschäftigen. Über unsere primären Zielgruppen hinaus haben wir deshalb als potenzielle Leserinnen und Leser auch Schülerinnen und Schüler sowie Studierende im Blick. Im Anschluss an jedes Kapitel finden Sie kleinere Aufgaben, Projektideen und Anregungen zur Diskussion im Klassenzimmer sowie vertiefende Literaturvorschläge. Lösungsskizzen für die Aufgaben haben wir am Buchende aufgeführt.
Von einem Text, der sprachliche Formen und das, was sie für uns im kommunikativen Alltag leisten, in den Mittelpunkt rückt, darf man einen geschlechtssensiblen Umgang mit Personenbezeichnungen erwarten, zumal die Steuerung der Aufmerksamkeit beim Hören und Lesen durch die Wahl von Genusformen durch einschlägige Forschung gut belegt ist (Stahlberg & Szesny 2001). Wir haben uns allerdings in Abweichung von gängigen Praktiken (z. B. konsequente Nennung beider Geschlechter, Binnen-I, Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt) für eine spielerische Option entschieden und wechseln im weiteren Text das Genus kapitelweise. In den ungeraden Kapiteln verwenden wir das Femininum, in den geraden das Maskulinum. Das jeweils andere Geschlecht und weitere Identifikationsoptionen sind in allen Fällen ausdrücklich, wenngleich formal unausgedrückt, mitgemeint. Weiterhin verwenden wir auch hin und wieder etablierte Generalisierungen wie „Studierende“, und wenn das Geschlecht bekannt ist, referieren wir entsprechend.
Wir danken an dieser Stelle der Herausgeberin und dem Herausgeber der LinguS-Serie für ihre Geduld und hilfreiche Vorschläge sowie Stella Baumann, Frauke Fried, Mareike Keller, Johanna Tausch und Wintai Tsehaye für die konstruktive Rückmeldung zu früheren Textentwürfen. Beim Bundesraat för Nedderdüütsch, Institut für niederdeutsche Sprache (www.ins-bremen.de), bedanken wir uns für die Genehmigung, die Titelseite einer Broschüre in Kapitel 2 abzudrucken.1
1 Einstimmung und Überblick
1.1Zum Einstieg ein Selbstversuch
In diesem Band geht es um unterschiedliche Facetten des Spracherwerbs und darum, was passiert, wenn wir im Laufe unseres Lebens mehrsprachig werden oder bereits von Anfang an mit mehr als einer Sprache aufwachsen. Dabei verwenden wir die Bezeichnungen mehrsprachig und bilingual synonym, das heißt, wieviele sprachliche Systeme wir uns aneignen, ist an dieser Stelle nicht weiter relevant. Betrachten wir als Ausgangspunkt die Beispiele in (1), produziert von Personen mit unterschiedlicher Erwerbsbiographie.1
(1)
a
isch ischə aufräumen
b
ich räum auf
c
wo is das Junge is?
d
Mummy picking flowers inə garden
e
you’re gonna be sorry if you make them shorter because die fallen so schön hier
f
mit Hauptsatz ich habe keine Probleme. Nur mit Nebensatz
g
dann da kommt Rauch raus
h
Die hatten beiden rausgekommen zu sehen weder des auto hatt ihrgenwehrmand wegetahn
Wenn Sie raten sollten, ob diese Äußerungen von ein- oder mehrsprachigen Personen produziert wurden, würde Ihnen, von (1e) und vielleicht (1f) und (1h) abgesehen, die Antwort vermutlich schwerfallen. Dafür gibt es einen guten Grund: Es ist nicht einfach! Einfacher ist es, einen ersten Eindruck dahingehend zu gewinnen, was diese Sprecherinnen bislang gemeistert haben. Dies können Sie aber nur, wenn Sie wissen, auf welche Indizien Sie bei Äußerungen achten sollten.
Betrachten wir einmal die einzelnen Sätze in (1) genauer: Welche Wortarten treten auf? Wahrscheinlich erinnern Sie sich an die Fachtermini für Wortklassen wie Verb, Nomen, Artikel, Präposition, Konjunktion, Partikel, Adjektiv, Adverb? Spätestens nach dem 3. Kapitel werden sie Ihnen wieder geläufig sein. Was fällt Ihnen bezüglich der Wortstellung auf? Erkennen Sie Wortgruppen (sogenannte Phrasen), und anhand welcher Kriterien könnten Sie die Subjekte eines Satzes identifizieren? Wären Sie in der Lage, die morphologische, also wortinterne, Struktur der einzelnen Wörter zu beschreiben? Und generell: Welche Merkmale dieser Äußerungen gehorchen Ihrer Ansicht nach einer Grammatik des Deutschen? Wir bezeichnen solche folgsamen Merkmale im Folgenden auch als „kanonisch“ oder „wohlgeformt“.
Die Beispiele in (1a) und (1b) stammen von einem Mädchen mit Russisch als Erstsprache (abgekürzt L1). Deutsch ist ihre frühe Zweitsprache (fL2). Zum Zeitpunkt der Tonaufnahme, der wir beide Äußerungen entnommen haben, ist sie drei Jahre und einen Monat alt (abgekürzt 3;1) und erst seit ihrem Eintritt in eine Kita wenige Wochen zuvor in intensivem Kontakt mit dem Deutschen. Wir sehen, dass sie in (1a) ein rudimentäres Satzmuster mit einem Infinitiv, aufräumen, produziert, gleichzeitig in (1b) aber eine fortschrittlichere Struktur, in der die Partikel auf nun rechts vom Verb erscheint. Das Verb stimmt sogar schon mit dem Subjekt ich in Person und Numerus (1. Person Singular) überein. Wir sagen dazu: Es ist finit. Nicht lange davor hatte das Kind noch auschließlich Fragmente wie (1a) produziert. Aber zum Zeitpunkt des alternierenden Auftretens von (1a) und (1b) erkennen wir: Der Erwerb geht voran, die Richtung stimmt! Halten wir an dieser Stelle schon einmal fest, dass einfache und fortschrittlichere Strukturvarianten im Repertoire einer Person koexistieren können. Außerdem: Vergessen wir nicht, dass wir alle unser Leben lang nicht finite Satzfragmente wie in (1a) produzieren, so beispielsweise in dem fiktiven Dialog in (2).
(2)
A: Du könntest heute mal wieder aufräumen.
B: Ich aufräumen? Du bist doch an der Reihe!
Beispiel (1c), mit der Verdoppelung der Kopula is(t), wurde von einem monolingualen Mädchen im Alter 2;3 produziert. Deutsch ist also ihre L1. Allein diese eine Äußerung legt nahe, dass die Sprecherin ein zentrales organisatorisches Prinzip der Architektur deutscher Sätze erkannt hat: die Satzklammer, auf die wir in Kapitel 3 näher eingehen. Sie weiß – natürlich nicht bewusst! –, dass ein finites Verb in deutschen Sätzen in zwei Positionen im Satz auftreten kann, allerdings nicht gleichzeitig, wie in diesem Fall. Im Unterschied zu der Zweijährigen werden Sie nach der weiteren Lektüre explizit wissen, warum diese beiden Verbpositionen im Deutschen wichtig sind. Das Mädchen weiß es implizit schon mit 2;3. Sofern Sie mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen sind, wussten Sie dies im Alter von zwei bis drei Jahren ebenfalls implizit.
Die englische Äußerung (1d) stammt von einem Mädchen (Alter 2;4), das von Geburt an Deutsch und Englisch als doppelte Erstsprachen (notiert als 2L1) erwirbt. Dass sie zweisprachig ist, kommt hier allerdings nicht zur Geltung. Ihr Englisch entspricht dem Stand monolingualer Kinder mit L1-Englisch. Was Sie jetzt noch nicht ahnen können, weil wir darauf erst in Kapitel 4 eingehen: Die deutsche Grammatik des Mädchens ist in diesem Alter schon sehr viel weiter fortgeschritten als ihre englische Grammatik. In deutschen Sätzen produziert sie mühelos, was im Englischen noch fehlt, z. B. finite Verben aller Art, inklusive Hilfsverben, die wir in (1d) noch vermissen. Kanonisches Englisch wäre ja Mummy is picking flowers. Halten wir auch hier schon einmal fest, dass sich von Geburt an erworbene Erstsprachen durchaus nicht immer gleich schnell entwickeln, und zwar auch dann nicht, wenn hinreichend Input in beiden Sprachen vorhanden ist. Die Frage, was es mit asynchronen Entwicklungen dieser Art auf sich hat, greifen wir in Kapitel 4 wieder auf.
Beleg (1e), eine sprachlich „gemischte“ Äußerung mit englischen und deutschen Anteilen, kann man zweifelsfrei einer mehrsprachigen Person zuordnen. Wir verdanken sie einer achtzigjährigen deutschen Emigrantin in den USA, die erst im Alter von 14 Jahren nach ihrer Einwanderung mit Englisch in Kontakt kam. Thema in (1e) ist die Frisur ihrer Gesprächspartnerin. Falls Sie sich jetzt fragen, ob diese Deutschamerikanerin nach 65 Jahren in den USA überhaupt noch ausschließlich deutsche Passagen produzieren kann: Ja, kann sie!
Beispiel (1f) wurde von einer fünfzigjährigen Lettin produziert, die seit fünf Jahren in Deutschland lebt und seit etwa einem Jahr Deutschkurse besucht. Ihr intensiver Kontakt mit Deutsch begann erst mit der Ankunft in Deutschland. Entgegen ihrer Meinung, sie hätte „keine Probleme“ mit deutschen Hauptsätzen, ist die Verbstellung in (1f) nicht kanonisch. Aber ist das wirklich ein Problem? Keinesfalls für die Kommunikation! Jedenfalls stellt sich an dieser Stelle vielleicht schon der Verdacht ein, dass die Platzierung deutscher Verben eine Erwerbshürde darstellt – vielleicht sogar bei Erwachsenen noch mehr als bei Kindern?
Die Äußerung in (1g) stammt von einem zweijährigen monolingualen Jungen mit Deutsch als alleiniger L1. Auch hier weicht die Verbstellung – wie in (1f) – von dem ab, was wir von einem kanonischen Hauptsatz im Standarddeutschen erwarten.
Bei (1h) handelt es sich um den getippten Satz einer Siebzehnjährigen, die in den USA als Kind eingewanderter Eltern mit Deutsch als Erstsprache – als sogenannter Herkunftssprache, dazu mehr in Kapitel 4 – aufgewachsen ist. Ihre Aufgabe bestand darin, nach Betrachten eines kurzen Videofilms, in dem ein fiktiver Unfall zu sehen war, einen Zeugenbericht zu verfassen. Spontan würden Sie sicher im ersten Satz ein anderes Hilfsverb (waren) vorziehen und vor den Infinitiv ein um einfügen. Bei ihrgenwehrmand denken Sie ganz richtig an eine Verschmelzung von irgendwer und irgendjemand. Insgesamt vermuten Sie, dass sich die Schreiberin mit der deutschen Orthographie schwertut. Das stimmt, denn in ihrer amerikanischen Schule gab es keinen Deutschunterricht.
Ahnen Sie, was sich hinter dem weder verbirgt? Die junge Frau verwendet hier das englische Wort whether anstatt des deutschen ob. In ihren deutschen mündlichen Unfallschilderungen taucht das Wort in eingedeutschter Aussprache auf: [vedə]. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung ist Englisch die von der Verfasserin des Unfallberichts meistens und souveräner gesprochene und geschriebene Sprache.
Vermutlich verstehen Sie bereits jetzt schon, warum es keineswegs leicht ist, Erwerbstypen anhand dessen, was gesprochen oder geschrieben wird, zu unterscheiden. Die exakte Zuordnung zu bestimmten Erwerbsszenarien (Erstspracherwerb einer Sprache, doppelter Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb in unterschiedlichem Alter etc.) ist daher aus pädagogischer Sicht weniger wichtig als die Entwicklung eines Blicks für Strukturmerkmale, die uns verraten, wie weit Lernende auf ihrem Weg zur Zielsprache bereits gekommen sind. Natürlich würden Sie in der Realität – im Unterschied zu unserem kleinen Selbstversuch hier – nicht nur einzelne Äußerungen in den Blick nehmen, sondern Sie könnten sich auf vielfache schriftliche und mündliche Äußerungen von Lernerinnen stützen.
Jedenfalls werden Sie im Zuge Ihrer weiteren Lektüre erkennen, dass die Personen, die wir in (1) zitiert haben, Erwachsene und Kinder, ein- oder mehrsprachig, mit sehr ähnliche Herausforderungen zu kämpfen haben. Manche Lernerinnen bewältigen sie auf erstaunlich ähnliche Weise; manchmal sehen wir Unterschiede auf dem Weg und im Resultat, weil sich die Erwerbsbedingungen unterscheiden (z. B. Alter, kognitive Ressourcen und Verarbeitungskapazität, das qualitative und quantitative Angebot einer einsprachigen oder mehrsprachigen Umwelt, bereits vorhandene ähnliche oder unterschiedliche Sprachen, Minoritäts- oder Majoritätsstatus). Wichtig ist: Die grammatischen Systeme, die sich dabei entwickeln, sind nicht chaotisch, und die Art und Weise, wie Lernerinnen mit ihren grammatischen Ressourcen umgehen, zeugt von innovativen Problemlösestrategien.
1.2Sprache: komplex und immer dabei
Steven Pinker, dem wir mehrere spannende Bücher über unsere Sprachfähigkeit verdanken, schrieb: „We are verbivores, a species that lives on words.“ (2007, S. 24). Dabei mutet er seiner Leserinnenschaft mit verbivore ein nicht existentes Wort zu, offensichtlich im Vertrauen darauf, dass man sich die Bedeutung erschließen kann.1 Um verbivore (‚Wortfresser‘) und den sprachlichen Witz dahinter zu verstehen, muss man englische Wörter wie herbivore (‚Pflanzenfresser‘), piscivore (‚Fischfresser‘) oder carnivore (‚Fleischfresser‘) kennen. Alle sind ursprünglich dem Lateinischen entlehnt und, ebenso wie species im gleichen Zitat, Beispiele für bildungssprachliche Register. Natürlich drückt verbivore wortwörtlich genommen etwas faktisch Unmögliches aus, im Unterschied zu den drei anderen Bezeichnungen. Dennoch verstehen wir die intendierte Bedeutung problemlos. Pinkers eigentliche Botschaft lässt sich etwa folgendermaßen paraphrasieren: Sprachen spielen eine immens wichtige Rolle in unserem Leben; unser Wortschatz ist rasant und grenzenlos erweiterbar. Er sagt dies allerdings auf eine einprägsamere und viel amüsantere Weise als unsere Paraphrase und appelliert zugleich durch die Art der Formulierung an unseren Bildungshorizont und an unseren Spaß am Spiel mit sprachlichen Formen und Bedeutungen.
Wohl keine unserer kognitiven Leistungen kann mit unserer Fähigkeit mithalten, jede einzelne von existierenden 6.000 bis 7.000 Sprachen zu erwerben. Dabei handelt es sich gleich in mehrfacher Hinsicht um eine höchst komplexe Leistung, sowohl bezüglich des sprachlichen Kenntnissystems (der sogenannten Kompetenz) als auch seiner Verwendung (Performanz) und den daran beteiligten, in Echtzeit ablaufenden Verarbeitungsschritten. Mit Kompetenz meinen wir im Gedächtnis abgespeicherte Wissensbestände: konzeptuelle Einheiten und Bauanleitungen (Konstruktionsregeln) für Silben, Wörter, Phrasen und Sätze, die wir im Zuge des Spracherwerbs entdecken und verinnerlichen (internalisieren), darunter auch das überwiegend implizite Wissen, das wir als Grammatik bezeichnen.
Komplex ist das Ganze, weil mehrere Wissenstypen daran beteiligt sind. Man spricht hier auch von unterschiedlichen koexistierenden Ebenen:
Phonologie (lautliche, melodische und rhythmische Merkmale)
Morphologie (wortinterne Struktur)
Semantik (Bedeutung von Wörtern und Sätzen)
Syntax (Satzbau, Wortstellung)
Pragmatik (Wissen um kontextangemessene Verwendung, Sprecherbedeutung)
Eine zentrale Aufgabe beim Spracherwerb besteht folglich darin, in detektivischer Kleinarbeit die Bausteine aller Ebenen und die Gesetzmäßigkeiten ihrer Kombinatorik zu entdecken. Außerdem müssen vielfältige Schnittstellenprobleme gelöst werden, d. h. Lernende müssen herausfinden, wie die verschiedenen Ebenen zueinander passen. Um ein Beispiel zu nennen: Als Sprecherinnen des Deutschen wissen wir, dass bestimmte und unbestimmte Artikel vor Nomen erscheinen, nicht danach. In dem Artikel den in dem Satz Hast du den Kuchen gegessen? steckt eine semantisch relevante Information über Definitheit (vgl. den Unterschied zu Hast du einenKuchengegessen?), außerdem Hinweise auf das grammatische Genus (Maskulin), Numerus (Singular) und Kasus (Akkusativ) des direkten Objekts. Im Fall von Hast du den Kuchen gegessen? weist die Wahl des bestimmten Artikels auf einen spezifischen Kuchen hin. Wer hier den bestimmten Artikel verwendet, nimmt an, dass die angesprochene Person weiß, um welchen Kuchen es sich handelt. Obwohl als Frage formuliert, liegt hinsichtlich der pragmatischen Funktion einer solchen Äußerung (der eigentlichen Sprecherbedeutung) eine Interpretation als Vorwurf oder Ausdruck von Enttäuschung nahe, weil anscheinend nichts vom Kuchen übrig ist.
Die Komplexität sprachlicher Performanz, d. h. der an der Sprachverwendung in Echtzeit beteiligten Prozesse, kann man sich leicht vor Augen führen. Beim Sprechen und Verstehen in gut beherrschten Sprachen greifen wir hochautomatisiert und extrem schnell auf unseren Wissensspeicher zu. In Momenten, in denen wir nicht besonders fit sind (müde, dehydriert, durch Medikamente oder Alkohol außer Kraft gesetzt u. a. m.), verläuft dieser Prozess nicht immer optimal, aber unter normalen Bedingungen vollbringen wir tatsächlich Erstaunliches. Dass wir uns dabei hin und wieder versprechen oder verhören, ist Teil unseres normalen kommunikativen Alltags, passiert aber eigentlich in Anbetracht der Komplexität sprachlicher Systeme und ihrer Verwendungsgeschwindigkeit geradezu überraschend selten (Leuninger 1993).
Beim normalen Sprechen produzieren Erwachsene zwei bis drei Wörter pro Sekunde, die wir thematisch passend unter 20.000 bis 50.000 Wortkandidaten unseres aktiven Wortschatzes auswählen.2 Nach einer anfänglichen Idee, worüber wir reden wollen, übernimmt unsere mentale Grammatik die Regie und baut auf allen Ebenen nach und nach Strukturen zusammen, die zu unseren intendierten Sprechakten (Bitten, Befehlen, Fragen etc.) passen. Das Ergebnis unserer Planung kulminiert schließlich in Instruktionen an unseren Artikulationsapparat. Dieser sorgt dann dafür, dass wir Wörter nacheinander, rhythmisch angemessen, mit unserer Atmung koordiniert und einigermaßen verständlich produzieren. Dabei werden aufeinander folgende Wörter beim informellen Sprechen auch kontrahiert oder – technischer ausgedrückt – klitisiert. So finden wir klitisierte Pronomina, z. B. [çabn] in ich habe ihn gesehen im Deutschen oder je l’ai vu im Französischen, und klitisierte Hilfsverben im Englischen, vgl. I’ve seen him.
Obwohl wir diese Prozesse nicht bewusst steuern, unterliegen sie unserer Kontrolle – man spricht hier auch vom Monitoring. Da wir uns selbst sprechen hören, können wir eigene sprachliche Fehlleistungen unmittelbar reparieren, häufig von Gesprächspartnerinnen unbemerkt. Es gelingt uns sogar oft, Versprecher (z. B. rotieren statt votieren, rechts statt links) rechtzeitig zu stoppen, bevor wir sie artikulieren. Noch während wir anderen zuhören und das von ihnen Geäußerte nach und nach interpretieren, planen wir unseren nächsten Einsatz und warten vielleicht schon ungeduldig auf die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Dabei scheuen wir nicht einmal davor zurück, jemandem ins Wort zu fallen oder – wenn uns an einer Freundschaft liegt, hoffentlich nicht zu oft! – die Sätze anderer zu beenden. In unsere Äußerungsplanung gehen viele unterschiedliche kontextuelle Faktoren ein, z. B. unsere Einschätzung des Alters, Status, des Weltwissens und der sprachlichen Kompetenzen unserer Gesprächspartnerinnen sowie unser Wissen um das einer bestimmten Situation angemessene Register (z. B. eher formell oder informell). Außerdem bemühen wir uns darum – naja, meistens! –, unsere Gesprächspartnerinnen nicht durch unhöfliche Formulierungen zu kränken.
Unser sprachliches Wissen interagiert mit unseren sonstigen kognitiven Fähigkeiten. Mit Hilfe des nicht verbalen Kontextes und unseres Weltwissens können wir Äußerungen anderer selbst dann erschließen, wenn sich unser Gegenüber missverständlich ausdrückt. Dabei hilft uns auch die Annahme, dass sich Gesprächspartnerinnen normalerweise kooperativ verhalten und uns nicht in die Irre führen wollen.3 Man vergleiche dazu folgendes Szenario.
(3)
Eine Kundin betritt ein Buchgeschäft.
Buchhändlerin:
Kann ich helfen?
Kundin:
Ich suche den Jungen Werther.
Buchhändlerin:
Goethe finden Sie im Untergeschoss.
Aufgrund ihres Professionswissens kann die Buchhändlerin problemlos ausschließen, dass die Kundin eine bestimmte Person sucht: einen jungen Mann namens Werther. Als Kundinnen würden wir die Reaktion der Verkäuferin auch nicht als Hinweis dahingehend interpretieren, dass Goethe zwecks Signierung seines Werks oder anlässlich einer Lesung wiederauferstanden und im Untergeschoss des Buchgeschäfts zu finden ist. Vielmehr würden wir davon ausgehen, dass die Reaktion der Buchhändlerin einen relevanten Bezug zu unserem Anliegen aufweist, und uns ins Untergeschoss begeben.
Halten wir also fest, dass Menschen über ein Arsenal effizienter verbaler und natürlich auch gestischer und mimischer Interaktionsstrategien verfügen. Dies gilt auch für asymmetrische Situationen, d. h. wenn wir oder unsere Gesprächspartnerinnen noch mitten im Spracherwerbsprozess stecken und auf den guten Willen anderer angewiesen sind. Wir kommunizieren erfolgreich, obwohl wir uns in Unterhaltungen oft selbst unterbrechen, z. B. weil uns beim Reden eine bessere Formulierung einfällt, weil wir nach Wörtern suchen oder, wie oben erwähnt, eigene Versprecher reparieren. Trotz solcher Mängel – ja, man möchte sagen: gerade deswegen! – zeigt unser sprachliches Verhalten, wie virtuos und höchst flexibel unser Sprachverarbeitungssystem mit unseren Ressourcen unter Echtzeitbedingungen umgeht. Mit anderen Worten: Unsere Performanz erweist sich als höchst kompetent,4 und zwar sogar dann, wenn wir uns über das Diktat unserer Grammatiken hinwegsetzen und erfinderisch über Etabliertes hinausgehen – wie im Fall von verbivore. Im Bemühen um Kommunikation entstehen Äußerungen, in denen die Grenzen einzelsprachlicher Grammatiken – wenn auch nicht die Grenzen natürlicher menschlicher Sprachen – mühelos überschritten werden. Dies werden wir in späteren Kapiteln sowohl im Zusammenhang mit Erwerbsstrategien als auch beim Code-Mixing (→ 6) noch deutlicher sehen können.
1.3Sprachliches Wissen: nicht beobachtbar und dem Bewusstsein weitgehend verschlossen
Jenseits wissenschaftlicher Streitigkeiten darüber, wie man sich unser sprachliches Wissenssystem vorstellen sollte und wie es in neuronale Muster und Aktivitäten unseres Gehirns übersetzt werden kann, ist die Unterscheidung von Kenntnissen einerseits und beobachtbarem Verhalten andererseits sinnvoll. Ein Kognitionspsychologe hat dies einmal sehr prägnant formuliert: ‟… underlying all cognitive activity is a more perfect system than that displayed by the record of behavior itself.“ (Pylyshyn 1973, S. 31). In dem Zitat ist von einem zugrundeliegenden System die Rede. Für die sprachwissenschaftliche Forschung besteht ein erhebliches Problem darin, dass sich dieses System nicht direkt beobachten und messen lässt. Wir können immer nur aufgrund von Verhaltensindikatoren, sei es durch Sprechen, Schreiben oder Verstehensreaktionen (z. B. Reaktionsgeschwindigkeit, elektrische Signale des Gehirns, Bildbenennung, Blickbewegung, Wiederholen und Beurteilen von Sätzen, Nachspielen etc.) auf vorhandenes Wissen schließen. Hinzu kommt, wie wir schon betont haben, dass wir in unserem sprachlichen Verhalten problemlos die Grenzen unserer einzelsprachlichen Grammatiken überschreiten können. Das heißt im Übrigen auch: Wir reproduzieren nicht einfach nur, was schon in unserem verbalen Gedächtnis gespeichert ist. Wie käme sonst je etwas Neues zustande? Wie könnten sich Sprachen wandeln, wenn wir immer nur genau das sehen und hören, was uns ein vorhandenes und damit konservatives System diktiert?
Unser Kenntnissystem ist, wie bereits betont, weitgehend implizit, d. h. unserem eigenen Bewusstsein nicht zugänglich, im Unterschied zu explizit verfügbarem Wissen, zu dem wir uns mehr oder weniger stichhaltig äußern können, z. B. wann und warum wir im Deutschen jemanden duzen oder siezen. Leider haben wir keine Erinnerung daran, wie wir unseren eigenen Spracherwerbsprozess nach und nach gemeistert haben, auch wenn unsere Eltern und Großeltern mit mancherlei belustigenden Anekdoten und optimistischen Annahmen hinsichtlich ihrer eigenen Rolle aufwarten können. Zweifellos haben sie uns mit allem Nötigen versorgt und dennoch das Ausmaß ihres Beitrags in vieler Hinsicht überschätzt. Das aber müssen Sie ihnen aber nicht unbedingt verraten!
1.4Sprachliches Wissen: abstrakt, vielseitig und dynamisch
Typischerweise, aber im Grunde inkorrekt, reden wir in einer Weise über Sprachen, als ob es sich dabei um Gegenstände handelte, die man erwerben, verlieren oder unbeschadet an Folgegenerationen vererben könnte. Aber mit der Bezeichnung Sprache verweisen wir, wie eben erläutert, auf ein gedankliches Konstrukt, nämlich ein Wissenssystem, auf dessen Existenz wir anhand unterschiedlicher Arten von Evidenz schließen. Hinzu kommt, dass Sprache, auch wenn wir von ihr in der Einzahl sprechen, multiple Kenntnissysteme (Dialekte, Register, Stile o.ä.) umfasst. Da sich jede Generation – genauer: jedes einzelne Kind – diese sprachlichen Systeme anhand relevanter Erfahrung in Eigenregie aneignen muss, kommt es notwendigerweise zu Brüchen bei der Weitergabe von einer Generation zur nächsten.1 Die Auswirkungen von Diskontinuität werden besonders deutlich, wenn Kinder eine Erstsprache erwerben, die in ihrer Lebenswelt zunehmend in den Hintergrund gedrängt wird, wie im Fall von Herkunftssprachen oder Minderheitensprachen





























