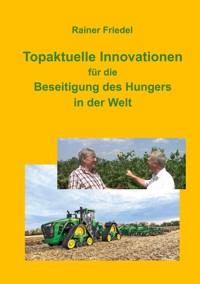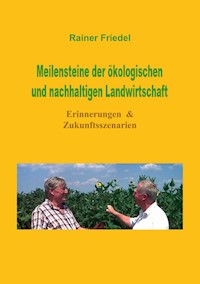
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was erwartet Sie in diesem Buch? Der Autor beschreibt seine persönlichen Erinnerungen zur ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland und vielen weiteren Ländern auf allen Kontinenten. Dabei berichtet er in erzählerischem Tonfall von einer Vielzahl selbst bearbeiteter Projekte aus der langen Zeitspanne von etwa 1975 bis heute und leitet Gedanken ab, welche dieser Erfahrungen in die zukünftige betriebliche Praxis, aber auch in politische Entscheidungen übernommen werden könnten. Leser, die sich mit ähnlichen Themen befassen, erhalten eine Fülle von Anregungen für ihre eigenen Projekte. Diese Impulse entstehen zuerst aus seinen eigenen praktischen Erfahrungen mit der erfolgreichen Großraumlandwirtschaft in Vogel- und Wasserschutzgebieten. Bedeutende Flächenanteile des Landwirtschaftsbetriebes konnten später in einen Nationalpark überführt werden. Dies geschah nicht zur Sanierung, sondern wegen der vorhandenen reichen Biodiversität und der guten Qualität von Boden, Wasser und Landschaft. Das Know-how aus mehreren Hundert Projekten seiner agrarökologischen Beratungsfirma finden sich im Buch wieder. Seine Fachkompetenz aus der Arbeit als Leiter einer in vielen Ländern tätigen Zertifizierungsstelle macht dieses Buch spannend, lehrreich und gut lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Vergangenheit schreibt der, dem Gegenwart und Zukunft wichtig sind.
nach Johann-Wolfgang von Goethe
Inhaltsübersicht
Vorwort
Mein Weg bis zum ersten Meilenstein
Der ökologische Landbau
Die Wegbereiter
Agrarökologie ab 1920er Jahren
Agrarökologie ab den 1950er Jahren
Mein Start in den ökologischen Landbau
EU-Bio-Verordnung von 1992 schafft sicheres Bio-Recht
IFOAM - Die globale Öko-Familie
Zeittafel als Zusammenfassung
Aus dem Alltag der wachsenden Bio-Kontrollstelle
Kooperation mit Control Union Certifications
Die Praxis der nachhaltigen Landwirtschaft
Herausbildung der nachhaltigen Landwirtschaft
Meine eigenen Nachhaltigkeitsprojekte
Zertifizierung nachhaltiger Landwirtschaft
Was jetzt für eine nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland getan werden könnte
Beruflicher Neuanfang in der Mitte des Lebens
Nachhaltiger Weltfrieden zur Gewährleistung ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft
Über das Buch und den Autor
Inhaltsübersicht
Vorwort
Mein Weg bis zum ersten Meilenstein
Kindheit und Studium
Zingst - Landwirtschaft in Schutzgebieten
Rückblick auf die Zingster Agrar-Erfahrungen
Der ökologische Landbau
Die Wegbereiter
Albrecht Daniel Thaer
Johann Heinrich von Thünen
Justus von Liebig
Agrarökologie ab 1920er Jahren
Agrarökologie ab den 1950er Jahren
Agrarökologie in der jüngsten Gegenwart
Mein Start in den ökologischen Landbau
Die frühe Praxis des ökologischen Landbaus in Deutschland
Die Pioniere
Anbauverbände strukturieren ihre Regeln
EU-Bio-Verordnung von 1992 schafft sicheres Bio-Recht
Die Grundregeln
Die aktuellen Rechtstexte
IFOAM - Die globale Öko-Familie
Die Philosophie der IFOAM
Der ökologische Landbau ist eine Schlüsseltechnologie zur Beseitigung weltweiter Krisen
Prinzipien und Standards der IFOAM
Die Vorteile des ökologischen Landbaus
Vorteile für die Gesellschaft
Vorteile für die Landwirte
Vorteile für die Verbraucher
Notwendigkeit der permanenten System-Bewertung
Öko-Entwicklungsziele in Deutschland bis 2030
Der Biomarkt in Deutschland und in der Welt
Zertifizierung im Öko-Landbau – ein neues Instrument in der Landwirtschaft
Notwendigkeit, Vorteile und Arbeitsprozesse der Zertifizierung
Wie Öko- und Bio-Betriebe mit den Biovorschriften arbeiten
Wie eine Bio-Kontrollstelle arbeitet
Schaffung der Arbeitsvoraussetzungen für eine Bio-Kontrollstelle
Durchführung der Bio-Kontrollen
Erteilung des Zertifikats
Forschung und Wissenstransfer
Zeittafel als Zusammenfassung
Aus dem Alltag der wachsenden Bio-Kontrollstelle
Der erste Bio-Kunde und erste Praxisschritte
Der Nitrofen-Skandal
Beschwerden an die Kontrollstelle
Kunden-Typen
Bio-Vorlesungen an der Agrarfakultät der Berliner Humboldt-Universität
Neuentwicklungen für den Zertifizierungsmarkt
Bio-Auditor in der Ukraine
Ein neuer Kollege und Freund kommt zu uns
Bio-Überraschung in Indien
Bio-Beratung in Kasachstan
Bio in Transformationsländern
Öko-Direktor in Polen
Fassungslosigkeit in Israel
Zertifizierte Qualitätsproduktion im Oman
Missverständnisse
Bio ist gesünder
Importierte Bio-Ware ist nicht sicher
Kontrollstellen drücken ein Auge zu
Missverständnisse von Bio-Landwirten
Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus
Öko-Landbau 3.0
Öko 4.0
Digitalisierung im Öko-Landbau
Schwerpunkt Ackerbau
Schwerpunkt Viehhaltung
Was jetzt für den Öko-Landbau getan werden könnte
Fachkompetenz an der Führungsspitze einbringen
Zukunftsfähige Agrarstruktur schaffen
Ökologischen Landbau als Teil eines umfassenderen Systems verstehen
Intensivierung der Forschung und Verbreitung der Ergebnisse in Demonstrationsbetrieben
Den Rechtsrahmen auf Nachhaltigkeitsaspekte erweitern
Reduzierung von Bio-Importen nicht tropischer Herkunft
Ein paar weitere Details
Fazit
Erweiterung der Bio-Kontrollstelle durch Kooperation mit Control Union Certifications
Die Praxis der nachhaltigen Landwirtschaft
Herausbildung der nachhaltigen Landwirtschaft
Meine eigenen Nachhaltigkeitsprojekte
Modellbetrieb Pahren Agrar
Revitalisierung zurückgebliebener Agrarregionen
Beispiel 1: Revitalisierung der Kartoffelproduktion im Fläming
Beispiel 2: Revitalisierung der Gemüseproduktion im Oderbruch
Nachhaltige Landwirtschaft in Biosphärenreservaten
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Biosphärenreservat Biberland (Mittlere Elbe)
Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
Biosphärenreservat Spreewald
Schutz der regionalen Herkunft von Lebensmitteln.
Erste EMAS-Validierung in Europa
Agrar-Wertschöpfungskette von Biomasse bis Wasserstoff
Biogasanlage: 1960-er Jahre
Modellversuch Wärme-/Stromerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen (1993)
Windenergie auf Bauernfeldern
Strukturiertes Management für Landwirte
Ländlicher Tourismus
BEISPIEL 1:AGRARPARK DEDELOW
BEISPIEL 2:REGIONALMARKE FÜR DEN BAUERNVERBAND SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Regionale Wirkung nachhaltiger Landwirtschaft
Praktikanteneinsätze
Internationalisierung meiner Nachhaltigkeitsaktivitäten
Malaysia – Cameroon Highlands
Israel
Argentinien
China
Fernerkundung
Russland
Oblast Gdjetobilsk
USA
Missverständnisse
KÜHE AUF DER SOMMERWEIDE
HÜHNER AUF FREILAUFFLÄCHEN
MASSENTIERHALTUNG
WELCHE ERTRAGSHÖHE IST NACHHALTIG/OPTIMAL?
DIEMENGE MACHT DAS GIFT
ÜBERDÜNGUNG
MONOKULTUR
LEITBILD DER LANDWIRTSCHAFT
Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume
Zertifizierung nachhaltiger Landwirtschaft
Zertifizierung - ja. Warum? Wie?
Zertifizierungsprogramme für die nachhaltige Landwirtschaft
Nutzensaspekte der Zertifizierung
Private Zertifizierungssysteme unterstützen internationale gesellschaftliche Interessen
Die Initiatoren und Träger von Zertifizierungssystemen
Vom Instrument der Pioniere zum Zertifizierungsdschungel
Zukunftstrends für die nächsten sechs bis zehn Jahre
Zukunftstrend 1: Zertifizierung erfasst weitere gesellschaftliche Entwicklungen
Zukunftstrend 2: Weitere Professionalisierung der Prozesse
Zukunftstrend 3: Einfach und kostengünstig zu managende Zertifizierungssysteme
Zukunftstrend 4: kontinuierlicher Wissenszuwachs bei Anwendern
Zukunftstrend 5: Vertrauen erhalten
Was jetzt für eine nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland getan werden könnte
Bereitschaft zur Anpassung ist Teil des Problems
Verstetigung der öffentlichen Diskussion
Zukunftsfähige Agrarstruktur schaffen
persönliche Zukunftssicherheit für Landwirte schaffen
Schlaggröße und Landschaftsstruktur
Flächenknappheit im deutschen Agrarleitbild berücksichtigen
Rasch Flurneuordnung für Landwirte und Landschaft starten
Handeln statt Zeit versäumen
Breitenanwendung des technologischen Fortschritts
Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung erhöhen
Agrarverbände als Träger von Zertifizierungsprogrammen
Reduzierung der Exportmengen von Agrarprodukten
Lebendige Dörfer erhalten und entwickeln
Fazit
Beruflicher Neuanfang in der Mitte des Lebens
Neugierig während der Wende
Seltsame Begrüßung
Bedeutung der Wende und Wiedervereinigung für uns
Persönlicher Verlust und Neuanfang
Alltag im „neuen Leben“
Nachhaltiger Weltfrieden zur Gewährleistung ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft
Über das Buch und den Autor
Das Buch
Der Autor
Hinweise zur Rechtschreibung und Grammatik
Vorwort
Immer mehr Menschen erkennen den bereits begonnenen Klimawandel. Forscher sammeln Umweltdaten und bewerten diese. Die Schlussfolgerungen werden immer ernster.
Am wirksamsten zur Entfaltung einer Gegenoffensive sind in den letzten Jahren für die Öffentlichkeit die „Fridays for Future“ erkennbar. Junge Menschen in Deutschland und der Welt sorgen sich um ihre Zukunft und darum, dass in der Gegenwart zu wenig getan wird, ihre Zukunft zu sichern. Die deutsche Politik schläft bisher. Im Jahr 2021 musste die Regierung sogar vom Bundesverfassungsgericht geweckt werden, um aktiv zu werden. Sie träumt zu diesem Thema aber weiter.
Während dessen vertrocknen in Deutschland Millionen Bäume. Statt grüner Wälder präsentieren sich große Landschaftsteile als braune Landschaften voller toter Bäume.
Die Sommer werden heißer. Die Anzahl von Unwettern steigt. Deren Wirkungen münden in Katastrophen (zuletzt im Juli 2021 in Süddeutschland und Sachsen).
Menschen leiden und sterben. Auch die Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden zerstört. Riesige Kosten entstehen, um den Betroffenen zu helfen. Verantwortungsvoll denkende Menschen sehen, dass Geld nur einmal ausgegeben werden kann und die Kosten für die kommenden Generationen zur Bewältigung der Klimakrise nicht deren Lebensqualität verschlechtern dürfen. Heute muss gehandelt werden.
Die Landwirtschaft steht als Branche unter Beobachtung von Kritikern. Stichworte: Gift auf den Feldern, Insektensterben, Rückgang der Zahl von Vögeln und Niederwild, Quäl-Haltung von Nutztieren. Die Liste von Schäden durch nicht nachhaltige Landwirtschaft ist berechtigt und lang.
Zum Glück steht dieser berechtigten Kritik auch Gutes gegenüber. Die Ernährung der deutschen Bevölkerung mit Lebensmitteln aus heimischer Produktion ist gesichert. Immer mehr Menschen möchten im Urlaub nicht nur ferne Länder besuchen, sondern erholen sich in heimischer Landschaft, deren Bild überall in Deutschland von der Landwirtschaft mitbestimmt wird.
Die häufigsten Stimmen zur Bewertung der Situation der deutschen Landwirtschaft kommen von ganz normalen Bürgern und Konsumenten. Sie sind hoch engagiert und motiviert. Sie haben den Vorteil, dass sie durch die Lupe ihrer bereits fest etablierten Vorstellung alles besonders groß sehen. Sowohl das Gute als auch das Ungewollte.
Landwirte, die die landwirtschaftlichen Arbeitsprozesse ausüben und von den Arbeitsergebnissen leben, haben gewöhnlich ein ganz anderes Bild im Kopf, als Urlauber aus der Stadt. Sie sind gebunden an die existierende Ausstattung ihrer Betriebe und an ihre Erfahrungen, die sie oft auch von ihren Vorfahren übernommenen haben. Veränderungen sind in diesem Umfeld nicht nur vom Wollen abhängig, sondern auch von existierenden Rahmenbedingungen, auf die die Kritisierten oft gar keinen Einfluss haben.
Meist erfordern Veränderungen erhebliche Investitionen. Auch kostet der Übergang von gewohnten Arbeitsabläufen mentale Überwindung und erfordert auch Erwerb und Akzeptanz neuen Wissens.
Um die Landwirte herum sind viele, die es „besser wissen“, z.B. die Verbraucher, die Eltern mit ihren Kindern, die Naturschützer. Weitere Gruppen, z.B. Politik und Forschung holen sich das Idylle-Leitbild der Landwirtschaft bei den Verbrauchern ab. Zu wenige aus diesen beiden Gruppen leiten das Bild der zukünftigen deutschen Landwirtschaft daraus ab, wie die realen Schädigungen der Landwirtschaft am Klima und Ökosystemen rasch gemindert und beseitigt werden können und wie die Landwirtschaft unserer Enkel aussehen sollte. Manche teilen die gesamte Landwirtschaft in konventionell, ökologisch und nachhaltig ein. Dabei ist die Zahl der konventionell wirtschaftenden Landwirte und die von ihnen bewirtschaftete Fläche in Deutschland und in der Welt viel größer als bei den anderen beiden Formen.
In diesem Buch möchte ich davon berichten, welche Meilensteine der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft ich während meiner langen Berufslaufbahn beobachten und zum Teil mitgestalten konnte. Damit möchte ich verbinden, Argumente vorzutragen, die zur sachgerechten Bewertung der realen Situation in der Landwirtschaft erforderlich sind. Außerdem stelle ich meine Vorstellungen zu einem zukunftsfähigem Bild von nachhaltiger Landwirtschaft vor, die die natürlichen Bedingungen sowie die Ansprüche der deutschen Wohnbevölkerung berücksichtigt.
Ein Buch reicht nicht aus, alle diese Fakten und Meinungen darzustellen und zu bewerten. Ich möchte mich deshalb auf einige Meilensteine konzentrieren. Damit meine ich ganz besondere Ereignisse oder Erkenntnisse, die die weitere Entwicklung jeweils auf eine höhere Stufe hoben. Wann stellte man fest, dass Agrochemikalien nicht nur hilfreich sind? Wann begannen die Pioniere Alternativen zu finden? Wie erfolgte die Veränderung der Haltungsformen im Stall von der „Quäl-Haltung“ zu artgerecht gebauten Ställen? Wann kamen die Worte Nachhaltigkeit und Ökologie in der praktischen Landwirtschaft an? Wie erfolgte die Umsetzung in die Praxis?
Seit Mitte der 1970er Jahre nahm ich selbst an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Positionen an diesem Wandel teil. Aus diesem Blickwinkel werde ich hier über die Entwicklung der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland und der Welt berichten.
Dies sind meine persönlichen Erinnerungen und Ansichten. Es ist kein Fachbuch.
Mein Weg bis zum ersten Meilenstein
Kindheit und Studium
Mein Vater war Landwirt und wir wohnten auf dem Dorf. So lernte ich manches über die damalige Landwirtschaft schon als Kind und Heranwachsender im Alltag.
Nach 8 Schuljahren begann ich im Jahr 1962 vier Jahre an der „Erweiterten Oberschule“, heute heißt dies Gymnasium, weiter zu lernen. Diese 4-jährige Bildung erfolgte damals so, dass ich so, wie alle anderen meiner Mitschüler, am Ende dieser Schulzeit zwei gültige Abschlüsse erhielt. Der eine Abschluss war das Abiturzeugnis. Dieses bestätigte die Hochschulreife, um studieren zu können.
Der zweite Abschluss war ein Facharbeiterbrief für Rinderzucht. Hierzu gab es alle 3 Wochen einen Wechsel zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule. An der Berufsschule lernten wir die Fächer Fütterung, Melken, Fortpflanzung usw. Im Ausbildungsbetrieb führten wir die üblichen Arbeiten im Team mit den fest angestellten Erwachsenen durch. Für den Abschluss als Facharbeiter musste ich eine schriftliche Arbeit anfertigen. Thema: Zwischenfruchtanbau in meinem Ausbildungsbetrieb. Außerdem erfolgte 1966, nach 4 Lehrjahren, eine praktische Prüfung. Ich musste vor einer kleinen Kommission von Berufschullehrern bestimmte Arbeiten im Stall „vorführen“. Die Worte Nachhaltigkeit und Ökologie habe ich in dieser Zeit nicht kennengelernt.
1968 begann ich dann mein 4-jähriges Universitätsstudium an der Universität Leipzig. Ich hatte mich für das Fach Landwirtschaft beworben. Es wurde aber ein Studium der Tierproduktion. Die Landwirtschaftsbetriebe hatten sich am Beispiel der Industrie orientiert und wurden spezialisiert und vergleichsweise zu anderen Regionen in Deutschland ziemlich groß. Es gab nun Spezialbetriebe der Tierproduktion und Spezialbetriebe der Pflanzenproduktion. So musste ich eine der Sparten wählen.
Der Prozess der Spezialisierung des Studiums wurde „Hochschulreform“ genannt. Ich wurde für unser Studienjahr als Studienjahressprecher gewählt. Schon ein paar Monate nach Start des Studiums musste ich in dieser Funktion vor 700 Menschen im großen Saal des Leipziger Zoo eine Rede zur Studienreform halten. Ich habe das Manuskript heute noch. Ich hielt, wie alle aufsässigen Studenten der Welt, einen sehr kritischen Vortrag. Die Rede zog aber keinerlei Folgen nach sich. Weder für das Reformprogramm, noch für mich. So geht es wohl auch heute vielen Studenten-Rednern in der Welt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Zeit meines Studiums (1968-1972) die Worte Ökologie und Nachhaltigkeit an der Uni kennen lernte. Denke ich an diese Zeit zurück, dann spielte wohl eher die Ressourcenökonomie eine markante Rolle. D.h. wie kann von einem Hektar möglichst viel geerntet werden und wie bringt man eine Kuh dazu, mehr Milch zu geben.
Zingst - Landwirtschaft in Schutzgebieten
1978 habe ich im Forschungszentrum für Tierproduktion Dummerstorf mein Promotionsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Danach ging ich im gleichen Jahr nach Zingst. Dort wollte ich zusätzlich zur Wissenschaft auch die praktische Landwirtschaft kennen lernen.
Was ich bei der Vorbereitung auf den Wechsel weder ahnte, noch wusste: In Zingst begann meine Befassung mit Ökologie und Nachhaltigkeit ein Hauptthema meines Berufslebens zu werden. Mehrere Besonderheiten des Betriebes und seines Umfelds waren dafür maßgebend.
Zuerst waren die sehr großen landwirtschaftlichen Flächen des VEG1 Zingst von mehreren großen Vogel- und Wasserschutzgebieten betroffen. Die Agrarflächen werden im Norden und Westen durch die Ostsee und im Süden und Osten durch die Bodden-Seen begrenzt. Östlich des Ortes liegt einer der größten Rastplätze für Kraniche in Europa. Dazu kommen natürlich solche Vogelarten, deren Lebensraum am Wasser liegt, z.B. Prachttaucher, Rohrdommel, Blässgans, Eiderente und viele weitere. Aber auch viele Singvogelarten sind heimisch, z. B. Sumpfrohrsänger, Mönchsgrasmücke, Feldlerche, Stieglitz u.a. Hinzu kommen Rehe, Wildschweine, Hasen usw. Insgesamt eine sehr bemerkenswerte Biodiversität.
Zum zweiten waren die Ackerflächen sowie die Wiesen und Weiden sehr grundwassernah. Das ist für den Ertrag von den Flächen vorteilhaft. Die Grundwassernähe verlangt aber ein sehr feinfühliges Management mit Agrarchemikalien, insbes. Dünger, weil die Gefahr besteht, dass die Mittel ausgewaschen werden und so eine ernsthafte Verschlechterung der Wasserqualität entstehen kann.
Ein weiterer besonderer Sachverhalt war, dass das VEG Zingst Initiator und Mitgliedsbetrieb der Produktionsvereinigung Jungrinderaufzucht (PVJ) war. Diese neuartige Organisationsform war ein agrarpolitisches Experiment der Regierung. Sie war einmalig im ganzen Land. Ich durfte dabei sein.
PVJ
5 Mitgliedsbetriebe 15.450 ha 50.000 Jungrinder
Die zur PVJ gehörigen 5 Landwirtschaftsbetriebe mit insgesamt über 15.450 ha Fläche und 50.000 Jungrindern bildeten gemeinsam die Produktionsvereinigung. Der westlichste Betrieb lag dicht bei Bad Doberan. Der östlichste auf der Insel Rügen. Zwischen beiden Betrieben liegen 150 Straßenkilometer.
Alle Mitgliedsbetriebe erhielten bestimmte, sonst unübliche Rechte und finanzielle Zuwendungen. Einer der Vorteile war z.B., dass die PVJ zu vielen Industrieunternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen Direktkontakte unterhielt. Dadurch waren wir sehr eng mit der aktuellen Forschung und den neuesten Maschinen in Verbindung. Bei uns wurden die neuen Traktoren aus dem Traktorenwerk Schönebeck und die aktuellen Modelle der Erntemaschinen vom Landmaschinenwerk Neustadt im produktiven Einsatz erprobt. Auch der Einsatz von neu gezüchteten Gräsern (Forschungsinstitut Paulinenaue) und neuer Tiermedikamente (Serumwerk Jena) sowie viele weitere Kooperationen waren Grundlagen für eine hohe Produktivität, der in der PVJ mitwirkenden Landwirtschaftsbetriebe.
Mit diesen Erfahrungen aus den 1970er Jahren zur Kooperation der praktischen Landwirtschaft mit der Spitzenforschung des Landes im Kopf, lese ich jetzt die Reportage „Precision Farming Ökolandbau 4.0: Wenn digital auf Bio trifft“ von 20202. Dort sagt ein als Pionier interviewter Landwirt (40 Jahre nachdem ich in Zingst arbeitete): „Wann sich das [die Digitalisierung einiger erster Schritte seines Ackerbaus] auszahlt, kann ich nicht sagen. Ob ich in die teilflächenspezifische Aussaat einsteige, hängt von meinen Kollegen ab. Alleine werde ich auf keinen Fall in neue Saattechnik investieren, die mit Aussaatkarten in unterschiedlichen Saatstärken sät.“ Zwischen meiner Erfahrung in Zingst und den Worten dieses heutigen Pionier-Landwirts, der Interesse an der Digitalisierung hat, liegen 4 Jahrzehnte. Nach technologischem Niveau gemessen, scheint es, als stünde der heutige Pionier vor größeren technischen Innovationsproblemen zu stehen als ich in den 1970er Jahren.
Die Struktur des VEG Zingst, seine Größe und Leistungsfähigkeit sowie seine vielseitigen Kooperationsverbindungen waren vom Direktor Herbert Malzahn aufgebaut worden. Als junger Kollege habe ich an ihm immer sehr bewundert, wie individuell er mit Menschen umgehen konnte. Er sprach mit dem Traktoristen und Stallarbeiter ohne Dünkel deren „Bauernsprache“. Aber mit gleicher Sicherheit beherrschte er auch die „Ministeriumssprache“, wenn er einen Minister im Unternehmen zu Gast hatte. Das befähigte ihn, Außergewöhnliches zu schaffen. Als Zeichen ehrfürchtiger Hochachtung wurde er auch weit außerhalb des Betriebes anerkennend der „Grüne Baron“ genannt3.
Herbert Malzahn trug aus dem erfolgreichen VEG Zingst die Initiative für die PVJ nach Berlin zum Ministerium. Dort wurde aus seiner Idee das agrarpolitische Experiment der Regierung. Herbert Malzahn wurde dafür vom Direktor des VEG zum Leiter der PVJ „befördert“.
Ich kam etwa 1½ Jahre nach PVJ-Gründung nach Zingst in sein Führungsteam. Dort wurde ich mit 31 Jahren Stellvertreter von Herbert Malzahn und dann, nach seinem Ausscheiden, sein Nachfolger auf dem Posten des Leiters der PVJ.
Hier konnte ich die fachlichen Grundlagen in der betrieblichen Praxis studieren, wie Landwirtschaft in einem äußerst sensiblen ökologischen Umfeld hoch effizient betrieben wird. Darauf konnte ich in meinen späteren Jahrzehnten immer wieder zurückgreifen.
Die Arbeit in der Produktionsvereinigung hatte aber auch viele weitere Erinnerungswerte. Beim Aufbau des VEG Zingst, was den Grundstein der PVJ bildete, ist es dem damaligen Direktor Herbert Malzahn gelungen, im großen Betrieb eine Betriebsatmosphäre zu schaffen, die voller Begeisterung für den Betriebsaufbau war. Dieser Elan blieb nicht auf die Mitarbeiter des VEG begrenzt. Der Schriftsteller Meyer-Scharfenberg war davon so angetan, dass er einen Roman über den Betrieb inmitten der Vogelschutzgebiete schrieb4. Die Konflikte zwischen Vogelschutz und Landwirtschaft beschreibt er spannend und lebensnah. Dabei ist die Darstellung so, dass die Konflikte und das Bemühen um die Vereinbarkeit der gegensätzlichen Anforderungen von Vogelschutz und Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Viele Belegschaftsmitglieder kommen im Roman mit leicht verändertem Namen vor. So sind sie für den eingeweihten Leser im Buch gut erkennbar und der Autor bringt so manche Schrulle und Episode in sein Buch, dass es für den eingeweihten Leser eine besondere Lust ist, darüber zu lesen. Später hat das Fernsehen der DDR den Roman unter dem namen „Inselsommer“5 verfilmt und landesweit ausgestrahlt. Wenn so eine Atmosphäre vorhanden ist, ist es ein großes Erlebnis dabei gewesen zu sein.
Neben dem Direktor gab es auch einen intellektuellen Gegenspieler. Es war der Tierarzt Dr. Roland Slucka. Er war nicht nur ein begnadeter Tierarzt, sondern auch ein sehr kenntnisreicher Ökologe. Auch deshalb war er Kandidat der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften in Berlin. Er war der auf höchstem Niveau sachverständige Mahner. Seine Vorschläge waren dem, mehr auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Direktor, immer wichtig. Das Funktionieren der intensiven Landwirtschaft in einer sensiblen Umgebung ist zu großen Teilen seinen Beobachtungen und Anregungen zu danken.
Über eine weitere Person, die mein Leben in Zingst beeinflusste, möchte ich noch kurz berichten. Es ist Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Stubbe (1902-1989). Für jüngere Generationen ist der Name vielleicht nicht mehr sehr bekannt. Die folgenden zwei Punkte seines langen Forscherlebens, erscheinen mir für die Menschen, die nach ihm leben, seine Persönlichkeit besonders zu kennzeichnen.
In den 1940er und 1950er Jahren hatte der sowjetische Forscher Trofim Denissowitsch Lyssenko eine eigene Theorie der Genetik entwickelt, die für Landwirtschaft in der Sowjetunion eine verbindliche Basis wurde. Prof. Stubbe lebte als Genetik-Forscher in der DDR, die in der damaligen Zeit politisch eng an die Sowjetunion gebunden war. Er erkannte die grundlegenden Fehler der Theorien von Lyssenko und stellte sich öffentlich dagegen. Dies erforderte damals einen ganz außerordentlichen Mut. Wer damals an der Sowjetunion zweifelte, war dem Gefängnis und Berufsverbot sehr nahe. Durch Stubbes feinfühliges aber stringentes Engagement vermied die kleine DDR große Schäden in der Landwirtschaft. Solche Schäden haben damals die Landwirtschaft der Sowjetunion hart getroffen. Auch das verbündete China litt unter Lyssenkos Irrlehre, wie auch die meisten anderen verbündeten Länder. Prof. Stubbe hat sein Land mit sehr hohem persönlichem Risiko vor Schaden bewahrt.
Seine zweite Leistung mit Langzeitwirkung war die Gründung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR. Es war die mit Abstand größte Forschungsorganisation des Landes für die Landwirtschaft. Sie zählte 1990 etwa 35 Institute mit etwa 3.500 Wissenschaftlern sowie über 30.000 Angestellten. Diese Forschungsinstitute schufen die wissenschaftlichen Grundlagen, dass in der DDR die Landwirtschaft ein sehr hohes Innovationspotenzial hatte. Dieses gibt den Landwirten auch noch lange nach der Wiedervereinigung eine sichere Wettbewerbsposition.
Prof. Stubbe lud mich öfter zu sich nach Hause ein. Er wohnte in einem sehr schönen, rohrgedeckten Hause gleich hinter dem Deich. Er war längst pensioniert, aber er wollte von mir, der ich gerade die 30 Jahre überschritten hatte und schon eine bemerkenswerte Stellung besaß, viel von der aktuellen Situation der Landwirtschaft wissen. Die Gespräche sind mir unvergesslich. Seine fachlich aufrechte Haltung wurde mir lebenslang Vorbild, wenngleich ich zum Glück nie vor existenziellen Entscheidungen in dieser Sache stand.
Außerdem habe ich ihm einmal aus meiner kleinen Schafgruppe ein Lamm verkauft, welches dann auf seinem Grundstück den Rasen kurzhielt. Auch diese winzige Episode ist mir unvergesslich.
Viele Jahre später, ich wohnte schon längst nicht mehr in Zingst und hatte nach der Wiedervereinigung in Berlin meine eigene Beratungsfirma Agro-Öko-Consult gegründet, kam ein nicht-landwirtschaftlicher Aspekt der Nachhaltigkeit auf mich zu. Ich traf mich mit einem guten Zingster Freund wieder, um über alte und neue Zeiten zu plaudern. Dabei berichtete er mir, wie sich in ganz wenigen Jahren nach der Wiedervereinigung das idyllische Fischerdorf, das bestimmt war von den traditionellen Wohnhäusern mit Rohrdach (heute wird „Reed“ dazu gesagt), verwandelt hatte, in eine „aufgetakelte alte Matrone“ (seine Worte). Jeder, der es schaffte nahm hohe Kredite auf, um sein Haus rasch hochzupuschen, so dass er vom zu erwartenden Touristenstrom gut leben könnte. Wegen Fehlens einer Bausatzung verlor der Ort in aller Kürze seinen natürlichen Charme und wurde zu einem Ausstellungsgelände, für allen Schnickschnack, den man im Baumarkt kaufen kann.
Urlauber kamen trotzdem in Scharen und das Vermieten erbringt eine gute Rendite. „Allerdings“, sagte mir mein Freund, „es darf keine Wasserpest durch die Landwirtschaft kommen. Dann sind wir alle Pleite. Ohne Touristen können wir nicht mehr leben.“ Bis heute habe ich nicht davon gehört, dass der Tourismus im Ort und der Umgebung durch die Landwirtschaft jemals geschädigt worden wäre. Offensichtlich sind die vor Jahrzehnten gelegten fachlichen Grundlagen gemeinsam mit dem neuen Wissen der hinzugekommenen Fachleute bis heute gut funktionsfähig, Landwirtschaft, Ökologie und Tourismus zu vereinbaren.
Rückblick auf die Zingster Agrar-Erfahrungen
Ich kann mich heute beim Schreiben dieser Zeilen nicht erinnern, dass es zurzeit als die PVJ existierte (1970er und 1980er Jahre), in Zingst oder in den anderen Mitgliedsbetrieben der Produktionsvereinigung eine ökologische Begleitforschung gab. Ich vermute, es gab tatsächlich keine. Dieses Thema war in dieser Zeit nicht prioritär. Wie ich es schon im Zusammenhang mit dem Studium in Leipzig berichtete, stand damals die Ressourcenökonomie im Vordergrund. Durch die Landwirtschaft verursachte ökologische Schäden waren zu dieser Zeit kein Thema. Wahrscheinlich waren sie gering oder sie waren noch gar nicht beobachtbar, weil der Chemieeinsatz im Vergleich zu heute noch gering war.
Viele Jahre später ließ mich im Rückblick ein aktuell durchgeführtes Projekt die Situation zur Ökologie und Nachhaltigkeit in der Mitte und zu Ende der 1970er Jahre noch einmal mit hinzugekommenem Wissen neu durchdenken. Das kam so:
Meine 1990 gegründete Firma Agro-Öko-Consult GmbH erhielt etwa 2014 von einem bemerkenswerten Industriekonsortium (Gaze de France-SUES, GASAG Berlin und STRABAG) einen spannenden Auftrag. In der westlichen Altmark war seit Ende der 1960er Jahre Erdgas im industriellen Maßstab gefördert worden. Für diesen Zweck entstand im Laufe der Jahrzehnte ein umfangreiches Netz an verschiedenen unterirdischen Rohrleitungen. Als Gesamtlänge aller Rohrleitungen in dem relativ kleinen Förderkreis mit ca. 30 km Durchmesser wurde von 3.000 km gesprochen. Als dann, nach dem Jahr 2000, die Fördermengen immer weiter rapide zurückgingen, wurde die Frage aufgeworfen, ob es möglich ist, dieses Rohrnetz für neue Zwecke zu nutzen. Die Gedankenkette war, aus landwirtschaftlichen Rostoffen Biogas zu erzeugen und dann mit Windenergie aus dem Biogas Stadtgas und/oder Wasserstoff herzustellen. Das dichte Röhrennetz aus der zu Ende gehenden Erdgasförderung würde oberirdische Biomassetransporte fast gänzlich vermeiden, weil es fast überall möglich war, eine Biogasanlage direkt an das vorbeiführende Rohrnetz anzuschließen.
Unser Auftrag bestand darin, eine Machbarkeitsstudie für die Erzeugung der landwirtschaftlichen Rohstoffe zu erstellen und möglichst viele Landwirte für dieses Konzept zu gewinnen. Die Studie wurde ein voller Erfolg.
Bei einer Diskussion im kleinen Expertenkreis des Konsortiums entwickelte sich einmal eine Diskussion, deren Einstiegssätze ich noch genau im Kopf habe.
Das Konsortium fragt mich: „Was kann man denn tun, dass die Biomasse durch die Landwirte besonders kostengünstig produziert werden kann.“
Ich antwortete wie aus der Pistole geschossen: „Erträge steigern, mehr von jedem Hektar ernten.“
Konsortium: „Geht denn das?“
Mein Mund antwortete rasch, ohne dass ich detailliert nachdachte: „Natürlich, früher habe ich einen Landwirtschaftsbetrieb geleitet, der deutlich höhere Erträge hatte als unsere Nachbarn und dadurch sehr rentabel war.“
Konsortium: „Da habt ihr aber tüchtig Chemie raufgeschmissen.“ Dieser Satz wurde durch eine Miene begleitet, in der gleichzeitig echter Wissensbedarf signalisiert wurde und ein böser Vorwurf.
Ich: „Ja natürlich, Aber durch die angewandte Ackerbaukultur gab es nie beeinträchtigtes Grundwasser. Außerdem wurden große Flächenanteile dem später gegründeten Nationalpark zugeordnet. Nicht zur Sanierung, sondern wegen der vorhandenen reichen Biodiversität und weiterer sehr geeigneter ökologischer Parameter.“
Diesen letzten Satz hatte ich seit meinem Weggang aus Zingst bis zum Gespräch mit den Industriepartnern an die 30 Jahre lang niemals wieder im Kopf gehabt. Nun war er für mich geboren. Seitdem lässt mich der Gedanke nicht los, dies alles mit dem Wissen von heute genauer zu bewerten. Erst jetzt, wo ich meinen früheren Beruf als Hobby betreiben kann, habe ich die Zeit, meine Erlebnisse zum Thema ökologische und nachhaltige Landwirtschaft besser zu ordnen. Erst jetzt kann ich dieses Nachdenken durch Recherchen untersetzen. Nun scheint mir die Zeit passend, meine Erinnerungen zur ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft aufzuschreiben und aus den Erinnerungen von 4 Jahrzehnten auch Überlegungen zur Zukunft „meiner“ Branche abzuleiten.
1 VEG – Volkseigenes Gut. Rechtsform für Landwirtschaftsbetriebe in der DDR.
2https://www.agrarheute.com/technik/ackerbautechnik/digitalisierung-Landwirtschaft-bio-563417
3 Aus Wertschätzung an meine „Lehrzeit“ bei Herbert Malzan gab ich meiner 1990 gegründete Firma die Firmenfarbe grün, die auch seine Lieblingsfarbe war.
4 Fritz Meyer Scharfenberg: „Der Mann auf dem Kirr“, Buchverlag Der Morgen. Außerdem lernt man Meyer-Scharfenberg als intimen Schilderer der Küstenbewohner und deren Mentalität sehr lesenswert kennen im Buch „Boddengeflunker“, Hirnstorff Verlag, Rostock, 1978
5https://www.fernsehenderddr.de/index.php?script=dokumentationsblattdetail&id1=14796
Der ökologische Landbau
Die Wegbereiter
Seit ewigen Zeiten sind Landwirte interessiert, von ihrem Acker mehr zu ernten und von einem Schaf mehr Wolle zu scheren. Über die längste Periode der Landwirtschaft gab es aber fast keine Kenntnisse über Biologie und Genetik sowie die vielen belebten und unbelebten Faktoren, die die Ertragsfähigkeit von Böden bestimmen. Die Dreifelderwirtschaft und der einfache Pflug, der von Tieren gezogen wurde waren die „Technologie“ dieser Zeit. Der Sohn übernahm ganz einfach die Erfahrungen des Vaters. Fortschritt war wohl damals ein so fremder Gedanke, wie es für uns heute unvorstellbar ist, Fortschritt nicht zu kennen und nicht anzustreben. Idealisten verklären dies als naturverbunden, lassen aber außer Acht, was dies für die Lebensverhältnisse der Menschen bedeutete.
Albrecht Daniel Thaer
Erst um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert kamen mit Albrecht Daniel Thear und seinem heute noch modern klingenden Buch „Grundsätze der rationellen Landwirthschaft“ erste Ideen auf, die man zu Recht als Begründung der Agrarwissenschaft bezeichnen kann. Seine Vorschläge waren, der damaligen Situation entsprechend, vor allem auf die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und auf die Erleichterung der Arbeit gerichtet. Für Ökologie und Nachhaltigkeit gab es noch keinen Bedarf.
Johann Heinrich von Thünen
In der Thaer-Richtung folgen dann die Arbeiten von Johann Heinrich von Thünen. Diese begründen die landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre mit solchen damals neuartigen Elementen wie Agrarkredit, Bodenwert und den Thünen’sche Ringen. Noch kein Wort von Ökologie und Nachhaltigkeit.
Justus von Liebig
Ein weiterer deutscher Neuerer der Landwirtschaft war Justus von Liebig, ein Chemiker. Er erkannte, dass Pflanzen für ihr Wachstum dem Boden Nährstoffe entziehen und dass die Zugabe von Nährstoffen in den Boden den Ertrag erhöhen kann.
Mit dieser Erkenntnis begann der bergmännische Abbau von Stoffen, die als Pflanzennährstoffe geeignet sind. Deren Einsatz sowie die parallele, einfache Technisierung von landwirtschaftlichen Arbeiten erbrachten für Deutschland innerhalb weniger Jahrzehnte fast eine Verdopplung der landwirtschaftlichen Erträge. So konnte die rasch wachsende Bevölkerung, insbes. in den Städten, überhaupt ernährt werden.
Seine später die ganze Welt positiv beeinflussenden Neuerungen sind noch nicht mit dem heutigen Wortverständnis der Begriffe Ökologie und Nachhaltigkeit zu beschreiben. Im Gegenteil. Irrende Menschen sehen in ihm denjenigen, der mit der Einführung der Chemie in die Landwirtschaft, auch der eigentliche Urheber von Überdüngung, Insektensterben usw. ist. Dies sind aber die Folgen der Fehlanwendung der damaligen Innovationen. Hierauf werde ich später noch zurückkommen.
Agrarökologie ab 1920er Jahren
Der bemerkenswerteste Meilenstein zwischen den 1920er und 1970er Jahren (diese Zeitangaben sind natürlich unscharf), ist die Herausbildung der Idee vom ökologischen Landbau. Dies begann in Deutschland und der Schweiz zu Beginn der 1920er Jahre. Heute ist diese Bewirtschaftungsform über die ganze Welt verbreitet und tut dort ihre guten Wirkungen.
Zur Einordnung in die Zeitskala möchte ich dies hier kurz erwähnen. Für eine ausführliche Diskussion der Entwicklung und heutigen Stellung des ökologischen Landbaus sowie seiner immensen Rolle auch für weitere Aspekte der Ernährung, des Umweltschutzes usw. gibt es dazu das unten auf dieser Seite beginnende eigenständige Kapitel.
Die 1930er Jahre waren in Deutschland, aber auch in den USA, Jahre erheblichen Wirtschaftswachstums. Dieses wurde auch durch die rasante Entwicklung der Chemieindustrie vorangetrieben, was damals eine junge Branche war. Die Agrarchemie entwickelte sich rasch, weil es zwei Treiber gab, die sich gegenseitig verstärkten. Bauern lernten den Nutzen von Düngemitteln (insbes. N, P, K) und anderer Chemikalien kennen und die Nachfrage stieg. Die Chemieindustrie entwickelte immer mehr neue Erzeugnisse und das Angebot wurde größer. Mit Beginn des Krieges wurden die Produktionskapazitäten auf den Kriegsbedarf umgestellt.
Agrarökologie ab den 1950er Jahren
Rasch nach Kriegsende kam ein bedeutender neuer Aufschwung der Agrarchemie. Die ersten ernsten Schäden durch zu viel Chemie wurden bereits Anfang der 1950er Jahre mit dem Pflanzenschutzmittel DDT festgestellt. Jedoch blieb das Wissen auf Experten begrenzt und erst 1970 erfolgten Produktions- und Einsatzverbot. In dieser Zeit vollzogen sich in der Bundesrepublik auch der Contergan-Skandal und das Waldsterben. Diese Ereignisse trugen wesentlich bei, die Öffentlichkeit für auch schädliche Wirkungen der Chemie zu sensibilisieren. Jedoch vergingen Jahrzehnte bis die Mahner der ersten Stunde das Ohr der Massen erreicht hatten.
Agrarökologie in der jüngsten Gegenwart
Die agrarökologische Situation hat gegenwärtig in Deutschland einen Tiefpunkt erreicht. Man kennt ziemlich genau die Ursachen für das Artensterben in Flora und Fauna. Die wichtigsten sind:
Verlust von Lebensräumen,
intensive, nicht nachhaltige Nutzung der Ökosysteme,
Eintrag von Schad- und Nährstoffen in Boden, Wasser und Luft,
Klimawandel.
Mitte der 2010er Jahre wurde bekannt, dass die Zahl der Insekten in Deutschland in den letzten Jahren um 70 – 80% gesunken ist. Wenige Jahre später wird die rasche Verringerung von insektenfressenden Singvögeln gemeldet. Es gibt inzwischen ganze Landschaften ohne Reh und Hase.
Man kennt die Verursacher der einzelnen Schadensarten. Aber es entsteht der Eindruck als würden sich lediglich Naturschutzverbände, aufgeweckte Schüler und einige Medien mit dem Problem beschäftigen. Die Verursacher selbst, sowie deren Verbände und die themenrelevanten Agrarforscher sowie die Industrie, die die schadensverursachenden Erzeugnisse produziert und vertreibt, bringen keine umsetzungsfähigen Maßnahmenvorschläge zustande. Deutsche Agrarökologen forschen lieber in Afrika und Asien und füllen mit diesen Ergebnissen ihre Publikationslisten und Archive.
Die Politik kommentiert nur. Die Behörden schreiben oder lassen Zukunftskonzepte schreiben, denen aber keine Umsetzungsmaßnahmen folgen. Es gibt keine wirklich greifenden, regionsgroßen Aktionen, die zumindest ein mittelfristiges Aufhalten des erschreckenden Trends erwarten lassen könnten.
Die gegenwärtig von der Gesellschaft und der Politik weitgehend geduldete Zurückgezogenheit der Verursacher des Artensterbens in Flora und Fauna ist jedoch die wesentlichste Ursache dafür, dass sich die ökologische Situation in Deutschland in einer ernsthaften Krise befindet.
Bewundernswerte Aktionen von Schülern und besorgten Bürgern werden medienwirksam verkündet. Was durch Politik, Industrie und Landwirtschaft falsch gemacht und durch Experten nicht erkennbar für die Öffentlichkeit mitgeteilt wird, kann durch Schülerplakate jedoch nicht ausgeglichen werden.
Für mich ist das Nicht-Hinsehen und das Abwarten um mich herum schwer zu ertragen, habe ich doch selbst schadarme Landwirtschaft in der Praxis erlebt6 und erlebe heute, dass diese guten praktischen Erfahrungen völlig ignoriert werden, wohl allein deshalb, weil dieses Wissen östlich der Elbe geschaffen wurde.
Mein Start in den ökologischen Landbau
Ich hörte den Fachbegriff „Ökologischer Landbau“ das erste Mail zu Beginn der 1990er Jahre. Ein ehemaliger Arbeitskollege, der im gleichen Forschungsinstitut promovierte wie ich, war (etwa 1991) nach einem Weiterbildungslehrgang im Bundesministerium für Landwirtschaft, noch im gleichen Jahr zu einem weiteren Lehrgang bei der EU in Brüssel. Er erzählte mir von seinen Erlebnissen in Brüssel und erwähnte, dass die EU eine neue Verordnung für den „Ökologischen Landbau“ vorbereitet. Wir wussten beide nicht genau was das bedeutet. Aber ich war wie elektrisiert. Ich suchte noch nach neuen Themen für meine soeben gegründete Beratungsfirma Agro-Öko-Consult GmbH.
Mein Ziel war ja, die Erfahrungen aus meiner Zeit in Zingst weiterzugeben. Der Kollege schickte mir dann Informationsmaterial. Mit dem konnte ich die Gründung der Bio-Kontrollstelle für die Agro-Öko-Consult GmbH vorbereiten. Im Vergleich zu heute waren die Anforderungen damals vollkommen lapidar. Ich musste einen formlosen Antrag beim Senat von Berlin einreichen. Daraufhin kamen zwei Beamte in unser Büro. Sie stellten eine Reihe von Fragen, die leicht zu beantworten waren. Die wichtigsten zu erfüllenden Kriterien waren, dass mindestens 2 Personen tätig sind (Vertretungspflicht) und dass die Kontrollstelle ein Telefon hat, um Kundenanrufe entgegenzunehmen. Für Leser die das nicht wissen: heute besteht die Zulassung aus umfangreichen Antragsunterlagen sowie Überprüfungen zur fachlichen und technischen Leistungsfähigkeit.
Der Kollege fand dann nach Abschluss seines EU-Lehrgangs doch keine Arbeit in einer Behörde und kam zu mir in die Agro-Öko-Consult als gleichberechtigter Geschäftsführer. Wir arbeiteten sehr erfolgreich zusammen beim Aufbau dieser landwirtschaftlichen Beratungsgesellschaft. 15 Jahre später, fast auf den Tag genau nachdem Beginn der Zusammenarbeit, nutzte er dann doch noch die Chance, für ein Ministerium zu arbeiten.
Die Bio-Kontrollstelle entwickelte sich rasch. Ich war nun Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft und Leiter der darin eigenständigen Einheit „Bio-Kontrollstelle“. Beide Arbeitsfelder hatten keine Überschneidungen mit Themen und Kunden.
Wieder waren meine früheren Erfahrungen zur Landwirtschaft in Schutzgebieten sehr nützlich. Ich verstand sehr schnell, was es bedeutet, die Vorschriften der Verordnung zu erfüllen. In den allerersten Jahren stellten viele Brandenburger Landwirte an uns den Antrag, kontrolliert und zertifiziert zu werden. Wir waren in Berlin/Brandenburg eine starke Bio-Kontrollstelle geworden. Die Kontrollstellen-Kollegen aus dem Süden Deutschlands, die uns zu dieser Zeit vom theoretischen Wissen her weit überlegen waren, hatten sich noch nicht auf den Weg nach Berlin gemacht.
Die ersten Kontrollen führte dann ein junger Mitarbeiter durch, der an der Uni Bonn den ökologischen Landbau im Studium ausführlich kennen lernte. Er hat seine Berufslaufbahn bei uns begonnen. Später hat er auf hoher Beamtenebene gearbeitet. Bis zu seinem viel zu frühen Tod waren wir gut befreundet.
Dass wir noch nicht alles genau wussten, stellte uns auf die gleiche Stufe wie die anderen Bio-Kontrollstellen. Denn die mussten, wie wir die Anwendung der nagelneuen EU-Öko-Verordnung auch noch üben.
Mit der Zeit konnten wir davon reden, die Marktführerschaft bei der Bio-Zertifizierung in Brandenburg und Berlin innezuhaben. Die Mehrheit der Brandenburger Landwirte wurde von uns kontrolliert und zertifiziert. Der übrige Teil von einer größeren Zahl von Kontrollstellen, die bis dahin jeder nur recht wenige Kunden hatten.
In Berlin kontrollierten wir hauptsächlich Bio-Betriebskantinen, die auch zu einem bestimmten Anteil komplettes Bio-Essen im Angebot hatten. Ein Ministeriumsmitarbeiter antworte mir mal auf meine Frage, wie viele Bio-Kontrollstellen in Berlin arbeiten, dass dies nicht veröffentlicht wird. Ich könnte aber davon ausgehen, dass um 90% der Berliner Bio-Küchen Zertifikate von der Kontrollstelle der Agro-Öko-Consult ausgestellt bekämen. Zu unseren Kunden gehörten alle Mensen aller Berliner Universitäten, die Küchen im Bundeskanzleramt und im Bundespräsidialamt, die Betriebskantinen großer Industriebetriebe sowie die großen Caterer Bärenmenue und Sodexho sowie viele, viele weitere.
Zu dieser Zeit gründeten im Jahr 2000 16 Gleichgesinnte, zu denen ich auch gehörte, auf Initiative von Michael Wimmer die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e.V. Diese Zusammenarbeit brachte dem Öko-Landbau in Berlin und Brandenburg tüchtigen Aufwind, der auch uns nützte. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Wir konnten mit unseren vielen Kunden auch dem Verein Impulse geben.
Jahre danach, im Jahr 2014, wurde aus meiner lokal begrenzten Bio-Kontrollstelle der Agro-Öko-Consult eine global tätige Zertifizierungsstelle7 mit ca. 30 Zertifizierungsbereichen, darunter natürlich weiterhin die Bio-Zertifizierung. Durch den gewachsenen Aufgabenbereich hat sich meine Zusammenarbeit mit der FÖL immer weiter verringert und ist dann leider eingeschlafen.
Im Rückblick sehe ich, dass der ökologische Landbau als eine spezifische Form der Landwirtschaft, nun seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil meines Berufsalltags ist. Es gab viele erinnerungswerte Ereignisse. Jedes wurde zu einem weiteren Stein des Mosaiks, wie sich mir der ökologische Landbau heute darstellt und was ich im Weiteren mit Partnern und Kollegen teilen konnte. Über einige solcher Geschehnisse, Erinnerungen und zugehörige Gedanken möchte ich im Folgenden berichten.
6 s. S. → Abschnitt „Zingst - Landwirtschaft in Schutzgebieten“
7 Der Begriff „Zertifizierungsstelle“ wird bei der Mehrheit der Zertifizierungssysteme benutzt. Im ökologischen Landbau wurde in allen EU-Verordnungen von 1993 bis 2018 der Begriff „Kontrollstelle“ verwendet. Mit der EU-VO von 2018 (gültig an 2022) wurde dann erstmalig der Begriff Zertifizierungsstelle auch im ökologischen Landbau der EU benutzt.
Die frühe Praxis des ökologischen Landbaus in Deutschland
Die Pioniere
Die Grundlagen des ökologischen Landbaus, wie er heute weltweit realisiert wird, entstanden in den 1920er Jahren in Deutschland und in der Schweiz als private Initiative von Menschen, welche die damals entstehende industrielle Lebensweise ablehnten. Sie bauten auf Ideen von Vorläufern zu Ende des 19. Jahrhunderts auf, z.B. der Eden-Genossenschaft in Oranienburg (Gründung 1893 unter dem Namen „Vegetarische Obstbau-Kolonie Eden e.G.m.b.H.“).
Es entwickelten sich nebeneinander verschiedene Strukturen, z.B. die „Lebensreform“-Bewegung und Demeter sowie eine ganze Anzahl von Vereinen, deren Namen heute nur noch die Forscher kennen. Auch gab es diverse Autoren (z.B. Bilz, Steiner, Tessenow, Damaschke u.a.) und Zeitschriften, die ihre Ideen für einen „natürlichen“ Ackerbau und eine darauf aufbauende „gesunde“ Ernährung und Lebensweise publizierten. Eine gemeinsame Beschreibung dessen, was wir heute unter dem Begriff „ökologischer Landbau“ verstehen, gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Die Initiatoren und aktiven Interessenten dieser neuen Lebens- und Ernährungsweise verbanden sich mit gleichgesinnten Landwirten, die bereit waren, ihre Produktionsverfahren zu verändern, um die ethisch begründeten Wünsche der Lebensreformer zu erfüllen. Diese Bauern ersonnen Produktionsverfahren, bei denen sie auf industriell hergestellte Dünger, Pflanzenschutzmittel und Unkrautbekämpfung verzichten konnten.
Sie fanden (wieder8) heraus, dass es auch ohne Chemie geht. Die Bodenfruchtbarkeit kann durch eine vielfältige Fruchtfolge gefördert werden und die Stickstoff-Versorgung der Pflanzen ist durch Anbau von Leguminosen möglich. Die Gründüngung ist zur gezielten Humusbildung nützlich usw.
In den folgenden Jahrzehnten interessieren sich immer mehr Menschen für diese naturschonende Ernährungs- und Lebensweise. Auch immer mehr Landwirte stiegen um, auf die Ausnutzung der in der Natur vorhandenen Unterstützungsmittel zur Erzeugung gesunder Lebensmittel. Die Zahl der Verbraucher und der Landwirte mit diesen neuen Ideen blieb in Bezug auf die Gesamtbevölkerung, noch über Jahrzehnte sehr gering.
Mit diesen Pionieren haben sich schrittweise die Rollen von Landwirt und Konsument vertauscht. Seit jeher produzierten die Landwirte mit den von ihren Vätern gelernten Methoden, mit denen sie Lebensmittel produzieren konnten. Nun bestimmten in dieser Szene die Verbraucher, welche Produktionsweisen die Landwirte anwenden sollten und welche nicht. Die Konsumenten wurden dabei von ethischen Motiven geleitet, nicht von agrarischem Fachwissen. Aber die beteiligten Landwirte übernahmen gern die ethische Triebfeder und stellten ihre Betriebe auf das damals neuartige Produktionsverfahren um (folgende Abbildung).
Fest verbindliche Produktionsregeln gab es nicht. Die Vermarktung erfolgte auf individueller Ebene und auf Vertrauensbasis. Die Anzahl von Verbrauchern, die auf natürlichem Weg hergestellte Lebensmittel essen wollen, stieg immer weiter an und immer mehr Landwirte produzierten exakt so, wie es die Verbraucher damals nachfragten. Kontrolle und Zertifizierung entwickelten sich erst Jahrzehnte später.
Verbraucher und Landwirte beabsichtigten, dass der Boden und die Pflanzen im Produktionsprozess nicht mit (möglicherweise) giftigen Produktionshilfsmitteln kontaminiert werden. Auch ihre Enkel sollten saubere, gesunde Böden für die Erzeugung gesunder Lebensmittel haben. Das Grundwasser, welches Rückstände von Dünger und Pestiziden aus den Feldern spült, sollte nicht Gift in die Flüsse bringen, die mit dieser Last in die Meere fließen. Die Wildkräuter, denen vielfältige Funktionen auch für die Gesundheit der Nutzpflanzen und des Bodens zugeschrieben werden (Biodiversität), sollten nicht durch chemische Bekämpfung vollständig vernichtet werden. Diese Pflanzen sollten als Bestandteile einer intakten Natur in einem bestimmten Bestand auf den Feldern erhalten bleiben. Lediglich eine Reduzierung der Wildkräuterdichte sollte den Nutzpflanzen Bedingungen für ausreichende wirtschaftliche Erträge geben. Wildkräuter wurden durch Jäten, Hacken und Bürsten nur so weit reduziert, so dass den Nutzpflanzen genügend Nährstoffe zukommen, die ökologische Vielfalt jedoch nicht abgetötet wird.
Anbauverbände strukturieren ihre Regeln
Jahrzehnte später, in den 1970er Jahren, entstanden mehrere bis heute tätige private Anbauverbände: Biokreis (1979, regionaler Schwerpunkt), Naturland (1982, Initiative wissenschaftlich orientierter Landwirte und Verbraucher) sowie Ecovin (1985, Weinbau). Diese schrieben ihre jeweiligen Produktionsregeln auf und machten dies für ihre Mitglieder verbindlich.
Landwirte konnten Mitglied dieser Verbände werden. Sie mussten sich verpflichten, die Produktionsregeln des Verbandes einzuhalten. Im Gegenzug erhielten sie von den Verbänden Vermarktungshilfe, Beratung und bessere Möglichkeiten, sich mit anderen Landwirten auszutauschen. Dies gilt bis heute.
2021 wirtschafteten 35.716 Höfe in ganz Deutschland nach den Grundsätzen der EU-Öko-Verordnungen. Davon waren 16.744 Betriebe (ca. 47% aller Öko-Betriebe) Mitglied in den 8 deutschen Öko-Anbauverbänden. Die teilweise deutlich verschiedenen durchschnittlichen Betriebsgrößen deuten auf unterschiedliche agrarstrukturelle Gegebenheiten im Einflussbereich der Verbände.
Verband
Anz. Mitglieder
Fläche gesamt (ha)
Fläche je Mitglied (ha)
Bioland
7.744
488.912
63,13
Naturland
3.721
286.405
76,97
Demeter
1.599
106.486
66,59
Biokreis
1.285
82.236
63,99
Biopark
509
111.416
218,89
Gäa
385
43.796
113,76
Ecovin
241
2.722
11,29
Verbund Ökohöfe
134
16.164
120,63
Ecoland
51
3.885
76,18
Im Marketing werben die Anbauverbände damit, dass sie ihre Mitglieder verpflichten, nach „härteren Kriterien“ als die EU-VO zu arbeiten. Das ist ein maßgeblicher Vorteil insbesondere für den Tierschutz.
Was die Verbände nicht mitteilen ist, dass die Erlaubnis zur Vermarktung von Öko-Erzeugnissen der Landwirte allein durch ein Zertifikat auf der Basis der EU-Öko-VO möglich ist. Dies erscheint mir sehr berechtigt. Mehrfach ist mir begegnet, dass Anbauverbände zum Schutz ihrer Marke der Öffentlichkeit verschweigen, dass einzelne Verbandsmitglieder sich nicht nach den vorgegebenen Regeln verhalten und damit Öko-Betrug begehen. Der Ausschluss von Öko-Betrügern vom Markt wird in der Praxis nur durch die rechtswirksamen Regeln der EU-Öko-Verordnungen sicher unterbunden, indem Betrüger auf dieser Basis zur Verantwortung gezogen werden. Damit ist der Verbraucherschutz der maßgebliche Vorteil der EU-Bio-Verordnung.
1988 schlossen sich die damals existierenden Anbauverbände in der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL) zusammen. Nun wurden gemeinsame Basisrichtlinien definiert, die den Mindeststandard der ökologischen Landwirtschaft beschrieben. Die AGÖL nahm die politische Interessenvertretung wahr. 2002 löste sich die AGÖL auf. Als neuer branchenübergreifender Spitzenverband aller Anbau-, Verarbeitungs- und Handelsverbände gründeten die Bio-Akteure noch im selben Jahr den Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), der seitdem die politische Vertretung der Branche als deutscher Dachverband wahrnimmt.