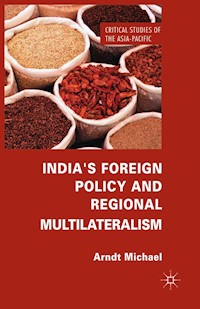Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Durch unsere Entwicklung durften wir lernen, ein selbstverantwortliches Leben zu führen. Wer sollte es uns dann verwehren, auch selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen? Serge, Alma, Giada und Marcell wollen so wie jetzt nicht mehr weiterleben. Ihre Beweggründe sind unterschiedlich; was sie eint, ist der Wunsch, ihre Entscheidungbewusst, selbstverantwortlich und in Würde treff en zu können. Sie wenden sich an Herrn Blau, der ihnen eine 12-tägige Klausur in der Stille, ohne Kontakt zu anderen auferlegt. Jeder der vier setzt sich dieser Stille aus. Jeder durchläuft seinen eigenen inneren Prozess. Jeder ist am Ende bereit für seine eigene Entscheidung. Der Sterbe- und Trauerbegleiter Michel Arndt will mit diesen vier persönlichen Sichtweisen zum vielstimmigen Diskurs über Sterbehilfe beitragen. Im Rahmen seiner Arbeit hat er die Erfahrung gemacht, dass die meisten Antworten auf Fragen und Probleme im Menschen selbst schlummern. Mit seinem Buch bietet er eine Art Spiegel an, in dem der Leser, die Leserin sich selbst etwaige Fragen stellen oder die im Buch gestellten für sich selbst refl ektieren können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Arndt
MEIN HERZ IST STILL UND WILL ES
Selbstbestimmt leben und sterben – vier freie Entscheidungen
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2023
Man hat nie Angst vor dem Unbekannten; man hat Angst davor, dass das Bekannte aufhört.
Jiddu Krishnamurti
Bibliografische Information durch die
Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über https://dnb.de abrufbar.
Lektorat: Barbara Lösel, Nürnberg (www.wortvergnügen.de)
Cover: Axel Voigt, Zirndorf, (www.folio-print.de), unter
Verwendung eines Fotos von Tim Johnson/pixabay
Copyright (2023) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
INHALT
Vorwort
Herr Blau
Einstimmung
Morgen geht gestern nicht weiter – Serge Carré, 36 Jahre, verheiratet, eine Tochter, Lungenkrebs im Endstadium
Im Bistro
Herr Blau
Das Ferienhaus
Die Klausur
Anne-Marie und Mijou
Die Holzschachtel
Die Geburtstagsbriefe
Vernunft ist etwas für Optimisten!
Le fil de la vie est mince
Ein schlechter Tag
Freude mit Schatten
Ein Buch: Das Leben. Gebrauchsanweisung
Du fehlst mir
Der letzte Geburtstagsbrief
Ohne Macht
Der zwölfte Tag
Ich muss nicht erst Verzweiflung erfinden, um Schluss zu machen – Alma Le Bon, 89 Jahre, verwitwet, zwei erwachsene Kinder
Zigarillos und Bücher
Nicolas
Das Fotoalbum
Meine Liebsten!
Die Fliege
Ohne Laufmaschen kein Leben!
Sartre
Der Eintopf
Erinnerungen
Eine gesättigte Lösung
Der Tag fließt dahin
Herr Blau
Mein letzter Tag …
Ein Wolf, der das Wild nur noch mit den Augen verfolgt – Giada Masia, 69 Jahre, alleinlebend, Landwirtin
Der Kreis
Am Meer
Herr Blau
Unterm Sternendach – À l’hôtel de la Grand Ourse
Unter Schafen
Bella
Die Wölfin – la louve
Auberge des Carpes
Von Angesicht zu Angesicht
Einvernehmen und Lust
Jahreszeiten
Die Übergabe
Unvollendet
Dank
Das Band ist gerissen
Les enfants du paradis
Das Meer
Wer sich selbst erkennt, ist verantwortlich – Marcell Hibou, 58 Jahre, katholischer Geistlicher
Eine Tür öffnet sich …
Nach einer kurzen Nacht
Die Nacht verbeugt sich vorm Tage
Ein Troll
Die Brust eines Mannes
Der Schreibtisch
Ohne Traum
Der Spiegel
Unruhiges Meer
Chère Madame
Das Gespräch
Der neue Tag
Ausklang
Nachwort
Dank
VORWORT
Dies ist ein Buch über den freien Willen, über die Würde des Menschen. Mit diesem Buch möchte ich zum vielstimmigen Diskurs über die Sterbehilfe beitragen.
Zum grundlegenden Verständnis eine Begriffsklärung:
Ein Suizid ist die vorsätzliche Beendigung des eigenen Lebens. Suizid: lateinisch sui, seiner [selbst], und caedere, töten. Im Deutschen sprechen wir von Selbstmord und Freitod – zwei Bezeichnungen, die gegensätzlicher nicht sein können.
„Selbstmord“ hat die Ursache im Äußeren (z. B. das Gefühl, nicht gesehen zu werden; Sinnverlust; Depression), die i. d. R. zu einer Verengung der Wahrnehmung führt. Somit ist eine freie Entscheidung fragwürdig.
„Freitod“ ist ein autonomer Entschluss aus dem Inneren; gewachsenes, erwachsenes Leben in Achtsamkeit, gereift zur Entscheidung für die eigene Würde.
Wir alle wissen, dass wir sterben müssen. Wir wissen eben (noch) nicht, wann und wie.
Ich habe Menschen als Seelsorger, Sterbe- und Trauerbegleiter unterstützt und kenne Suizidenten wie auch ihre trauernden Hinterbliebenen; zwei völlig unterschiedliche Situationen! Suizidenten sind eher verzweifelt und nehmen akut nur ihr Leid war, nicht die möglichen Folgen ihrer Handlung. Und ihre Hinterbliebenen (Suizid-Trauernde) sind i. d. R. sprach- und fassungslos, hilflos der Warum- und Schuldfrage (hätte ich es nicht eher sehen müssen!?) ausgesetzt. Noch hinzu erfahren sie i. d. R. leider immer noch eine Ausgrenzung durch andere (z. B. Freunde, Nachbarn).
Der „Motor“ für die Gestaltung unserer Würde ist unser freier Wille. Und der Staat hat diesen freien Willen mit Gesetzen zum Schutze aller zu regeln. Durch das BGH-Urteil vom 26.02.2020 (2 BvR 2347/15) waren die Parteien aufgefordert, Gesetzentwürfe vorzulegen.
Der Kern des BGH-Urteils besagt zusammengefasst:
„Jeder hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Dies schließt die Freiheit mit ein, sich selbst das Leben zu nehmen und sich dabei von anderen helfen zu lassen. Dieses Recht ist nicht auf schwere oder unheilbare Krankheiten beschränkt. Es besteht in jeder Phase des Lebens.“ (Klaus Hempel; ARD, 2020)
Leider sind am 06.07.2023 zwei Gesetzesentwürfe von fraktionsübergreifenden Gruppen über eine Neuregelung der Suizidhilfe mehrheitlich zurückgewiesen worden. Somit muss das Gesetz neu beraten werden.
Der freie Wille verlangt uns Eigenverantwortung ab. Freiheit ist eine Zumutung!
Fragt man, warum ein geflüchteter Ukrainer, der durch die Rückkehr ins Kriegsgebiet sein Leben in Gefahr bringt, eher akzeptiert wird, als eine andere Person, die sich aus welchem Grund auch immer suizidiert, so wird das Spannungsfeld deutlich, in dem wir uns bewegen, wenn wir uns mit dem Begriff Freiheit auseinandersetzen. Hier kommt die Moral ins Feld. Und die Moral, wie die Geschichte zeigt, ist jederzeit verhandelbar.
Grundsätzlich kann man sagen: Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Auch wenn er ein Individuum ist, so kann er sich dem sozialen Kontext nicht entziehen. Folglich gibt es eine innere Freiheit (z. B. Gewissens- und Meinungsfreiheit) und eine äußere (z. B. Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit). Nichtsdestotrotz müssen wir, so wir volljährig sind, unser Leben selbst verantworten; der Staat macht das nicht für uns. Wenn Gesetze im gegenseitigen Respekt und auf Augenhöhe vereinbart werden, so bildet dies die Grundlage für die Akzeptanz in einer Gesellschaft. Institutionen wie z. B. der BGH kontrollieren und überprüfen diese Vereinbarungen. In diesem Sinne müssen Gesetze dann vom Gesetzgeber natürlich zum Wohl aller einen Schutz vor Missbrauch beinhalten. Was die Sterbehilfe betrifft, kann dies die obligatorische Einrichtung eines Beratungsangebotes sein.
Ich habe bewusst kein Fachbuch geschrieben, sondern erzähle von vier Menschen, die in sehr persönlichen Prozessen ihre existenzielle Entscheidung für oder gegen den Freitod deutlich machen. Hierfür nehmen sie die Hilfe von „Herrn Blau“ in Anspruch.
Herr Blau ist eine Metapher für das gesellschaftlich geregelte Ja zum Suizid. In den diversen Gesetzesentwürfen soll u. a. im Bundestag noch geklärt werden, wie viel professioneller Beratungsbedarf (ähnlich bei Schwangerschaftsabbrüchen) nötig ist, um die „Erlaubnis“, Suizid begehen zu können, zu erhalten. – Der Beratungsbedarf ist hier gleichzusetzen mit der Klausur in der Stille, in die sich die Protagonisten begeben – die unabdingbare Voraussetzung, die Herr Blau von ihnen für ihre Entscheidung verlangt.
Mit diesen vier Beispielen biete ich eine Art „Spiegel“ an, in dem der Leser, die Leserin sich selbst etwaige Fragen stellen oder die im Buch gestellten für sich selbst reflektieren bzw. beantworten können.
Durch meine Begegnungen mit Menschen habe ich selbst sehr konkret erleben dürfen, dass die meisten Antworten auf Fragen und Probleme im Menschen selbst schlummern (ressourcenorientiertes Arbeiten); wir sind nur dazu da, diese Schätze heben zu helfen; deshalb dieses Buch.
Michael Arndt
Juni 2023
HERR BLAU
In jedem Ort gibt es auf dem Friedhof ein Quartier des Bleus. Unser Geschlecht ist älter als jeder Friedhof. Auch wenn einige sagen: „Verschwinden Sie! Sie wissen doch nicht, was es heißt, eine Liebe zu verlieren! Vas te faire cuire un œuf!“, so bin ich, Herr Blau, das große Nein und Ja zugleich. Eben das öffentliche Ärgernis, eine Art sichtbarer „Teufel“, der die Erinnerung ans Paradies wachhält, so dass es ihn wirklich geben muss. – Jeder weiß, wo ich zu finden bin. Manch einer hebt den Hut im Vorübergehen. Eine andere spuckt verächtlich. Und doch bleibt eine gewisse Milde erhalten.
Ja. Ich bin Herr Blau, die Fortsetzung der Kirschblüte, der Gang zum Markt, die gefüllten Netze der Fischer und Hausfrauen. Ich bin die Suppe, die jeder auslöffelt. Der Duft von Anis und vom Flieder. Ich bin das Warten. Auch die Neugierde der Menge. Ihr Blick; eine echauffierte Mischung aus äugender Unsicherheit und heimlicher Bewunderung. Das Vergebliche schlechthin. Ich bin immer mit dabei. Ich bin der Betrachter des Seestücks über dem verschlissenen Sofa von Madame Charlotte. Das Wiegen der Hüften und der damit einhergehenden Gedanken und Begehrlichkeiten. Ich bin Ihre Entscheidung.
EINSTIMMUNG
Hier ist die Ewigkeit.
Dort – alles.
Weit oben? –
Nein.
Weiter rechts? –
Gibt es eigentlich einen Osten oder Süden im Universum? –
Egal!
Sagen wir einfach: Dort!
Wir sagen einfach: Dort ist die Sonne.
Dort die Erde.
Unser blauer Planet.
Dort unten steht eine weiße Mauer.
An dieser Mauer lehnt ein kleiner, untersetzter Mann. Er lächelt. Die Stirnglatze glänzt wie die wenigen schwarzen Haarsträhnen, die sich scheinbar gewillt und fast zärtlich der Krümmung der Kopfhaut anschmiegen. Als ob Mauer und Mann eine innere Verwandtschaft pflegen, stehen sie der morgendlichen Sonne zugewandt. Keinerlei Unruhe haftet an ihnen, noch sind sie Objekt irgendeiner Begierde.
Unter dem geschlossenen Augenpaar fügen sich die Lippen des Mannes der Zufriedenheit. Der Tag ist gerade sechs Stunden alt und eine vor Blau strotzende Luft füllt schon den Himmel über dem kleinen Ort. Eine betagte Frau kommt mit einem Weidenkorb, dessen Tragegriffe durch sorgsam, dicht an dicht umwickelte Bindfäden gehalten werden, an ihm vorüber.
„Guten Morgen, Herr Blau.“
Der Mann an der Mauer blinzelt, nickt und hebt die Hand mit dem schwarzen Hut.
„Das wird ein Tag, Madame Charlotte!“
Und schon ist sie vorüber. Der Weg mit den buckeligen Pflastersteinen glänzt wie ein primitiv zusammengesetztes Spielbrett. Andere Frauen mit ebensolchen Körben oder hüpfenden Kindern an den Händen folgen in die gleiche Richtung dem Weg zur Kirche.
Heute ist Markttag.
Als keine Gestalt mehr des Weges kommt, hebt Herr Blau seine Augen. Sein streunender Blick saugt das Licht des gelungenen Morgens ein.
„Das wird ein Tag, Monsieur!“
Als ob eine Entscheidung notwendig geworden ist, streicht eine Hand, sich der gewohnten Rundung des Schädeldaches vergewissernd, über Haupt und Haar, setzt den Hut auf und geht. Zielsicheren Schrittes begleitet ihn der Schatten auf dem Weg zum Marktplatz. Dort findet das Leben zweimal in der Woche seinen öffentlichen Ausdruck.
Als der Mann das Bistro neben dem kleinen Zeitschriften- und Tabakladen erreicht, setzt er sich an einen Tisch, schlägt die Beine übereinander und betrachtet so, als ob ihn das ganze Treiben hier nichts anginge, das Geschehen.
Ohne Eile kreuzen nahende und sich im Marktgeschehen verlierende Menschen sein Blickfeld. Allmählich füllen sich die Körbe und Taschen so wie das Sonnenlicht die Gassen. Das, was die Welt um den kleinen Ort am Meer hervorbringt, wird auf dem Marktplatz feilgeboten.
Verschiedene Obst- und Gemüsesorten türmen sich neben meerfrischem Fisch, Muscheln und Krebsen. Die geöffneten Mäuler der aufgebahrten Forellen erinnern an einen finalen Gesang, dessen Ende von einer Fermate scheinbar unendlich verlängert wird. Am Stand vis-à-vis hängen ortstypisch gewürzte Lammschinken und Schweinswürste im Koriander- und Thymianmantel im Morgenlicht. Nebenan werfen gehälftete, rohe Schlachtkörper Schatten, unter dem ein Paar äugende Hühner, Enten und stoisch kauernde Kaninchen auf Kundschaft harren. Ein herber Geruch entströmt dem Tisch mit den kleinen nach oben konisch zulaufenden Käsezylindern aus Schafs- und Ziegenmilch. Ihre Haut scheint mit Asche paniert zu sein. Eier, Honig, Gewürze, verschiedene Weine in Flaschen, Mandeln, Obst und Öle, einfache Decken und Kleider, Gegenstände des täglichen Bedarfs für Haus, Hof und Land reihen sich Stand für Stand aneinander.
Kurz nach dem allmählichen Abbau der Stände erhebt sich Herr Blau, bezahlt und geht. Wie jeden Tag im Jahr wendet er sich der Kirche zu, um dort gegen vierzehn Uhr seinen gewohnten Platz unter dem großen Baum einzunehmen. Jeden Tag kommt er dabei am Haus der Familie Valcure vorbei.
„Bon jour, Mesdames et Messieurs Valcure.“
Scheinbar einem stillschweigenden Ritual verschrieben, dringt kein Ton über ihre Lippen. Das Ehepaar Valcure sitzt, so lang das Wetter gut ist, den ganzen Tag auf seiner Bank. Zwei dunkle Augenpaare folgen interessiert den alltäglichen Geschehnissen vor ihnen auf der Straße. Beinahe synchron verfolgen die Blicke der Eheleute einen vorbeifahrenden Wagen oder sie bleiben an zwei Frauen, die ins Gespräch vertieft mit ihren Besorgungen von dannen gehen, hängen. Wie Besucher einer Tennisveranstaltung, die dem unbedingten Reiz unterliegen, fortwährend der Flugbahn einer hellgelben Filzkugel zu folgen, sitzen sie einmütig vor ihrem Haus, das einmal ihrer Tochter gehörte. Jeder im Ort weiß von dem tragischen Tod der jungen Frau. Sie stürzte sich hochschwanger vom Kirchturm. – Wie keilriemenbetriebene Jahrmarktfiguren sitzen beide stumm nebeneinander. Madame Valcure thront in einer feuerwehrroten Strickjacke, unter der sich zwei bauschige, kissengroße Brüste zu verbergen suchen, neben ihrem Mann. Die hagere Männergestalt mit der Sonnenbrille verliert sich neben der ihrem Namen alle Ehre machenden Ehegattin. Ein wagenradgroßer Sonnenhut beschattet ihr breites Gesicht. Immer noch scheint trotz allem von ihrer voluminösen Leibesfülle ein Hauch von Jugend, eine Idee von Begehrlichkeit auszugehen; ein weiblicher Monolith aus Form und Farbe neben einem dürren Graureihermännchen, das notdürftig die zu groß geratene Sonnenbrille mit einem Bindfaden hinter dem Nacken gesichert hat. Eine alte Militärmütze beschattet die fettigen Haare. Der grobe Stoff der dunklen Arbeitskleidung scheint den Charakter seines Überlebensrezepts in dieser Ehe zu verraten. Einvernehmlich bewegen sich ihre Köpfe.
Im Weitergehen vernimmt Herr Blau das Quietschen von Fensterangeln.
„Herr Blau, es ist schon weit nach Mittag. Kommen Sie doch, bevor die Suppe kalt wird.“
Im Fenster des gegenüberliegenden Hauses bedeutet ihm die alte Frau vom Vormittag zu kommen.
„Gewiss doch, Madame Charlotte, ich komme.“
Aus dem weißen Teller steigt heller Dampf in sein Gesicht.
„Riecht köstlich, Madame Charlotte, einfach köstlich!“
„Ich weiß, die Reste sind das Beste, Herr Blau.“
„Hm … die Reste … das Beste“, murmelt er. Und splitternd bricht das Weißbrot, bevor er es als handliches Stück in die safranfarbene Suppe taucht.
„Fisch und Estragon: eine gute Ehe, Madame Charlotte.“
Sie lacht leise und saugt hörbar die Flüssigkeit vom quergestellten Löffel.
Als der Tisch abgeräumt und die Teller unter fließendem Wasser wieder hell geworden sind, weist sie auf ein altes Chaiselongue unter einem mächtigen Seebild, das aschgelb vom langen Warten auf Wind geworden ist.
„Dort können Sie ruhen, Herr Blau. Sie wissen, mein Mann … Er hatte immer sein Nickerchen gemacht. Ich wecke Sie beizeiten.“
„Sehr freundlich, Madame Charlotte, überaus freundlich. Danke.“
Sanft und bestimmt zugleich ist die Stimme, die ihn auffordert, die Augen zu öffnen und zu erwachen. Die alte Frau vor ihm ist die Gewissheit selbst. Ihre unprätentiöse Art, der selbstverständliche Klang ihrer Stimme, die weder Hof hält noch einen anderen hofiert, sind es, die die Gegenwart dieser Frau für ihn so überaus angenehm sein lässt. Jedes Mal, wenn er in diesen kleinen Ort kommt, eröffnet sich hier auf die natürlichste Weise ein beinahe familiärer Hort. Ein Heim, das den Kindern zeitlebens ein Dach, eine Suppe, ein Bett, ein Wort, eine um alle Dinge wissende Stille bereithält – mag da doch kommen, was da wolle. In seinem Innern, besonders dort im Raum unterhalb der verknöcherten Fontanelle, dort spürt er, dass sie die Einzige im Ort ist, die ihn nicht fragen wird, die weder Rat verlangt noch gibt.
In ihrer Wohnung, die nur aus einer Wohnküche und einer winzigen Schlafkammer besteht – die Notdurft wird im Hof im Häuschen neben dem Federvieh verrichtet – scheint die Zeit schon seit einem halben Leben stillzustehen. Es ist so, als hätte die Zeit hier ein Zuhause, um vom fortwährenden Ticken einmal auszuruhen. Alle Dinge sind wie vordem, jedes an seinem angestammten Platz, jederzeit auffindbar und nutzbringend zu gebrauchen, jeglicher Frage nach Veränderung hohnlachend, da kein plausibler Grund dafür zu erkennen ist. Alle Gegenstände tragen die gleiche Patina aus Windstille und Annahme.
„Ich weiß, Madame Charlotte, die Zeit.“
„Ja, die Zeit, Herr Blau, die Zeit; das Wasser unterm Kiel, es wird bleiben.“
Verstehend kreuzen sich ihre Blicke.
Ein wissendes Schweigen nimmt zwischen ihnen Platz, sodass man das monotone Lied der tickenden Pendule über der Anrichte neben dem Fenster, das in den Hof hinausschaut, als einzige Unterteilung des angebrochenen Nachmittags vernimmt.
„Ich muss gehen, haben Sie vielmals Dank für Ihre Freundlichkeit. Auf Wiedersehen, Madame Charlotte.“
„Auf Wiedersehen, Herr Blau.“
MORGEN GEHT GESTERN NICHT WEITER
SERGE CARRÉ, 36 JAHRE, VERHEIRATET, EINE TOCHTER, LUNGENKREBS IM ENDSTADIUM
IM BISTRO
„Salut, Gaspard.“
„Salut, Serge. Du siehst erstaunlich gut aus. Geht es dir besser?“
„Komm, setzten wir uns hier hin. Ich muss mit dir sprechen. Es ist so eine Art Dringlichkeitssitzung.“
„Serge, was ist denn so dringlich? – Geht es dir nun besser oder nicht?“
„Klarer. Ich habe eine Entscheidung getroffen.“
„So. Eine Entscheidung. Erzähl.“
„Was willst du trinken?“
„Kommt drauf an, was du zu erzählen hast.“
„Ich nehm einen … – ach, lass uns eine Flasche Wein bestellen. Einen trockenen Roannaise, einen Roten, der ist gut hier. Der hat nicht so viel Umdrehungen.“
„Darfst du denn …?“
„Mir ist danach.“
„Meinetwegen. Aber nun erzähl schon. Was ist los?“
„Du weißt doch noch, wie alles angefangen hat, mit den Schmerzen in der Brust. Das war, du erinnerst dich, letztes Jahr an meinem Geburtstag.“
„Ich erinnere mich.“
„Dachte, es sei das Herz. Doch es war Krebs.“
„Das weiß ich doch alles. Komm zum Punkt!“
„Gaspard, es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen. Ich habe jeden verdammten Tag das Gefühl, dass ich bald sterbe. – Es ist schwer auszuhalten, diesen Moment nicht zu wissen … Wie lange noch? Wie wird das weitergehen? Verstehst du?“
„Ja – ja, ein bisschen … Erzähl weiter, Serge, ich hör dir zu.“
„Erst die Diagnose. Dann diese Scheißmetastasen! Überall. Erst im Rippenfell, dann im Kopf und jetzt auch noch in den Knochen. Ich will das alles nicht mehr.“
„Was willst du nicht mehr?“
„Leben.“
„Du spinnst doch. Du weißt doch gar nicht, hast du selbst gerade gesagt, wie lange du noch hast.“
„Der Krebs ist so aggressiv. – Er wächst schnell. Er hat es auf einmal unheimlich eilig. Ich jetzt auch.“
„Du hast es immer eilig gehabt. Denk an deinen Radsport im Klub.“
„Das meine ich nicht, Gaspard. Früher, da habe ich darüber nie nachgedacht. Doch jetzt … Das, was mir noch bevorsteht, das möchte ich nicht erleben. Das möchte ich auch meiner Familie ersparen. Das sind seltsame Gedanken, ich weiß. Plötzlich ist die Freiheit weg. Verstehst du? Die Freiheit. Ich hab nur noch die Freiheit zu gehen. Alles reduziert sich auf wenig bis gar nichts. Schau mich doch an, Gaspard! Ich bin kein Sportler mehr. Nein. Nur noch ein Witz mit Sauerstoffgerät.“
„Wissen Anne-Marie und Mijou schon davon?“
„Nein.“
„Und deine Mutter?“
„Auch noch nicht. Deshalb sprech ich ja mit dir.“
„Schönes Gespräch … Was willst du machen?“
„Gehen.“
„Und wann?“
„In etwas mehr als zwei Wochen.“
„Wie? Zwei Wochen? Und dann ist Schluss?“
„Ja.“
„Du bist verrückt! Du willst dich umbringen?“
„Ja.“
„Das ist nicht okay, Serge, überhaupt nicht okay. Das machen doch nur Irre!“
„Gut, dann bin ich eben ein Irrer, wenn du meinst. – Doch du steckst nicht in meiner Haut! Ich habe Schmerzen, nicht du. Zumindest nicht die.“
„Brauchst du Mitleid?“
„Weder Mitleid noch fromme Sprüche. Ich brauche Ruhe. Klarheit. Ein Ziel, verstehst du. Ich will wissen, wann Schluss ist. Diese Ungewissheit halte ich nicht aus.“
„Du gibst dich auf?“
„Nein. Ich geh es an. Der Krebs oder ich – das ist nicht mehr die Frage. Der Krebs gewinnt. Das ist sicher. Und bevor er das tut, geh ich ihm lieber entgegen. Ich! Nicht dieser Vielfraß!“
„Wie?“
„Erhängen, Tabletten und so, das alles kommt nicht in Frage. Ist mir zu unsicher. Ich will nicht am Erbrochenen ersticken, weil ich alles Mögliche geschluckt habe. Ich möchte hinterher nicht wieder aufwachen. Die größte Strafe für mich wäre, weiterzuleben. Was passiert, wenn es schiefgeht? Eine Zwickmühle. Verstehst du? – Und auch wenn du mich da nicht verstehst: Es gibt Seiten, die nur einem selbst gehören.“
„Und Hoffnung? Gibt es die für dich überhaupt nicht?“
„Sich daran zu klammern, wäre sinnlos. Es raubt mir die restlichen Kräfte, die ich noch für den letzten Weg brauche.“
„Wenn ich dich so reden höre, Serge, vielleicht hast du ja recht: Ja, bislang ist es noch jedem gelungen, zu sterben.“
„Gaspard, über die Krankheit kannst du scherzen, nicht übers Sterben. Sterben ist nicht Teil des Witzes.“
„Entschuldige – ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll.“
„Ist schon gut. Ist eben alles nicht einfach. Auch für dich nicht. – Ich möchte so klar wie möglich aus dem Leben gehen. Möchte auch noch Zeit zum Abschiednehmen haben. Wer weiß denn schon, ob ich mich morgen noch erkenne? Du weißt, es gibt keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr. Ich bin austherapiert – unheilbar. Ich kann nichts dafür, dass am Ende die Ärzte das Gefühl haben, zu versagen. Mit meiner Entscheidung nehme ihnen sogar ein Stück weit die Verantwortung ab. Verstehst du?“
„Und palliativ? Ich hab gehört, dass man da überhaupt keine Schmerzen am Schluss haben muss.“
„Im Regelfall ist das so. Doch auch der Rest ist mir zu unsicher. Außerdem geht mir die gebetsmühlenhafte Wiederholung der Alternativlosigkeit der palliativen Medizin auf die Nerven.“
„Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie.“
„Ich treff mich morgen mit einem Mann.“
„Wer ist das?“
„Eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit unter vielen.“
„Was für eine Möglichkeit?“
„Es ist eine Vereinbarung.“
„Eine Vereinbarung?“
„Morgen weiß ich mehr.“
„Und dann?“
„Weiß ich mehr.“
„Und wie?“
„Weiß nicht. Wird er mir erzählen. Ich weiß nur, dass er die Tage begrenzen kann. Und nur das zählt für mich.“
„Ist das nicht strafbar?“
„Suizid ist nicht strafbar. Und wenn ich umfalle, dann wird keiner erkennen können, dass das geplant war. Somit ist es auch nicht strafrechtlich relevant. Ich will lieber aufrecht sterben, als auf Knien leben. Gaspard, die Freiheit kann man nicht erfinden. Du musst sie möglich machen.“
„Sind wir denn überhaupt frei? Sind wir nicht eher abhängig?“
„Wir sind abhängig, das siehst du ja an meiner Situation. Doch wenn ich die Möglichkeit dazu habe, meine Abhängigkeiten selbst zu wählen, dann wähle ich. Nelson Mandela war jahrzehntelang im Gefängnis. Doch sein Geist sah keine Gitter.“
„Was wäre denn, wenn morgen …“
„Ach wäre … Gaspard, wäre ist nicht! Du hast mich noch immer nicht verstanden! Es gibt keine Rettung. Dieser Abschied, dieser Scheißabschied, besonders der von Anne-Marie und der Kleinen … Entschuldige bitte … Es ist so heftig … Hätt Mijou doch so gern noch begleitet, wenigstens bis sie aus dem Gröbsten heraus ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihnen das sagen soll. Hab richtig Schiss davor. Das ist schlimmer als der Tod. Glaub mir.“
„Wann willst du es denn sagen?“
„Ich bin feige, ich weiß. Ich weiche dieser Begegnung aus. Hab gedacht, ich schreib es ihnen.“
„Die haben aber ein Recht darauf, es von dir persönlich zu erfahren.“
„Das ist persönlich. Stell dir nur vor, du müsstest …“
„Ich muss aber nicht. Will mir das auch gar nicht vorstellen.“
„Ja, genau, das ist es, Gaspard. Genau das! Du willst es dir nicht vorstellen. Doch du musst! Du musst das in meiner Situation. Das ist ja das Brutale. Gerade den beiden möchte ich das nicht antun müssen. Gerade ihnen nicht! In der Fantasie kann man problemlos von einem Hochhaus springen, ohne sich zu verletzen; in der Wirklichkeit, Gaspard, finde ich mich danach bestenfalls auf einer Intensivstation wieder. Und auch da wollen sie mich nicht mehr.“
„Das klingt alles sehr düster. Du scheinst mir pessimistisch, resigniert und auch, wenn ich dir so zuhöre, depressiv zu sein.“
„Soll ich etwa positiv denken, meinst du das? Möchtest du, dass ich mich gleich in einem Kreißsaal erhänge? Jeden Tag eine Scheinhinrichtung, das will ich nicht!“
„Serge, nun beruhige dich. Bitte. Du musst etwas Geduld mit mir haben.“
„Ja, ja, ich weiß, mein dritter Vorname ist Geduld, Gaspard. Mir geht es einfach nicht gut. Nicht wegen morgen. Nein. Wegen den beiden und dir. Aber sprechen wir von etwas anderem. Erinnerst du dich an unsere schöne Anglerzeit? Wo wir fast jedes Wochenende mit dem Boot rausgefahren sind?“
„Ja, das war eine schöne Zeit.“
„Wir beide, du und ich, sind raus. Eigentlich um was zu angeln. Doch meistens haben wir nichts gefangen, sondern haben einfach diese Weite, diese besondere Stille um uns genossen.“
„Ja, das haben wir.“
„Weißt du noch, dieser Barsch, dieser kraftvolle Bursche? Der hat die Schnur fast zum Reißen gebracht. Wir staunten über diese immense Kraft und zogen den Hut vor ihm. Wir schnitten die Schnur durch.“
„Ja, das hatte er sich verdient.“
„So ähnlich geht es mir. Gebt mir bitte die Erlaubnis, meine Schnur durchzuschneiden.“
„Uh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Es ist schwer, Serge, so schwer, dich ziehen zu lassen nach all dem Erlebten. Eigentlich war uns doch das Fischen egal. Wichtig war, dass wir zusammen im Boot saßen. Jedes Mal berührte uns eine große Hand, Serge, eine Hand aus aufziehendem Wetter, aus leichtem Dümpeln, aus den wechselnden Schatten am Ufer, aus glitzerndem Wasser und den in unmittelbarer Nähe aufspringenden Fischen, die unser Vorhaben verspotteten.“
„Oui, c’est vrai, mon ami. Auf das Leben! Auf das Leben, was noch da ist.“
„Auf das Leben, Serge.“
„Genau das haben wir in solchen Momenten dann auch getan. Wir entkorkten die Weinflasche und ließen es uns gut gehen. Solche Momente waren uns heilig und viel zu selten. Und doch! Wir haben sie erlebt, erleben dürfen! Ein gelebtes Glück. Und wer, bitteschön, hat schon Glück in dieser Welt? Ich glaub, nicht viele.“
„Ja, Serge, wir hatten Glück. Und du hast Glück mit deiner Anne-Marie und Mijou. Und deshalb musst du auch mit ihnen sprechen. Versprichst du mir das?“
„Das kann ich nicht. – Ich muss mir alle Kraft genau einteilen, sonst schaff ich das nicht. Und wenn noch Kraft und auch Zeit übrigbleiben, dann spreche ich mit beiden. Mehr kann ich momentan nicht sagen.“
„Bist du nicht katholisch? Wie kriegst du das denn mit dem da oben hin?“
„Wenn ich mich an früher, an die Zeit in Yvetot erinnere, als ich jeden Sonntag die Hostie vom Pfarrer erhielt – ich glaubte damals wirklich daran –, hatte ich ein Gefühl, als ob der Postbote mir gerade ein Rundumsorglos-Paket gegeben hätte. Doch heute … Mir fällt es sehr schwer, mir irgendeine Vorstellung davon zu machen. Es hilft mir nicht. Und wenn ich an meinen Bettnachbarn im Krankenhaus denke: Vier Wochen wurde er am Leben gehalten! Leben konnte man das nicht nennen, Gaspard. Wille und Würde schon gar nicht! Er ist jämmerlich in der Nacht erstickt. Und wenn ich zuletzt noch an meinen Arzt denke, der zu mir gesagt hat: ‚Wir haben nicht mehr genügend Zeit dafür, dass Für und Wider einer erneuten Bestrahlung zu diskutieren. Am besten, Sie bringen Ihre Angelegenheiten in Ordnung.‘ Ja, das waren seine Worte: Bringen Sie Ihre Angelegenheiten in Ordnung. – Und … und auf meine Frage, ob er mir nicht beim Sterben helfen könnte, schüttelte er nur den Kopf und sagte: ‚Bedaure, nein.‘ Vielleicht kannst du jetzt verstehen, dass ich selbst entscheiden muss! Die Nächte danach … waren für mich schrecklich. Diese unheimliche Leere, diese drohende Stille am Rande einer Ohnmacht. Ich will mutig sein. Noch kann ich es. Mich nicht mehr entmutigen lassen. Verstehst du das?“
„Ja, mehr und mehr.“
„Hast du mal den alten japanischen Film von Kurosawa gesehen, Rashomon?“
„Nein. Was ist damit?“
„Gaspard, wir beide, wir sitzen hier zusammen und jeder nimmt das, was hier gerade passiert, doch anders wahr. Jeder ist allein damit. – Und dieses Alleinsein war es, was mich damals an dem Film berührte und auch bestürzte. Die Gemeinsamkeit ist eine Illusion. Jeder hat andere Erfahrungen und kommt zu eigenen Schlüssen. In der Geschichte wird eine Situation, ein Überfall war es, mehrmals aus der unterschiedlichen Sicht der Beteiligten erzählt. Jedes Mal hatte sie eine andere Bedeutung. Und du und ich sehen durch unsere Brille und erzählen auch etwas anderes. Damals überraschten mich meine blauäugigen Gefühle. Und heute, Gaspard, heute fühl ich mich wie ein Autist, wie ein Pfefferstreuer! Keiner hat Mitleid, weil er nur ein Loch hat … zum Atmen. Der Salzstreuer hat drei.“
„Wie willst du das mit Maman regeln, oder wirst du ihr auch nur schreiben?“
„Wenn ich an Maman denke, denke ich automatisch an die Zeit in Yvetot zurück. Immer wenn ich einen Ort verlassen habe, habe ich auch meine Erinnerungen an ihn dort gelassen. So entstand ein Graben, der mir guttat, je weiter ich mich entfernte. Und heute ist es egal, wie nah oder fern ich Maman bin; es lindert den Schmerz nicht. Apropos Schmerz. Wenn ich an das Verrecken – anders kann ich es nicht bezeichnen – an das Verrecken vom Alten denke … Nein. So möchte ich nicht enden! Ich konnte am Schluss nicht mehr mit ihm sprechen. Das Gefühl war immer da, dass er mir noch etwas sagen wollte. Wir haben uns verpasst. Zu seiner Beerdigung war der ganze Ort auf den Beinen. Und ich blieb zurück, zurück mit dieser Vergangenheit, die ich nicht mehr ändern konnte. Darum möchte ich dieses Leben friedvoll verlassen, nicht im Ringen nach Atem.“
„Du hast doch sicher eine Patientenverfügung?“
„Ja. Ich habe ein Testament, in dem alles für die Familie geregelt ist, und auch eine Verfügung. Kein Mensch darf über das Leben eines anderen verfügen … auch nicht die Gesellschaft oder der Staat. Doch eine Patientenverfügung ist auch nicht ganz sicher. Vielleicht hast du ja mitbekommen, dass die Sterbehilfe neu geregelt werden muss. Im bisherigen Sterbehilfegesetz war die Patientenverfügung für den Arzt nicht immer unbedingt bindend. Es gibt dafür entsprechende Beispiele. C’est tout.“
„Das wusste ich nicht.“
„Die bestehenden Gesetze gehen, meiner Meinung nach, am Menschen … an mir vorbei. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass mein Wollen nicht zählt. Es ist ein Gesetz gegen, nicht für den Menschen! Die Politiker müssten mal auf so eine onkologische Station gehen! Dann würde ihre Demenz abnehmen.“
„Was wünscht du dir von mir?“
„Was ich mir wünsche? Hm. – Ich wünsch mir von dir ein liebevolles Unterlassen, ein Lassen. Und …“
„Und …?“
„Pas de tristes. Keine Traurigkeit. Denk an unsere schöne Zeit. Und wenn du kannst, besuch ab und an Anne-Marie und Mijou. Das wäre schön.“
„Das mit dem Traurigsein kann ich dir nicht versprechen, Serge. Es fällt mir doch jetzt schon schwer. Doch das mit dem Besuch krieg ich hin. Versprochen.“
„Gut. Hast du denn schon mal für dich Bilanz gezogen? Oder überlegt, wie du dein weiteres Leben gestalten willst? – Ah, du schüttelst den Kopf.“
„Vielleicht überleg ich mir das. Aber nicht jetzt. Bist du denn trotz allem mit dem, was du bisher gemacht hast, zufrieden?“
„Im Großen und Ganzen ja. Haus, Frau, Kind, Freund, jedoch keinen Hund, kein Meerwasser-Aquarium mit seltenen Fischen, nur einen Kleinwagen von Hyundai und ab und an einen Urlaub. Deshalb gibt es für mich auch nicht die Frage: Hospiz oder Bordell? Kirche oder Bistro? Goldener Schuss oder Tabletten? Verstehst du? Kein Schuss, nur Schluss. Ich mach einfach Schluss.“
„Bedauerst du was?“
„Ja, dass es mit uns nicht weitergeht, Gaspard, das bedaure ich sehr. Und, und natürlich das mit meinen Lieben. – Vielleicht war ich, nein bestimmt war ich das, ungehalten und auch mal ungerecht, zu ehrgeizig und genau. Ich würde, wenn möglich, versuchen, es heute anders zu machen. Doch insgesamt …“
„Und Maman?“
„Nein, das mit Maman, ist für mich so in Ordnung. Hab immer einen besseren Draht zu Papa gehabt. Maman tut mir leid. Es tut mir leid, dass sie sich so zurückgezogen hat. Sie redet kaum noch mit mir. Sie tut sich selbst leid. Besonders, seit Papa tot ist.“
„Gibt es noch was?“
„Noch was? – Hm. – Ja, tatsächlich, es gibt noch was. Ich sag’s dir hier im Vertrauen, Gaspard. – Vielleicht, aber nur vielleicht, hätte ich, wenn ich als junger Mann damals mutiger gewesen wäre, eine andere geheiratet.“
„Ach, eine andere? Wen denn?“
„Eine junge Verkäuferin aus Rouen. Claire hieß sie. Damals war ich dort in der Ausbildung. Immer wenn ich das kleine Geschäft betrat, strahlte sie mich mit ihrem hellblauen Willkommensblick an. Knusprig wie die krossen Croissants aux beurre, die sie mir in die Tüte packte! – Wie gern hätte ich in sie, in die Hübsche, hineingebissen. – Ach, wie gern! Das Blau ihrer Augen lachte im Wissen um ihre Versuchung. Ich konnte leider nicht alles haben, was das Füllhorn des Übermuts mir bot.“
„Das stimmt, Serge. Du hattest ja immer große Auswahl.“
„Ja, das Leben war doch schön! Schon am Morgen vor der Arbeit, in dieser Backstube, wurde ich von ihm umarmt und angelächelt. – Hab sie sogar zu Tarte normande eingeladen. Doch ich war nicht hartnäckig, nicht schnell genug. Prompt zog sie mit einem anderen davon. Leider.“
„Das sagst du jetzt, Serge. Doch mit der Pflicht hattest du es damals nicht so. Trotzdem, ist schon verrückt, das alles. Hätte auch alles anders kommen können.“
„Wem sagst du das. Doch, Gaspard, entschuldige bitte, ich bin doch sehr müde geworden. Das Gespräch hat mich mehr angestrengt, als ich dachte. So viel geredet, hab ich lang nicht mehr. Drum ist es jetzt an der Zeit zuzulassen, dass der Rest der Welt sich um sich selbst kümmert. Das hat er eh getan. Sehr lange, vielleicht zu lange, habe ich mit dir so nicht geredet. Es hat mir gutgetan, Gaspard, mit dir zu sprechen.“
„Ach, Serge, mir geht es ähnlich. War gut, war sehr gut, das Gespräch. Und trotz allem: Egal, mon ami, wie du dich entscheidest. Es ist deine Entscheidung.“
„Dank dir. Komm her, lass dich umarmen, mein Lieber.“
HERR BLAU
„Bon jour, sind Sie Herr Blau?“
„Oui Monsieur …?“
„Ah … Carré, Serge Carré.“
„Enchantée. – Was führt Sie zu mir, Monsieur Carré?“
„Wie soll ich das sagen? – Bevor ich das Interesse an der Welt verliere …“
„… kommen Sie zu mir. Ich verstehe.“
„Da ich nicht eingeschläfert werden kann wie ein Hund …“
„Ja, das sind die üblichen Probleme, weshalb mich Leute wie Sie sprechen wollen. – Ich sehe, dass Sie Sauerstoff brauchen. Demnach sind Sie krank, sehr krank, Monsieur.“
„Oui.“
„Sie haben beschlossen …“
„Ja, ich habe beschlossen. Die meisten von uns – ich habe ein Lungenkarzinom im Endstadium – sterben innerhalb eines Jahres. Und ich will weder am Ende ersticken noch, dass ich mich nicht mehr wiedererkenne.“
„Das verstehe ich sehr gut. Deshalb gibt es mich. Es gibt mich quasi an jedem Ort, so man mich aufsuchen möchte.“
„La belle indifference ist nichts für mich. Ich habe Frau und Kind und möchte ihnen natürlich mein Dahinsiechen ersparen. Wissen Sie, Herr Blau, mein Kopf weiß, dass ich bald sterben muss, doch mein Herz …“
„Ihr Herz ist noch nicht so weit. Und Sie fühlen es: Aus dem Tod ernährt man kein Leben. Nicht jeder kann das, was Sie vorhaben. Es ist kein einfacher Entschluss.“
„Nein. Sicherlich nicht. Doch was muss ich tun, Monsieur? Ich will nicht elend ersticken müssen oder sonst wie leiden.“
„Das müssen Sie auch nicht. Sie kommen am zwölften Tag wieder genau an diese Stelle, reichen mir die Hand und … Ihr Sterben ist beschlossen.“
„Zwölf Tage sagen Sie?“
„Ja, zwölf. So lang ist die Vorlaufzeit. Eine Zeit, in der Sie sich zurückziehen müssen. Sie bleiben allein. Haben keinerlei Kontakt. Das ist die Bedingung. Das bedeutet, dass Sie mit keinem sprechen, auch nicht mit Familie oder Freunden. Sie gehen auch nicht aus dem Haus. Denn dort treffen Sie unweigerlich auf Menschen, die Sie kennen. Und das würde die Situation unüberschaubar machen. Sie bleiben ganz allein für sich. Es ist eine Art Überprüfung, eine Bewährungszeit, in der Sie sich ganz gewiss werden, was Sie am Ende wirklich wollen. Sie, Monsieur Carré, nicht jemand anderes!“
„So viel Zeit brauche ich nicht. Ich weiß, was ich will, sonst wäre ich ja nicht hier.“
„Das glaube ich Ihnen sofort. Doch um diesen Weg mit mir zu gehen, ist dies eine unerlässliche Bedingung, die erfüllt sein soll. – Und glauben Sie mir, Monsieur Carré: Viele haben sich danach anders entschieden. – Dafür ist diese Zeit. Und die, die sollten Sie sich und Ihrer Familie zuliebe nutzen. Ihr Leben ist nicht wiederholbar.“
„Zwölf Tage. Hm. – Das ist sehr lang. Ich habe auch Sorge, dass ich die Zeit vielleicht nicht überlebe oder dass die Metastasen im Kopf etwas anderes mit mir vorhaben.“
„Wie lang ist lang genug? – Das ist eine schwierige Frage. Ich kann Ihnen nichts anderes anbieten. Sie werden sehen: Zwölf Tage lösen sich auf wie Quellwolken. Der Tod nicht. Ich weiß nur, dass er da ist. Das Einzige, was ich vermag, ist, die Zeit ein wenig zu beschneiden. Sie gehen jetzt für zwölf Tage in die Stille der Klausur. Ich werde dann hier warten. So Sie beschließen, mich hier wieder zu treffen, und mir die Hand reichen, ist es besiegelt. Dann können Sie noch bestimmen, wie viele Tage sie noch leben wollen. Einen Tag oder maximal zwölf weitere.“
„Warum nicht gleich?“
„Weil die Menschen sehr unterschiedlich sind.“
„Und wie werde ich sterben?“
„Sie erlöschen wie eine Kerze, ohne Schmerzen.“
„… wie eine Kerze.“
„Ach, Monsieur, ich sehe, … Sie weinen. – Das ist gut. Wie gern würden Sie mit Ihrer Familie noch Jahre weiterleben. Es tut mir sehr leid, dass das so ist. Umso mehr habe ich großen Respekt vor Ihrem Entschluss. Sie warten nicht, bis man Sie holt. Nein. Sie wollen, so lang es noch geht, Ihr Leben gestalten.“
„Das wird meine letzte Übung sein.“
„Ja, für echtes Glück bezahlt man mit Tränen.“
„Das ist wohl mein letzter Frühling.“
„Oui, Monsieur Carré. – Das Gestalten und die Hilflosigkeit sind ein wesentlicher Teil des Menschen. Dazwischen lebt man. Geburt und Sterben sind gleich.“
„Versprechen Sie mir, dass …“
Sie haben doch Vertrauen in sich, Monsieur, sonst wäre Sie nicht hier. Es gibt so viele Arten zu leben und mit dem Tod umzugehen, wie es Menschen gibt. Jeder hat seine eigene Strategie. Ich bin für Sie da. Auch am zwölften Tag.“
„Gut. Einverstanden.“
„Ab morgen zwölf Tage. Und Sie werden sehen, dass diese Zeit eine ganz besondere ist, egal, wie Sie sich entscheiden werden. Sie ist immer ein Gewinn.“
„Vielen Dank, Herr Blau, vielen Dank und auf bald.“
„À bientôt, Monsieur Carré.“
DAS FERIENHAUS
Vor dem Haus von Gaspard.
„So schnell sieht man sich wieder, Serge.“
„Schön, dass du so schnell für mich Zeit hast. Ich war heute um vierzehn Uhr bei diesem Mann, von dem ich dir erzählt habe.“
„Und? Wie war er?“
„Okay. Und doch für mich erstaunlich. Drum habe ich eine Bitte an dich, Gaspard.“
„Erzähl, was kann ich für dich tun?“
„Ich muss zwölf Tage ganz allein verbringen. Darf mit niemanden Kontakt haben … auch nicht mit dir. Und … du hast doch dieses kleine Ferienhaus dort an der Küste. Das ist doch frei, oder?“
„Ja, das ist es. – Wozu zwölf Tage und dann allein?“
„Das ist die Bedingung. Und erst ab dem zwölften Tag kann ich dann endgültig entscheiden, wie viele Tage ich noch leben will.“
„Und wie viele Tage willst …?“
„Ach, Gaspard, das Ganze dauert mir viel zu lang. Möglichst bald. Kannst du mir das Haus dafür überlassen?“
„Ja. Das geht. – Es ist zurzeit frei.“
„Das ist sehr gut. Danke, dass du das für mich tun willst.“
„… und ich kann dich da nicht besuchen?“
„Nein. Ich darf keinen Kontakt haben. Soll mir alles noch einmal gut durch den Kopf gehen lassen. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass mein Entschluss steht.“
„Vielleicht ist das auch gut und du kommst doch noch zur Besinnung, Serge.“
„Wohl kaum …“
„Brauchst du noch was? Oder soll ich dir noch etwas besorgen?“
„Nein, ich hab schon alles dabei. Hier in den zwei großen Taschen. Medikamente, Sauerstoff, etwas zu essen und Wein. Ich brauch ja nicht viel. Wasser ist ja vorhanden. Was zu schreiben und noch ein paar andere Dinge. Kannst du mich hinfahren?“
„Jetzt sofort?“
„Ja, wäre gut.“
„Willst du nicht erst noch reinkommen und mit uns zu Abend essen?“
„Nein, Gaspard. Ich glaub es ist gut, wenn …“
„Okay. Dann steig schon mal ein. Ich sag bloß Bescheid, dass ich noch einmal kurz weg muss.“
Wir sitzen im Auto.
„Du sagst aber keinem …“
„Nein, nein. Bestimmt nicht. Hab ich mir schon gedacht …“
„Ja und noch etwas. Kannst du vielleicht nach drei Tagen zum Haus kommen und …?“
„Ich denk, du darfst …“
„Nein. Kein Besuch. Nur, dass du die zwei Briefe, die ich Ann-Marie und der Kleinen schreiben will, dass du die mitnimmst und einsteckst. Ich leg sie vorne in den Briefkasten. Du hast ja den Schlüssel dafür, Gaspard.“
„Okay, mach ich. – Wird wohl, so du dich nicht doch noch eines Besseren besinnst, das Letzte sein, was ich für dich tun kann.“
„Ach, Gaspard, – fahr mich einfach hin. Bitte …“
„Hier sind wir.“
„Ach, noch etwas … Kannst du mich am zwölften Tag, um halb zwei, nicht früher, wieder abholen? Ich treff ihn dann wieder, verstehst du, den Mann. Du brauchst mich nur bis zum Markt fahren. Das wäre gut.“
„Am zwölften Tag? – Okay, Serge, ich werde da sein.“
„Gut. Ich steig jetzt aus. Du brauchst nicht mitkommen. Das schaff ich schon. Und mach dir bitte keine Sorgen, ja. Wird schon schiefgehen … Komm schon her und lass dich noch einmal drücken, lieber Freund. Und: Danke.“
„Serge, mein Freund …“
DIE KLAUSUR
Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Ich verharre und lausche dem verklingenden Geräusch. Hier also wirst du bleiben. Ich bücke mich und gehe mit einer Tasche nach der anderen ins Wohnzimmer. – Ich habe die Fenster geöffnet, nun wende ich mich der Küche zu, um mir einen Tee zu machen.
Mit Thermoskanne, Teeglas und dem Rest von mir lasse ich mich in einen der Sessel fallen. Ich gieße ein und beobachte, wie der Dampf aus dem Teeglas sich im Raum auflöst. Er wird dünner, transparenter, ist plötzlich einfach weg. Und immer noch steigt neuer Dampf auf. Stumpfsinnig, fast betäubt starre ich nach draußen. Der Tag, das Licht verabschieden sich allmählich. – Ich fühle mich wie ein ausgewrungener Spüllappen; zu nichts mehr fähig.
Irgendwann wache ich aus meinem Dämmerzustand auf. Es ist dunkel geworden. Unter Mühen beziehe ich eine Seite des großen Bettes und bereite mich für die Nacht vor.
Noch eine Weile starre ich an die Decke, dann falle ich dem Schlaf in die Arme.
ANNE-MARIE UND MIJOU
Jetzt, nach dem bescheidenen Frühstück, denke ich an die Briefe. Zu allererst schreibe ich Anne-Marie. Nur was? – Wie soll ich anfangen? – Plötzlich fallen mir die Worte meines alten Lehrers ein. Er fragte mich damals, wie es mir denn ginge nach der Beerdigung meiner Großmutter. Damals wusste ich überhaupt nicht, was ich antworten sollte. In gütigem Ton sagte er: „Serge, mein Junge, lass dir Zeit. Es kommt. Lass dir einfach Zeit. Was wichtig ist, wirst du dann schon sagen.“ Und so war es dann auch.
Also, Serge, was willst du Anne sagen?
Meine Liebste! Mutter unserer kleinen Mijou! Liebste Anne! Mein Weib, es fällt mir unendlich schwer, Dir zu beschreiben, wie es mir gerade geht. Ich habe auch Schiss vor diesem Brief. Doch ich will, ich muss ihn schreiben!
Mir geht es schlecht und gut zugleich. Auch was ich schreibe, ist gut und weniger gut; je nach dem. Gesundheitlich geht es mir schlecht. Das liegt auf der Hand. Gut geht es mir, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich bin jetzt hier allein. In der nächsten Zeit, in den nächsten elf, zwölf Tagen werde ich mit niemandem, auch nicht mit Dir, liebste Anne, und nicht mit Mijou Kontakt haben. Du wirst erstaunt sein und fragen, warum denn bloß? – Ja, warum?
In diesen Tagen muss ich mir sicher und klar darüber werden, ob mein Entschluss, vor dem nahenden Tod aus dem Leben zu scheiden richtig ist. – Erschrick nicht, Anne! Bitte. Erschrick nicht. Ich halte die Ungewissheit, wann und wie ich sterbe, einfach nicht mehr aus! Ich bin der faulende Apfel, der ungenießbar wird. Wenn man ihn zerschneidet, ist es kein Apfel mehr. Und ein Zurück an den Ast ist unmöglich!
Irgendwas in mir hat aufgehört zu sagen: Mach weiter, Serge. Und die andere Seite in mir schweigt dazu. Je mehr ich in der Stille bin – und das ist sonderbar –, umso ruhiger werde ich, umso besser geht es mir damit. Ein konkreter Plan raubt keine Kraft, verstehst du? Ein Ziel, das ich angehen kann, ist für mich hilfreich. Ich fühle mich dann dem Krebs gegenüber nicht völlig ausgeliefert. Ich will nicht um jeden Preis leben.
Warum gerade ich, Anne? Warum? Warum bloß trifft es unsere Familie?
Du weißt, dass ich gekämpft habe. Das weißt Du. Jetzt ist genug gekämpft. Ich habe nur noch wenig Kraft. Und ich weiß nicht, was die Metastasen in meinem Kopf noch anstellen werden, ob ich Dich, Mijou, mich morgen noch erkennen werde. Das weiß ich nicht. Ich will nicht so enden. Da ich spüre, dass der Tod nicht mehr weit weg ist, soll er näherkommen. Ich verwehre ihm nicht mehr den Zutritt zu meinem Leben. Wenn ich könnte, liebste Anne, würde ich anders entscheiden, das kannst Du mir glauben! Es ist so ungerecht! Ich will gesund werden! Will doch leben! Aber ich will auch die Kontrolle über mich nicht verlieren! Soll ich nur noch Körper sein? Nein. Weniger als ein Tier sein? Nein, das will ich nicht! Auch nicht zum Schluss im Hospiz, das ja nur eine Sterbeanstalt ist, dahindämmernd verrecken will ich nicht! Behaltet mich so, wie ich bin, in Erinnerung, nicht als debilen Zellhaufen! Drum werde ich, so lang ich es noch kann, diesen Weg gehen. Drum muss ich hier diese innere Auseinandersetzung, diese Überprüfung meines Entschlusses mit mir selbst ganz allein ausmachen. Nach dieser Zeit möchte ich noch ein letztes Mal mit Dir sprechen und zusammen sein. Auch mit Mijou, der ich auch einen Brief schreiben werde. Mijou weiß, wie es um mich steht. Doch Kinder, das weißt Du, Anne, gehen mit solchen Situationen anders um als Erwachsene.
Du, meine liebste Anne, und die Kleine sind das Beste, was mir je in meinem Leben passieren konnte! Es tut mir unendlich leid, wie es ist. Ich würde Euch beiden das so gern ersparen. Doch ich kann es nicht. Ich wäre schon längst nicht mehr, wenn ich Euch nicht hätte. Ich brauche Deine, Eure Zustimmung. Bitte. Bitte! Ich weiß, wie schwer das ist.
Mir geht es doch genauso.
Ich umarme Dich, mein Engel.
Dein Mann. Dein Serge.
Zufrieden mit dem Schreiben lege ich mich zum Ausruhen auf das Sofa im Wohnzimmer. Nach kurzer Zeit schlafe ich ein.
Als ich aufwache, sind knapp zwei Stunden vergangen. Ich mache mir etwas zu essen und einen neuen Tee und setze mich wieder an den Tisch, um den noch ausstehenden Brief an Mijou zu schreiben.
An meine liebste Mijou!
Mein Kind, ich bin sehr traurig, dass ich so krank bin. Dass ich nicht bei Dir sein kann!
Ich weiß nicht genau, wie ich Dir das alles erklären soll. Es ist so schwierig. Nicht nur für mich, sondern auch für Dich. Du weißt, dass Papa sehr, sehr krank ist. Du weißt auch, dass Papa nicht mehr gesund werden kann. Die Ärzte haben alles versucht. Doch nichts hilft jetzt so richtig. Um selbst noch einmal darüber nachzudenken, habe ich mich für ein paar Tage von allen zurückgezogen. Von Maman und auch von Dir. Ich werde mit niemanden sprechen, auch nicht mit Gaspard. Ich darf keinen Besuch haben. Denn ich muss darüber nachdenken, wie ich meine letzten Tage verbringe. Und das kann ich nur allein. Kannst Du das verstehen? Es ist so traurig, dass es so ist. Denn die schlimme Krankheit hat auch meinen Kopf befallen. Ich bin nicht sicher, dass mein Kopf weiter gut denken kann. Das aber will ich auf alle Fälle! Ich will nicht, dass der Krebs mich besiegt. Das ist wie beim Schachspielen, Mijou. Darum werde ich nicht bis zuallerletzt warten, was mit mir passiert. Verstehst Du das? Bevor der Krebs mich besiegt, gehe ich lieber. Dass ist so, als würde ich vor dem Schachmatt den König umwerfen. – Ich weiß, mein Schatz, das ist schwer für Dich zu verstehen. Sehr schwer! Doch ich habe eine Bitte an Dich: Bleib an der Seite von Maman. Die braucht Dich jetzt sehr. Und wenn ich nach elf, zwölf Tagen wieder bei Euch bin, möchte ich mit Dir sprechen, möchte ich ein bisschen Zeit mit Dir verbringen; vielleicht am Meer, wenn Du willst. – Vielleicht kannst Du in der Zwischenzeit ein Bild für mich malen? Was hältst Du davon? Oder wir gehen zum Strand und sammeln wie früher schöne Steine und Muscheln? – Und wenn Du an mich denkst – zum Beispiel abends im Bett –, dann erinnere Dich daran, wie schön es war, als wir gemeinsam im Urlaub am Meer waren und Burgen aus Sand und Tang gebaut haben. Weißt Du noch, wir haben sie mit unseren Steinen und Muscheln verziert? Oder erinnre Dich, wie ich Dir das Schwimmen beigebracht habe. Du bist jetzt ein großes Mädchen, das viel kann!
Hab bitte, bitte Geduld. Verzeih, dass ich in dieser Zeit nicht bei Dir bin.
Papa hat Dich ganz doll lieb, vergiss das bitte nicht!
Mein Schatz, meine kleine Mijou, Papa drückt dich ganz, ganz lieb.
Dein Papa
Puh, Serge, du hast es geschafft! – Ich falte die Briefe und stecke sie in zwei Kuverts: ein Brief für Anne und den anderen für Mijou. Noch Namen und Adressen drauf: fertig.
Ich stecke die Briefe in den Hausbriefkasten, der vorne am Weg steht, dann nehme ich eine Flasche Rotwein aus meiner Tasche. Mit Flasche, Glas und Hut setze ich mich draußen auf einen Terrassenstuhl und schaue über den Klippenrand zum Meer hinunter. Die Sonne hat ihren Zenit überschritten und wirft Schatten.
Ah, es ist doch noch ganz schön frisch! Ich erhebe mich, um mir meinen Anorak zu holen. Alles strengt mich an. Jeder Schritt und sogar das Briefeschreiben. Dankbar fühle ich die Stütze des Terrassenstuhls, der mir ein wenig die Last meines Körpers abnimmt. Eigentlich dürfte ich der Medikamente wegen keinen Wein trinken, ich weiß. Ein, zwei Gläser gönne ich mir aber trotzdem …
DIE HOLZSCHACHTEL
Nach tiefem Schlaf erwache ich am Morgen. Ich habe von Anne-Marie und Mijou geträumt. Ach, was vermisse ich sie!
Vielleicht ist diese Auszeit eine verschenkte Zeit, die ich lieber mit den beiden verbringen sollte? Dieser Gedanke überrascht mich. Das hatte ich nicht so bedacht. – Aber wie würde ich mein Vorhaben dann lösen? Ich weiß es nicht. Wie soll ich mich denn selbst aus dem Leben katapultieren? Wie? Alle Möglichkeiten habe ich doch durchgespielt! Keine schien mir sicher. Keine blieb übrig, die nicht Zweifel und weiteres Leid vermeiden würde. Herr Blau kam mir da schon gerade recht. Niemand würde etwas bemerken. Und die Leute würden eh denken, was sie wollen. Anne-Marie und die Kleine wissen, wie es mir geht, dass es jederzeit vorbei sein kann. Von Tag zu Tag muss ich weitermachen. Es bleibt mir nichts anderes übrig.
Also nutze die Zeit, Serge.
Jetzt, nach dem Frühstück, krame ich in meinen Taschen nach einer kleinen Holzschachtel, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Eine kleine, dunkelbraune Holzschachtel für Mijou, in der ich sonst Nägel aufbewahrte.
So gut ich kann, säubere ich die Schachtel an der Spüle mit einem kleinen Schwamm. Nun kommt die Maserung wieder frisch zum Vorschein, ich bin zufrieden. Die werde ich mit meinem Schatz noch bekleben. Wir wollen ja noch Muscheln und Steine sammeln. – Es soll eine ganz schöne, eine besondere Kiste werden. Mijou ist jetzt acht Jahre. Am 29. Mai, das ist bald, wird sie neun. Dann soll sie das erste Mal das Kistchen öffnen. Es wird mein letztes Geschenk an sie sein. Ich werde ihr für jeden weiteren Geburtstag einen Brief schreiben. Bis sie achtzehn ist. – Ach, Mijou … wie gern würde ich dich noch wenigstens bis dahin begleiten! Ich muss schlucken … Tränen steigen auf … Scheiße! … Was für eine große Scheiße. – Energisch schüttle ich die schweren Gedanken ab. Nachdem ich mir Block und Kugelschreiber zurechtgelegt habe, beginne ich:
Zum neunten Geburtstag
An meine kleine, große Mijou!
Nun bist Du schon neun Jahre auf dieser Welt. Deine ersten neun Jahre! Maman ist jetzt schon dreimal so alt wie Du. Und ich? Ich war es auch. Wie wird es wohl sein, wenn Du dreimal so alt bist? Wo wirst Du dann sein? – Vielleicht hast Du ja dann einen festen Freund oder bist sogar schon verheiratet? Wer weiß. Ich hätte Dich doch so gern begleiten wollen! Ich wollte doch auf immer und ewig dein Papa sein, zu dem Du jeder Zeit hättest kommen können. Doch …
Doch fort mit euch, ihr finsteren Gedanken! Mijou Carré, meine Tochter, hat heute Geburtstag! Und den sollst Du feiern! Denn seitdem Du auf der Welt bist, ist jeder Tag ein Feiertag. Ach, was warst du winzig, als Du geboren wurdest! Ich war damals dabei, bei Maman, als sie dich geboren hat. Ein Erlebnis, das ich nicht vergessen habe. Ganz wie mit Mehl bestäubt, wie eine kleine Gummipuppe kamst du aus Mamans Bauch. Und zuerst sagtest du keinen Pieps. Erst als man Dich an den Füßen wie ein Strang Koteletts in die Höhe hielt und Dich von oben bis unten abklopfte, erst dann fingst Du an zu schreien. Das macht man so mit Neugeborenen, damit sie das erste Mal allein atmen können. Danach wurdest Du gesäubert und in eine warme, kuschlige Decke gewickelt. Maman und ich haben große Augen gemacht und vor Glück geweint. Ja, mein Schatz, so war das. Und heute hast Du schon neunmal ein Jahr gelebt. Papa gratuliert Dir, das weißt Du. Papa wird immer an Dich denken. Er schaut von oben runter und freut sich über Dich. Ich wünsche Dir, dass Du einen wunderschönen Tag erlebst! Kuchen isst, Geburtstagsgeschenke auspackst, Dich freust über die Glückwünsche der anderen. Vielleicht unternehmt ihr ja noch was Schönes. Wer weiß.
Bleib gesund, meine Mijou! Und vergiss nicht, Maman zu grüßen!
Ton papa, der Dich lieb hat!
Ein merkwürdiges Gefühl macht sich in mir breit. Ich schreibe an die Zukunft. An eine Zeit, in der ich nicht mehr bin. – Sehr fremd diese Vorstellung …
Soll ich noch einen schreiben? – Nein. Hab ja noch etwas Zeit. Und vielleicht ist es gut, wenn ich jeden Tag nur einen schreibe. Ich falte den Brief und schiebe ihn in ein Kuvert. Zum neunten Geburtstag für meine Mijou, male ich noch in großen Lettern auf den Umschlag.
Für Anne-Marie schreibe ich keine Briefe. Nein. Für sie hab ich etwas anderes. Schon ein paar Tage vor meinem Entschluss habe ich in einem Juweliergeschäft eine schöne Goldkette gekauft. So eine hat sie noch nicht. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn ich nicht mehr bin, dass sie dann meinen Ehering auf der Brust trägt. – Das wünsche ich mir.
Den restlichen Tag verbringe ich mit dem Einräumen meiner persönlichen Dinge, mit ausruhen und lesen.
DIE GEBURTSTAGSBRIEFE
Ich erwache und habe Schmerzen. Irgendetwas drückt mir in die Rippen. Als ich dort hinfühle, spüre ich einen harten Gegenstand. Das Buch; bin wohl beim Lesen eingeschlafen.
Na wenigstens spür ich noch was! – Doch neben dem Schmerz nistet ein sumpfiges, ein bedrohliches Gefühl. Ich erinnere mich, dass ich geträumt habe:
Eine alte Frau mit faltigem Gesicht, das von einem rot-buntem Kopftuch gehalten wird, hält mir lächelnd eine große Glaskugel hin und sagt: „Schauen Sie, schauen Sie nur! Und Sie werden sehen, was geschehen soll.“ Wie gebannt starre ich in das Kugelinnere. Inmitten einer weiten Ebene sehe ich eine Stadt. Es ist abends und in jedem Haus ist ein Licht. Die Straßen sind erleuchtet. Die Kirche wird angestrahlt. Kein Mensch ist auf der Straße zu erkennen, nur ein heimatloser Hund streunt herum. Da sich nichts bewegt, beobachte ich den Hund, wie er an jeder Hausecke anhält, um zu schnüffeln. Ab und an hebt er das Bein und trottet weiter. Der Hund scheint durstig zu sein. Denn mit einem Mal strebt er zielsicher zum Brunnen auf den Marktplatz. Dort stellt er sich auf die Hinterbeine, um an das Nass der untersten Brunnenschale zu gelangen. Sein Bemühen ist erfolglos. Mit einem beherzten Sprung landet er im Wasserbecken und trinkt begierig. Als er wieder herausspringen will, gelingt es ihm nicht. Seine Beine scheinen im Wasser festzustecken. Es lässt ihn nicht mehr los. Irritiert schaut er um sich. Keine Hilfe in Sicht. Er bellt. Keinerlei Reaktion. Niemand ist da, um ihn aus dieser misslichen Lage zu befreien. Da vernehme ich wieder die raue Stimme der Alten: „Sie sehen: Es nützt nichts, wenn jemand sagt, du musst stark sein. Davon wird man nicht stark.“ Fragend beobachte ich die Szenerie auf dem großen Platz. – Langsam, ganz langsam sehe ich den Hund kleiner werden. Er versinkt. Als das Tier es merkt, geht das Bellen in ein jämmerliches Jaulen über. Schließlich verstummt es und der Brunnen steht da, als ob nichts geschehen ist. –
„Haben Sie keinen Zauberspruch, um den Hund zu retten?“, frage ich sie.
„Welchen Hund? Da ist kein Hund.“
Verunsichert schaue ich erneut in die Kugel. Sie ist leer. Nur ein kleiner Zettel liegt auf dem Grund der Glaskugel. Auf dem Zettel entdecke ich einen Schriftzug: Träume machen blind. – In diesem Moment erwache ich und habe Schmerzen.
Irritiert, von den befremdlichen Nachtbildern berührt, schaue ich mich im Raum um. Ich brauche Orientierung.
Mühsam erhebe ich mich und stehe im Bad vor dem Spiegel. Ich sehe mein Konterfei und bin beruhigt. Ich bin es. Bin noch da. – Ein Gesicht aus bleichen Segelleinen, das man in ein längliches Oval geschnitten hat, schaut mich aus tief liegenden, großen Augen an. „Warst auch mal schöner“, murmele ich, und verrichte wie gewohnt meine Morgentoilette.
Nach Frühstück und der lästigen Medikamenteneinnahme sitze ich wieder am Tisch und schreibe:
An meine liebste Mijou, an das Geburtstagskind, das heute schon zehn Jahre alt wird!
Von Herzen alles, alles Gute für Dich, das wünscht Dir Dein Papa!
Liebste Tochter, dies ist schon mein zweiter Brief, den Du dem Schatzkästchen, das Maman für Dich verwahrt, heute entnimmst.
Mijou, ich wünsche Dir von Herzen: Bitte bleib gesund! Sei weiterhin fleißig. Denn so unterstützt Du Maman! Sie hat es jetzt bestimmt nicht immer einfach. Auch wünsch ich Dir, dass Du gute Arbeiten schreibst. Dass Du viel lernst, was Du später gut brauchen kannst. In Mathe bist Du ja immer schon gut gewesen. Und in den anderen Fächern? Wie läuft es da? Die Hauptsache ist, dass Du Dich nicht unterkriegen lässt und trotzdem weitermachst, auch wenn es zwischendurch mal nicht so gut läuft.
Dir, mein Schatz, einen wunderschönen Geburtstag! Sicherlich werden heute ein paar Mitschüler und Freunde zu Dir kommen.