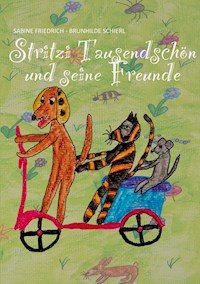Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nutzt sich der Jakobsweg ab, weil er sozusagen in Mode gekommen ist? Seit Showmaster und andere Prominente von ihren Pilgerschaften nach Santiago di Compostela berichten, könnte dieser Verdacht aufkommen. Wie die vorliegenden Berichte einer realistischen und bodenständigen Persönlichkeit wie Brunhilde Schierl zeigen, kann sich ein Pilgerweg gar nicht abnützen, wenn er in der richtigen inneren Haltung begangen wird. Und da kommt es nicht einmal darauf an, dass das große Weihrauchfass von Santiago erreicht wird. Wer mit dem Willen aufbricht, sich von diesem Weg und seinen Begegnungen verändern zu lassen, kommt in jedem Fall ans Ziel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Dank gilt allen, die mich für diesen Weg unterstützt haben. Es sind so viele, dass ich sie namentlich nicht erwähnen kann. Einen Namen möchte ich allerdings besonders hervorheben:
Liselotte
Ihr widme ich dieses Buch.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einleitung
Die Pilgerreise beginnt
Ein Schulbus rettet mich aus dem Gewitter
Bittet, und ihr werdet bekommen!
Herzen und Türen öffnen sich
Der inneren Stimme folgen
Bewegung in der Natur macht glücklich und heilt
Gemeinsamkeit verbindet
Dem Herzen schenken
Im Hier und Jetzt leben
Segenswünsche
Abschied von Deutschland
Begegnung mit Liselotte in Frankreich
Verwirrung in Thann
Fröhliche Nonnen und Riesenzucchini
Espresso gratis
Wetterchaos und einsame Wälder
Innere Heilung
Rettender Engel in der Not
Heimkehr
Nachtrag: Der Weg ist das Ziel
Bilder
VORWORT
In meinem Alltag habe ich viel mit einsamen Menschen zu tun.
Diese Menschen verstecken ihre Einsamkeit ebenso wie ihre eventuelle materielle Not. Für die banalsten Kleinigkeiten oder Handgriffe, die ihnen selbst viel bedeuten würden, wagen sie sich niemandem zuzumuten. Sie wollen nicht zur Last fallen, niemanden belästigen.
Bitten ist für viele in der eigenen Familie schon schwierig geworden.
Jemanden außerhalb des Familienkreises zu bitten, wird in unserer Gesellschaft ein zunehmendes Tabu.
Gleichzeitig mache ich die Erfahrung, dass es viele Menschen gibt, die ihre Menschenliebe und Hilfsbereitschaft gerne ausleben möchten, aber in unserer anonymen, distanzierten Zeit gar nicht mehr wissen, wie und wo. Könnte man diese beiden Gruppen zusammenbringen, wie viel schöner, wie viel wärmer wäre unsere Welt.
Oft frage ich mich, wo die Schlüssel für ein besseres menschliches Miteinander für uns alle zu finden wären.
Was einst eine selbstverständliche Nachbarschaftshilfe war, wird heute weitgehend von Institutionen gegen Bezahlung übernommen.
So hat uns der Wohlstand mit all seinen Folgen bezüglich des Bittens und Dankens aus der Übung gebracht.
Für etliche ist der Wohlstand längst wieder vorbei. Die Sozialleistungen des Staates schwinden zunehmend. Die Institutionen sind nicht mehr bezahlbar. Was bleibt uns, wenn wir mit zunehmenden Alter nicht isoliert und einsam in Not versinken wollen?
Manche Lebenseinstellungen sind wohl neu zu überdenken. Was ist tragfähig, was nicht? Ein neues Miteinander, eine Rückbesinnung auf alte Zeiten könnten hilfreich sein.
Für dieses Miteinander brauchen wir auch die Fähigkeit, zu bitten und zu danken, zu geben und zu nehmen. Bitten setzt eine Haltung von Demut voraus. Das heißt, ich muss eingestehen, dass ich es allein nicht schaffe, dass ich den anderen brauche. Gleichzeitig brauche ich den Mut, mich damit schutzlos zu öffnen und in gewisser Weise auszuliefern. Denn niemand garantiert mir, dass der andere meine Bitte erfüllt. Er hat immer das Recht zu einem Nein. Die Angst vor einer verletzenden Absage hindert viele, überhaupt zu bitten.
Meine Pilgerreise gab mir die Möglichkeit, das Bitten und Danken in besonderer Weise zu üben. Eine lange Pilgerreise war früher ein großes Wagnis. Pilger waren oft einfache Leute. Sie galten als hochachtungs- und schützenswert. Ihnen zu helfen, ihnen Obdach für eine Nacht neben Speis und Trank zu bieten, galt als allgemeine Christenpflicht. Zahlreiche Hospitalbauten in ganz Europa zeugen von der Kraft dieser frommen Massenbewegung.
Pilger machten sich auf den Weg, um zu suchen, zu finden, zu bitten und zu danken. Dafür nahmen sie Entbehrungen in Kauf und wählten einen einfachen Lebensstil.
Soweit wie möglich habe ich mich in die Rolle eines Pilgers aus alter Zeit begeben und mich ebenfalls der Güte und Unterstützung meiner Mitmenschen anvertraut. So bin ich den Jakobsweg in nicht alltäglicher Weise gegangen. Mit wenig Geld und viel Gottvertrauen habe ich mich auf den Weg ins Ungewisse gemacht.
Ich wollte nicht nur das Bitten und Danken üben, sondern auch Erfahrung sammeln. Wie weit ist es für einen Pilger in der heutigen Zeit ebenfalls möglich, auf die Güte seiner Mitmenschen zu vertrauen? Wie weit sind die Menschen der heutigen Zeit für einen Pilger berührbar?
Mit meinen persönlichen Erfahrungen von diesem Pilgerweg möchte ich jedem Menschen Mut für seinen Alltag machen.
Es gibt mehr „Engel“ um uns herum, als wir glauben.
Allerdings sind sie unsichtbar, solange sie nicht gebraucht werden.
Memmelsdorf, August 2011
EINLEITUNG
Der Jakobsweg hat mich nie sonderlich berührt.
Für mich war überall da, wo ich tagelang allein durch die Natur lief, meine Mitte, meinen Bezug zu Gott und meine Verbindung zum Ganzen spürte, mein Jakobsweg. Ich hatte kein Verlangen nach Massenansammlungen, schmuddeligen oder überfüllten Herbergen. Ich liebte das Gehen in Stille, den Frieden und die Schönheit in der Natur auch in der Nähe meines Wohnortes. Wozu also eine lange Anreise in ein Land, dessen Sprache ich nicht spreche, dachte ich ganz pragmatisch. Von dem, was ich über den Jakobsweg in Spanien gelesen hatte, war vieles eher abschreckend für mich.
Doch dann kam alles ganz anders.
Eher zufällig kam mir ein Flyer zwischen die Finger. Josef, ein Pastoralreferent in meiner Gegend, bot Mitte Mai für fünf Tage eine Jakobswegwanderung von Hof bis Pegnitz an. Ich zauderte, weil für diese Zeit das komplette Gepäck im Rucksack zu tragen war. Durch einige gesundheitliche Beschwerden war ich überzeugt, keinen Rucksack tragen zu können. Meine bisherigen Wanderungen hatte ich immer mit Hilfe des Autos bewältigt. Somit musste ich nur geringes Tagesgepäck, wie Regenjacke, Wasserflasche und Brotzeit tragen. Nach achtzehn bis zwanzig Kilometern Strecke war meine Leistungsgrenze erreicht.
Am Abend kehrte ich dann per Anhalter zu meinem Auto zurück. Trampen erlebte ich stets problemlos. Es kam dabei zu schönen Begegnungen und guten Gesprächen. Ich stand kaum länger als fünf Minuten, bis ein Auto anhielt. Mit Hilfe freundlicher Mitmenschen gelangte ich rasch zu meinem Auto zurück. Dann fuhr ich zu dem Punkt, an dem ich die Wanderung beendet hatte, suchte mir einen geeigneten Platz zum Schlafen und zog die Vorhänge vor die Fensterscheiben.
Ich besitze einen Citroen Berlingo, den ich mit einem bequemen Bett ausgestattet habe. Mit Wasserkanister und Gaskartuschenkocher bin ich autark. In den frühen Morgenstunden, wenn ich noch in keinem Gasthof mein Frühstück bekommen würde, filtere ich mir Bohnenkaffee, esse Müsli oder Honigbrot und starte in den frischen Tag hinein.
Die frühen Morgenstunden empfinde ich immer als ganz besonders schön. Soviel Ruhe und Frieden liegt noch in der Atmosphäre. Das genieße ich sehr bei meinen Wanderungen.
Nun, eine Wanderung mit vollem Gepäck sah ich für mich als Herausforderung. Aber ich wollte es wagen. Mein Zaudern führte zu einer sehr kurzfristigen Anmeldung vor Beginn der Tour. Ich betrachtete es als ein Experiment. Fünf Tage mit Gepäck würde ich schon irgendwie durchstehen. Wenn nicht, dann konnte ich auch abbrechen und mit dem Zug nach Hause fahren.
Die Wandertage von Hof nach Pegnitz brachten mir die überraschende Einsicht, dass ich durchaus einen Rucksack tragen kann. Er darf nur nicht übermäßig schwer sein. Mein Rucksack wog sechseinhalb Kilogramm. Das war zu schaffen.
Unsere kleine Pilgergruppe bestand aus vier Frauen und zwei Männern. Wir verstanden uns gut untereinander.
Aber diese Tage führten zur Erkenntnis, dass ich bei längeren Wanderstrecken nicht gruppentauglich bin. Ich muss mein eigenes Tempo gehen. Die Streckenlänge und die Pausen muss ich so ansetzen, wie sie meiner Gehfähigkeit mit all ihren Einschränkungen entsprechen.
Der Pastoralreferent, der die Gruppe führte, berichtete von seinem Jakobsweg nach Santiago. Vor drei Jahren lief er an einem Stück, innerhalb von vier Monaten, von Bamberg nach Santiago.
Das faszinierte mich. Ich wurde hellhörig.
Von persönlichen Erlebnissen erzählte er nicht viel, ließ eher ahnen, dass er dabei besondere Erfahrungen gemacht hatte.
Erstmals hörte ich Näheres über den Jakobsweg und seine tiefere Bedeutung für die Menschen.
Jakobus der Ältere, ein Jünger Jesu und späterer Apostel, kam als Missionar angeblich bis nach Spanien. Nach seiner Rückkehr 44 nach Christus wurde er in Jerusalem enthauptet. Sein Leichnam - so berichtet die Legende – gelangte nach Spanien, wo seine Grabstätte in Vergessenheit geriet. Im 9. Jahrhundert wurde sein Grabmal wiederentdeckt und seither erfährt er als Nationalheiliger und Schutzpatron der Pilger große Verehrung.
Um das Grab des Apostels ranken sich zahlreiche Legenden.
Als Jakobsweg (spanisch: Camino de Santiago) wird der Pilgerweg zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus bezeichnet. Die früheren Pilger gingen von Santiago noch knapp 90 Kilometer weiter bis zum Meer, um sich hier die „Jakobsmuschel“ zu holen. Diese verlieh ihnen später zu Hause oder, wenn sie sich auf dem Rückweg am Jakobsweg niederließen, Privilegien.
Die Jakobsmuschel wurde zum Zeichen dieser Pilgerschaft. Der Knoten der Muschel kann als Sinnbild und als Ausgangspunkt für die segnenden Strahlen stehen, die uns beschützen und leiten. Die Jakobsmuschel steht auch für die Armut der Pilger und deren Absage an die Dinge dieser Welt.
Spanien war für die Menschen früher das Ende der Welt. Der Weg nach Westen, dem Weg der untergehenden Sonne folgend, ist symbolisch mit dem Weg zum Tod hin vergleichbar. Wer von Santiago de Compostella wohlbehalten zurückkehrte, war wie neu geboren, ein neuer Mensch. Das sogenannte „Ende der Welt“ ist Cap Finisterre am Atlantik. Hier angekommen, galt es, ein Erneuerungsritual abzuhalten. Einem alten Brauch folgend, verbrennen manche Pilger ein Kleidungsstück als Zeichen des Abschieds vom Alten. Dies gilt als Symbol für den Beginn eines neuen Lebens.
Es gibt zwei Arten, den Weg zu wandern:
Man sucht Gott und findet sich selbst, oder man sucht sich und findet Gott.
Der Pilger nimmt von zu Hause einen Stein mit, um ihn abzulegen. Er nimmt symbolisch etwas mit, um sich dann für immer davon zu trennen. Am Cruz de Ferro, einem Eisenkreuz, legen Pilger ihren Stein ab. Überall in Spanien sind Steinhügel, die von den Pilgern aufgerichtet werden. Sie stehen symbolisch für die Sünden oder Lasten, die man mit sich trägt und dann ablegt. Die Steine am Weg sind die, die man zurücklässt.
Es gibt inzwischen viele Aussagen über den Jakobsweg: Wer auf dem Jakobsweg stirbt, kommt sofort in den Himmel, die anderen müssen für ihre Sünden den Weg zu Ende laufen. Josef erzählt vom eigenen Schatten, der täglich mitgeht, dem man einfach nicht entgehen kann, so sehr man es vielleicht möchte. Mich interessierte plötzlich alles, was mit der alltäglichen Umsetzung einer solche Pilgerreise zu tun hatte.
Wie schafft man es mit dem Gepäck für eine derart lange Reise? Was macht man, wenn es tagelang regnet? Wie funktioniert es mit sauberer Wäsche? Wie klappt es mit Übernachtungen, mit Lebensmitteln? Wie findet man den Weg? So lauteten meine Fragen.
Je mehr ich darüber erfuhr, desto mehr entwickelte sich bei mir eine, für meine gesundheitlichen Verhältnisse fast absurd anmutende Idee:
Ich wollte ebenfalls von Bamberg nach Santiago laufen! Ich wollte ebenfalls eine Langzeit-Pilgerreise unternehmen! Plötzlich erschien mir dieser Jakobsweg nicht nur interessant, sondern auch machbar und möglich. Zweifellos würde ich mehr Zeit brauchen als dieser kräftige, gesunde und vor allem jüngere Mann. Auch etliche Ausfalltage würde ich einkalkulieren müssen.
Von einem Moment zum anderen brannte in mir ein Feuer, das täglich stärker wurde. Es gibt eine Bibelstelle, die mich schon in meiner Kindheit tief berührt hat.
Es ist die Aussendung der Jünger bei Markus 6, 7-13.:
Nehmt nichts mit auf den Weg außer einem Wanderstock, kein Brot, keine Tasche und auch kein Geld. Zieht Sandalen an und nehmt an Kleidung nicht mehr mit, als ihr auf dem Leib tragt. Wenn euch jemand aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von da weiterzieht.
Dieser Text kam mir wieder ins Bewusstsein.
Die Aussendung der Jünger ist nicht mit meinen Motiven für den Jakobsweg vergleichbar. Ich besitze keine Fähigkeiten zu heilen, sondern bin nur eine Suchende. Aber diese Bibelstelle inspirierte mich und übte einen seltsamen Reiz auf mich aus. Ich wollte wie ein Pilger von früher pilgern und dabei einen möglichst einfachen Lebensstil wählen. Über meine beabsichtigte Form des Pilgerns sprach ich mit niemandem.
Am liebsten wäre ich sofort nach meiner Heimkehr aufgebrochen. Doch ich hatte mit meiner Freundin Daniela ab 28. Mai eine zweiwöchige Radtour am Rhein vereinbart. Diese Radtour war mit ihrem Geburtstagsgeschenk zu meinem 60. Geburtstag verknüpft. Darauf hatte ich mich bisher riesig gefreut. Doch nun verblasste diese Freude. Die Radtour hatte ihre Bedeutung verloren.
In mir brannte nur noch ein Wunsch: Auf nach Santiago.
Mir war klar, dass es nach der Radtour von der Jahreszeit her zu spät wurde, um noch aufzubrechen. Ich wollte nicht die große Hitze von Spanien und die wegen der Urlaubszeit der Spanier überfüllten Herbergen erleben.
Das bedeutete, ich konnte erst im nächsten Jahr aufbrechen. Außerdem hatte ich von Firmen schon Kostenvoranschläge für mein Hausdach und die Fassadenrenovierung eingeholt. Es galt nur noch die Kostenvoranschläge auszuwerten und den Auftrag zu vergeben.
Das alles stand nun störend im Raum.
Schließlich kam ich zu einer Kompromisslösung:
Diesen Sommer durchquere ich Deutschland und schaffe es vielleicht bis Taizé oder gar bis Le Puy.
Der 28. Juni war die erste Möglichkeit, mich terminlich freizumachen. Für diesen Tag ließ ich mir einen Pilgerpass ausstellen. Startpunkt war die Jakobskirche in Bamberg. Kurz davor ergab sich spontan die Gelegenheit, die ersten drei Tagesetappen durch den Steigerwald gemeinsam mit meiner Freundin Daniela zu laufen. Daniela wohnt bei mir im Haus. Sie hatte noch einige Tage Urlaub.
Die erste Etappe ging von Bamberg bis Burgebrach, die zweite von Burgebrach nach Burghaslach und die letzte bis nach Markt Bibart. Am Abend fuhren wir jeweils nach Hause und reisten am nächsten Morgen erneut an.
Das passte mir gut, denn ich wollte mein echtes Pilgerleben nicht im Dunstkreis meines Wohnortes beginnen. Wie ich mein Pilgern umsetzen wollte, was das beinhaltete, darüber hatte ich keine nähere Vorstellung. Deswegen machte ich mir keinerlei Gedanken. Alles würde sich aus der Situation ergeben.
Bereits am zweiten Wandertag mit Daniela bekam ich durch meine neuen Wanderschuhe Blasen an den Zehen und musste mir in einem Dorf ein Pflaster erbitten. Am dritten Tag bekam ich ordentliche Schmerzen im linken Knie. Der Schleimbeutel entzündete sich und führte zu einer Schwellung am Knie.
Das geht ja heiter los, dachte ich.
Die letzten Tage vor der Abreise verbrachte ich mit hochgelagertem Bein und Kühlmaßnahmen für das Knie. Nachts, wenn ich aufwachte durchzuckte mich als erstes der Gedanke: Du bist verrückt mit deinem Vorhaben! Doch sofort meldete sich meine innere Stimme und verscheuchte diesen Gedanken.
Am Dienstag, der eigentlich mein Starttag sein sollte, entschied ich, mein Knie noch einen Tag länger zu schonen. Es war immer noch schmerzhaft und geschwollen.
Aber den 29. Juni plante ich als endgültigen Starttag.
Alle Reisen haben eine heimliche Bestimmung,
die der Reisende nicht ahnt.
Martin Buber
DIE PILGERREISE BEGINNT
Mittwoch 29. Juni 2011
Heute stehe ich sehr zeitig auf. Alles ist gepackt und vorbereitet. Wegen meiner noch immer vorhandenen Knieprobleme fährt mich Daniela nicht wie ursprünglich geplant zu meinem Startpunkt nach Markt Bibart, sondern ich fahre mit dem eigenen Auto.
Dies hat für mich den Vorteil, noch einige Tage mit geringem Tagesgepäck laufen zu können. Auf diese Weise hoffe ich mich schonend einzulaufen und das Knie wieder ganz in Ordnung zu bringen. Außerdem habe ich so für die ersten Tage gleich meine Übernachtungsmöglichkeit dabei.
Über den Zubringer, die Bundesstraße 505, befahre ich ein kurzes Stück der Würzburger Autobahn. Ich verlasse sie bereits an der Ausfahrt Schlüsselfeld wieder. Auf den Landstraßen ist kaum Verkehr. Die Dörfer im Steigerwald sind noch unbelebt.
In einem Dorf sitzt ein weißer Hase mitten auf der Straße und bewegt sich nicht vom Fleck. Ich fahre langsam an ihn heran und hoffe, dass er weghoppelt. Doch er bleibt sitzen. Nun bin ich so dicht vor ihm, dass ich ihn nicht mehr sehen kann. Also halte ich völlig an, damit Herr Langohr gemütlich die Straße räumen kann. Er lässt sich Zeit.
Vermutlich ein entlaufener Stallhase, der noch keine Autos kennt. So früh am Morgen will ich mich seines Schicksals jedoch nicht annehmen. Es dürfte um diese Zeit schwierig sein, seinen Besitzer zu finden. Ich wünsche ihm Glück für seinen weiteren Weg.
In Markt Bibart parke ich bei der Kirche und schlüpfe in die neuen Wanderschuhe. Ich weiß, dass man den Jakobsweg nicht mit neuen Schuhen angehen soll. Die alten habe ich vorsorglich ebenfalls dabei. Doch die fallen fast auseinander und ich fürchte, dass sie die geplante Tour mit 1200 Kilometern nicht mehr durchhalten.
Mit einem sehr starken Knick-Senk-Spreizfuß, bei einem ausgeprägten Hallux valgus, ist für mich jeder Schuhkauf ein größeres Problem. Für jeden Verkäufer bin ich damit eine Herausforderung. Ein Schuhproblem kann ich unterwegs mit Sicherheit nicht lösen. Kaputte Schuhe würden einen Abbruch der Tour bedeuten. Meine Schuhe müssen diese Reise durchhalten. Das zwingt mich, die neuen Wanderschuhe doch noch in den nächsten Tagen einzulaufen.
Es gab Gewitter- und Unwettermeldungen. So marschiere ich bereits um halb sieben in Markt Bibart los. Vor vielen Jahren habe ich mit meinen vier kleinen Kindern ein Gewitter am Gipfel eines Berges erlebt. Das sitzt mir noch heute im Nacken. Seither habe ich großen Respekt vor den Gewalten der Natur. Ich versuche jedem Gewitter in der freien Natur auszuweichen.
In Markt Bibart suche ich die Wegmarkierung und lasse mich von ihr in den Wald leiten. Bis Rothenburg habe ich eine Wegbeschreibung. Die führt acht Kilometer nur durch Waldgebiet, durch den Limpurger Forst. Dieser Weg durch den Steigerwald ist vorwiegend als Kunigundenweg markiert. Bisher kam ich damit gut zurecht. Doch heute habe ich meine Probleme. Ich finde den Weg in diesem Abschnitt des Waldes sehr schlecht markiert. Es fällt mir oft schwer, mich für den einen oder anderen Weg zu entscheiden. Und schon verliere ich die richtige Route. Irgendwann habe ich das Gefühl, unsinnige Umwege zu gehen. Es ist bereits Mittagszeit. Von der Gehzeit her müsste ich längst den Wald verlassen haben. Mir wird klar: Ich habe mich total verlaufen. Den Weg zurück bis zur letzten Markierung würde ich vermutlich nicht mehr finden, es wäre auch viel zu weit. Zu oft bin ich ohne mein Wanderzeichen abgebogen oder geradeaus gelaufen. Die Wanderzeichen wechselten dann in alle möglichen Farben. Keines davon kann ich in meiner Wanderkarte entdecken.
Der weitere Weg wird spannend sein, denn künftig werde ich nicht einmal eine Wanderkarte mitführen.
Erneut stehe ich an einer Weggabelung und muss eine Entscheidung treffen. Ein Weg ist mit einem mir unbekannten Wanderzeichen ausgeschildert. Er führt leicht bergauf. Das kann nicht passen, denn ich muss hinunter ins Tal. Der andere Weg führt zwar abwärts, hat aber keinerlei Wanderzeichen. Mein Knie schmerzt zunehmend und am Himmel zeigen sich bereits die grauen Unwetterwolken. Ich entscheide mich, auf dem markierten Wanderweg zu bleiben.
Doch je länger ich laufe, desto mehr steigt der Weg an. Er führt mich von einer anderen Seite auf eben den Berg, von dem ich komme. Nach etwa zwei Kilometern werde ich nervös. So komme ich nie ins Tal. Also kehre ich um, um an der letzten Weggabelung doch den unmarkierten, abwärts führenden Weg zu nehmen. Er passt zwar nicht von der Richtung, aber ich will einfach nur noch raus aus dem Wald, egal wo. Auf keinen Fall will ich ein Unwetter im Wald erleben.
Also wieder zurück zur Weggabelung, wo ich erneut die Wanderkarte studiere. Doch ich kann nicht herausfinden, wo ich mich überhaupt befinde. Der Wald ist groß und hat viele Wege. Hier kann man stundenlang umherirren. Meine Wegentscheidung kann ich nur auf Vermutungen aufbauen. Doch das gibt keine wirkliche Orientierung. Ich bin ratlos.
Meine innere Stimme sagt mir plötzlich: Keinesfalls einen unmarkierten Weg nehmen. Mir bleibt keine andere Wahl als der Weg bergauf. Ich laufe den gleichen Weg, den ich eben umgekehrt bin, zurück. Vielleicht komme ich irgendwann an eine Kreuzung, die mir zur Orientierung verhilft, hoffe ich.
Jetzt bin ich ziemlich nervös und verdopple mein Tempo. Mir läuft die Zeit davon. Innerlich kämpfe ich gegen meine Gewitterpanik.
Ich muss Ruhe bewahren, sonst mache ich nur unsinnige Sachen, wie eben. Mindestens vier zusätzliche Kilometer hat mir das eingebracht. Solche Eskapaden kann ich mir gerade jetzt nicht leisten, weder für das Knie, noch von der Zeit her.
Die Panik lässt mich den Schmerz im Knie fast vergessen, ich spüre stattdessen den inneren Zeitdruck.
Kein Wald macht mir Angst, auch wenn ich mich verlaufe, sofern ich nur genug Zeit habe. Die scheint mir jetzt zu fehlen. Das Unwetter naht und wenn ich mein Knie zu lange und zu sehr belaste, kann mich das zur Gehunfähigkeit bringen. Ich habe das mit meinem Knie bereits erfahren. In diesem Riesenwald ist mir den ganzen Tag noch kein einziger Mensch begegnet. Nun bereue ich, das Handy im Auto gelassen zu haben. Im Notfall könnte es doch nützlich sein.
Der Weg steigt immer mehr bergan. Aber ich bin nun entschlossen, ihm zu folgen, bis er mich zu anderen Markierungen führt. Tatsächlich entdecke ich irgendwann mein ersehntes Wanderzeichen. Mein Weg wäre vermutlich schon oben am Berg ein schmaler, stets abwärts führender Pfad gewesen, der die breiten Forstwege abschneidet. Auch jetzt überquert der Pfad den Forstweg und leitet mit der Markierung den Pfad bergab.
Nun ist mir klar, welche unsinnigen Schleifen ich marschiert bin. Irgendwo muss ich die Markierung zu diesem Pfad übersehen haben, sofern sie tatsächlich vorhanden war.
Ich bin ungeheuer erleichtert. Mit diesem Abkürzungspfad gelange ich schnell nach unten. Endlich lichtet sich der Wald. Ich laufe an Wiesen und Feldern vorbei und gelange kurz vor zwei Uhr nach Weigenheim.
Nun erst, wo ich mich in Sicherheit weiß, spüre ich mein Knie wieder. Siebeneinhalb Stunden bin ich gelaufen, viele Kilometer mehr, als für diese Tagesetappe geplant war. Das reicht! Nach Uffenheim müsste ich weitere viereinhalb Kilometer auf betoniertem Flurweg laufen. Das tue ich meinem Knie nicht mehr an. Ich beschließe, ab hier zu meinem Auto zu trampen. Doch in diesem abgeschiedenen Ort bewegt sich kein Auto. Ich stehe längere Zeit an der Straße. Es ist entsetzlich heiß und drückend. Drei Autos verlassen in großen zeitlichen Abständen den Ort, halten aber nicht an. Das ist nicht sehr ermutigend.
Endlich kommt ein Wagen mit zwei jungen Männern. Sie halten und nehmen mich mit. Sie sind auf dem Weg nach Uffenheim. Wir erreichen über eine unbedeutende Verbindungsstraße die Bundesstraße zwischen Uffenheim und Markt Bibart. Mir ist sofort klar, dass hier niemand für mich anhält. Die Autos fahren auf einer derartigen Vorfahrtsstraße mit großer Geschwindigkeit, viel zu schnell, um mich zu beachten.
Also lasse ich mich mit nach Uffenheim nehmen. Das ist zwar die verkehrte Richtung, doch am Ortsende von Uffenheim sehe ich größere Chancen für mich. Hier versuche mein Glück.
Wegen der Hitze sind nur wenige Menschen unterwegs. Wer kann, verkriecht sich im Haus. Entsprechend dünn ist der Verkehr auf der Straße. Es dauert einige Zeit, bis wieder ein Auto anhält. Ein älteres Ehepaar, das hier Urlaub macht, ist auf dem Weg nach Suggenheim. In Suggenheim muss ich dann von der Bundesstraße in die andere Richtung abzweigen. Hier nimmt mich rasch ein sympathischer Mann mit, der mich in Markt Bibart direkt an meinem Auto absetzt.
Mein Auto stand in der prallen Sonne und kocht regelrecht. Ich reiße alle Türen auf, bevor ich mir die Wanderschuhe ausziehe. Es nützt nicht viel, da die Temperaturen in der Sonne ebenfalls extrem sind. Erst einmal will ich zur Kirche, mir meinen Pilgerstempel holen und auch irgendwo meine leere Wasserflasche auffüllen.
Aber ich kann den Autoschlüssel nicht finden. Ich suche unter den Kleidungsstücken auf meinem Bett, in allen Hosentaschen, leere den Rucksack aus, suche die Sitze und den Boden ab. Der Schlüssel bleibt verschwunden. Ich durchwühle alles, was nur denkbar ist – ohne Erfolg. Der Aufenthalt in der sengenden Sonne gibt mir den Rest. Ich halte es hier kaum mehr aus, kann mich aber nicht vom Auto entfernen, wenn ich es nicht absperren kann. Noch einmal durchsuche ich alles, diesmal langsam und sehr gründlich. Der Schlüssel ist nicht auffindbar.
Ich bin ratlos. Das gibt es doch nicht. Ich zweifle an meinem Verstand. Er muss einfach da sein. Mein Hirn kann in dieser Hitze kaum mehr arbeiten. Erst einmal muss ich raus aus der Sonne. Ich will mich in den Schatten einer Eingangstreppe auf der anderen Straßenseite setzen. Von dort habe ich das Auto im Blickfeld. Als ich die Autotüren zuschlage, steckt der Schlüssel im Schloss der Hecktüre. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich atme auf.
Erlöst schließe ich mein Auto ab und laufe mit Wasserflasche und Pilgerpass zur Kirche. In der kühlen Kirche hoffe ich mich zu erholen – aber sie ist versperrt.
Die Frau, die gerade zufällig vorübergeht, ist die Pfarrsekretärin. Sie sieht, dass ich in die Kirche will und spricht mich an. Ich erkläre ihr, dass ich Jakobuspilgerin bin und einen Pilgerstempel möchte.
„Da haben Sie aber Glück, dass ich gerade jetzt hier vorbeikomme“, meint sie und geht mit mir ins Pfarrbüro. Ich bekomme Stempel und Trinkwasser. Auf einen Zug leere ich die Halbliterflasche und fülle sie noch einmal auf.
Mein entsetzlich heißes Auto hat keine Klimaanlage, damit fahre ich nach Westphül, ein kleiner Ort vor Uffenheim. Eine Bekannte, die mir für diese Nacht ein Bett angeboten hat, wohnt hier. Natürlich könnte ich auch im Auto schlafen, aber ein Zimmer ist zweifellos komfortabler.
Vor ihrem Haus, im Schatten einer großen Scheune, parke ich. Bevor ich mich bei ihr melde, strecke ich mich erst einmal auf meinem Autobett aus um mich bei geöffneten Türen etwas zu erholen. Denn plötzlich fühle ich mich sehr erschöpft und bin zum Einschlafen müde. Mein Bett ist eine reine Wohltat. Meine Knochen und Beine schmerzen.
Eigentlich wollte ich den Jakobsweg sachte angehen lassen. Es kommt doch meistens anders, als man denkt.
Mein Auto scheint sehr ungünstig zu stehen. Ständig fahren verschiedene Traktoren nahe an mir vorbei, um mich herum, in das offene Scheunentor hinein und gleich wieder hinaus. Immer wird nur kurz etwas abgeladen. Im Drei-Minuten-Takt geht das so zu. Ich fühle mich so erschöpft, dass ich keine Kraft habe, mir einen anderen Platz zu suchen. So ertrage ich diese Widrigkeiten in gottergebener Haltung. Schließlich spricht mich ein Bauer an. Ich blockiere sein Tor.
Ächzend erhebe ich mich, klingle bei Birgit und kündige meine Ankunft an. Sie hat gerade Besuch. Ich will nur wissen, wo ich im Schatten parken kann, ohne jemanden zu behindern. Dann will ich mich wieder flachlegen, erkläre ich ihr.
Schatten ist rar und vorwiegend an ungünstigen Stellen.
Dann stehe ich im Baumschatten vor ihrer Garage, auf der anderen Seite des Hauses. Hier ist Ruhe. Schon bin ich fast eingeschlafen, da kommt Birgit. Ihr Besuch ist gegangen. Als erstes bitte ich um eine kühle Dusche. Danach fühle ich mich schon bedeutend besser.
Am Nachmittag öffnet der Himmel seine Schleusen für heftigen Regen. Im schattigen Wintergarten unterhalten wir uns bis in den Abend hinein. Mein schmerzendes Knie ist hoch gelagert und ich behandle es in Abständen mit Kühlpackungen. Dieses Problem muss ich in den nächsten Tagen in den Griff bekommen.
Die Nacht verbringe ich im Zimmer ihrer Tochter. Es regnet heftig weiter. Das angekündigte Unwetter tobt sich allerdings in weiterer Entfernung aus und richtet dort große Schäden an.
Donnerstag, 30. Juni 2011
Um viertel vor acht breche ich auf und fahre weiter nach Uffenheim. Es regnet unverändert. Im Rathaus von Uffenheim versuche ich mich für die nächste Etappe zu orientieren. Kostenlose Umgebungskarten gibt es hier nicht. Meine einzige Wanderkarte endet hier.
Irgendwie werde ich es schon schaffen, auch ohne Karte klarzukommen. Bleibt zu hoffen, dass die heutige Wegmarkierung besser ist als die gestrige. Ich parke mein Auto und suche den Weg zum Ort hinaus.
Um neun Uhr laufe ich los. Es regnet nicht mehr, nur noch graue Regenwolken schweben über mir. Mit der Zeit wird es freundlicher. Ich laufe durch den Ort Custenlohr. Mir ist jetzt sehr nach einer Tasse Kaffee zumute.
Auf einem Balkon steht eine Frau.
„Guten Morgen! Würden Sie mir eine Tasse Kaffee verkaufen? Es gibt hier weit und breit keine Gaststätte“, frage ich hoffnungsvoll.
„Ich bin hier Urlaubsgast und habe keinen Kaffee“, entgegnet sie achselzuckend.
Trotzdem bedanke ich mich und ziehe weiter.
In Habelsee steht wieder eine Frau auf dem Balkon. Erneut bitte ich um eine Tasse Kaffee. Die Frau ist diesmal sehr freundlich und unterhält sich sogar ein wenig mit mir. Sie würde mir ja gerne eine Tasse Kaffee geben, wenn sie in ihrer eigenen Wohnung wäre. Aber sie ist hier an ihrem Arbeitsplatz und putzt die Wohnung.
Also geht es weiter ohne den ersehnten Kaffee. Unterwegs hoppelt mir ein Hase über den Weg. Ich freue mich darüber.
Es ist schon Mittag, als ich in Endsee ankomme. Hier gibt es eine Wirtschaft mit Biergarten. Ich schaue mir den Biergarten hinter dem Gebäude an. Im überdachten Bereich wäre ein trockener Sitzplatz. Ich will nicht einkehren, sondern nur ein wenig ausruhen und meine eigene Brotzeit essen. In der freien Natur ist alles nass.
Ich betrete das Lokal und erkläre der Wirtin, dass ich Jakobswegpilgerin bin und in ihrem Biergarten ein wenig ausruhen möchte. Sie erlaubt es und ich lasse mich nieder. Ich packe meine Brotzeit aus, stelle meine Wasserflasche auf den Tisch und lasse es mir gut gehen.
Die Wirtin, eine etwa vierzigjährige Frau, erscheint und wir kommen ins Gespräch. Schließlich frage ich sie, was bei ihr eine Tasse Kaffee kostet.
„Weil Sie es sind, einen Euro“, erwidert sie freundlich.
„Das finde ich nett! Mir wäre jetzt nach einem starken Kaffee. Ich hätte gern eine Tasse.“
„Mein Kaffee ist immer gut, ich führe eine sehr gute Marke“, preist sie ihren Kaffee an.
Wenig später bietet sie mir Kirschkompott an. „Gratis natürlich“, fügt sie hinzu. Ich nehme dankend an und esse ihr Kirschkompott als Nachtisch.
Die Wirtin hat öfters Pilgergruppen zum Übernachten. Eine Übernachtung mit Frühstück kostet bei ihr zwanzig Euro.
„Bei mir gibt es ein sehr reichhaltiges Frühstück“, schwärmt sie. „Leider kommen viel zu selten Pilger vorbei.” Schließlich gibt sie mir Ratschläge, wie man als Pilger mit wenig Geld weiterkommt. Bei den Gaststätten Mithilfe in der Küche anbieten, Geschirrspüler ausräumen und ähnliches. Oder wenn man nicht anspruchsvoll und mit einem Zimmer zufrieden ist, das nach Abreise der Gäste noch nicht gereinigt ist, hat man gute Chancen, umsonst zu übernachten, meint sie.
Die Wirtin setzt sich zu mir und vertraut mir immer mehr von ihrem Leben an. Es entsteht Nähe und Vertrautheit zwischen uns. Also bleibe ich fast zwei Stunden in der Gaststätte. Am Schluss duzen wir uns. Ich verspreche ihr, mich nach meiner Tour telefonisch bei ihr zu melden und zu berichten. Auf einem Bierdeckel notiert sie ihren Namen und ihre Telefonnummer.
Bevor ich gehe, schaue ich mir ihre Gaststube von innen an. Dabei verliere ich bei jedem Schritt kleine Erdklumpen aus meinem Schuhprofil. Sofort drückt sie mir den Besen in die Hand. Ich kehre meine Spuren rückwärts laufend wieder weg. Wir verabschieden uns sehr herzlich voneinander. Es ist zwei Uhr nachmittags.
Im Weiler Gipshütte sehe ich eine Frau, die gerade im Garten Blumen gießt. Ich bitte sie um Trinkwasser. Sie ist nett und herzlich. Wir wechseln ein paar Worte, und ich ziehe mit ihren guten Wünschen weiter.
In Steinsfeld kommt man direkt an der Kirche vorbei. Sie ist verschlossen. Den Pilgerstempel erhält man vom evangelischen Pfarrer im Pfarrhaus. Von ihm bekomme ich auch den Schlüssel, damit ich die Kirche besichtigen kann.
Danach erklärt er mir, dass es hinter Steinsfeld keine Übernachtungsmöglichkeit mehr gibt, erst wieder in Rothenburg. Er empfiehlt mir hier im Landhotel, gleich neben der Kirche, zu übernachten.
„Das ist ein wirklich gutes Haus, es wird von allen gelobt. In Rothenburg sind die Quartiere nur teurer“, gibt er zu bedenken. „Überlegen Sie sich das und schauen Sie sich das Haus ruhig an“, fügt er hinzu. Ich bedanke mich und besichtige das Landhotel von außen.
Eigentlich wollte ich diese Nacht erstmals im Auto schlafen. Aber nun reizt es mich, den Tipp der Wirtin von Endsee auszuprobieren. Das Hotel macht einen sehr gepflegten Eindruck. Da habe ich wenig Hoffnung, mit meinem Ansinnen zu landen. Aber einen Versuch ist es wert.
Die Türe ist geschlossen, also drücke ich auf die Klingel. Eine ältere Frau öffnet im ersten Stock das Fenster und schaut zu mir herab.
„Grüß Gott, ich bin Pilgerin auf dem Jakobsweg. Was kostet denn bei Ihnen eine Übernachtung?“ frage ich nach oben gerichtet.
„Mit Frühstück für eine Nacht fünfunddreißig Euro“, ist die Antwort.
„Ich komme aus Bamberg und habe noch einen weiten Weg vor mir, nach Südfrankreich, nach Taizé. Für meine Übernachtung würde ich gerne arbeiten. Haben Sie für mich in der Küche oder sonst wo Arbeit?“ rücke ich nun mit meinem eigentlichen Anliegen heraus. Sie lächelt mir freundlich und verständnisvoll zu.
„Ich habe schon gespült und sonst gibt es nichts für Sie zu tun. Aber ich mache Ihnen einen Sonderpreis. Sie können das Zimmer für fünfundzwanzig Euro haben“, versucht sie mir entgegenzukommen.
„Das ist zwar sehr nett, aber ich reise als Pilgerin mit schmaler Kasse.
Ich suche wirklich ein Quartier, das meine Kasse nicht belastet. Vielleicht haben Sie ein ganz einfaches Zimmer, vielleicht eines von abgereisten Gästen, welches noch nicht geputzt ist? Und vielleicht findet sich dafür doch noch ein wenig Arbeit?“
„Warten Sie mal, ich komme runter“, ist ihre Antwort und sie schließt das Fenster. Die Frau scheint die Chefin zu sein. Donnerwetter! Bei diesem gepflegten Haus hätte ich eher geschäftsmäßige Distanz als diesen freundlichen, menschlichen Umgang erwartet.
Die Haustüre öffnet sich.
„Wir haben hier ein Nebengebäude, in dem schon öfter Pilger geschlafen haben. Wenn es Ihnen gut genug ist, können Sie dort umsonst schlafen“, bietet sie nun an. Sie ist tatsächlich hier die Chefin.
Sie läuft mit mir über den Hof und zeigt mir das Nebengebäude. Hinter der Eingangstüre betreten wir einen Raum, der wohl einst als Bar genutzt wurde. Eine Theke ist im Hintergrund zu sehen. Tischtennisplatte und Kickertisch füllen nahezu den Raum aus. Gleich neben der Eingangstüre gibt es einen Wasserhahn mit Ausguss. Das ist doch schon einmal gut, denke ich.
Nach links geht es in einen großen Raum, der beinahe wohnlich eingerichtet ist. Ein großer Kleiderschrank, Tisch, Sessel, Sofa stehen an den Wänden. In der Mitte breitet sich ein wuchtiger Billardtisch aus.
Es handelt sich um einen ehemaligen Stall. Die Fenster zur Straße erinnern noch daran. Zur Hofseite wurde ein normales Fenster eingebaut.
„Wenn Ihnen das reicht, bringe ich Ihnen eine Matratze und Decken, dann können Sie die Nacht hier verbringen“, bietet sie an.
„Ja, ich nehme das gerne an“, gebe ich zur Antwort. Sie geht in den Nebenraum der einstigen Bar. Mindestens zehn Matratzen sind aufeinander gestapelt und jede Menge Bettzeug liegt herum. Sie nimmt eine Matratze und wir tragen sie gemeinsam in meinen Übernachtungsraum.
„Für heute bin ich noch zu wenig gelaufen, deshalb gehe ich noch die sieben Kilometer bis Rothenburg“, erkläre ich ihr. Sie schaut mich fragend an.
„Ich komme am Abend per Anhalter hierher zurück“, fahre ich fort.
Sie versteht nicht, warum ich nach Rothenburg will, wenn ich doch hier übernachte. Sie schaut mich noch immer verständnislos an, befasst sich dann aber nicht weiter damit.
„Decken bekommen Sie am Abend, wenn Sie zurück sind. Frühstück gibt es ab halb acht und es kostet fünf Euro, wenn Sie es wünschen“, damit ist für sie alles Nötige besprochen.
Für längere Gespräche hat sie offensichtlich keine Zeit, aber sie ist dennoch sehr freundlich und aufmerksam.
Ich verabschiede mich und laufe weiter Richtung Rothenburg. Am Lindleinsee gibt es ein sehr schönes Töpfereihäuschen. Ich gehe in den Laden und schaue mir die Waren an. Der Inhaberin erkläre ich gleich, dass ich als Pilgerin unterwegs bin und nichts kaufen kann, sondern mich nur umsehen möchte.
Die Tatsache, als Jakobspilgerin unterwegs zu sein, löst offensichtlich bei vielen Menschen positive Gefühle aus, wie ich schon nach dieser kurzen Zeit feststellen kann.
Wir kommen in ein gutes Gespräch. Sie erzählt mir von einer Radtour mit Zelt in England, bei Dauerregen. Die schönsten Begegnungen hatten sie, als sie völlig durchweicht und immer wieder auf Unterstützung angewiesen waren. Es ist unglaublich, wie viele nette und hilfsbereite Menschen ihnen begegneten. Als sie wegen des Wetters kapituliert und das Zelt mit der Post nach Deutschland geschickt hatten, gab es nicht annähernd so schöne Begegnungen wie vorher.
Auch diese Geschichte bestätigt, dass man mit Bitten die Herzen vieler Menschen öffnen kann.
Meine heutige Tagesetappe ist am Stadtrand von Rothenburg beendet.
Von hier aus trampe ich zurück nach Uffenheim. Von der Innenstadt aus gibt es nach meiner bisherigen Erfahrung kaum eine Chance, ein Auto zu stoppen.
Sofort hält ein junger Mann, der von der Arbeit nach Hause fährt. Er wirkt sehr blass, trägt einen kleinen Spitzbart, hat den Kopf an den Seiten kahl geschoren und sich hinten einen langen, dünnen Pferdeschwanz wachsen lassen. Er sieht ulkig aus. Das nimmt ihm etwas von dem Ernst, den er ansonsten ausstrahlt. Wir können uns gut verständigen.
Er gibt mir noch einen Tipp, wo ich in Rothenburg ganztags kostenlos parken kann. Bei meinem Auto setzt er mich ab und ist meinetwegen sogar einen Umweg gefahren.
In der Nähe des Autos befinden sich Supermärkte. Ich kaufe mir Tomaten und Paprika, wasche alles mit Hilfe meines Wasserkanisters und bereite mir auf dem Parkplatz mein Abendessen.
Kurz vor sieben Uhr komme ich am Landhotel in Steinsfeld an. Ich parke das Auto in einer Nebenstraße, um bei der Wirtin keine Verwirrung zu erzeugen. Ich bleibe im Freien auf einer Bank, da ich nicht die Absicht habe, als Gast einzukehren.
„Sie können sich gerne in die Gaststube setzen“, fordert mich die Wirtin auf.
Das Angebot nehme ich an, suche mir eine schöne Nische und studiere meine Unterlagen. Unter den Gästen spricht sich herum, dass ich Pilgerin auf dem Jakobsweg bin. Sofort werde ich in Gespräche verwickelt. Ich entschließe mich nun doch zu einem Frühstück im Hotel und bestelle es. Es dauert nicht lange, da bekomme ich das Bedürfnis, mich auszustrecken. Ich sage der Wirtin Bescheid. Sie gibt mir saubere Decken und ein Handtuch. Dann zeigt sie mir noch, wo ich Dusche und Toilette benutzen kann. Alles ist in sauberem Zustand. Sogar Seife ist vorhanden. Ich muss von meiner „Pilgerherberge“ aus nur über den Hof gehen.
Die Luft in meinem Schlafraum ist abgestanden. Die Fenster zum Hof lassen sich nicht öffnen, die Griffe sind abmontiert. Also kippe ich beide Stallfenster. Doch das reicht längst nicht aus, um frische Luft in den großen Raum zu bringen.
Die Zimmertüre besteht aus einer Schwingtüre, die sich nicht verschließen lässt. Auch die Türe zum Hof ist nicht verschließbar. Als ich mich im Raum umschaue, frage ich mich, auf was ich mich da wieder einmal eingelassen habe. Eigentlich wäre ich jetzt lieber in meinem Auto.
Aber ich will ja richtig pilgern und dann gehört so etwas dazu. In Spanien wäre ich vermutlich froh über eine derartige Unterkunft. Die Dusche nehme ich sofort in Anspruch. Danach reibe ich mir die schmerzenden Beine mit Arnika ein. Siebenundzwanzig Kilometer Weg hinterlassen eben ihre Spuren.
Am linken Bein in Knöchelnähe hat sich eine Zecke festgesetzt. Ich merke es zu spät und kratze sie versehentlich mit dem Fingernagel ab. Das hinterlässt eine winzige, blutige Stelle am Bein. Ich hoffe, dass dies eine von den gutartigen Zecken ist, mit der ich mich nicht infiziere. Aber auch als gute Zecke hat sie damit ihr Leben verspielt. Dann öffne ich die Schwingtüre und die Türe zum Hof, um mit Durchzug die abgestandene Luft aus dem Raum zu bringen. Die frische Luft tut gut. Ich bin so müde, dass ich bald einschlafe und auch gut durchschlafe.
EIN SCHULBUS RETTET MICH AUS DEM GEWITTER
Freitag, 1. Juli 2011
Wie gewohnt wache ich zeitig, aber mit schweren Gliedern auf. Es ist noch zu bald für ein Frühstück. Mein Zeckenbiss ist gerötet, leicht angeschwollen und juckt stark.
Um sieben Uhr gehe ich in den Frühstücksraum und frage die Chefin, ob ich mich einstweilen setzen dürfe. Das Frühstück beginnt erst um halb acht und die Wirtin richtet das Büffet. Um mir die Zeit zu vertreiben frage ich sie, ob sie ein Gästebuch hat. Sie bringt es mir mit der Bemerkung, dass da schon lange niemand mehr rein geschrieben hat.
Ich schreibe meinen Dank für ihre Unterstützung meines Pilgerweges hinein und zitiere einen Spruch, der mir sehr gut gefällt:
Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Albert Schweitzer
Die Chefin bringt mir vorzeitig den Kaffee an den Tisch und sagt, ich könne mich ruhig schon bedienen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen und greife herzhaft zu. Das Frühstück ist fürstlich, mit allem was das Herz begehrt. Die fünf Euro sind zweifellos ein Pilger-Sonderpreis. Ich darf mir ein Brötchen für den Weg mitnehmen.
Zwar ist die Wirtin zurückhaltend, sucht kein Gespräch mit mir. Aber in ihrer Zurückhaltung ist sie keineswegs desinteressiert, sondern sehr menschlich und entgegenkommend. Ich fühle mich nicht wie ein Almosenempfänger, sondern wie ein vollwertiger Gast behandelt. Eine sehr schöne Erfahrung.
Wir verabschieden uns mit freundlichen Worten. Ich bedanke mich für alles und kündige an, dass ich irgendwann als ganz normaler Tourist bei ihr einkehren werde.
Um acht Uhr breche ich auf, laufe um die Ecke zu meinem Auto und fahre nach Rothenburg. Während der Autofahrt beginnt es heftig zu regnen. Tatsächlich bekomme ich am Topplerweg, neben dem Rödertor, einen Parkplatz. Ohne Stöcke, dafür mit dem großen Stockschirm laufe ich erst einmal zum Marktplatz.
In der Apotheke zeige ich meinen Zeckenbiss und frage, ob man in diesem Fall etwas unternehmen müsse. Die Apothekerin rät mir dringend, zum Arzt zu gehen und mir gegen Borreliose das Antibiotikum Doxycyclin verschreiben zu lassen. Das müsste ich 14 Tage einnehmen, um nicht das Risiko von Spätschäden einzugehen.
„Wenn ich das nehme, dann ist mein Jakobsweg zu Ende. Mit solchen Medikamenten kann ich diese Anstrengung nicht bewältigen“, entrüste ich mich. Die Apothekerin erklärt mir, dass sich in der Regel um den Biss ein Hof bildet, der immer weiter nach außen wandert. Spätestens dann müsste ich etwas dagegen tun.
„Aber die Infektion kann auch ohne äußere Zeichen ablaufen“, warnt sie.
„Ich werde mein Bein beobachten. Im Moment sind Medikamente für mich indiskutabel. Aber vielen Dank für die Auskunft.”
Anschließend suche ich das Touristenbüro auf. Ich will in Erfahrung bringen, wo ich den Jakobsweg finden kann. Innerhalb der Stadtmauern ist aus Denkmalschutzgründen keine Wegmarkierung angebracht.
Die Jakobsmuschel finde ich erst außerhalb der Stadt.
Die junge Frau im Touristenbüro ist sehr entgegenkommend. Sie kopiert mir die nächste Etappenbeschreibung aus einem Pilgerbuch. Für Touristen gibt es einen kostenlosen Internetzugang. Damit schaue ich mir den örtlichen Wetterbericht an. Unwetterartige Gewitter mit Hagel werden gemeldet. Gleichzeitig wird eine Blitzwarnung gegeben. Bei Gewitter besteht Lebensgefahr, zeigt die Wettermeldung an. Na, hoffentlich schaffe ich meine heutige Etappe bis ans Ende ohne Gewitter. In der Jakobskirche hole ich mir den Pilgerstempel. Der Pilger darf die Kirche mit dem Riemenschneider-Altar kostenlos besichtigen. Sonst müsste ich zwei Euro bezahlen.
Danach verlasse ich die Stadt, steige hinab ins Taubertal und an der gegenüberliegenden Seite im Wald wieder hoch. Immer wieder regnet es. Ich gehe über eine weitgestreckte Hochfläche. Wenn ich zurückblicke, sehe ich noch lange die wunderschöne Silhouette Rothenburgs. Häufig muss ich den Regenschirm öffnen. Nach etwa acht Kilometern bin ich in Enzenweiler. Schwarze Gewitterwolken ziehen nun auf. Aus einiger Entfernung dringt Donnergrollen an mein Ohr. Vor mir liegen noch gut zwölf Kilometer Weg mit einem sehr langen Waldstück. Es ist mittags halb eins. In einem überdachten Bushäuschen will ich meine Mittagsbrotzeit machen und das Gewitter abwarten. Entweder es entlädt sich oder es zieht weiter, denke ich.
Meine Paprikaschote ist nicht gewaschen. Gerade ist dieser Ehec-Virus aktuell und ich will sie lieber doch mit Wasser abwaschen. Beim nächstbesten Haus klingle ich.
Es öffnet eine ältere, etwa siebzigjährige Frau, die mich durch ihre Brillengläser freundlich ansieht. Ich gebe mich als Jakobswegpilgerin zu erkennen und bitte sie, mir die Paprikaschote für meine Mittagsbrotzeit zu waschen und mir meine Trinkflasche mit Leitungswasser aufzufüllen.
„Das mache ich gerne“, ist ihre Reaktion. „Aber möchten Sie nicht hereinkommen und einen Teller Suppe essen? Mein Mann und ich haben schon gegessen, aber die Suppe ist noch warm“, fügt sie hinzu. „Vielen Dank! Wenn Sie mich so nett einladen, sage ich nicht nein.“ Ich bin erfreut über soviel Gastfreundlichkeit.
Schon sitze ich in der Küche und die Frau erhitzt den Suppenrest für mich. Hier fühle ich mich sofort wohl, ein bisschen wie zu Hause. Diese Frau strahlt soviel Güte und Menschlichkeit aus.
Ich berichte ihr, dass ich das Gewitter im Bushäuschen abwarten wollte. Der Blick aus ihrem Fenster lässt nicht erkennen, was aus den schwarzen Wolken geworden ist. Nach der Suppe bin ich satt. Den Kuchen, den sie mir noch anbietet, lehne ich dankend ab. Wir unterhalten uns ungewöhnlich freundschaftlich. Gar nicht wie zwei fremde Menschen.
Nach einiger Zeit breche ich auf. Die Frau schickt mir viele gute Wünsche mit auf den Weg, schenkt mir noch einen Apfel und sagt, wenn ich irgendein Problem hätte, könnte ich gerne zurückkommen. Ihre Türe stünde für mich jederzeit offen.
Ungewöhnliche Worte, und sie tun gut! Ich bin sehr berührt von der liebevollen Art, die sie mir entgegenbringt und staune über soviel Offenheit und Gastfreundschaft.
Bisher hat sich kein Gewitter bemerkbar gemacht. So erwarte ich, dass es sich verzogen hat. Beschwingt und glücklich über diese schöne Begegnung verlasse ich das Haus.
Als ich bergauf das Ende des Dorfes und die Hochebene erreicht habe, trifft mich fast der Schlag!
Der Himmel ist tiefschwarz. Was ich vorhin gesehen habe, waren im Vergleich zu diesem Anblick harmlose, dunkle Wolken. Jetzt wirkt alles äußerst bedrohlich. Man möchte meinen, die Welt geht gleich unter. Mehrere Blitze zucken kurz hintereinander am Himmel. Ich erinnere mich an die Wettervorhersage. Sie hat unwetterartige Gewitter mit Hagel angekündigt.
Zurückgehen hat wenig Sinn. Vom Haus der älteren Frau habe ich keine Sicht auf das Wettergeschehen. Einen Moment stehe ich ratlos da und weiß nicht, wohin ich mich wenden soll.
Mein Weg würde nun nach links zum Wald führen. Geradeaus in Richtung der schwarzen Wolken steht ein einzelnes Haus außerhalb des Dorfes. Von hier aus könnte ich die Entwicklung des Wetters gut beobachten.
Der Wind beginnt plötzlich kräftig zu blasen. Es wird jeden Moment losgehen. Ich versuche einzuschätzen, ob ich die dreihundert Meter zu diesem Haus noch schaffen kann, bevor der Himmel seine Schleusen öffnet. Dann entscheide ich mich für dieses Haus. Nur hier kann ich sehen, wie sich das Wetter entwickelt.
So schnell ich kann eile ich auf das Haus zu. Vereinzelt fallen die ersten schweren Tropfen. Eine junge Frau befindet sich im Garten und will vor dem Sturm noch Beeren von ihren Sträuchern pflücken. Ich frage, ob ich mich bei ihrem überdachten Eingang ein wenig unterstellen dürfte, bis sich das Gewitter verzogen habe. Die Frau ist einverstanden. Noch habe ich die Illusion, ich könnte dieses Gewitter abwarten, um dann meinen Weg fortzusetzen.
Innerhalb weniger Minuten findet ein richtiger Temperatursturz statt. Die Bäume biegen sich im heftigen Wind. Ich friere in meiner Kleidung und drücke mich in eine windgeschützte Ecke. Es beginnt leicht zu regnen. Der Himmel wirkt immer schrecklicher. Allmählich kann ich nicht mehr daran glauben, dass es sich hier um ein kurzes Gewitter handelt.
Da kommt ein Schulbus. Ein kleiner Junge steigt aus und läuft zum Haus. Erst jetzt geht es richtig los. Die Frau verlässt den Garten, um mit ihrem Sohn ins Haus zu gehen. Wir tauschen im überdachten Vorbau ein paar Worte aus. Ich berichte ihr, dass mein Auto in Rothenburg steht. Sie bietet mir an, bei ihr ein Stück Kuchen zu essen. Ich lehne dankend ab, da ich ja meinen hohen Blutzuckerspiegel mit entsprechender Ernährung senken will. Kuchen hilft mir dabei nicht.
Dann geht ein richtiger Wolkenbruch nieder. Wassermassen prasseln herab, Blitze zucken.
„Von diesem Ort hier kommen Sie nicht weg“, meint die Frau. „Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn Sie zurück nach Rothenburg wollen, ist der nächste Schulbus um zwei Uhr die einzige und letzte Möglichkeit, von hier wegzukommen. Sie können ja den Busfahrer fragen, vielleicht nimmt er Sie mit“, rät sie mir.
Für mich würde das bedeuten, die Tour abzubrechen. Ich bin heute so wenig gelaufen. Innerlich bin ich dazu noch nicht bereit, suche nach einer anderen Lösung. Am liebsten wäre mir, wenn das Gewitter in einer Stunde vorbei wäre und ich dann meinen Weg hier fortsetzen könnte. Unter dem Vorbau des Hauses will ich erst einmal abwarten. Wir verabschieden uns voneinander. Sie geht mit ihrem Kind ins Haus.
Um mich herum tobt das Unwetter und es schüttet wie aus Eimern. Allmählich reift in mir der Gedanke, doch den Schulbus nach Rothenburg in Anspruch zu nehmen. Hier in der Kälte ein bis zwei Stunden zu stehen, erscheint mir nicht sinnvoll. In dieser Zeit kann ich wenigstens mein Auto näher zu meiner Wanderetappe bringen. Bis dahin ist das Gewitter vermutlich vorbei und ich habe die Zeit sinnvoll genutzt, stelle ich mir vor. Es dauert noch zwanzig Minuten, bis der Schulbus kommt. Zwanzig Minuten können lang sein, wenn man in der Kälte steht.
Der Bus kommt und hält am Haus. Ich springe mit meinem Schirm hin. Nachdem das letzte Kind ausgestiegen ist, befindet sich außer dem Busfahrer nur noch ein Mann darin. Ich erkläre dem Fahrer meine Situation und bitte ihn, mich nach Rothenburg zu meinem Auto mitzunehmen, denn ich will bei diesem Wetter die Etappe abbrechen.
Der Busfahrer ist ein fröhlich wirkender, etwa fünfundfünfzigjähriger Mann, offensichtlich ein Gemütsmensch, ein Menschenfreund.
„Steigen Sie ein, selbstverständlich können Sie mitfahren. Für Frauen machen wir Männer doch alles“, fügt er augenzwinkernd, charmant lächelnd hinzu.
„Das höre ich gerne. Ich merke schon, hier bin ich genau richtig“, lache ich ihn an.
„Und was meinen Sie, wie es sich bei den Frauen gegenüber den Männern verhält?“ frage ich ihn anschließend.
„Die Frauen machen noch viel mehr für ihre Männer.“
„Das glaube ich auch. Ich finde es gut, dass Ihnen das bewusst ist. Noch schöner, wenn Sie es auch zu schätzen wissen.“
Für einen Moment wird er ernst und nachdenklich: „Doch, ich weiß das zu schätzen. Aber ich weiß auch, dass es viele Männer nicht zu schätzen wissen.“
„Soviel Einsicht bei einem Mann! Das ist ja selten, aber es gefällt mir natürlich“, antworte ich anerkennend. „Es tut gut, immer wieder auf nette Männer zu treffen.” Ich freue mich ehrlich.
Der zweite Mann im Bus grinst vor sich hin, beteiligt sich aber nicht am Gespräch. Der Busfahrer interessiert sich für meinen Pilgerweg, will wissen, wie ich das mit dem Auto handhabe, und manches mehr. Er wundert sich, dass ich so ganz allein unterwegs bin.
„Ich will jetzt nur mein Auto holen. Und nach dem Gewitter will ich in Enzenweiler meine Tour fortsetzen“, teile ich ihm meine Entscheidung mit.
„Von diesem Dorf kommen Sie nicht weg und auch nicht hin. Unter der Woche höchstens mit dem Schulbus, am Wochenende jedoch geht hier gar nichts“, ist seine nüchterne Feststellung.
„Na ja, ich werde mir noch überlegen, wie ich mit dieser Situation umgehe. Nun will ich erst mal wieder am Auto sein. Es steht am Rödertor. Vielleicht können Sie mich bei ihrer Tour an einer günstigen Stelle absetzen“, frage ich ihn.
In Rothenburg angekommen fährt er direkt Richtung Rödertor.
„Wo fahren Sie denn jetzt hin“, rufe ich verwundert aus.
„Dann ändere ich heute eben meine Route und komme ein paar Minuten zu spät beim nächsten Haltepunkt an“, lächelt er verschmitzt.
Am Tor angekommen strecke ich ihm die Hand hin: „Ganz herzlichen Dank für diesen außergewöhnlichen Service: Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu fahren. Alles Gute für Sie.“
„Auch Ihnen alles Gute für Ihre weitere Tour“, antwortet er freundlich.
Schon bin ich auf der Straße, nur wenige Meter von meinem Auto entfernt. Ich winke ihm zu, bis er um die Kurve verschwindet.
In Rothenburg regnet es unverändert heftig. Kein einladendes Wanderwetter. Deshalb laufe ich erneut in die Stadt hinein. Inzwischen habe ich trotz Suppe wieder Hunger bekommen. Im Touristenbüro befinden sich bequeme Sessel um einen Tisch herum. Ich packe meine Brotzeit aus, schneide meine Paprikaschote und wärme mich gleichzeitig auf. Danach versuche ich im Internet an mein Postfach zu gelangen. Besonders gut bin ich damit nicht vertraut und weiß nicht, ob ich mich an einem fremden Computer zurechtfinde.
Es gelingt und ich schreibe Daniela in einer E-Mail, was ich heute erlebt habe. Mein Postfach zeigt, dass Laurin, eine Bekannte, mich zusammen mit Daniela zu einem Weinabend auf dem Balkon einlud. Schade, da wäre ich gerne hingegangen. Ich schreibe Laurin, dass ich in Rothenburg auf dem Jakobsweg sei.
Ich fahre mit dem Auto los. Noch immer habe ich die Absicht, mit meiner Tour in Enzenweiler anzuknüpfen. Doch der Himmel ist dort unverändert voll kräftiger, schwarzer Gewitterwolken. Sie haben nicht vor, sich zu verziehen, sondern kreisen ständig über dieser Hochebene. Es hat wirklich keinen Sinn. Also fahre ich weiter nach Schrozberg, wo das Ende meiner Tagesetappe gewesen wäre. Gerade noch rechtzeitig erreiche ich das Pfarrhaus.
Der Pfarrer und seine Frau sind gerade im Aufbruch zu einer Veranstaltung. Von der Frau bekomme ich den Pilgerstempel und die Information, was die Übernachtung im örtlichen Pilgerhaus kostet. Sie soll 24 Euro, plus 6 Euro für das Frühstück kosten. Das ist mir zu teuer.
Ich werde im Auto schlafen und frage, wo ich einen sicheren Stellplatz finden könnte. Die Pfarrersleute empfehlen mir, mich direkt neben ihre Garage am Pfarrhaus zu stellen. Das Garagentor lassen sie für mich offen, damit ich früh Strom für meinen Wasserkocher habe. Im Pfarrgarten kann ich Wasser holen. Und dort darf ich auch das Gebüsch benutzen, wenn ich nachts raus muss, zwinkert mir die Frau zu.