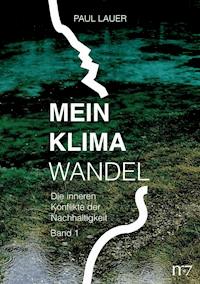
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Wandel beginnt bei mir. Ich fahre Auto, esse Fleisch und fliege auf Urlaub. Ist es meine Vorstellung eines guten Lebens, die meine Umwelt zerstört? Der Klimawandel ist in aller Munde – aber was ist mit mir? Steckt mein Leben in der Krise? Oder nur das Leben generell? Diesem Buch liegt die Überzeugung zugrunde, dass ich die ökologische Krise nur dann begreifen kann, wenn ich mich auch als entscheidenden Teil dieses Ungleichgewichts erkenne. Gesellschaftliche Veränderung ist die Summe vieler persönlicher Veränderungen. Der Klimawandel ist auch der meine. Zu meinem Wandel wird der Klimawandel, indem ich die Äußerlichkeit der ökologischen Krise auch in ihrer Innerlichkeit begreife: Ich nehme mich und meine inneren Konflikte als Schauplatz der Krise wahr und werde auf jene Möglichkeitsräume aufmerksam, die ich in mir schaffen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Wandel beginnt bei mir
Ich fahre Auto, esse Fleisch und fliege auf Urlaub. Ist es meine Vorstellung eines guten Lebens, die meine Umwelt zerstört? Der Klimawandel ist in aller Munde – aber was ist mit mir? Steckt mein Leben in der Krise? Oder nur das Leben generell? Diesem Buch liegt die Überzeugung zugrunde, dass ich die ökologische Krise nur dann begreifen kann, wenn ich mich auch als entscheidenden Teil dieses Ungleichgewichts erkenne. Gesellschaftliche Veränderung ist die Summe vieler persönlicher Veränderungen. Der Klimawandel ist auch der meine.
Zu meinem Wandel wird der Klimawandel, indem ich die Äußerlichkeit der ökologischen Krise auch in ihrer Innerlichkeit begreife: Ich nehme mich und meine inneren Konflikte als Schauplatz der Krise wahr und werde auf jene Möglichkeitsräume aufmerksam, die ich in mir schaffen kann.
Mag. Paul Lauer M.A., geb. 1984 in Graz, Studium der Politikwissenschaft in Wien und Valladolid, sowie der Friedens- und Konfliktforschung in Innsbruck und San Jose, Costa Rica. Freier Konfliktwissenschaftler mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Konflikttransformation und interkultureller Dialog.
Stella
dir vor!
Inhalt
Vorwort
TEIL 1 Flowing
Einleitung
Grundlagen
Mein Wandel
Struktur der Welle
TEIL 2 Staccato
Beziehungen
Fakten
Moral
TEIL 3 Chaos
Tiefen
Künstlichkeiten
Sicherheiten
Gipfel der Unsicherheit
TEIL 4 Lyrical
Verbindungen
Entfaltungen
TEIL 5 Stillness
Ökosophie R
Mein Klimawandel
Anhang
Meine DeuteragonistInnen
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Wie lieblich ist es, dass Worte und Töne da sind:sind nicht Worte und Töne Regenbogen und Schein-Brücken zwischen Ewig-Geschiedenem?
Zu jeder Seele gehört eine andre Welt;Für jede Seele ist jede andre Welt eine Hinterwelt.
Zwischen dem Ähnlichsten gerade lügt der Schein am Schönsten;Denn die kleinste Kluft ist am schwersten zu überbrücken. <Friedrich Nietzsche>
Vorwort
Diese meine Geschichte ist mit Worten und auch Tönen geschrieben. Jeder Satz möchte eine Brücke sein. Unterschiedliche Perspektiven gibt es endlos. Deine ist nicht die meine. Auch innerhalb meiner Selbst gibt es derer viele – so möchte ich sagen. Wenn der eine oder andere Satz unsere Hinterwelten überbrücken kann, so bin ich zufrieden. Zwischen uns mögen die Klüfte größere oder kleinere sein. Aber schon in mir beginnen sie, diese kleinen Klüfte. Und diese Klüfte sind am schwersten zu überbrücken – so scheint es.
Nietzsches Zitat habe ich mir selbst als Postkarte nach Hause geschickt, in meine erste eigene Wohnung. Ich saß auf der griechischen Insel Ios, gemeinsam mit anderen Post-MaturantInnen tief im dionysischen Kater gefangen, und las also „Also sprach Zarathustra“. Ich weiß nicht mehr, wieso mich gerade diese Zeilen so faszinierten. Sicher scheint nur, dass ich selbige damals anders gelesen und aufgefasst haben dürfte. Falls ich mir schon damals die Frage gestellt habe, wie ich leben möchte, so dürften auch meine Antworten darauf andere gewesen sein. Sicher scheint wiederum nur, dass ich es nicht mehr mit Bestimmtheit sagen kann.
Wie will ich leben? Diese Frage wird auf den folgenden Seiten von großer Bedeutung sein. Sie umrahmt diese Arbeit so wie sie mein Leben umfasst. Sie bildet eine stabile Brücke zwischen mir und meiner Mitwelt. Sie umgibt mich und meine Umwelt. Sie bildet den nachvollziehbaren Grund, wieso das Thema der ökologischen Krise so eng mit meiner persönlichen Entwicklung verwoben ist. Mein Leben, das inmitten von Leben leben möchte1, ist auch eines, das glücklich inmitten von glücklichem Leben leben möchte.
Wie sehr ist sie meine, diese ökologische Krise? Ist sie mein Untergang, meine Chance? Steckt mein Leben in der Krise? Oder nur das Leben generell? Ist es eine Frage der Problemstellung? Eine Frage der Wahrnehmung? Ist die ökologische Krise dadurch beeinflusst, dass wir manche so genannten Probleme für wahr nehmen und andere nicht?
Diesem Buch liegt die Überzeugung zugrunde, dass ich die ökologische Krise nur dann (be-)greifen kann, wenn ich mich auch als entscheidenden Teil dieses Ungleichgewichts erkennen kann. Um komplexe gesellschaftliche Dynamiken zwischen panischer Angst und stoischer Gelassenheit, sowie all ihre anderen spannenden Nuancen, besser zu verstehen, braucht mein Blick nicht in die Ferne zu schweifen. Der Klimawandel ist auch der meine.
1 Schweitzer (2007)
TEIL 1 Flowing
Denken [will] gelernt sein, wie Tanzen gelernt sein will, als eine Art Tanzen [...] Tanzenkönnen mit den Füßen, mit den Begriffen, mit den Worten: habe ich noch zu sagen, daß man es auch mit der Feder können muß – daß man schreiben lernen muß? – Aber an dieser Stelle würde ich deutschen Lesern vollkommen zum Rätsel werden. <Friedrich Nietzsche>
TEIL 1 Flowing
Einleitung – Hier und Jetzt – Wie will ich leben? – Ich und die ökologische Krise – Meine Konflikte – Grundlagen und Eingrenzungen – Das Subjekt der Wissenschaft – Grundlagen – Die vielen Frieden – Energetische Frieden – Die transrationale Wende – Humanistische Psychologie – Ganzheitlich-systemischer Ansatz – Tiefenökologie – Mein Wandel – Mein Körper – Fünf Rhythmen – Flowing, Angst und Trägheit – Der Tanz der Personae – Struktur der Welle.
Einleitung
Diese Einleitung gestaltet sich wie erste Tanzschritte von jemandem, der tanzen nicht als etwas betrachtet, das erlernt werden müsste. Ich werde mich von meinen Schritten führen lassen und dabei sämtliche Inseln streifen, die ich auf meiner Reise noch ausführlicher zu besuchen gedenke. Themen und Begriffe werden in diesem ersten Teil ineinanderfließen, und erst zu einem späteren Zeitpunkt genauer erläutert werden. Ich lade die Leserin2 dazu ein, sich ebenso auf dieses Treiben einzulassen, und von meinen kleinen und größeren Schritten führen zu lassen. Im Übrigen werden manche Schritte weibliche, manche männliche Endungen haben. Im Gesamten soll dabei eine hermaphroditische Schriftform entstehen, die auf alle Umständlichkeit verzichten darf.
Eine Tänzerin, ein Sänger, ein Poet samt seinem Ich und mehrere Schauspieler werden durch die verschiedenen Teile führen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Teil meiner Person sind. Das gesamte Buch bezieht sich auf mich und meine Lebensrealität. In den meisten Fällen schreibe ich in der Ich-Form. In einigen Fällen benutze ich die Wir-Form und beziehe mich dann auf meine Ichs und meine Umgebung. Wenn ich von meiner Gesellschaft spreche, dann beziehe ich mich auf die mir nahe Gesellschaft, deren Teil ich bin. Was an dieser Stelle noch verwirrend wirkt, wird über die nächsten Seiten hinweg sehr verständlich.
Hier und Jetzt
Es gäbe nur zwei Tage im Jahr, an denen wir nichts zu tun vermögen, so habe Buddha gesagt. Gestern und morgen. Hier und Jetzt gilt es zu entscheiden, wie ich mein Leben leben möchte. Das Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist von fundamentaler Bedeutung für eine Auseinandersetzung mit mir und meiner Mitwelt. Auch wenn diese Frage für jede Einzelne hier und jetzt selbst beantwortet werden muss, bleibt sie doch eng mit Vergangenem und vermeintlich Zukünftigem verbunden.
Hier und jetzt ist eine zeitliche wie auch räumliche Eingrenzung. Es geht weder darum, einer Vergangenheit nachzuhängen, noch von einer (anderen) Zukunft zu träumen. Das, was ich jetzt tue, prägt mein Sein. Und das Sein ist entscheidend für Veränderungen, während das Haben an Vergangenem festhält. „Im Habenmodus ist der Mensch an das gebunden, was er in der Vergangenheit angehäuft hat: Geld, Land, Ruhm, sozialen Status, Wissen, Kinder, Erinnerungen.“3
Erich Fromm4 beschreibt das Hier und Jetzt als Ewigkeit, beziehungsweise als Zeitlosigkeit: „Auch die Zukunft kann man erleben, als sei sie das Hier und Jetzt.“5 Dies ist für ihn die Kunst des echten utopischen Denkens. Es geht dann darum, die Vorstellung eines zukünftigen Zustands so sehr ins Bewusstsein mit einfließen zu lassen, dass mein gegenwärtiges Tun dadurch geprägt wird. Diese Zeitlosigkeit, dieses Verschwimmen von heute und morgen, ist für Fromm das Gegenteil von bloßem Tagträumen.6 Die deutsche Kulturwissenschaftlerin Hildegard Kurt7 formuliert es nach meinem Geschmack am schönsten, indem sie schreibt: „Wir können auf die Zukunft hin denken und, bedeutsamer noch, von der Zukunft her.8 Und in der Art, wie wir das, was noch nicht Wirklichkeit ist, wahrnehmen, für wahr nehmen, oder auch nicht, formen wir es mit.“9
Außerdem verlangt das Hier und Jetzt nach einem Ort. „Suche deinen Ort und handle danach“10, lautet eine javanische Weisheit. Mein Leben, mein Sein, mein Tun – all das braucht einen Ort des Geschehens. Der Prozess der Globalisierung hat unsere Welt klein und uns glauben gemacht, dass wir als Weltgesellschaft11 global zu agieren haben. Ich möchte keinesfalls bestreiten, dass es globale Zusammenhänge zu verstehen und zu beachten gilt. Dennoch soll in diesem Buch aufgezeigt werden, dass wir bei allem globalen Handeln die Nähe zu unseren lokalen und naheliegenden Orten zu verlieren drohen. Niemand ist auf der ganzen Welt zu Hause. Der norwegische Philosoph und Begründer der Tiefenökologie Arne Naess12 formuliert es so: „Wo das Selbst günstige Entwicklungsbedingungen vorfindet, betrachtet der betreffende Mensch seine eigene Umgebung, aber auch die ganze Natur mit Wohlwollen und positiven Gefühlen.“13 Mein Hier und Jetzt bedeutet die Verbundenheit zu einem Ort und eine klare Vorstellung davon, wie ich an diesem Ort leben möchte.
Es spricht nichts dagegen, sich auf der ganzen Welt zuhause zu fühlen. Es spricht aber auch vieles dafür, sich an einem Ort besonders zu Hause zu fühlen, Wurzeln zu schlagen und sich selbst und seine Umwelt dort wachsen und gedeihen zu lassen. Denn dafür braucht es Zeit und Aufmerksamkeit. Und diese erscheint mir reichlich knapp, sollte ich sie auf die ganze Welt verteilen wollen. Ähnlich problematisch verhält es sich bei der Vorstellung einer geeinten Welt. Der bekannte Slogan „global denken, lokal handeln!“ übersieht die banale Tatsache, dass er schlicht zu etwas Unmöglichem auffordert. Die amerikanische Tiefenökologin Dolores LaChapelle macht das deutlich, wenn sie uns Menschen auf unser Dasein als Säugetiere aufmerksam macht: „Ein Säugetier kann nicht wirklich über den Planeten reden, weil es den Planeten nicht sieht. Dieser schöne Slogan von der ‚Einen Welt‘ wird nicht funktionieren. Ein Säugetier muss den Ort, über den es läuft, sehen, um sich darum zu kümmern.“14 Dementsprechend sei diese eine Welt eine künstliche Idee, ein gesellschaftliches Hirngespinst. „Wir können die Erde nicht lieben. Was wir lieben können, ist unser Platz auf dieser Erde.“15 Obwohl diese Aussage auf den ersten Eindruck eher paradox anmutet, werden die kommenden Seiten eine solche Ortsverbundenheit auch in ihrer Verbindlichkeit darstellen.
Braucht auch die Utopie einen Ort, um nicht als bloßer Wunschtraum zu verpuffen? Die Utopie wird niemals zu einem Ort werden, so viel steht fest. Die Utopie, als Nicht-Ort, kann als Plan, Konzept oder Vision verstanden werden, um sich einen anderen Ort vorzustellen, dessen Erreichen bereits durch den Namen verunmöglicht wird. Ich kann die Utopie aber sehr wohl mit meinem Ort verbinden und sie als „Möglichkeitsraum“ nutzen. „Utopien sind ein großartiges Mittel, um Denken und Wünschen zu üben: sich einen wünschbaren Zustand zu imaginieren, macht den Status quo zu lediglich einer Variante von vielen möglichen Wirklichkeiten.“16
Der deutsche Sozialpsychologe Harald Welzer17 kritisiert die Ökologiebewegung dafür, das anregende Mittel der Utopie gänzlich außer Acht zu lassen: „Die Ökologiebewegung war nie utopisch. [...] Es geht [ihr] weniger positiv um die Frage, wie die Gesellschaft sein solle und zu denken wäre, sondern negativ und immer präsentistisch darum, wie sie gerade nicht sein sollte.“18 Möchte ich so leben, wie ich momentan lebe? Möchte ich als Teil einer Gesellschaft leben, die ihre Mitwelt ausbeutet und zerstört? Und was kann ich dagegen tun?
Die entscheidende Frage wird sein, ob ich mir eine andere Welt vorstellen kann – ob ich mir überhaupt vorstellen kann wie es aussehen könnte, sollte sich etwas ändern. Untergangsszenarien sind rasch gemalt, bei anregenden Zukunftsvisionen geizen aber auch die grünsten Politikerinnen gerne mit Farbe.
Wie will ich leben?
Vorstellungen, wie wir unser Leben nicht leben möchten, vernehme ich dauernd und überall. Die Tänzerin möchte nicht ihr ganzes Leben in einer Großstadt verbringen. Der Sänger möchte nicht bis er 70 ist in einem Büro ohne Fenster arbeiten. Das Ich des Poeten möchte nicht jeden Tag im Stau stehen, nicht einmal im Jahr für zwei Wochen nach Mallorca fliegen und es möchte kein genmanipuliertes Hühnchen auf seinem Teller. Umgekehrt wird es schon deutlich schwieriger: Wo möchte ich mein Leben verbringen? Wie sieht meine ideale Arbeit, meine Freizeit, meine Ernährung etc. aus? Eine Vorstellung davon zu haben, wie ich leben möchte, setzt voraus, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze – mich und meine Bedürfnisse kenne.
Es kann durchaus als (eurozentristischer) Luxus betrachtet werden, sich diese Frage überhaupt stellen zu können. So sitze ich hier an meinem Schreibtisch, tippe Worte in meinen Laptop und sinniere über das Leben. Hunger zu erleben, kein Dach über dem Kopf zu haben oder gar erschossen zu werden – all das brauche ich momentan nicht wirklich zu fürchten. Es kann aber auch als Faulheit oder Arroganz betrachtet werden, sich diese Frage in einer gewaltträchtigen Konsumgesellschaft nicht zu stellen. Denn sie bedeutet nichts anderes als sich bewusst mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen und Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen.
Meine Gesellschaft erlebe ich als höchst erfolgreich dabei, mich von mir selbst abzulenken, eine Vielzahl an bemerkenswert absurden Wünschen in mir aufkommen zu lassen und mich derart gut zu unterhalten, dass meine (kritischen) Fragen im Hintergrund verschwinden. Und ich als Teil dieser Gesellschaft trage dazu bei.
Vor welchem Leben fürchten wir uns? Was bezeichnen wir als schlechtes Leben? Die Frage nach dem guten Leben scheint mir und meiner Umgebung eine ambivalente zu sein. Bei all unserem Wissen der so genannten Moderne erleben wir uns als unwissend, wenn es um die grundlegendsten Fragen der menschlichen Existenz geht.19 Wenn gutes Leben den Prinzipien Gesundheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz kompromisslos folgen muss, dann „fragen wir uns nur noch, wie wir möglichst lange leben beziehungsweise überleben können“20.
Die Frage nach dem eigenen Leben setzt etwas voraus, das der Sicherheit gerne als gegenteilig betrachtet wird21: Die Freiheit zur Selbstbestimmung. Ich muss über mein Leben selbst bestimmen können, um es entsprechend meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Zu einem selbstbestimmten Leben gehört nicht nur, die eigenen und gesellschaftlichen Dynamiken zu hinterfragen und zu durchschauen, sondern sich im Zweifelsfall auch von Manipulationen befreien zu können. Der Schweizer Philosoph und Schriftsteller Peter Bieri22 fordert in diesem Zusammenhang zu einer „Aneignung des eigenen Denkens, Fühlens und Erinnerns“23 auf. Für Bieri ist die Selbstbestimmung untrennbar mit einem Sinn fürs Mögliche verbunden.24 Erst die nötige Phantasie und Einbildungskraft kann mich auf Fragen, die sich um Würde und Glück drehen, Antworten finden lassen. Dies erfordert eine innere Reise durch das eigene Selbst, um auf die Suche nach der eigenen Stimme zu gehen.25
Folglich führt mich die Frage nach dem „Wie“ meines Lebens, die Suche nach meiner Selbstbestimmung und meiner eigenen Stimme, unmittelbar zu meinem Selbst. Es ist auf weiten Strecken eine innere Reise, die mich erst in jene Tiefe der ökologischen Krise eindringen lässt, wo ich meine Antworten zu suchen beabsichtige. Denn noch bevor ich mich überhaupt innerhalb meiner Beziehung zur Natur verorten kann, muss ich meine Natur besser verstehen und hinterfragen. Mich, als gewachsenes Resultat tausendfacher Prägungen, die, wiederum mit Peter Bieri gesprochen, jenen „Sockel“ bilden, über den wir nicht bestimmen können. Es kann nur darum gehen, eine innere Selbstständigkeit zu erlangen, die mich Einfluss auf meine Innenwelt nehmen lässt, „auf die Dimension meines Denkens, Wollens und Erlebens, aus der heraus sich meine Handlungen ergeben.“26
Ist ein „gutes“ Leben nachhaltig? Nachhaltigkeit ist eines jener Schlagworte, das in keiner Diskussion rund um die ökologische Krise fehlt. „Nachhaltige Entwicklung“, schreibt die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED) in ihrem Brundtland Bericht 1987, „ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation dient, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.“27 Eine tiefergehende Betrachtung dieser bekannten Definition kommt nicht daran vorbei, nach einer genaueren Definition der erwähnten Bedürfnisse zu fragen.28 Wissen wir, was diese Formulierung meint, wenn sie von Bedürfnissen spricht? Meinen Du und ich das Gleiche, wenn wir von unseren Bedürfnissen sprechen?
Der indische Philosoph Amartya Sen bringt mich an dieser Stelle weiter, wenn er von Entwicklungspotenzialen (capabilities) spricht. Daran anknüpfend wäre die Herausforderung jene, allen Menschen und kommenden Generationen die Entwicklungspotenziale zu bewahren, welche für jene Freiheit (oder Selbstbestimmung) stehen, ihnen ein Leben zu ermöglichen, das sie als lebenswert schätzen.29 Das macht uns darauf aufmerksam, dass Bedürfnis kein Begriff ist, den man unbestimmterweise einfach so verwenden kann. Dessen Bestimmung schließt alle angesprochenen Schritte mit ein, die sich bei der Frage, wie ich leben möchte, stellen. Bedürfnisse können nicht pauschal durch Ressourcen befriedigt werden. Ein Fahrrad mag ein Leben um einiges lebenswerter machen. Es hilft aber wenig, wenn es aufgrund von Schnee, Wüste oder körperlicher Unfähigkeit nicht gefahren werden kann.30
Bei näherer Betrachtung der erwähnten Definition von Nachhaltigkeit wird schnell deutlich, wieso Bedürfnisse und Entwicklungspotenziale, aber auch Lebensstrategien und Wohlbefinden in einem komplexen Wechselspiel stehen31, dessen Simplifizierung den Menschen mit einer Maschine gleichsetzt. Ein Mensch möchte wachsen und gedeihen, in Selbstbestimmung leben, eigene Entwicklungspotenziale nutzen und nach Glück streben. In Anlehnung an Hildegard Kurt32, werde ich den Begriff der „Zukunftsfähigkeit“ als Synonym für Nachhaltigkeit verwenden, um den vielseitigen, lebendigen Prozess besser beschreiben zu können.
Mir erscheint die Vorstellung, die ökologische Krise als eine Chance zu erkennen, um die Frage nach einem sinnerfüllten Leben neu zu stellen, als äußerst anziehend33. Vieles deutet darauf hin, dass sich unsere Gesellschaft in einer Sackgasse befindet und nicht so weitermachen kann, wie bisher. Mit absoluter Sicherheit sagen lässt sich das nicht. Sicher scheint mir aber jedenfalls, dass sich unsere Vorstellung von Fortschritt und Lebensstandard zunehmend von persönlichen Entwicklungspotenzialen und Lebensqualität, von Zukunftsfähigkeit und Glück, wegbewegen.
Der Klimawandel ist ein gutes Klima für einen Wandel.34 Eine gesellschaftliche Veränderung wird durch viele persönliche Veränderungen getragen. Veränderungen zu einem zukunftsfähigen Leben können nur außerhalb der Komfortzone liegen, „also dort, wo es etwas entschleunigter, sesshafter und bescheidener zugeht“35. Hierzu wird es nicht ausreichend sein, mit abschreckenden Szenarien dunkle Aussichten zu malen und darauf zu hoffen, dass sich mehr und mehr Menschen für ein nicht weiter definiertes Gegenteil von Weltuntergang entscheiden und in diesem Sinne ihre Lebensweise verändern. Ich wünsche mir mehr Mut zu Visionen! Lasst uns mehr Utopien erschaffen, die weder sofort zerplatzen wie Tagträume noch als rigide Handlungsanweisungen verstanden werden müssen. Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunftsfähigkeit dürfen nicht mit Generalplänen und Ideologien verwechselt werden. Es geht darum, unseren Möglichkeitssinn zu schärfen, der Phantasie freien Lauf zu lassen und unsere Gegenwart von der Zukunft her neu zu denken.36
Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie ich leben möchte, ist mein erster Schritt in diese Richtung. Ich beginne meine eigene kleine Gegengeschichte zu schreiben. „Eine solche Gegengeschichte ist vielstimmig, fragmentarisch, ein Mosaik aus unterschiedlichen, gescheiterten und erfolgreichen Entwürfen eines guten Umgangs mit der Welt. Sie ist kein lineares holistisches Programm, kein datenbasierter Masterplan.“37 Und fernab von jeglichem ersehnten Ziel ist es vielmehr ein offener Tanz in eine mich anziehende Gegend – ein Probieren, ohne Angst vor Fehlern, und zum Scheitern bereit.
Was? – Ich und die ökologische Krise
Ich bin ein Kind des Erdöl-Zeitalters. Auch meine Eltern und Großeltern sind mit Erdöl und dessen Erzeugnissen groß geworden. Das Ausmaß hat sich aber während den 30 Jahren meines bisherigen Lebens rapide gesteigert.38 Ich bin von Erdöl umgeben. Die Mehrheit aller Gegenstände hier in meiner Wohnung würde entweder gar nicht existieren, komplett anders aussehen oder schlicht unerschwinglich für mich sein, wäre da nicht das „Wundermittel“ Erdöl. Während meine Großeltern sich noch halbwegs an ein Leben vor der durch Erdöl dominierten Zeit erinnern können, ist für mich und meine Generation der Gedanke, ohne Erdöl auskommen zu müssen, unvorstellbar. Wir wüssten wahrscheinlich nicht einmal genau, auf was wir dann alles verzichten müssten.
Erdöl ist ein Wundermittel. Wenn wir uns vor Augen führen, dass ein 40-Liter-Tank voll Benzin mit ungefähr vier Jahren(!) an menschlicher Arbeit gleichgesetzt werden kann39, dann fällt vor allem eines sofort auf: Wir gehen mit unserem Erdöl sehr großzügig um. Ich lebe in einem Zeitalter des billigen Erdöls. Es wird geradezu verschleudert. Unsere Marktwirtschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie auch jene Dynamik im Blick hätte, die abseits unserer eigenen Lebensspanne liegt. Das Zeitalter des billigen Erdöls begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wird auch den optimistischeren Prognosen nach bis 2050 zu Ende gehen. 200 Jahre hätte diese Zeit dann gedauert. 200 Jahre, in denen wir den Großteil der in unserem Planeten gelagerten Energie aufgebraucht haben, die sich über Millionen Jahre dort angesammelt hatte.
Der Brite Richard Hopkins, der mit seinem Handbuch für die Energiewende40 bekannt geworden ist, vergleicht die Verfügbarkeit von billigem Erdöl treffend mit dem Zaubertrank der Comic-Gallier:
Like Asterix and Obelix’s magic potion, oil makes us far stronger, faster and more productive than we have ever been, enabling our society to do between 70 and 100 times more work than would be possible without it. Beginning near the moment when slavery was finally going out of style, we have lived with this potion for 150 years and, like Asterix and Obelix, have got used to thinking we will always have it, indeed we have designed our living arrangements in such a way as to be entirely dependent on it.41
Erdöl hat unsere Produktivität um ein Vielfaches gesteigert und unseren Lebensstandard auf ein Niveau gehoben, das sogar für meine Großeltern noch einem Wunder gleicht. Und es zählt zu den wichtigsten Aufforderungen dieses Buchs, uns bewusst zu machen, dass wir uns an einen Lebensstandard gewöhnt haben, der 50 Personen rund um die Uhr mit aller Kraft für mich Radfahren lässt – und 50 weitere für Dich.42
Damit bin ich bereits bei der Wurzel der ökologischen Krise angekommen. Ich habe mich an einen Lebensstandard gewöhnt, der in keinem Verhältnis zu vorherigen Generationen steht. Und ich bin mir über das enorme Ausmaß unseres Energieverbrauchs nicht einmal im Klaren. Ich bin in hohem Maße von billigem Erdöl abhängig. Ich bin süchtig nach dem „schwarzen Gold“. Jeden Tag erhalte ich meine Ration und es würde mir reichlich dreckig gehen, würde ich darauf verzichten müssen. So wie mir geht es vermutlich der Einen oder dem Anderen unter Euch auch. So weit, so schlecht.
Da gibt es aber noch die andere Seite der Medaille, und diese möchte ich als die echte Schattenseite des ganzen Dilemmas bezeichnen. Ähnlich wie bei anderen maßlosen Suchtverhalten, zieht auch unser Umgang mit dem Erdöl eine Spur der Verwüstung nach sich. Unser Planet wird nicht nur ausgebeutet, sondern auch in seinem ökologischen Gleichgewicht empfindlich getroffen. Wir Menschen bedrohen die Natur und somit uns selbst. Es ist eine Grundüberzeugung dieses Buchs, dass sich der Mensch nicht von der Natur trennen lässt. Und für mich zeigt sich ganz offensichtlich, dass unsere Beziehung zur Natur auf ähnliche Weise gestört ist, wie jene zu uns selbst.
Letztlich ist es unerheblich, ob und wann uns das Erdöl ausgehen wird, welche Szenarien wir bei einem Temperaturanstieg von 2° Celsius zu befürchten haben, oder ob der Klimawandel in irgendeiner der prognostizierten Formen eintreten wird. Denn all das sind in ihrer abstrakten Weise Hirngespinste des uns prägenden Denkens, die uns eine grundlegende Veränderung so schwierig machen. Ein „Zwei-Grad-Ziel“ verändert mein Denken und Handeln nicht. Wir können das Problem nicht mit dem gleichen Denken lösen, das uns in diese Sackgasse manövriert hat.43
Der Klimawandel ist aus den heutigen Medien nicht mehr wegzudenken. In seiner abstrakten Form bietet er den idealen Stoff für alarmierende Berichterstattungen und Katastrophenfilme, aber auch für internationale Konferenzen, nationale Gesetze, neue Handelsrichtlinien und vermeintlich „grüne“ Wirtschaftsmodelle. Harald Welzer bezeichnet den Klimawandel als das „perfekte unlösbare Problem“. Von allen Seiten sammeln sich ostentative Besorgnis, Forschungsanstrengungen und politische Maßnahmenkataloge. Doch das Spektakel „stört das Betriebssystem von Extraktion und Konsumismus nicht, sondern treibt mit Modernisierungsimpulsen wie Energiewende und ‚green economy‘ die Handlung voran.“44
Ganz den griechischen Wurzeln des Wortes „Problem“ entsprechend45, werfe ich folgende Problemstellung auf: Das Problem ist, wie wir den Klimawandel zu unserem Hauptproblem machen und welche Lösungsansätze aus dieser Problemdefinition resultieren. „Das Problem ist nicht das Problem, das Problematische am Problem ist die Art, wie versucht wird, es zu bewältigen.“46 Das wahre Problem ist unser Denken, der rational-objektivierende Würgegriff unserer modernen Wissenschaft. „Nicht Ereignisse wie Krieg, Kriminalität, Drogen, wirtschaftliches Chaos oder Umweltverschmutzung, mit denen wir konfrontiert werden, machen die wahre Krise aus, sondern das Denken, das sie verursacht, und zwar unentwegt.“47
Meine Gesellschaft hat die Natur zu unserem Problem gemacht und will meine Aufmerksamkeit damit von mir selbst weg lenken. Von allen Seiten wird nach neuen (meist technischen) Lösungen gesucht, um der aus den Fugen geratenen Natur Einhalt zu gebieten. Auf dass sie uns nicht mit ihren Wogen überflutet, mit ihren Stürmen verwüstet und durch ihre Trockenheit verhungern lässt! Das Narrativ der Herrschaft wird weitergeschrieben und nur leicht modifiziert: Die durch uns beherrschte Natur stellt uns vor neue Herausforderungen, die uns eine Nachbesserung der Herrschaftsverhältnisse abverlangen. Diesem Narrativ und der daraus resultierenden Problemstellung folgend, beabsichtigt meine Gesellschaft nicht, ihr Verhältnis zur Natur zu überdenken, sondern die Vergesellschaftung der Natur auf eine neue Basis zu heben.48 Ich als Mensch, meine Natur und mein Verhältnis zur mich umgebenden Natur sind nicht der Fokus einer solchen, den Diskurs dominierenden, Problemdefinition. Der Konsum-Kapitalismus bleibt unangetastet.
Die Dominanz dieser Problemdefinition prägt meine Problemstellung. Wie meine Gesellschaft und folglich auch ich mit dem „Problem Klimawandel“ umgehen bildet den Kern meines Buchs. Entgegen dem vorherrschenden Diskurs rund um Klimawandel und ökologische Krise sehe ich den einzig erreichbaren Hebel für eine Veränderung in der persönlichen Dimension – und somit auch bei mir selbst. Und jene Konflikte, die mir als Teil dieser Gesellschaft eine Veränderung meines eigenen Verhältnisses zur Natur so schwierig gestalten, diese inneren Konflikte werden im Zentrum meiner Suche stehen. Zugespitzt gesprochen bin ich ein Süchtiger in einer Gesellschaft von Süchtigen, die sich ihrer Sucht erst noch bewusst werden muss. Einem Süchtigen, der sein sinnvolles Leben abseits dieser Sucht finden möchte, stehen zahlreiche innere Konflikte bevor. Und diese, schließlich, werden der Hauptgegenstand dieses Buchs sein.
Wieso? – Meine Konflikte
Der amerikanische Mediator William Ury rät allen Konfliktarbeiter-Innen: „Start close to home!“49 Und da ich mich selbst als Konfliktarbeiter betrachte, folge ich diesem Rat im doppelten Sinne: Einerseits wird meine Beziehung zur ökologischen Krise in dieser Arbeit auf eine Weise behandelt, die meine unmittelbare Lebenswirklichkeit spürbar macht. Andererseits wird auch die räumliche Nähe und Umgebung meines Lebens von großer Bedeutung für die Art und Weise meiner Ausführungen sein.
Ich mache mich zum Protagonisten meines eigenen Bildungsromans. Das liegt nicht etwa daran, dass ich mich als am geeignetsten für diese Rolle halte. Vielmehr findet sich die plausible Erklärung darin, dass ich niemanden so gut kenne, wie mich selbst. Und da es sich schließlich auch um eine Reise in mein Inneres handelt, war die Frage der Besetzung schnell geklärt. Ich starte nahe bei mir.
In mir finde ich kleine Entsprechungen jener Konflikte, die sich auf gesellschaftlicher Ebene prägend auf unsere Beziehung zur Natur auswirken. Ich kann tief in meinem Inneren Ängste und Wut, Bequemlichkeiten und Unsicherheiten, Bedürfnisse und Wünsche etc. aufspüren, die mich und mein Verhalten zu meiner Mitwelt bestimmen. Bei genauerer Betrachtung und Unterscheidung zwischen Bedürfnissen, Wünschen, Trieben und sonstigen Begehrlichkeiten wird klar, dass meine Vorstellung von einem lebenswerten Leben in hohem Maße durch meine unmittelbar mich umgebende Gesellschaft geprägt ist. Diese Prägung ist maßgeblich für meine inneren Konflikte und ähnelt jenen, die ich in anderen Mitmenschen erkennen kann.
Wäre ich in einer Gesellschaft aufgewachsen, die es für naturgegeben und moralisch vertretbar halten würde, (fremde) Menschen auf unseren Speiseplan zu setzen, dann würde ich mich heute an einer anderen Form des Vegetarismus versuchen. Ich könnte gerade erste Versuche starten, nicht jeden Tag billiges, aus industrieller Menschenhaltung stammendes Fleisch zu essen und würde mit verschiedensten Leuten über das Für- und Wider diskutieren. Manche würden sagen, dass sie sich sehr genau anschauen, aus welchen Regionen der Welt das Menschenfleisch geliefert wird, das bei ihnen auf den Tisch kommt. Einige gehen sogar so weit, dass sie sich die Menschen im lebenden Zustand noch am „Bauernhof“ ansehen, um sich ihres glücklichen Lebens vor dem Schnitzeldasein zu vergewissern. Andere würden behaupten, dass es in der Natur des Menschen liege, andere Menschen zu essen: „Die Stärkeren essen die Schwächeren. So ist der Verlauf der Natur! All jene, die sich plötzlich an dieser Angewohnheit stoßen, handeln jener Natur zuwider.“
Mit diesem Beispiel will ich auf zugegebenermaßen extreme Art und Weise deutlich machen, dass meine soziale Prägung nichts Unumstößliches ist. Sie kann und muss auf kritische Weise von mir hinterfragt werden. Gerne argumentiert meine Gesellschaft mit der Natürlichkeit der Dinge, um Bedürfnisse und Verhaltensweisen zu legitimieren. Meine Natur aber, als Triebfeder in meinem Inneren, ist unmöglich von meiner Sozialisierung zu trennen. Meine Natur ist sozialisiert.
Gäbe es heute ernsthafte Erwägungen, unserem sogenannten Problem der Überbevölkerung durch menschliche Fleischproduktion beizukommen, wäre die empörte Reaktion kaum auszudenken. Wir lassen jährlich tausende an Flüchtlingen in unseren Meeren ertrinken, aber diese dann auch noch zu essen, das wäre zu viel. Nicht nur die Grenzen unserer Meere, Nationen, Wirtschaftsunionen und Handelsabkommen konstruieren wir, auch jene Grenzen des Unmoralischen, Pietätlosen und Unmenschlichen bestimmen wir selbst.
Diesen bestimmenden Faktor meiner Gesellschaft möchte ich mitbedenken, wenn ich mir über jene Verhaltensweisen Gedanken mache, die im Zusammenhang mit meiner Natur und meinem Verhältnis zur Umwelt stehen. Ich bin mit regelmäßigem Fleischkonsum aufgewachsen und in einer Zeit großgeworden, in der Fleisch einerseits immer erschwinglicher wurde und andererseits immer fragwürdigere Produktionsbedingungen durchlief. Autos zählen für mich zu jenen Gegenständen, die sich auch die Minimalverdienerin leisten können muss. Im Winter erwärmt russisches Gas meine Altbauwohnung auf angenehme 20° Celsius. Flugzeuge bringen mich zu erschwinglichen Preisen an die abgelegensten Orte unserer Erde. Und alle diese leuchtenden, duftenden, wohlklingenden und berauschenden Dinge, die es zu erstehen keiner Opfer mehr bedarf, berauschen mich. Mein Umfeld berauscht mich. Unendliches Glück scheint zum Greifen nahe. Und ja, sie treten brav in die Pedale, Tag und Nacht, die 50 freundlichen Damen und Herren in meinem Garten.
Und nun gelangen wir an diesen interessanten Punkt, an dem Teile der Gesellschaft an mein Gewissen appellieren, auf diese Errungenschaften (freiwillig) zu verzichten. Ich solle auf Fleisch verzichten, den öffentlichen Verkehr benutzen, weniger heizen, mit dem Zug reisen, den Konsum einschränken und einige der radelnden Stromerzeuger in die Freiheit entlassen. Und zu welchem Zweck wird mir dieser Verzicht nahegelegt? Um es anderen Menschen besser gehen zu lassen. Damit vorwiegend Menschen auf weit entfernten Landstrichen unserer Erde nicht unter den sich verändernden Umweltbedingungen zu Schaden kommen und damit nachkommende Generationen menschenfreundlichere Bedingungen vorfinden. Wieso aber wird der Diskurs so moralisch aufgeladen geführt? Was soll auf diese Weise in uns erreicht werden?
Der Klimawandel fängt mich in einem komplexen Netz aus sozialisierten Moralvorstellungen ein und stellt mich vor zahlreiche Herausforderungen. Er generiert eine Vielzahl an intrapersonalen Konflikten (also Spannungen innerhalb meiner Person), die in einem engen Wechselspiel mit der Gesellschaft und den interpersonalen Konflikten (also Spannungen zwischen Personen) stehen. Mich als Person in diesem Spannungsverhältnis näher zu beleuchten ermöglicht einen Perspektivenwechsel auf den Gegenstand des Klimawandels und der ökologischen Krise.
Wie? – Grundlagen und Eingrenzungen
Dieser Perspektivenwechsel hin zur intrapersonalen Dimension der ökologischen Krise macht mich zum Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Mit etwas Phantasie siehst Du mich als Protagonisten meiner eigenen Erzählung die verschiedenen Abschnitte meines Bildungsromans durchschreiten. Mein Verhältnis zu meiner Umwelt steht ganz ohne Zweifel im Zentrum meiner Wanderung. „Abenteuer- wie Bildungsromane haben das gemeinsame Merkmal, dass ihre Protagonisten sich selbst verändern, indem sie sich auf den Weg machen. Am Ende sind sie andere geworden, und das macht die eigentliche Verlockung aus.“50 Und wenn ich, ganz unähnlich dem Werther Goethes, am Ende der Erzählung noch leben sollte, dann trage mir bitte meinen Lebenswillen nicht nach.
Um meinem subjektiven Ansatz folgen zu können, musst Du mich – meine Denk- und Handlungsweisen – besser verstehen können. Wieso beziehe ich mich so stark in ein Thema mit ein, das doch von so vielen auf rein wissenschaftlich-objektive Weise bestens analysiert zu werden scheint? Wie passt mein Leben mit der ökologischen Krise zusammen? Welche Magie lässt den Klimawandel zu meinem Wandel werden? Wie kann ich einen Themenbereich persönlich abhandeln wollen, der doch im globalen Zusammenhang mit einer unendlichen Zahl an Faktoren steht? Ganz einfach: Weil mich keine bisherige „Lösung“ unseres Problems befriedigt. Weil mich die vielen abstrakten Lösungsansätze aus Politik, Wirtschaft, Naturwissenschaft etc. keinesfalls überzeugen. Weil ich schlicht das Gefühl habe, dass sich unsere Wissenschaft in einer objektiv-rationalen Sackgasse befindet und kühl an aller Menschlichkeit vorbei zu rechnen droht. Meine knapp 30 Lebensjahre haben in mir die Überzeugung groß werden lassen, dass die entscheidenden Antworten auf alle noch so globalen Fragen auch nur im kleinen Kreis des Zwischenmenschlichen zu finden sind. Und auf diese Suche werde ich mich begeben.
Sei Du der Wandel, den Du in der Welt sehen möchtest!51 Der Klimawandel, so abstrakt und unwirklich er mir auch erscheinen mag, ist jedenfalls nicht der Wandel, den ich in der Welt sehen will. Meinem Professor Wolfgang Dietrich52 folgend, muss ich als Friedensarbeiter „durch die Drachengrube der eigenen, inneren Schatten marschieren“53, um jener Wandel zu sein. Die Philosophie seiner „vielen Frieden“ hat meinen Ansatz des Buchs maßgeblich beeinflusst. Die subjektive Ausrichtung als Grundpfeiler meiner wissenschaftlichen Arbeit ist in diesem Umfeld gewachsen.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht also die der Wissenschaft wenig vertraute Ich-Perspektive. Für den deutschen Biologen Günter Altner kann die Ich-Perspektive der Wissenschaft als notwendiges Korrektiv dienen. Die „Subjektivität des erkennenden Ichs [muss] im Hoheitsgebiet der exakten Wissenschaft beheimatet werden“54. Dieser Eingriff ist seines Erachtens notwendig, da die strikte Objektivierung als „methodische Einengung und Zurichtung [...] die dynamischen Gleichgewichtssysteme der Natur zum Kippen bringt“55. Ganz im Sinne Altners soll meine subjektive Annäherung an die ökologische Krise dieses enge Wissenschaftsverständnis aufbrechen und den Diskurs um eine persönliche Perspektive erweitern.
Für Michel Foucault tut ein Autor gut daran, auf die eigene Transformation während des Schreibprozesses besonders Acht zu geben: „I am not interested in the academic status of what I am doing, because my problem is my own transformation [...]. Why should a painter work if he is not transformed by his own painting?”56 Jene bezeichnende Äußerung Foucaults habe ich aus Norbert Koppensteiners Werk „The Art of the Transpersonal Self“57 entnommen. Nicht nur dieses Buch, auch und insbesondere Koppensteiners persönlicher Eindruck auf mich, während meines Studiums in Innsbruck, prägen meine Ansätze auf diesen Seiten. Für ihn kann das Schreiben eines Buchs immer auch als „Auseinandersetzung des Selbst mit dem Selbst“ gesehen werden, als Teil einer bewussten Annäherung an Transformation.58
Schreiben ist eine Art des Ausdrucks. Selbst die vermeintlich objektiv gestaltete Form des Schreibens gibt Einblicke über die innere Lebenswirklichkeit der Autorin. Meine Annäherung an die ökologische Krise hegt den Anspruch, sowohl eine wissenschaftliche zu sein, als auch – durch die subjektive Ausrichtung – mit dem rationalobjektiven Dogma der verbreiteten Wissenschaft zu brechen. Schon das Schreiben einer Geschichte allein kann uns dabei unterstützen, über das eigene Leben zu bestimmen.59 Und das ist, wie ich bereits ausgeführt habe, ein erster Schritt in Richtung einer Beantwortung der Frage, wie wir leben möchten. Bei Peter Bieri klingt das so: „Wer [die Geschichte] schreibt, muß dazu die innere Zensur lockern und zur Sprache bringen, was das Erleben sonst nur aus dem wortlosen Dunkel heraus einfärbt. Das kann eine gewaltige innere Veränderung bedeuten. Man ist nach einem Roman nicht mehr ganz derselbe wie vorher.“60
Mein Selbst bildet das Zentrum erzählerischer Schwerkraft. Demnach ist meine Erzählung in so hohem Maße selektiv (zeitlich, räumlich, kulturell, sprachlich etc.) wie an meine Person geknüpft. Es geht mir erstens darum, eine Erzählung über mich selbst in einen stimmigen Zusammenhang mit dem Thema der ökologischen Krise zu bringen. Und zweitens darum auf diesem Wege Selbsttäuschungen aufzudecken, die in meiner Erzählung als unstimmig hervortreten.61
Wenn wir erkennend Einfluß auf unsere Wünsche und Emotionen nehmen, indem wir sie in ihrer Herkunft und tieferen Bedeutung verstehen lernen, geht es um etwas anderes: Jetzt kümmern wir uns darum, wer wir sein wollen, was uns wichtig ist und worum es in unserer Zukunft gehen soll.62
Meine Erfahrungen mit verschiedensten inter- und transdisziplinären Annäherungen an die ökologische Krise haben mich überzeugt, dass es von großer Bedeutung für den Diskurs ist, die innere Dimension näher zu beleuchten. Der Tiefenökologe Arne Naess schreibt sinngemäß, der Weg müsse sich zuerst nach innen richten, um dann erst – wieder nach außen gerichtet – die Wirklichkeit in ihren Umrissen umgreifen zu können.63 In mir – in meinen Bedürfnissen, Wünschen, Denkweisen und Widerständen – verstecken sich viele Hinweise darauf, wieso ich mich auch gesellschaftlich mit einer Trägheit gegenüber möglichen Veränderungen konfrontiert sehe. Es kann, so mein Gefühl, sich einer Offenheit gegenüber Spiritualität nicht verwehren, wer ernsthaft an eine Veränderung seines Selbst und seiner Umgebung glauben möchte. Der Glaube an mich und mein Potenzial, zu einer Veränderung meines lokalen Systems beizutragen, ist die Grundlage jeglicher Transformation.
Koppensteiner hat auch diese subjektive Perspektive im Blick, wenn er davon ausgeht, dass sowohl Nietzsche als auch Foucault Konflikt als einen der Hauptbeweggründe für Transformation angesehen haben. Die Reflexion über die mich durchziehenden, inneren Konflikte kann mir den Weg zu Veränderungen ebnen.64 Mit dem Übersteigen jener Schwelle, so meint wiederum Foucault, die ein Subjekt auf die eigene Veränderung zusteuern lässt, beginnt die aktive Erzählung des Selbst.65 Diese Konflikte im Inneren auszuleuchten bedeutet gleichsam in Konflikt mit sich selbst zu treten. Der Vorstoß verlangt von mir, mich kritisch meinem eigenen Selbstbild zuzuwenden und Konstrukte „zweifelhafter Wahrhaftigkeit, voll von Irrtümern, Selbstüberredungen und Selbsttäuschung“66 aufzudecken. Die US-amerikanische Tänzerin und Musikerin Gabrielle Roth, deren Körperarbeit und Theorie der „Fünf Rhythmen“67 meine Sichtweise spürbar beeinflusst hat, beschreibt die Arbeit an sich selbst mit folgenden deutlichen Worten: „It means taking your life seriously, caring enough to see it honestly, to see and tell the truth. It should be a vital ongoing exercise in self-discovery: gradually finding your own voice, your own truths, your own story.“68
Nur dieser ehrliche Vorstoß zu meinem Selbst birgt die Chance, den objektiv gehaltenen Stillstand des Diskurses zu durchbrechen. Nur wenn ich als Autor meiner Erzählung Dir als Leserin zeigen kann, welche Konflikte, Sehnsüchte, Verletzungen und Vorstellungen von Glück mich zu diesem Thema bewegen, wahre ich die Chance zum Kern der Thematik durchzudringen.69 Wie ich bereits als meiner Problemstellung inhärent ausgewiesen habe, ist unser Problemumgang mit dem Klimawandel nicht von den gesellschaftlichen Denkprozessen zu trennen. Dem US-amerikanische Quantenphysiker und Philosoph David Bohm70 verdanke ich diesbezüglich folgenden Anstoß: Zu diesen verworrenen Denkprozessen gehört auch jene Gewohnheit (vielleicht gar Konditionierung) zur Annahme, dass die Wurzel des Problems nicht bei uns, sondern Schwierigkeiten im Allgemeinen äußere Ursachen haben. Und diese behandeln wir dann als jenes Problem, das es zu lösen gilt.71 Diesem mir sehr vertrauten Denkprozess möchte ich mich ebenso widmen wie der rational-objektiven Zwangshaltung der Wissenschaft, die sich solchen Paradoxa des täglichen Lebens viel zu wenig öffnet. Denn letztlich, und da stimme ich wieder mit Rob Hopkins überein, wird unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber den ökologischen und sozialen Herausforderungen von den inneren Ressourcen abhängen, und nicht von einem abstrakten intellektuellen Verständnis. „This is relatively new ground for the environmental movement, but it is crucial to our success and to engage enough people on the scale required.“72
Erforderlich wäre also eine tiefe und intensive Klarheit, eine Achtsamkeit, die über die Bilder und intellektuellen Analysen unseres verworrenen Denkprozesses hinausgeht und fähig ist, zu den widersprüchlichen Voraussetzungen und Gefühlen vorzustoßen, in denen die Verwirrung ihren Ursprung hat. Eine solche Klarheit impliziert eine Bereitschaft zur Wahrnehmung der zahlreichen Paradoxa in unserem täglichen Leben, unseren sozialen Beziehungen und letztendlich auch in dem Denken und Fühlen, das scheinbar in jedem von uns das ‚innere Selbst‘ bildet.73
Das Subjekt und die Wissenschaft
Subjektivität ist für meine geschätzte Kollegin Julia Felder74 „keine Gefahr für akademische Arbeit, sondern ihre Quelle“75. Mein Anspruch in dieser Arbeit ist keinesfalls jener, die Wissenschaft um eine allgemein gültige Wahrheit zu „bereichern“. Ich möchte den Diskurs um meine Wahrheit erweitern, so begrenzt diese Wahrheit auch erscheinen mag. Im Übrigen wird eine Kritik der modernen Wissenschaft und ihrem absoluten Anspruch Teil meiner eigenen (lokalen) Wahrheitsfindung sein. Auch Felder betont die subjektive Bedeutung von Werten als offensichtliche Begrenzung von Wahrheiten und zeigt sich wenig verständnisvoll gegenüber dem Anspruch, sich beim Schaffen einer wissenschaftlichen „Wahrheit“ selbst als Subjekt aus dem Spiel zu nehmen. Vielmehr gehe es doch gerade darum, eigene wissenschaftliche Aussagen und dessen inhärente (lokale) Wahrheit auszudrücken.76
So wie sich die Wirklichkeit nicht als theoretisch geschlossenes System verstehen lässt, so können wir sie auch nicht rein rational und objektiv erfassen.77 Folglich findet die Leserin in diesen Seiten nicht nur eine wissenschaftliche Analyse, die entsprechend ihrer Wesensart das zu Untersuchende isoliert und in seine Einzelteile zerlegt. Ihr zur Seite gestellt wird die Synthese das Fundament meiner Wissenschaftlichkeit bilden, und einem Aufruf Hildegard Kurts folgend, das vorherrschende Entweder-Oder durch ein Und ersetzen. Meine Arbeit wird Analyse und Synthese sein. Sie wird sich der Wissenschaft und der Kunst widmen. Sie möchte wissenschaftlich sein und persönliche Beweggründe beleuchten. Es geht um nichts weniger als um eine neue Wissenschaftlichkeit, die bestehende Zusammenhänge entdecken kann und „Netze lebendiger Menschen webt. [...] Anstatt der Wissenschaft, dem Wissenschaftsbetrieb und dessen oft zweifelhaften Nutznießern zu dienen, kommt es heute darauf an, mit ihr dem Schutz und der Entfaltung des Lebendigen zu dienen.“78
Formal gleicht meine Arbeit auch dem Essay und bietet Raum für „weiche und integrative Erfahrungssätze“79. Diese Räume sind von Vorteil, wenn die Wirklichkeit in letzter Instanz zwar nicht wissbar ist, sehr wohl aber erfahrbar bleibt. Für Kurt will eben diese Wirklichkeit „aus lebendigem Erfahren heraus begriffen werden“80. Der essayistische Stil bildet einen geradezu idealen Rahmen für meinen gleichsam essayistischen Vorstoß. So zu schreiben bedeutet, „man wirft sich in eine mögliche Zukunft hinein und geht dabei von Annahmen aus, die nicht schon vollständig auf ihre Richtigkeit hin überprüft sind. Man beginnt etwas, ohne genau zu wissen, worauf das am Ende hinauslaufen wird.“81 So werde ich mich und meinen Wandel von vielen Seiten beleuchten, ohne mich ganz zu erfassen, „denn ein ganz erfasstes Ding verliert mit einem Male seinen Umfang und schmilzt zu einem Begriff ein“82.
Auch der Wissenschaftsbetrieb profitiert von einer liebenden Haltung und Empathie. Kein Wissenschaftler steht seiner Arbeit gänzlich kühl und wertfrei gegenüber. Dass die subjektive Perspektive aus der modernen Wissenschaft verbannt wird, kann keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass letzten Endes jede noch so objektiv präsentierte Studie von individuellen Empfindlichkeiten beeinflusst wurde. Wieso sollte ich diese Einflüsse also ausklammern wollen? Ist es nicht um einiges ehrlicher und vor allem einer dem Menschen dienenden Wissenschaft zuträglicher, subjektive Einflüsse zu thematisieren und einzubeziehen? Eigene Ansichten können philosophisch begründet werden, „selbst wenn sie intuitiver oder emotionaler Art sind“83.
Neben Wolfgang Dietrichs Lehre der „vielen Frieden“84 bilden die Systemtheorie, die Tiefenökologie und die Humanistische Psychologie die Grundpfeiler meiner Arbeit. Die Systemtheorie ebnet den Weg für die Synthese als wissenschaftliches Mittel, um die Zusammenhänge als das Wesentliche in der Welt des Lebendigen zu erkennen.85 Die Tiefenökologie greift viele Ansätze der Systemtheorie auf und steuert jene grundlegende Ontologie bei, dass die Menschheit von der Natur nicht zu trennen ist.86 Die Humanistische Psychologie schließlich betont das Potential jedes einzelnen Menschen, sich selbst zu begreifen und zu verändern.87 Diesen Eckpfeilern entspricht auch jene Grundlage dieses Buchs, den Menschen als von Natur aus zur Menschlichkeit ausgerichtetes Wesen zu betrachten. Ein solches bestimmten anthropologischen Vorstellungen entsprechendes Menschenbild hat weitreichende Auswirkungen darauf, wie wir leben und leben wollen.88
Aus all diesen Grundlagen lassen sich spezifische, wissenschaftliche Richtlinien gewinnen, an die ich mich anzulehnen gedenke. Meinem subjektiven Ansatz entsprechend folge ich Hildegard Kurts Ausführungen des empathischen Ichs: „In seiner Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis ist sich das empathische Ich der faktischen Macht des wissenschaftlich-technisch-industriellen Komplexes wohl bewusst, betrachtet es aber als Teil seiner Verantwortung, sich möglichst wenig von den herrschenden Spielregeln manipulieren zu lassen.“89 Und auch ich möchte meinem Gegenstand mit einer Haltung innerer Gegenwärtigkeit begegnen, so wenig wie möglich urteilen, Theorien und Modelle nicht überbewerten und mich nicht dem Ideal einer angeblich wertfreien Wissenschaftlichkeit verpflichtet fühlen. Ich möchte mit einer positiven Sicht der Dinge Räume schaffen und Wissen eröffnen, das anregt und Hoffnung stiftet. Die Überzeugung der prinzipiellen Begrenztheit von wissenschaftlich Wissbarem fließt in meine Suche mit ein.90
Der Mensch, der den Frieden nicht zuerst in sich sucht, wird ihn im Äußeren nicht finden, weil es dort keinen objektivierbaren Frieden gibt. [...] Zugleich verlangen diese Lehren nicht nach Perfektion. Da es keinen verbindlichen Standard gibt, muss Frieden als Plural gelesen werden.91
Im Kontext nötiger Eingrenzungen möchte ich auch zu meinem Ort zurückkommen. Zu meinem Platz, über den ich laufe, den ich sehe und um den ich mich wirklich kümmern kann.92 Wenn ich, anknüpfend an Dolores LaChapelle, unsere Eine-Welt-Wahrnehmung als (idealistische) Illusion betrachte, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich mein Buch auch nur auf meinen Ort beziehen kann und möchte. Das gilt im direkten wie im übertragenen Sinne. Auch der geographische Ort meiner Wurzeln wird die dominante Szenerie darstellen. Ich bin in Graz aufgewachsen und lebe seit meiner Studienzeit in Wien. Weitere Schritte haben mich nach Innsbruck, Valladolid in Spanien und nach San Jose in Costa Rica geführt. Der Ort meines Geschehens aber, ist – analytisch gesprochen – ein österreichischer.
Es gibt keinen zwingenden objektiven Grund, wieso meine regionale Umgebung im Fokus einer Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise stehen sollte. Es gibt auch keinen objektiven Grund, wieso es nicht so sein sollte. Es gibt aber jedenfalls jenen überzeugenden subjektiven Grund, dass eine Arbeit, die sich mit mir im Zusammenhang mit der ökologischen Krise befasst, an meinem Ort zu spielen hat. Ähnliches gilt für die österreichisch-deutsche Sprache meiner Ausführungen und den deutlichen Überhang deutscher Literatur in meinen Quellen. Das ist mein Leben, wie es eben so passiert.
Es sei an dieser Stelle noch ergänzt, dass sich zumindest ein objektiver Grund meines regionalen Fokus auf Österreich und Deutschland in einem dort überproportionalen Interesse am Diskurs rund um die ökologische Krise finden lassen könnte. Für die unverbesserlichen Objektivistinnen unter Euch mag also der deutschsprachige Kulturkreis insofern eine geeignete Bühne für meine subjektive Reise darstellen, als dieser der Energiewende und sonstigen politisch „grün-markierten“ Themen verhältnismäßig viel Interesse entgegen bringt.
Grundlagen
Die vielen Frieden
Eine der wichtigsten Grundlagen meiner Arbeit ist die Theorie der „vielen Frieden“ von meinem Professor Wolfgang Dietrich. Er stützt sein Verständnis von Friedensarbeit auf den elicitiven93 Ansatz des US-amerikanischen Friedensforschers John Paul Lederach94. Diese kombinierte Annäherung an ein Verständnis von (den vielen unterschiedlichen) Frieden und Konfliktarbeit als Basis meines wissenschaftlichen Vorgehens, möchte in diesem Kapitel in ihren Grundzügen verständlich gemacht werden.
Wenn Dietrich von den vielen Frieden spricht, möchte er darauf aufmerksam machen, dass sich Frieden nur im Plural denken (und leben) lässt. Den einen Frieden gibt es im wahren Leben nicht. Es gibt nur die kleinen, lokalen, gelebten und subjektiven Frieden. Und diese können sich ergänzen und zu einem gemeinsam-geteilten Friedensgefühl werden. Kleine, lokale Frieden können sich aber auch gegenseitig behindern und sich nach außen hin gar kriegerisch artikulieren. Der Ansatz der vielen (verschiedenen) Frieden schafft den nötigen Raum, um die unzähligen Perspektiven auf Frieden überhaupt erst wahrnehmen zu können.95
Die Erzählung der Lysistrata, der „Heeresauflöserin“, konfrontiert uns beispielsweise mit jenem Verständnis von Frieden, den sie durch ihren Körper erwirken will. Sie überredet die anderen Frauen der Krieg führenden griechischen Soldaten, ihre Körper so lange nicht mehr zur Verfügung zu stellen, bis diese ihre Waffen niederlegen. Frauen verwenden ihre Körper als Druckmittel und erzwingenauf diese Weise den Frieden – gegen ihre Männer.96 Frieden wäre nach diesem Verständnis jener Zustand, wenn die Männer lieber zu ihren Frauen zurückkehren und das Kämpfen sein lassen.
Für die Griechen war Frieden (eirene) der bloße Zustand des Nicht-Kriegs, „die Stille zwischen den Tönen der Kriegs-Melodie“97. Der Kriegerethos der griechischen Gesellschaft samt seiner binären Weltsicht führt also zu einem (lokalen) Friedensbegriff, für den Frieden „bloß der Erholung und Aufrüstung für weitere, ruhmreiche Kriegstaten dient“. Er ist „nur als Nicht-Krieg denkbar. Er hat an sich keinen Wert“98.
Ein solches lokales Friedensverständnis muss im jeweiligen Kontext und in seiner Tiefe verstanden werden, um auch seine Begrenztheit nicht zu übersehen. Frieden ist nicht immer gleich Frieden. Meine Vorstellung von Frieden mag eine andere sein als die Deine. Die bloße Schaffung des Raumes für den Austausch unterschiedlicher Friedensvorstellungen gibt uns die Möglichkeit, auf ein geteiltes Verständnis von Frieden hinzuarbeiten. Auf diese Weise kann Schritt für Schritt aus den vielen kleinen subjektiven Frieden auch ein gemeinsames Friedensgefühl entstehen. Dementsprechend lautet auch die Präambel der UNESCO-Verfassung: „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, müssen auch die Bollwerke des Friedens im Geist der Menschen errichtet werden.“99 Diese Bollwerke müssen in jedem und jeder Einzelnen errichtet werden. Und das kann nicht funktionieren, wenn nicht auch jeder und jede Einzelne als Subjekt eines eigenen Friedens wahrgenommen wird.
Dein und mein Denken steht in einem sich gegenseitig beeinflussenden Wechselspiel mit dem gesellschaftlichen Denken. Unser Denken ist Teil der Gesellschaft und das gesellschaftliche Denken ist ein Teil von uns. Gegen jemanden oder etwas zu denken, ist für Dietrich bereits ein in sich selbst kriegerisches Denken. Ich habe dieses Denken schon zuvor als Teil meiner Problemstellung bezeichnet. Das Problematische am Problem des Klimawandels ist unser diesbezügliches Denken – unser rational-objektiver Tunnelblick. Für Dietrich ist der moderne wissenschaftliche Anspruch auf Objektivität obsolet.100 Der Mensch als Einzelner ist „zur Freiheit verurteilt, wie Jean Paul Sartre sagte, und deshalb stets verantwortlich für die Frieden, die er wählt“101. Diesem Gedankengang folgend kann nur eine subjektive Annäherung an die ökologische Krise die vielen kleinen Konflikte im Blick haben und die Verantwortung mit dem diesbezüglichen Umgang übernehmen.
Ausgangspunkt für eine solche Friedensarbeit ist immer der Mensch im Hier und Jetzt. Der Mensch in seiner Lebensrealität, in der er sich befindet, und die Konflikte, durch die er sich bewegt. Und da Konflikt für Dietrich102 ein „natürliches Produkt“ menschlicher Interaktion und „jeder Beziehung inhärent“ ist, gilt ihm Friedensarbeit als
Kunst, die schöpferische Energie dieses Geschenks für die Neugestaltung der sich stets verändernden persönlichen und gesellschaftlichen Beziehungen konstruktiv zu nutzen. Deshalb ist sie eher ein künstlerisches Unterfangen als ein lineares, formelhaftes Projekt kumulativer Aktivitäten, die auf ein bestimmtes Ziel hin steuern.103
Eine solche Friedensarbeit versteht Frieden als ein Sich-Einlassen auf die jeweilige Situation, und somit auf wechselnde Bedürfnisse, Gefühle, Wahrnehmungen und Kontakte. Insbesondere für den ökologischen Kontext ist es von großer Wichtigkeit, bei Frieden auch die untrennbare Verbundenheit jedes Menschen mit der Umwelt mitzudenken.104 Die eigene Bereitschaft dieser Umwelt wirklich zu begegnen und mit ihr in Dialog zu treten prägt das System als Ganzes. „Die Befreiung des Subjekts von seinen Erinnerungen, Ängsten, Hoffnungen, Wünschen, Komplexen, Vorstellungen und Vorurteilen ist gleichbedeutend mit Frieden für das System.“105 Dietrichs Ansatz geht nicht nur an dieser Stelle Hand in Hand mit der Humanistischen Psychologie und deren Fokus auf das menschliche Potential. Für ihn bietet beispielsweise die Gestalttherapie von Fritz Perls zahlreiche Möglichkeiten, das menschliche Potential wachsen zu lassen. Wenn Perls ein rückwärts gerichtetes durch ein aktualitätsbezogenes Ich ersetzt, macht er gleichsam aus dem Satz „Ich will, aber ich kann nicht“ ein paradoxes „Ich will, und ich will nicht“. Mein „Ich kümmere mich sehr um meine Umwelt und ich würde sie gerne entlasten, indem ich auf mein Auto verzichte, aber das kann ich einfach nicht“ wird zu einem „Ich kümmere mich sehr um meine Umwelt, und ich will mich nicht um sie kümmern“.
Diese Ansätze Dietrichs entsprechen einer elicitiven Konfliktarbeit John Paul Lederachs106, die es sich zur Aufgabe macht, in den jeweiligen Konflikten mit dem zu arbeiten, was da ist – was hier und jetzt bedeutend ist. Als Konfliktarbeit gilt demnach nicht, seine jeweiligen Erfahrungen, Methoden etc. unreflektiert in den Konflikt mitzunehmen und darauf aufbauend an einer Lösung zu arbeiten. Vielmehr nimmt eine Konfliktarbeiterin auf reflektierte Art und Weise bewusst die eigenen Konflikte mit und lässt sich dann auf die jeweiligen Prozesse vor Ort ein. Sie kommt keinesfalls als Expertin, sondern als offenherzige Vermittlerin (facilitator), die mit einem hohen Maß an „Intuition, Empathie, ethischer Reife und ästhetischer Wachheit“107 auch sich selbst als Teil des (Konflikt-)Systems wahrnimmt und so einer Transformation zuarbeiten kann. Lederach geht es metaphorisch gesprochen darum, Menschen dabei zu unterstützen, Fische im eigenen Teich zu fangen.108 Und dieser Ansatz unterscheidet sich maßgeblich von jenem weit verbreiteten, Menschen beim Fischen helfen zu wollen, indem man ihnen jene Maschinen zukommen lässt, die uns in unseren Seen so effektiv beim Fischen unterstützen. Der lokale Teich kann hierbei auch den lokalen Frieden symbolisieren.
Die elicitive Konfliktarbeit Lederachs und die Theorie der „vielen Frieden“ Dietrichs betonen die Wichtigkeit des persönlichen Potentials von Konfliktarbeiterinnen. Elicitive Konflikttransformation ist für Dietrich multidimensional, womit er das Zusammenspiel der persönlichen mit der gesellschaftlichen Dimension andeutet. „Here I believe is a fundamental paradox in the pursuit of peace. Peacemaking embraces the challenge of personal transformation, of pursuing awareness, growth, and commitment to change at a personal level.“109 Was Lederach hier als Paradoxon beschreibt, ist nichts anderes als das an vielen Stellen beschriebene Zusammenspiel persönlicher und gesellschaftlicher Dynamiken. So mutet es nur auf einen oberflächlichen Blick als widersprüchlich an, wenn wir bei unserer Suche nach dem äußeren Frieden auch als Friedensarbeiter bei uns selbst anfangen müssen.
Wolfgang Dietrich verwendet die Metapher des inneren Bergsees, um sich seiner Empfindung von innerem Frieden persönlich zu nähern.110 So ließe sich für ihn die Frage, wie er leben möchte, dahingehend beantworten, dass er möglichst viel Zeit seines Lebens an diesem inneren Bergsee verweilen möchte. Sein Leben, mein Leben und auch das Deinige wird davon beeinflusst sein, wie wir uns organisieren, um möglichst oft solche Orte aufsuchen zu können.
Eine der vielen Bedeutungen von Frieden, auf die Dietrich über die Jahre gestoßen ist, kommt aus Burkina Faso: In einer der dortigen Sprachen bedeutet Frieden nichts anderes als „frische Luft“, wie ihm ein Student erörterte.111





























