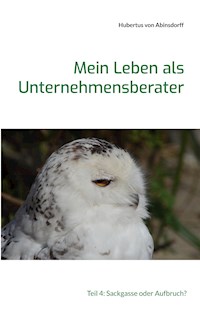
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wir alle haben Träume. Irgendwann beginnen sie, und bei denen, die ihr Leben leben, hören sie nie auf. Vielleicht verschieben sie sich. Oder sie wechseln ihre Intensität im Laufe der Zeit. Aber sie enden nicht. Mein Traumstudium zum Wirtschaftsingenieur durfte ich absolvieren. Um danach in meinen Wunschberuf als Unternehmensberater bei meinem Wunscharbeitgeber ins Berufsleben zu starten. Inzwischen arbeite ich seit über dreißig Jahren in der Beratung. In der letzten Zeit mit einem stärkeren Anteil in der Kundenbetreuung. Die Optimierung von Aufbau- und Ablauforganisationen ist etwas in den Hintergrund getreten. Mir ist die vertriebliche Seite etwas zu dominant geworden. Durch einen glücklichen Zufall habe ich vor kurzem eine neue Stelle gefunden. Dort dreht sich mein Tag wieder voll um die klassischen Beratungsthemen. Eine Zäsur. Ein Neuanfang. Auch im vorliegenden vierten Band handeln die Kapitel erneut von Menschen, Situationen und Stationen, die mich auf meinem Weg in besonderer Form geprägt haben, mein Menschen-, Unternehmens- und Gesellschaftsbild beeinflussten und erweiterten. Unternehmensberater ist immer noch mein Wunschberuf. Nach wie vor glaube ich daran, die Welt Tag für Tag ein kleines bisschen besser machen zu können. Nicht mit unübersichtlichen Excel-Tabellen und langweilenden Powerpoint-Präsentationen. Sondern mit den handelnden Menschen in den Projekten und Unternehmen. Vielleicht laufen wir uns dabei irgendwann einmal über den Weg. Ich würde mich freuen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erwartungen
Schritt 1: Verantwortung Großprojekt
Schritt 2: Langstrecke. Die Letzte
.
Schritt 3: Rollenverschiebungen
Schritt 4: Plattformwandel
Schritt 5: Krise und Chance
Resümee und Ausblick
Danksagung
Dieses Buch ist eine Fiktion.
Jede Ähnlichkeit zu existierenden Personen, Orten, Unternehmen oder Daten wäre rein zufällig.
Sollten Sie meinen, sich zu erkennen – es kann nicht sein.
Zumindest stimmt das Datum nicht.
Vorwort
Wir alle haben Träume.
Irgendwann beginnen sie, und bei denen, die ihr Leben leben, hören sie nie auf.
Vielleicht verschieben sie sich.
Oder sie wechseln im Laufe der Zeit ihre Intensität.
Aber sie enden nicht.
Mein Wunschstudium zum Wirtschaftsingenieur durfte ich absolvieren. Um danach in meinen Wunschberuf als Unternehmensberater bei meinem Wunscharbeitgeber ins Berufsleben zu starten. Im Frühjahr 2000 wechselte ich zu einem weiteren Wunscharbeitgeber. Für diesen war ich etwas über einundzwanzig Jahre tätig. Zunächst als Organisationsberater mit dem Fokus auf Prozessoptimierung. Nach und nach gewannen IT1-Themen einen stärkeren Anteil. Seit Ende 2016 haben sich die Arbeitsinhalte weiter verschoben: Die klassische Beratung nimmt nur noch weniger als die Hälfte meiner Tätigkeiten ein. Stattdessen liegt der Fokus nun auf der ganzheitlichen Betreuung ausgewählter strategischer Kunden. Seit einiger Zeit wächst meine Unsicherheit: Bewege ich mich hier persönlich auf einem zukunftsträchtigen, neuen Pfad – oder laufe ich sehenden Auges in eine Sackgasse? Mitte 2021 habe ich die Frage für mich mit letzterem beantwortet. Und durch einen glücklichen Zufall eine neue, wieder passendere Aufgabenstellung gefunden. Dazu später in den Episoden mehr.
Vor fast fünfundzwanzig Jahren entstanden bereits erste Ideen, interessante berufliche Aufgabenstellungen, besondere Erlebnisse und Eindrücke sowie menschliches Miteinander aufzuschreiben. Manche Ereignisse waren einfach so grandios … oder so peinlich … oder so skurril … oder so einmalig … oder so unverständlich … oder so unbeschreiblich – ich hatte das Gefühl, dass man diese festhalten muss, sie nicht vergessen darf. Sie vielleicht auch dem ein oder anderen geneigten Leser als Lebenserfahrung weitergeben sollte. Eine Art Tagebuch schien die passendste Form zu sein. Dieser Band ist der mittlerweile Vierte. Und (zunächst) wohl auch Letzte.
Das erste Buch2 handelt von meiner Studienwahl, der Berufsfindung und den ersten neun Arbeitsjahren in einer mittelständischen Strategie- und Organisationsberatung.
Band Zwei3 beschreibt den Übergang vom Mittelstand in den Konzern. In den Jahren von 2000 bis 2007 war ich in unterschiedlichsten Beratungsaufträgen für meine Kunden überwiegend in Deutschland und Europa unterwegs.
Teil Drei4 umfasst die Jahre 2008 bis 2012. Diese Phase ist geprägt von mehreren internationalen Einsätzen in Indien, China und Brasilien. Für mich im Rückblick die reichste Zeit meiner Laufbahn: Es gab so viel Neues zu erleben – ein unglaublicher beruflicher wie auch privater Zugewinn.
Die Episoden des vorliegenden vierten Buches fallen in die Jahre zwischen 2013 und 2021. Es werden sich umfangreiche Veränderungen meiner Arbeitsinhalte ergeben. Meine Zweifel wachsen, ob ich noch auf dem für mich richtigen Weg bin. Doch vom Grundsatz her – wie auch in allen Jahren zuvor – ist der Beruf des Unternehmensberaters nach wie vor mein Ding. Und so handelt auch dieses Buch von Menschen, Situationen und Stationen, die mich auf meinem Weg in besonderer Form geprägt haben, mein Menschen-, Unternehmens- und Gesellschaftsbild beeinflussten und erweiterten.
Ich habe bis heute immer wieder das Glück, überwiegend auf Führungskräfte, Kollegen und Kunden zu treffen, bei denen (trotz allem betriebswirtschaftlichen Rationalismus) der Mensch, der Mitarbeiter im Vordergrund steht. Natürlich werden wir daran gemessen, dass unsere neuen Lösungen letztendlich effizienter als die Vorhergehenden funktionieren. Aber nicht das Zahlen- und Methodenwerk macht uns erfolgreich, sondern die gemeinsame Umsetzung mit den Beteiligten und Betroffenen. Allerdings gewinne ich den Eindruck, dass sich dieses von mir so geschätzte zwischenmenschliche Klima eintrübt. Dazu wird auch die Corona-Pandemie beitragen. Doch bereits vor dem Virus war erkennbar, dass der geschäftliche (und der gesellschaftliche) Umgang rauer wird. Dem sollte jeder von uns – wo und wie immer er kann – täglich entgegenwirken.
Unternehmensberater ist immer noch mein Wunschberuf. Nach wie vor glaube ich daran, die Welt Tag für Tag ein kleines bisschen besser machen zu können. Nicht mit unübersichtlichen Excel-Tabellen und langweilenden Power- Point-Präsentationen. Sondern gemeinsam mit den handelnden Menschen in den Projekten und Unternehmen.
Vielleicht laufen wir uns dabei irgendwann einmal über den Weg.
Ich würde mich freuen!
1 IT: Informationstechnologie.
2 Mein Leben als Unternehmensberater / Wie alles begann / ISBN 9783749431106
3 Mein Leben als Unternehmensberater / Teil 2 / Vom Mittelstand in den Konzern / ISBN 9783751977159
4 Mein Leben als Unternehmensberater / Teil 3 / Über den Wolken / ISBN 9783753402567
Erwartungen
oder
Welche Wünsche und Hoffnungen habe ich?
Die Zukunft
Anders als zum Start des zweiten Buches liegt mit dem Beginn des vorliegenden vierten Teils kein Wechsel des Arbeitgebers hinter oder vor mir. Keine neue Position wartet auf mich. Zumindest kenne ich sie noch nicht. Das Arbeitsgeschehen wird daher vermutlich ohne große Brüche weitergehen. So wie bisher. Was erwarte ich von dem nun vor mir liegenden Berufsabschnitt? Erneut wünsche ich mir
Interessante Projekte
Internationalität
Ein gutes Miteinander im Kollegenkreis
Es gibt dann doch noch – ganz aktuell – drei weitere Wünsche: Sie betreffen das Ende 2012 gewonnene Projekt und meine Rolle darin. Ab Januar 2013 werde ich die Verantwortung als Projektleiter übernehmen. Daher wünsche ich mir, diese Aufgabe gut erfüllen zu können. Den an mich gestellten Anforderungen und Ansprüchen gerecht zu werden. Sowohl gegenüber dem Kunden, wie auch gegenüber meinem Arbeitgeber. Ergänzend wünsche ich mir, dass noch ein kleines Zipfelchen Freiraum übrigbleiben möge, um neben dem großen Projekt eine kleinere Aufgabe in einer anderen Aufgabenstellung durchführen zu können. Mich ängstigt die Vorstellung, einem einzigen Kunden von montags bis freitags komplett ausgeliefert zu sein. Und: Mir macht der Gedanke Bauchschmerzen, dass ich nun vielleicht für eine lange Zeit die gesamte Arbeitswoche vor Ort im Projekt verbringen muss. Fünf Tage von der Familie getrennt. Das wünsche ich mir nicht.
Schritt 1: Verantwortung Großprojekt
oder
Passen mir eigentlich diese Schuhe?
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man muss Schuhe suchen, die den Füßen gerecht sind. Verliert man die Schuhe, so behält man doch die Füße.
Unglaublich, wie viele unserer Sprichwörter sich um Füße, Schuhe und Schuster drehen.
13. Januar 2013
Durch Zufall habe ich vor einigen Wochen in einem Kulturmagazin gelesen, dass die legendäre Gruppe Kraftwerk ein Konzert in unserer Nähe geben wird. In der Jugend spielte ich auf dem Kassettenrecorder5 wieder und wieder die Aufnahmen meiner Lieblingsstücke „Die Roboter“, „Das Model“ und „Autobahn“. Musik, die schon damals süchtig machte. Mit dem Startschuss zum digitalen Vorverkauf sitze ich am Rechner, ergattere tatsächlich zwei Karten. Wenige Minuten später ist das Konzert ausverkauft.
Nun stehen wir in Düsseldorf im K206, warten gespannt mit unseren 3D-Brillen auf den Beginn des Spektakels. Und endlich ist es soweit: Ich hatte mir vorab ja einiges ausgemalt, aber definitiv nicht eine solch intensive Augen- und Ohrenreizung – innerhalb weniger Minuten fühlen wir uns wie in einer Art Trance. Eine unglaublich fesselnde, dichte Wirkung geht von der Musik in Kombination mit den auf der riesigen Leinwand eingespielten Videos aus. Schon an diesem Tag im Januar 2013 sind die vorgetragenen Titel aktueller denn je – aber erst im Rückblick heute, Anfang 2022, vermag ich zu erkennen, welche gigantischen Entwicklungen wir in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen haben, und wie kritisch Kraftwerk bereits die ein oder andere davon vor dreißig, vierzig Jahren bewertet hat.
Einige Beispiele:
Autobahn.
Veröffentlicht 1974. Dauer: Über zweiundzwanzig Minuten. Heute Abend werden auf der Videoleinwand ein VW Käfer und ein Mercedes auf einer ansonsten leeren Autobahn gezeigt. Beide Fahrzeuge sind natürlich Verbrenner – der Mercedes bestimmt ein feinstaubschleudernder Diesel. Ende 2020 werden bereits elf Millionen e-Autos auf den Straßen der Welt unterwegs sein. Tendenz exponentiell wachsend. Die etablierten Automobilhersteller kündigen 2021 an, ab circa 2030 ausschließlich e-Mobile bauen zu wollen. Im Text des Stückes heißt es: „…wir fahr´n …“. Vielleicht singen wir im Jahre 2035 stattdessen: „… wir werden gefahr´n …“. Denn parallel zur e-Mobilität arbeiten die Ingenieure mit Hochdruck an autonomen Fahrzeugen. Welche unglaubliche Entwicklung liegt in diesem Bereich hinter und auch noch vor uns.
Radioaktivität.
Veröffentlicht 1975. Anfang März 2011 kommt es nach einem verheerenden Tsunami zur Kernschmelze in mehreren Reaktorblöcken des Atomkraftwerks in Fukushima/Japan. Die Schäden – insbesondere die Auswirkungen auf die Anwohner und die Umwelt – sind verheerend. Deutschland beschließt daraufhin, komplett aus der Kernenergie auszusteigen. Nach aktueller Planung (Anfang 2022) wird 2023 das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Nukleare Stromerzeugung in Deutschland: In zehn Jahren von Einhundert auf null.
Anfang 2013 steht bei uns weder die Kohleförderung noch die Kohleverstromung zur Diskussion. Neun Jahre später wird der deutsche Ausstieg auch aus diesen beiden Industrien beschlossene Sache sein. Der Klimawandel – bedingt durch die stetig steigende Erderwärmung – zwingt uns dazu.
Mensch-Maschine.
Veröffentlicht 1978. Werden wir nicht jeden Tag angehalten, wie eine Maschine zu funktionieren? Fehlerfrei. Nahezu ohne Störungen. Immer mit der gleichen konstanten Leistungsfähigkeit. Begleiten uns nicht inzwischen Androiden in den Fabriken, unterstützen uns bei unseren Arbeiten, und stehen vielleicht sogar bereits in den Startlöchern, einige der Arbeiten komplett von uns zu übernehmen? Packen heute Unternehmen nicht längst ihre humanoiden Mitarbeiter in die gleiche Kategorie wie ihre Roboter – indem sie beide als (nahezu gleichwertige) Ressourcen bezeichnen, und mit den mehr oder weniger identischen Maßstäben kalkulieren? Der Übergang von geeigneten Aufgaben vom Menschen auf die Maschine ist in vollem Gange. Aus meiner Sicht besteht darin eine große Chance. Man denke nur an monotone, einseitig belastende Aufgaben. Die möglichen Risiken einer Roboterisierung müssen wir jedoch im Auge behalten.
MusiqueNonStop.
Veröffentlicht 1986. Heute Abend in Düsseldorf das letzte Stück. Die Musiker verlassen nach und nach die Bühne, die Synthesizer spielen nun eigenständig. Ohne Bediener. Im Vorhinein so programmiert. Immer das gleiche Lied. Dieselbe Melodie. Mit konstanter Geschwindigkeit. Bedeutet das in der Übertragung, dass wir Menschen nicht mehr gebraucht werden? Oder dass wir ersetzbar sind? Sagt uns die Konstanz der Melodie und des Tempos eine Kontinuität der Lebensmelodie und des Arbeitstempos voraus? Oder ist es das Sinnbild dafür, dass uns Computer (und Musik!) letztendlich überleben werden? Fragen über Fragen.
Die Bühne ist verwaist. Doch nach wie vor hören wir die Musik. Die Computer spielen alleine vor sich hin. Skurril. Irgendwann beenden auch sie – programmgesteuert – ihren Part. Der Vorhang fällt. Dunkelheit. Stille. Dann leuchten die Scheinwerfer auf. Die Musiker kommen zurück. Ohrenbetäubender Applaus. Ein einmaliger Abend. Eines der besten Konzerte, die ich je gehört und gesehen habe. Der Kopf ist voller neuer Bilder.
21. Januar 2013
Nachdem wir nur wenige Tage vor Weihnachten von einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in Hessen den Zuschlag für einen großen SAP-Rollout erhalten haben, waren bei mir die ersten drei Januarwochen von umfangreichen Vorbereitungen für das anstehende Projekt geprägt. Eine solch große Verantwortung zu übernehmen, so viele Kollegen als Projektleiter führen, ist für mich eine Premiere. Heute wird zunächst der interne Kickoff7 mit den eigenen Kollegen stattfinden, morgen erfolgt dann die Vorstellung unseres Teams beim Kunden. Ich bin aufgeregt.
Rollout- Projekte
Der Kunde hat sich vor achtzehn Monaten entschieden, die von ihm eingesetzte SAP-Unternehmenssoftware auf einen neuen Stand zu bringen. Die Rahmenbedingungen seines Geschäftes haben sich grundlegend verändert: In den vergangenen Jahren sind neue Märkte hinzugekommen, andere weggebrochen. Aufgrund der Globalisierung möchte er seine Wertschöpfungsketten über mehrere Länder verteilen, um so einerseits Kostenvorteile stärker zu nutzen, andererseits aufwändig erarbeitetes Knowhow vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Produzierte er vor zehn Jahren ausschließlich in Deutschland und exportierte rund fünf Prozent seiner Maschinen nach China, nimmt der chinesische Markt inzwischen über zwei Drittel seiner Erzeugnisse auf. Eine Fertigung dort vor Ort ist daher – alleine schon aufgrund der chinesischen Wirtschaftspolitik – unumgänglich. Allerdings sollen technologische Innovationen weiterhin gut geschützt bleiben. Die Fertigung in Asien beschränkt sich daher auf einfachere, überwiegend mechanische Komponenten, während die elektronischen Module sowie komplexere Baugruppen weiterhin ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt werden.
Das Unternehmen hat vor eineinhalb Jahren ein Beratungshaus damit beauftragt, seine bestehende SAP-Lösung zu analysieren, und gemeinsam mit den Fachbereichsverantwortlichen neue, die aktuellen und geplanten Gegebenheiten besser unterstützende Prozesse zu entwickeln. Die Vorarbeiten münden in ein sogenanntes Template – eine Art Mustervorlage für standardisierte Geschäftsprozesse. Das Template soll nachfolgend Schritt für Schritt in allen Landesgesellschaften eingeführt werden – dieses Vorgehen bezeichnet man als Rollout. Ursprünglich hatte unser Kunde vorgesehen, auch den Rollout komplett mit dem ursprünglich beauftragten Beratungshaus durchzuführen. Wie wir auf Umwegen erfahren, gab es jedoch Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Vorgehensweise, die den Kunden bewogen haben, uns nun ab Anfang 2013 als zweiten Partner ins Boot zu nehmen.
Unsere Aufgabe in den kommenden zehn Monaten wird es sein, die Fertigstellung des Templates zu unterstützen, und uns in dieser Zeit das Wissen über die eingestellten Funktionen und Prozesse anzueignen. Um dann ab Herbst 2013 den Rollout in die deutschen Werke durchzuführen. Das ursprüngliche Beratungshaus wird parallel dazu die Implementierung in den asiatischen Standorten verantworten.
Pünktlich versammeln sich meine zukünftigen Projektmitglieder im großen Besprechungsraum unserer Niederlassung. Der heutige Tag soll einerseits dazu dienen, dass wir uns untereinander kennenlernen – mit einigen der Kollegen habe ich zuvor bereits zusammengearbeitet, andere sehe ich gerade zum ersten Mal. Den Anwesenden geht es untereinander genauso. Das zweite wichtige Ziel: Es gilt, den mit dem Kunden geschlossenen Vertrag zu verstehen. In einer Übersicht werde ich meinem Team die vereinbarten Leistungskomponenten vorstellen. Drittens benötigen wir eine detaillierte, vom gesamten Team verstandene und mitgetragene Aktivitätenplanung der kommenden drei bis vier Projektwochen. Diese wollen wir morgen dem Kunden vorstellen, mit ihm durchsprechen und gemeinsam verabschieden.
Im Vorfeld habe ich auf über siebzig Folien Informationen zusammengetragen. Über unseren Auftraggeber, seine Produkte, Standorte, Managementstrukturen, Ansprechpartner. Die wesentlichen Komponenten und Leistungsverpflichtungen unseres Vertrages. Organisatorische Themen, zum Beispiel unsere geplanten internen Berichtsstrukturen. Aber auch eher banale Dinge: Umgebungskarten der Projektstandorte sowie Vorschläge für Übernachtungsmöglichkeiten. Wir starten heute in das Projekt mit elf Kollegen – in drei Monaten sollen es über zwanzig sein.
22. Januar 2013
Nachdem wir gestern einen guten internen Auftakt verbuchen konnten, geht es jetzt in die Höhle des Löwen. Es ist tatsächlich ein wenig so wie ein Besuch bei Raubtieren, denn die Fachbereichsverantwortlichen des Kunden empfangen uns leider nicht mit offenen Armen. Sie haben sich durch die Projektarbeit in den vergangenen Monaten an das ursprüngliche Beratungshaus gewöhnt. Es sind eng verbundene Pärchen zwischen Beratern und Kundenmitarbeitern entstanden. Man versteht sich. Und hat sich – trotz sicherlich einiger Differenzen – durchaus miteinander arrangiert. Der völlig normale Prozess in einem solchen Projekt. Das bereits im Einsatz befindliche Beratungshaus hat selbstverständlich null Interesse an einem zweiten Boxer im Ring. Und selbst die Kundenprojektleitung scheint nicht vollständig von dieser – von der Geschäftsführung beschlossenen – neuen Dreier-Konstellation überzeugt zu sein. Willkommen fühlen wir uns nicht. Nicht heute. Nicht morgen. Und auch nicht übermorgen.
Der Tag beginnt mit einer Einführungsveranstaltung in der Unternehmenskantine. Seitens des Kunden begrüßt uns der Projektsponsor, er erläutert das Projektvorhaben und das ab heute gültige, neue Zusammenarbeitsmodell. Während der anschließenden Vorstellungsrunde sehen wir in viele unbekannte Gesichter, versuchen, uns die genannten Namen einzuprägen. Danach geht es in die Projektetage. Die Berater sowie einige dem Projekt zugeordnete Kundenmitarbeiter sind hier in einem Großraumbüro untergebracht. Jede der sechs Tisch-Inseln steht für einen definierten, abgegrenzten Prozessbereich: Verkauf, Einkauf, Logistik, Produktion, Qualitätswesen und Service. Ein gutes Konzept, erleichtert es doch sehr die Kommunikation im eigenen Team sowie den Austausch mit den benachbarten Fachkollegen. Allerdings ist der Geräuschpegel bereits jetzt sehr hoch. Die Sitzverhältnisse sind beengt. In den kommenden Wochen werden weitere Berater zu uns stoßen.
Befindlichkeiten
Im Flur der Projektetage kleben DIN-A4 Folien an der Wand, auf denen sich jedes Projektmitglied mit Foto, Lebenslauf und privaten Interessen kurz vorstellen kann. Kann. Nicht muss. Es ist eine freiwillige Aktion. Ich unterstütze die Idee: Wir kommen gerade neu ins Projekt, treffen auf dreißig, vierzig völlig unbekannte Kunden- und Berater-Gesichter. Da hilft es doch jedem von uns, wenn man mal schnell nachsehen kann, wer denn mit mir gleich am nächsten Meeting teilnehmen wird. Bereits am zweiten Morgen hängt auch mein Steckbrief in der Galerie.
Alle meine Kollegen halten es genauso wie ich. Alle? Nein – einer nicht: Er wird mich in den kommenden vier Wochen wiederholt in Diskussionen verwickeln, in denen er den seiner Meinung nach fehlenden Datenschutz anprangert. Ich erkläre ihm wieder und wieder, dass keiner zu dieser Aktion verpflichtet ist – niemand muss sich beteiligen. Doch rede ich wie vor eine Wand. Einige Tage später erhalte ich einen Anruf seiner Führungskraft. Sie fragt, warum wir in diesem Projekt dazu gezwungen werden, private Daten zu veröffentlichen. Ich erläutere ihm, dass hier niemand irgendjemanden zwingt, irgendetwas Privates preiszugeben. Er ist verwirrt – sein Mitarbeiter habe ihm etwas völlig anderes erzählt. In der darauffolgenden Woche bittet die Kundenprojektleitung um ein Gespräch. Sie beschwert sich vehement, dass mein Anti-Team-Wand-Kollege augenscheinlich mehr Zeit damit verbringt, andere Projektmitglieder in Steckbrief- und Datenschutz-Diskussionen zu verwickeln, als am eigentlichen Projektauftrag zu arbeiten.
In Summe kostet mich das Verhalten des Kollegen in den ersten Projektwochen geschätzt ein bis zwei komplette Arbeitstage meiner ohnehin knappen Zeit. Es ist daher nur logisch, dass wir den Mitarbeiter bei nächstbester Gelegenheit aus dem Projekt nehmen. Auch im Rahmen seiner Abberufung versucht er, mich in endlose Fragerunden zu ziehen, die ich konsequent abblocke. Normalerweise ist das überhaupt nicht mein Stil. Aber das hier ist nicht normalerweise. Wie mögen nur seine Lehrer in der Schule mit ihm fertig geworden sein? Ich will es mir nicht weiter ausmalen.
Die Projektleitung sitzt in einem eigenen Büro. Zwar auf der gleichen Etage, aber dennoch separiert von den Beratern. Die Platzverhältnisse im Großraumbüro sprechen durchaus für diese Trennung, allerdings möchte ich gerne täglich die Stimmung, die Probleme, und auch die Lösungsbereitschaft der operativen Teams hautnah mitbekommen. Daher entschließe ich mich, meine Zelte bei den Beratern aufzuschlagen. Das bringt mir ein dickes Stirnrunzeln der Kundenprojektleitung ein. Sie würde mich lieber im sogenannten Projektbüro sehen – um mich damit eventuell auch gleichzeitig mehr unter Kontrolle zu haben? Meinem Argument der direkten Kommunikation kann man aber nichts entgegensetzen. Also ab ins Großraumbüro.
Ende Januar 2013
Plötzlich gibt es Menschen in unserer internen Organisation, die mir die Verantwortung für dieses Projekt nicht (mehr) zutrauen. Bisher konnte ich tatsächlich noch keine Erfahrungen in vergleichbaren Aufgabenstellungen – vor allem in dieser Projektgröße – sammeln. Man fragt mich: Weißt du eigentlich, dass du ab jetzt jeden Monat ungefähr den Gegenwert einer Doppelhaushälfte8 verantwortest? Ganz ehrlich? Nein. Darüber hatte ich mir bis dato noch keine Gedanken gemacht. War das ein Fehler?
Der Kunde kennt mich aus einem IT-Strategieprojekt, das ich vor einigen Jahren bei ihm durchgeführt habe. Während unserer Akquise im vergangenen Herbst hat er mehrfach nachgefragt, ob denn das Team, das er jetzt während der Angebotsphase zu Gesicht bekommt, auch dann tatsächlich in dieser Besetzung sein Projekt durchführen wird. Das haben wir immer bejaht. Seitens unseres an den Präsentationen teilnehmenden Managements gab es nie auch nur die leisesten Kommentare, dass ich nicht der geeignete Projektleiter sei. Nun also diese Zweifler. Die mir eine erfahrenere Person als Coach an die Seite stellen wollen. Darüber bin ich zunächst echt sauer9, hege den Gedanken, die Brocken hinzuschmeißen. Sollen es doch andere machen. Denen man es mehr zutraut. Ohne einen zusätzlichen Aufpasser. Doch nach zwei, drei Tagen des Schmollens sehe ich in dem Coaching-Angebot eine Chance. Eine Chance, mich persönlich weiterzuentwickeln. Eine Chance, wertvolle Unterstützung von einem langjährigen Groß-Projektleiter zu erhalten. Und eine Chance, eventuell auftretende Schwierigkeiten in der Verantwortung dann auch teilen zu können.
Mir wird also ein gestandener Projektmanager zur Seite gestellt. Gestanden bedeutet: Er hat bereits mehrere deutlich größere Projekte verantwortet. Zur Seite gestellt bedeutet: Wir treffen uns Anfang Februar einmal persönlich in unserer Niederlassung, besprechen die generelle Vorgehensweise. Danach telefonieren wir in einem vierzehntägigen Turnus jeweils eine Stunde am Freitagnachmittag. Der mir zugeteilte Kollege ist ein „Netter“ – die Diskussionen verlaufen immer konstruktiv, ich lerne in jeder unserer Abstimmungsrunden hinzu. Allerdings stelle ich fest, dass mir viele seiner vorgeschlagenen Vorgehensmuster als zu theoretisch, in meinem konkreten Fall als zu wenig praktikabel erscheinen. In diesem Auftrag lassen die Rahmenbedingungen (Kapazität, Budget, Planungsstruktur, Historie) seinen vorgeschlagenen Detaillierungsgrad nur selten zu. Ihm fällt es schwer zu akzeptieren, dass wir hier in ein laufendes Projekt mit seit vielen Monaten gelebten, etablierten Strukturen hineinkommen, und daher nicht spontan von heute auf morgen einen anderen (seinen …) Takt schlagen können.
Zusammenhänge, die man erst später versteht
Ich hatte mich ja gewundert, dass man mir intern zunächst ohne Wenn und Aber die Rolle des Projektleiters überträgt, dann aber kurze Zeit später meine Fähigkeiten in Frage stellt. Stück für Stück kristallisieren sich die tatsächlichen Gründe für diesen Meinungswechsel heraus. Gemäß den internen Richtlinien sollten Projekte dieser Größenordnung immer von zertifizierten Projektmanagern geleitet werden. Eine solche Ausbildung habe ich nicht. Somit dürfte ich diese Rolle eigentlich nicht einnehmen. Eigentlich.
Blöd ist nun, dass der Kunde auf meiner Person als Projektleiter besteht – zumal wir sie ihm ja auch im Rahmen der Akquise mehrfach zugesagt haben. Gemäß unseren Regularien müssten wir jetzt theoretisch von der gegebenen Zusage zurücktreten, und mich durch einen zertifizierten Kollegen ersetzen. Das würde dem Kunden sicherlich missfallen. Daher hat sich unsere Organisation den begleitenden Coach einfallen lassen. Das Projekt ist nun somit zumindest unter der direkten Beobachtung durch einen adäquaten Projektmanager. Wieder etwas dazu gelernt: So ist das mit den Richtlinien in der Theorie und in der Praxis.
In den jetzt vor mir liegenden Wochen werden fast täglich Entscheidungen erforderlich sein, welche nicht selten weitreichende Konsequenzen haben. Bei den meisten finde ich schnell zu einer eigenen Einschätzung, bin aber immer dankbar für eine zweite Meinung. Regelmäßig tausche ich mich daher mit meinem Chef-Chef aus. Er begleitet diesen Auftrag als Sponsor unseres Managements, wird im Projektverlauf jederzeit ein offenes Ohr für mich haben, mir viele pragmatische, realitätsnahe Ideen geben. Meinem offiziellen, zertifizierten Coach möchte ich kein Unrecht tun – aber wenn es eine Person gibt, die mich kontinuierlich durch sämtliche Höhen und Tiefen dieses Projekt begleitet, dann wird das mein Chef-Chef sein. Danke!
4. Februar 2013
In unserer Organisation überlegt man seit einiger Zeit, wie Projekte im Innenverhältnis transparenter dargestellt werden könnten, um sowohl Chancen wie auch Risiken früher zu identifizieren. Ein dafür neu entwickeltes Konzept wurde von den internen Gremien Anfang dieses Jahres verabschiedet, nun soll es an einigen Pilot-Projekten verprobt und verfeinert werden. Und was für eine Überraschung: Ich darf einer der Tester sein! Um es vorweg zu schicken: Jegliche Form von internem Berichtswesen ist mir ein Graus. Ich entwickle extreme Widerstandsgefühle, sobald ich einen Bericht nur „um-des-Berichtens-willen“ erstellen muss. Doch habe ich mir vorgenommen, so offen wie möglich an diesen Pilotversuch heranzugehen. Schließlich soll ja gerade in den Testprojekten geprüft werden, ob Annahmen, Vorgehensweisen und Detaillierungsgrade realitätsnah und zielführend festgelegt wurden. Mein Feedback kann es somit für die nachfolgenden Projektleitungs-Anwender nur besser werden lassen. Glaube ich. Noch.
In den kommenden drei Monaten werde ich zunächst wöchentlich, später vierzehntäglich Gespräche mit zwei Kollegen führen, die an der Ausarbeitung des neuen Verfahrens federführend beteiligt waren, und nun die Pilotprojekte begleiten. In den ersten Treffen geht es zunächst darum, anhand einer Checkliste die konkret für mein Projekt notwendigen Dokumente und Verfahren zu identifizieren. Wir schneidern uns sozusagen unsere Berichtsumgebung nach Maß. Vom Grundsatz eine gute Idee: Nutze nur das, was du wirklich benötigst. Meine erste Überraschung: Es stellt sich so ziemlich alles, was auf der Checkliste steht, als für mein Projekt erforderlich heraus. Der Kandidat (ich) darf in den nächsten Tagen zwölf(!) von insgesamt vierzehn Formularen initial ausfüllen und in den darauffolgenden Monaten turnusmäßig (alle vier Wochen!) aktualisieren. So umfangreich hatte ich mir den Papierkram nicht vorgestellt. Die Frage, was denn mein Projekt im Berichtswesen von einem zehnmal größeren Projekt unterscheidet (denn es fehlen ja nur noch zwei Dokumente zum Jackpot …), können meine Gegenüber nicht beantworten. Und auf die Frage, woher ich denn die – bisher nicht eingeplante – Zeit nehmen soll, zucken sie nur mit den Schultern. Das wüssten sie auch nicht. Mein Engagement erhält gerade einen ersten Dämpfer.
Berichtswesen – ein Praxisbeispiel
Nach einigen Wochen im Projekt stellt ein Kollege von mir zufällig fest, dass die von ihm wöchentlich erstellten Berichte von der Kundenprojektleitung nicht gelesen werden. Um sich sein Leben etwas einfacher zu machen, kopiert er daher nur die Datei der Vorwoche, ändert ein paar Kleinigkeiten im Text, und legt sie unter dem neuen Wochenindex ab. Das fällt zunächst niemandem auf. Dann spricht mich plötzlich die Kundenprojektleitung an. Es würde ein Bericht genau dieses Beraters fehlen. Klar, der ist diese Woche in Urlaub. Na, dann müsste er bitte eine Kopie der letzten Woche einstellen. Warum? Weil wöchentlich die Vollständigkeit der Dateien durch eine Mitarbeiterin des Projektbüros geprüft wird. Es zählt also jemand auf der Kundenseite nach, ob wir jede Woche zwölf Dateien ins Verzeichnis einstellen. Zwölf Berater, zwölf Dokumente. Für den Inhalt scheint sich niemand zu interessieren. Ein Witz, über den man nicht wirklich lachen kann.
Auf die schriftlichen Berichte unserer Berater könnte ich persönlich grundsätzlich verzichten. Mit meinen Kollegen bin ich im Großraumbüro täglich in Kontakt. Sie erzählen mir am Kaffeeautomaten in drei Minuten mehr, als sie je auf eine PowerPoint-Folie schreiben würden. Aber ich darf die schriftlichen Versionen nicht abschaffen: Auch unsere internen Projektvorschriften sehen einen Wochenbericht für jeden Berater (beziehungsweise jedes Team) vor. Die Idee dahinter: In einer eventuell negativen Projektsituation finden sich in den Wochenreports ganz bestimmt klare Formulierungen auf unsererseits angezeigte Verspätungen, nicht erfolgte Zulieferungen des Kunden, und vieles mehr. Ich hoffe, dass es nie zu einer Eskalation kommen wird – da würden sich die hoffnungsvollen Leser sicherlich sehr über die aufschlussarmen Inhalte der DIN A4-Folien wundern …
Wie zuvor bereits erwähnt, habe ich mir vor und seit dem Start des Projektes die Mühe gemacht, alles für unser Team Wissenswerte auf (inzwischen) knapp einhundert Power-Point-Folien zu dokumentieren. Das von meinen internen Audit-Kollegen geforderte Zentraldokument (von den vierzehn das umfangreichste …) ist von ihnen als Word-Template vorgesehen. Die beiden wollen mich allen Ernstes dazu überreden, die Grafiken und Texte aus meinen einhundert Folien in das Word-Dokument zu überführen. Und zwar idealerweise nicht eins zu eins. Sondern als neugeschriebene, ausformulierte Prosa. Das lehne ich kategorisch ab – was für ein völlig überflüssiger Unsinn! Stattdessen schlage ich vor, meine PowerPoint-Datei anstelle ihres Word-Templates als zukünftigen Dokumentationsstandard zu übernehmen. Das lehnen die beiden ab. Word wäre die gesetzte Vorgabe. Ich beginne mich zu fragen, ob es hier jetzt noch um Inhalte geht – um den Nutzen, um die Anwendbarkeit im realen Projektleben. Oder vergeuden wir unsere Zeit mit der Diskussion um Formate? Ohne Worte.
Da wir keine schnelle Lösung für die gegensätzlichen Positionen finden, sage ich den Kollegen zu, für den nächsten Termin einen Vorschlag zu erarbeiten. Eine Woche später: In jedes Unterkapitel ihres Word-Dokumentes habe ich den Verweis auf meine PowerPoint einkopiert. Copy. Paste. Copy. Paste. Und noch mal Copy. Und noch mal Paste. Das kostet mich ungefähr fünfzehn Minuten. Es erfüllt meinen Mindest-Standard. Und ich halte es für einen Kompromiss. Wenn auch für einen schlechten. Ihre Erwartungen erfüllt es nicht. Sie maulen herum, beharren auf einem „vernünftigen“ Ausfüllen ihrer Vorlage. Ich schlage ihnen vor, dass sie doch gerne die Daten in ihr Dokument übernehmen könnten – dann mögen sie sich dafür bitte selbst eine Person außerhalb meines Projektes suchen. Wir haben für solche Arbeiten weder den Aufwand kalkuliert, noch die Kapazitäten verfügbar. Sie sind nicht begeistert. Am Ende akzeptieren sie jedoch grummelnd meine Version. Allerdings nur als Ausnahme für dieses Projekt. Ein unnötiges, überflüssiges Schattenboxen neigt sich dem Ende zu. Und ich dachte, es solle alles einfacher werden.
Der Sinn eines Pilot-Projektes
Nach meinem Verständnis verfolgt ein Pilotprojekt immer das Ziel, etwas zuvor eher theoretisch Erarbeitetes an der realen Welt zu verproben. Um anschließend – je nach gewonnenen Erkenntnissen – sinnvolle Korrekturen in die Vorlage einzuarbeiten. Und es dann beim nächsten Projekt besser zu machen. Schneller. Einfacher. Verständlicher. Meinen Vorschlag, das Zentraldokument in Form einer PowerPoint-Datei anzulegen, halte ich für eine wertvolle Optimierung des ursprünglich ausgearbeiteten Vorgehens. Das wesentliche Argument: Die im Dokument gesammelten Informationen muss ich im Verlauf eines Projektes wiederholt – zum Beispiel bei Aktualisierungen – den Teamkollegen in einfacher Form vorstellen können. Ein Durchblättern eines Word-Fließtextes erscheint mir in der Praxis sperrig – die PowerPoint-Präsentation wäre bei Projektmeetings viel flexibler einsetzbar. Gegenargumente zu meinem Vorschlag liefern mir die Kollegen nicht. Erwartet hätte ich nun, dass sie ihr ursprüngliches Modell auf meinen praxisnäheren Vorschlag hin anpassen würden. Machen sie aber nicht. Warum sie bei ihrem Stil bleiben, können sie mir auch bei zweimaligem Nachhaken nicht beantworten. Ein drittes Mal werde ich nicht fragen.
5. Februar 2013
In einem Unternehmen der Druckbranche soll in den kommenden zehn Monaten ein Blueprint10 erstellt werden. Unser Angebot konnte den Kunden leider nicht überzeugen, ein anderes Beratungshaus hat den Zuschlag erhalten. Da der Blueprint die Vorstufe des eigentlichen Implementierungsprojektes darstellt, haben wir uns entschieden, mich dem Kunden während dieser ersten Phase als Qualitätssicherer anzubieten. Meine Aufgabe wird es sein, kritische anstehende Projektentscheidungen zu prüfen, und dem Auftraggeber eine zweite Meinung (oder auch Empfehlung) zu seinen Fragestellungen zu geben. Natürlich verfolgen wir mit der Besetzung dieser Rolle ganz klar die Idee, aus erster Hand wertvolle Informationen über den weiteren Verlauf des Projektes zu gewinnen, um uns dann bei der Ausschreibung der zweiten Projektphase gut positionieren zu können. Alle zwei bis drei Wochen werde ich für einen Tag vor Ort sein, um mit der Kundenprojektleitung die wichtigsten aktuellen Fragen und Problemstellungen zu diskutieren.
Heute gehen wir als erstes durch eine lange Liste der in der Altsoftware identifizierten Sonderprogrammierungen. Für den Blueprint stellt sich die Frage, ob man diese Programme zukünftig weiterhin benötigt. Und sie dann in der neuen Software zusätzlich entwickeln muss. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob inzwischen SAP-Standardfunktionen existieren, mit denen die aufgelisteten Zusatzanforderungen ohne separate Programmierung abbildbar wären. Last but not least ist zu klären, ob man gegebenenfalls – durch eine Veränderung des bisherigen Geschäftsprozesses – komplett auf die Sonderfunktionen verzichten könnte.
Das alte Lied
Ich erinnere mich an die ersten Tage meines Beraterlebens. Bereits damals wurde intensiv diskutiert, wie sich die Kunden von den vorherrschenden Individualprogrammierungen hin zur Nutzung angebotener Standard-Software entwickeln könnten. Die Historie zeigt die Wichtigkeit dieser Überlegungen, und die Notwendigkeit für jedes Unternehmen, den für sich richtigen Weg zu definieren und einzuhalten. Das Thema erscheint mir heute aktueller denn je.
Die ersten Geschäfts-Programme waren nahezu komplette Individualentwicklungen für das jeweilige Unternehmen. Einer meiner ersten Kunden setzte Mitte der 1980er Jahre zwar bereits auf einem Standard-Software-Kern auf – da jedoch der gesamte Markt noch in den Kinderschuhen steckte, und in dem gekauften Standard nur wenige Funktionen enthalten waren, heuerte man üblicherweise (mindestens) einen pfiffigen Programmierer an, der dann jeden von den Nutzern geäußerten Bedarf in Bits und Bytes umsetzte. Einerseits sehr komfortabel für die Anwender: (Fast) jeder Wunsch konnte im Laufe weniger Tage oder Wochen erfüllt werden. Andererseits ein Tag für Tag zunehmendes Risiko für das Unternehmen: Nur ein oder zwei Personen kannten den individuellen Programmiercode. Sie erarbeiteten sich mit jeder Zeile der geschriebenen Software ihren Dauerverbleib im Unternehmen, und idealerweise auch zusätzliche Renteneinkünfte. Nicht auszudenken, was mit einem solchen Betrieb bei längeren Ausfällen eines Entwicklers (zum Beispiel durch Krankheit) hätte passieren können – im Zweifel wäre das Unternehmen über Tage oder Wochen in wichtigen Prozessabläufen handlungsunfähig gewesen …
Mit der wachsenden Nachfrage an industriellen Standardprogrammen entstehen in den achtziger Jahren Softwareanbieter, die dem Kunden für die Implementierung umfangreicher Programmpakete eigene Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Parallel zu den Softwareherstellern mit ihren Beraterteams entwickeln sich IT-Systemhäuser, deren Consultants auf eine marktgängige Standardsoftware geschult werden, und so – unabhängig vom Hersteller – die Einführung und auch spätere Betreuung der Programme beim Kunden anbieten können. Das Unternehmen hat nun die Wahl, ob es die Beratungsleistung direkt beim Hersteller, oder lieber von einem Dritten bezieht. Mit der Ablösung der Individualprogramme durch eine industrielle Standardsoftware verringert sich die Abhängigkeit vom Wissen einzelner – und damit auch das Ausfallrisiko – drastisch.
Allerdings versäumen die meisten Unternehmen bei diesem Softwarewechsel die gleichzeitige Abschaffung der schnellen individuellen Wunscherfüllung: Weiterhin stehen die Anwender täglich bei den Beratern vor dem Tisch und wünschen sich hier noch ein rosa Schleifchen und dort ein weiteres lila Formular. Auf beiden Seiten – Softwarepartner und Kunde – herrscht auf der Management-Ebene Einigkeit, dass nun mit der Einführung der Standardsoftware alles gut werden wird. Die operative Ebene – Berater und Anwender – lässt das relativ kalt: Es findet nur selten ein geregelter Antrags- und Bewertungsprozess (und somit auch einmal eine Ablehnung) der Neuanforderungen statt. Wenige Jahre nach Einführung der industriellen Standardsoftware ist man zwar nicht mehr abhängig von Individual-Programmierern, dafür nimmt nun jeder Releasewechsel11 endlose Kapazitäten für das Testen der wie Pilze aus dem Boden schießenden Sonderentwicklungen in Anspruch.
Mit der Einführung der nächsten Softwaregeneration (diese ist technisch versierter, verfügt über eine größere Funktionsbreite, bietet den Anwendern schnellere Antwortzeiten) ab Anfang dieses Jahrtausends hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Das Management ruft „Heureka“ und beschließt für die Zukunft die ausschließliche Nutzung des eingekauften Standards. Ausschließlich? Na ja … also ... so fast ausschließlich … denn … da gibt es ja den guten Kunden X, dem wir seine Sonderwünsche schon immer erfüllt haben. Und der Anforderung der Fertigung, jede auch nur theoretisch mögliche Produktvariante über die Software abzubilden, muss natürlich auch entsprochen werden. Frau Meier aus dem Controlling möchte nicht auf ihren heißgeliebten Report verzichten – ohne den garantiert sie für nichts mehr. Und wenn im Vertrieb nicht die vierundachtzig individuellen Preiskonditionen nachprogrammiert werden, sinkt der Umsatz im kommenden Quartal garantiert um zwanzig Prozent. Orakelt der Verkaufsleiter. Und wie verhält sich dann das Management? Es sagt im Regelfall: „Ach so … ja dann … dann wollen – nein: Müssen! - wir natürlich den vorigen Zustand eins zu eins auch in dieser Software abbilden!“





























