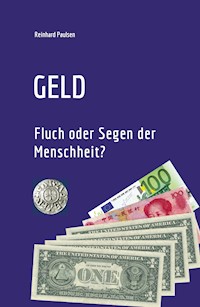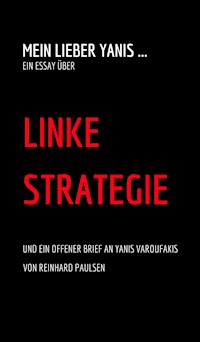
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein politischer Essay über die historisch gefährliche Lage der Welt und die Zukunftsperspektiven der Menschheit in Form eines Offenen Briefes an den Frontmann der "Democracy in Europe Movement 2025" (pan-Europa Organisation DIEM25), den Ex-Finanzminister Griechenlands und Professor der Ökonomie Yanis Varoufakis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der Autor
REINHARD PAULSEN (*1947)
In den Jahren 1967-1974 studierte er Geschichte an der Universität in Kiel. Er schloss das Studium mit dem Grad eines Magister Artium ab. Danach verließ er das akademische Intellektuellenmilieu und absolvierte eine Schlosserlehre. Anschließend arbeitete er als Betriebsschlosser in einer Aluminiumhütte, um dann 1977 zu einem weltweit tätigen Konzern der Chemischen Industrie zu wechseln, in dem er 35 Jahre bis zu seinem Ruhestand 2012 angestellt war. Seine Arbeit umfasste Schlosser-, Techniker- und Ingenieursarbeit und Tätigkeit in der Qualitätssicherung und im Reklamationswesen. In all diesen Jahren war er basisgewerkschaftlich engagiert, sei es als Vertrauensmann, als Betriebsrat oder in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, wobei er persönlich kritische Distanz zum Gewerkschaftsmanagement hielt. 2002 kehrte er, parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit nach 28 Jahren, an die Universität zurück und arbeitete ab 2006 an der Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaften an einem Promotionsprojekt zu hamburgischer und europäischer Schifffahrt im Mittelalter und deutscher Forschungsvergangenheit, das er im Jahre 2014 mit dem Grad eines Dr. phil. in mittelalterlicher Geschichte abschloss. 2013/2014 nahm er Lehraufträge in mittelalterlicher Geschichte an der Universität Hamburg wahr.
Mein lieber Yanis …
Ein Essay über
Linke Strategie
Und ein längerer Offener Brief an Yanis Varoufakis
von
Reinhard Paulsen
© 2016 Reinhard Paulsen
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7345-8321-6
e-Book:
978-3-7345-8323-0
Coverdesign Gunther Sosna
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
INHALT
Vorwort
1 Ich, meine Zeit und die Bestie des Nationalismus
1.1 Ein einzigartiger Moment in der Menschheitsgeschichte?
1.2 Die Nachkriegsperiode
1.3 Das verlogene, nationale “WIR”
1.4 Europa, ein Leuchtfeuer der Humanität?
2 Über die Demokratie
2.1 Selbstverwaltung vs. Demokratie
2.2 Repräsentative Demokratie und Klassenkampf
2.3 Von der Klassenzusammenarbeit zum Klassenkrieg
3 Nationen und globaler Kapitalismus
3.1 Ein gesellschaftliche Gift namens “Nation”
3.2 Nationen und Nationalstaaten: Relikte der Geschichte
3.3 Sich ändernde Sichtweisen durch Globalisierung
4 Kapitalismus contra Demokratie
4.1 Noam Chomsky: Es gibt keine kapitalistische Demokratie
4.2 Eine einzige Geschäftspartei mit Volkspartei-Fraktionen
4.3 Wahlverweigerern die Schuld geben?
5 Über das Volk
5.1 Das Volk: mal raus aus der, mal zurück in die Demokratie?
5.2 Über die “schweigende Mehrheit”
5.3 Über unsere Aufgaben
6 Die griechischen Erfahrungen
6.1 Die Politik von Syriza und das OXI-Referendum
6.2 Ein “unbescheidener Vorschlag” für offensive Politik
7 Den Kapitalismus in Europa reparieren?
7.1 „Europäischen Kapitalismus vor sich selbst retten“?
7.2 “Bescheidener Vorschlag”: Beratung des EU-Establishments
7.3 Yanis Varoufakis: Für kapitalistische Demokratie
7.4 Über die zwei Identitäten von DIEM25
8 Änderung der EU-Politik und Volksregierungen
8.1 Für den” Bescheidenen Vorschlag” auf einen LAMADI
8.2 Über “die bedeutendste Demokratie in Europa”
8.3 … und über wirkliche Volksregierungen
8.4 Der DIEM25-LAMADI konkret
8.5 Strategie und Taktik von DIEM25
9 Fazit: von DIEM25 zu SEUCAM?
10 Eine Strategie auf realistischer Grundlage tut not
10.1 Der drohenden Untergang des Kapitalismus
10.2 Der herrschende ÖkWk
10.3 Den Gordischen Knoten des Kapitalismus durchschlagen
11 Den richtigen Weg finden
11.1 Über die Staatsschuldenkrise
11.2 Über die Bankenkrise
11.3 Über die Investitionskrise
12 Strategisches Hauptziel: Finanzkapitalismus beseitigen
12.1 Das Tabu
12.2 Die modern Version des Tabus
12.3 Fiktives Kapital und Fiatgeld abschaffen
13 Strategisches Ziel: Den Krieg aus der Welt schaffen
13.1 Die Waffen- und Kriegsindustrie abschaffen
13.2 Exporte von Waffen, Militärgütern und Ersatzteilen verbieten
13.3 “Schwerter zu Pflugscharen!” Die Kriegsindustrie umwandeln
13.4 Die unheilige Dreieinigkeit bröckelt
13.5 Stell‘ dir vor es ist Krieg und keiner geht hin?
14 Ich komme zum Schluss
14.1 Es kommen harte Zeiten
14.2 Wofür du dringend gebraucht wirst, Yanis
Anmerkungen
Vorwort
Diese Abhandlung entstand im Frühjahr und Sommer 2016 im Zusammenhang mit der Formierung von DIEM25. Diese „Democracy In Europe Movement 2025“ wurde im Februar 2016 von einer Initiatorengruppe um den früheren griechischen Finanzminister und Wirtschaftsprofessor Yanis Varoufakis als vielversprechende, pan-europäische Demokratiebewegung ins Leben gerufen. Ich schloss mich an und wurde in der Hamburger Ortsgruppe aktiv.
Natürlich ging es in dieser erste Phase um eine Diskussion der Grundlagen, auf der diese basisdemokratisch konzipierte Bewegung arbeiten und ihre Aktivitäten ausrichten wollte. Wie die Vergangenheit zeigt, enden solche Ansätze leicht als politische Strohfeuer, wenn sie nicht einen soliden Klärungsprozess durchlaufen. Es zeigte sich für mich in den Verlautbarungen und Grundsatzpapieren als auch in der Meinungsvielfalt meiner neuen Mitaktivisten viel Unausgegorenes, großer Klärungsbedarf und vieles, was mit den Erfahrungen eines langen politischen Lebens nicht vereinbar war.
Da die mir wichtigen Grundsatzfragen tiefer gingen als der bereits vorstrukturierte, interne DIEM-Diskussionsansatz, entschloss ich mich, einen Offenen Brief an Yanis Varoufakis zu schreiben, denn es war offensichtlich, dass seine politische Ausrichtung und Vorgaben der Dreh- und Angelpunkt von DIEM25 sind. Dieser Brief wuchs sich automatisch zu einem längeren Essay aus. Wie immer erwächst Neues aus einer gründlichen Kritik des Alten und Bestehenden. Und so wurde aus dem Offenen Brief ein „längerer Offener Brief“, in dem ich versucht habe, den heutigen Grundfragen sich als links einordnender Politik auf den Grund zu gehen und kritisch teilweise völlig neu zu beantworten. Und so wurde aus meinem Brief an Yanis zugleich ein politischer Grundsatzessay von 110 Seiten über linke Strategie, der bei weitem den Rahmen von DIEM25 sprengt und versucht, Antwort auf bohrenden Fragen besorgter Menschen nach der Zukunft des Landes, der Welt, ja des Planeten Erde zu geben .
Ich schickte Yanis also Ende August den Offenen Brief zu, den ich für eine länderübergreifende Kommunikation auf Englisch verfasst hatte und postete DIEM-intern einen dreiseitigen „Trailer“, um auf das längere Papier zum Downloaden aufmerksam zu machen. Von Yanis erhielt ich eine kurze, freundliche Eingangsbestätigung, hörte dann aber nie wieder etwas von ihm. In der DIEM-Organisation selber nahm niemand die geringste Notiz von meinen Bemühungen. Ich kann nicht sagen, warum das so ist - ob man an den Fragen kein Interesse hat, ob man mir von der Führungsgruppe wegen der teilweise sehr harten Differenzen aus dem Wege geht oder ob viele Aktivisten nicht mit einem solchen langen Text auf Englisch zurechtkommen. Ich habe deshalb den englischen Essay überarbeitet, selbst in das Deutsche übertragen und in die hier vorliegende Buchform gebracht.
Ich hoffe natürlich auf eine rege Diskussion meiner Kritik an DIEM25 und meiner strategischen Grundüberlegungen in der Hoffnung, den globalen Kampf gegen den sich abzeichnenden ökonomischen, politischen und kulturellen Abgrund voranzubringen, dem die herrschenden Weltverhältnisse immer bedrohlicher näher kommen.
Hamburg, im November 2016
Reinhard Paulsen
Lieber Yanis,
Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, jemals in meinem Leben einen Brief an dich zu schreiben. Und doch scheinen sich unsere Wege dank der DIEM25-Initiative zu kreuzen. Ich bin Historiker und außerdem fast anderthalb Jahrzehnte älter als du. Das mögen unter anderem zwei Gründe dafür sein, dass wir die Dinge dieser Welt von einem unterschiedlichen Blickwinkel aus betrachten und einschätzen. Ich habe natürlich das Manifest und die anderen DIEM-Dokumente studiert und mich mit der Abhandlung „Bescheidener Vorschlag zur Lösung der Eurokrise“ und deinem Buch „And The Weak Suffer What They Must?” auseinandergesetzt. Ich habe bei deinen vielen Internet-Video-Auftritten genau hingehört. So habe ich dich erfahren können als einen großartigen, überzeugenden, ja charismatischen Redner und Diskussionspartner. Nun hat mich meine Lebenserfahrung gelehrt, in so einem Fall besonders aufzupassen und das spontan Begeisternde zu verifizieren. Jedenfalls löste die Beschäftigung mit dir und DIEM25 bei mir einen inneren Aufruhr aus. Früher Erlebtes passte nicht mit rationalen Überlegungen zusammen; verdrängte Enttäuschungen drängten an die Oberfläche, forderten Widerstand und aktive Opposition ein. Mein Alter von 68 war keine Ausrede mehr, im Gegenteil.
1 Ich, meine Zeit und die Bestie des Nationalismus
1967 warst du sechs Jahre alt, als du die damalige neofaschistische, griechische Militärdiktatur miterlebtest. Ihr musstet euch unter einer rote Decke verkriechen, um die Deutsche Welle im Radio zu hören (du berichtest davon im Vorwort von „And The Weak …“). In jener Zeit sammelte ich bereits Erfahrungen über Politik und Gesellschaft als Aktivist in der 68er Studentenbewegung. Während du in deinem Elternhaus als Bewunderer Willy Brandts und der deutschen Sozialdemokratie aufwuchst, beteiligte ich mich an der Entlarvung alter Nazi-Netzwerke und der Enttarnung von Seilschaften ehemaliger NS Parteigenossen, die sich immer noch gegenseitig deckten. Selbst heute noch siehst du in der Bretton Woods-Nachkriegsperiode mit ihrem US Gold- und Dollarstandard „die goldene Zeit des Kapitalismus“ und einen “einzigartigen Moment in der Menschheitsgeschichte“.1
1.1 Ein einzigartiger Moment in der Menschheitsgeschichte?
Für meine Generation stellte sich die Nachkriegsperiode als die Zeit eines weltweiten US-amerikanischen Coca-Cola Imperialismus dar. Im Schlepptau der einzigen westlichen Supermacht wurde Westdeutschland als der zukünftige, dankbare und gehorsame transatlantische Juniorpartner aufgebaut.
Im Zweiten Weltkrieg gerieten die imperialistischen Weltmächte zum zweiten Mal aneinander. Die Karten globaler Machtverteilung, internationaler Blockbildungen und ökonomischer Hegemonie wurden neu gemischt. Dieser zerstörerische Machtkampf löschte alles aus, was Gesellschaften zum Leben benötigen - die Produktionsstätten, die Industriestandorte, die Infrastruktur und Abermillionen von Arbeitskräften. In den meisten Ländern hatte der Krieg das soziale und ökonomische Leben zum Erliegen gebracht. Deutschland war ausradiert. Ökonomisch betrachtet war der Weltkrieg ultima ratio und tabula rasa des kapitalistischen Systems. Es konnte gar nicht anders kommen, als dass die Nachkriegsperiode in einem zerstörten Europa zu einer Zeit des Wiederaufbaus, des Wachstums und der Prosperität wurde. Der Neustart des Kapitalismus nach dem Weltkrieg konnte sich nur als ein Aufblühen gestalten.
Aber war er deshalb ein „einzigartiger Moment in der Menschheitsgeschichte?“ Nein, lieber Yanis! Eher ist das Gegenteil der Fall: eine sehr traurige, schmachvolle Zeit der Geschichte, mit kriegstraumatisierten, hungernden Menschen, die versuchten, die Gräuel des Krieges hinter sich zu lassen, so viele Männer tot oder in Kriegsgefangenschaft. Überall entwickelten gerade die Frauen einen zähen Überlebenswillen für sich und ihre Familien. Das gilt auch im besonderen Maße für die deutschen Trümmerfrauen. Mein eigener Vater starb nach der Kriegsrückkehr an schweren Kriegsverwundungen und musste seine Frau mit ihrem kleinen Sohn allein lassen – das war ich. So war die Lage überall in Europa oder auch in Japan. Unabhängig von der Kriegsschuldfrage erhob sich die Nachkriegsperiode aus den Militärfriedhöfen des Zweiten Weltkriegs, dem Holocaust, aus den Atombomben „Little Boy“ und „Fat Man“, die Hiroshima und Nagasaki ausradierten, oder aus dem gegenseitigen Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung in überfüllten Städten.
In Westdeutschland wurden die 50er und 60er Jahre zur sogenannten „Wirtschaftswunderzeit“. Die Wirtschaftsbosse der Vorkriegszeit waren wieder am Ruder – bis auf einzelne, in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Verurteilte. Die wirtschaftliche Machtelite wurde nach wie vor durch die wieder zugelassenen Kohle- und Stahlkonzerne, die zunächst entflochtenen, monopolistischen Chemiegiganten und die traditionellen, systemisch unverzichtbaren Universalgroßbanken geprägt. Ihre politischen Parteigänger und Beauftragten gruppierten sich nun um eine westlich-demokratische Verfassung und organisierten sich in neuen, passenden Parteien, die aber alle alte Wurzeln hatten.
Der NS Größenwahn hatte völligen Schiffbruch erlitten. Der alte nationalistische Geist, diese Ideologie deutscher Anmaßung war jedoch keineswegs überwunden. Versteckt hinter westlicher, demokratischer Modernität überlebte ein deutscher Anspruch auf naturgegebene Führerschaft aus angeborener Überlegenheit mehr oder weniger unbeschadet und wartete auf „bessere Zeiten“. Andererseits standen in den siegreichen Ländern Nationalstolz und Hurra-Patriotismus in voller Blüte. Ihre Verachtung für Deutschland und der Befriedigung darüber, diesen gefährlichen Mitspieler auf der ökonomischen Weltbühne niedergerungen zu haben, vereinte sie allerdings nur vorübergehend und oberflächlich.
1.2 Die Nachkriegsperiode
Die Nachkriegskonzepte für ein vereintes Europa standen in der Kontinuität ihrer nur den Gegebenheiten angepassten Vorläufer. Europastrategien waren nicht neu, im Gegenteil. Das wichtigste Kriegsziel Nazideutschlands bestand in der Errichtung einer sogenannten kontinentaleuropäischen Großraumwirtschaft unter der Führung eines Großdeutschen Reiches. In dieser wirtschaftlichen und politischen Blockbildung sahen die Nazis auch ihre globale Positionierung im Kampf um Welthegemonie. Solche europäischen Blockbildungspläne bestanden nach dem Krieg fort, auch wenn sich ihre strategische Ausrichtung wandelte. Nach neuer Lesart diente ein vereintes Europa der westeuropäischen ökonomischen und politischen Integration unter US-amerikanischer Schirmherrschaft. Genauer ausgedrückt, man wurde Bestandteil der Bretton Woods-Welt des Dollars. Darüber hinaus spielte dieses neue Europa eine zentrale Rolle als Bollwerk des kapitalistischen Westens im Kalten Krieg gegen den östlichen Sowjetblock. Die deutschen Staaten beiderseits des Eisernen Vorhanges wurden schon bald zu einem ernsthaften Faktor in den Machtkämpfen des Kalten Krieges.
Und so ging die westeuropäische Integration auf eine Weise vonstatten, wie du, Yanis, sie in deinem Buch analysiert hast. Was aber konnte man damals und was kann man heute von diesem alten Europa erwarten? Wir allen kennen die Geschichte Europas zumindest in ihren groben Umrissen und da offenbart sich eine unerfreuliche Realität: Jahrhunderte blutiger Kriege; wieder und wieder gingen die verschiedenen Völker Europas aufeinander los, töteten sich gegenseitig und hassten sich leidenschaftlich. Sie eroberten, unterdrückten und zerrissen sich gegenseitig ihre Länder im Namen von Religion, Kultur, Sprache, Revolution, Vater- und Heimatland oder alter historischer Ansprüche. Alles das kulminierte in zwei monströsen Weltkriegen. Die Massen der einfachen Bevölkerung auf allen Seiten mussten die Zeche mit unsäglicher Not, Elend und unvorstellbarem Blutzoll zahlen. Ihnen wurde schon vorher ununterbrochen nationalistisches Misstrauen eingeimpft. Sie wurden angeblich zum Besten ihres jeweiligen Nationalstaates gegeneinander aufgehetzt. Nationale Wunden heilen nur langsam und die Narben der Geschichte schmerzen noch eine lange Zeit. In dieser Hinsicht sind die 75 Jahre seit dem Weltkrieg eine recht kurze Zeitspanne. In Zeiten des Wohlstandes präsentiert sich die Welt vernünftig und freundlich. Sollten jedoch die ökonomische Situation kritisch und die politische Lage angespannt werden, zeigt sich, wie dünn doch das Eis zivilisierter Einheit und gegenseitiger Wertschätzung sind. Es bricht schnell ein und die Bestie des Nationalismus und gegenseitiger Verachtung erscheint wieder an der Oberfläche. Genau so etwas spielt sich gerade in Europa ab. Es wäre naiv, diese historischen Erfahrungen und Prägungen zu ignorieren, die tief im kollektiven Unterbewusstsein der europäischen Völker gespeichert sind. Immer wieder folgte man gehorsam, wenn auch oft widerwillig oder niedergeschlagen, „dem Ruf des Vaterlandes“, in Wahrheit aber nur Königen und Päpsten, Kaisern und Faschistenparteien, Zentralkomitees und Präsidenten in ihre Kriege um Herrschaft, Reiche und Nationalstaaten.
1.3 Das verlogene, nationale “WIR”
Was also vernebelt heute wieder in steigendem Maße Gemüt und Denkweise vieler normaler Leute? Was bringt sie dazu, ihresgleichen aus benachbarten Ländern zu misstrauen oder gegen Menschen anzukämpfen, die als verzweifelte Flüchtlinge zu uns kommen? Was lässt sie selbstsüchtig und herzlos werden, überall in Europa Rechtsextremisten unterstützen und Populisten und Demagogen des rechten Lagers hochzuspülen? In den Jahrhunderten vor der Globalisierung erlebten die Generationen der Menschen im Schnitt zwei Kriege mit. Schreckliche und brutale Kriegserlebnisse verzerrten sich zu tiefsitzendem Nationalismus. Das machte es für nationalistisch indoktrinierte europäische Bevölkerungen sehr schwer einzusehen, dass sie sich vor fremde Kriegskarren hatten spannen lassen. Sie konnten sich nur schwer eingestehen, dass sie nicht für ihre eigenen Interessen marschiert waren, sondern von herrschenden Klassen für deren Konkurrenz- und Machtkämpfe und Hegemoniestreben ausgenutzt worden waren.
Die einfachen Leute misstrauen gewöhnlich „denen da oben“. Sie sind aus Erfahrung misstrauisch gegen das, was ihnen von der wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Elite vorgesetzt wird. Dennoch schafft es diese Spitzengruppierung immer wieder, die Mehrheit auf ein engstirniges, kollektives, nationales „Wir“ festzulegen (WIR Briten, WIR Deutschen, WIR Franzosen, Griechen, Dänen, …). Es gelingt, die Menschen zu verwirren und zu verunsichern. Sie reagieren mit Misstrauen nach allen Seiten und suchen Sicherheit in ihrer jeweiligen nationalen Schale. Die Briten haben immer wieder mit einem Rückzug in die „splendid isolation“ das klassische Beispiel geliefert. Andererseits zeigte englische, nationale Empfindlichkeit mehrmals in der Geschichte seismographisch gefährliche Machtkonzentrationen auf dem Kontinent an. Der Brexit (er fand zeitgleich zu diesem Essay statt) scheint in dieser Beziehung die neueste Warnung zu sein. Zugleich ist er Anschauungsunterricht dafür, wie ein anmaßendes, nationales „WIR“ ein Land ruinieren kann.
Immer aber strebte man überall in den Bevölkerungen auch nach Frieden und guter Nachbarschaft. Es gab immer internationale Solidarität mit anderen Völkern, die für ihre Rechte kämpften. Die Geschichte kennt immer wieder bewundernswerte Beispiele des intellektuellen, politischen und bewaffneten Widerstandes gegen alle Arten von Unterdrückung, Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Dabei kam es regelmäßig darauf an, so deutlich wie möglich Freund und Feind auseinander zu halten, denn diese Grenzziehung entschied letztlich immer zwischen Sieg und Niederlage. Man muss sich vor Augen halten, dass viele, vielleicht sogar die meisten der Befreiungsbewegungen, Rebellionen und Aufstände in der Geschichte durch falsche Freunde zu Fall gebracht wurden, dass sie von innen heraus besiegt wurden. In modernen Zeiten ist es mehr denn je das allumfassende, nationalistische „WIR“, das mehr als alles andere den Blick für falsche Freunde trübt. Das verlogene „WIR“ täuscht gesellschaftliche Einheit unter Gleichen vor. Es kann aber keine nationale Gemeinschaft zwischen kapitalistischen Arbeitgebern und angekauften Arbeitnehmern, zwischen Finanzeliten und besitzlosen Bevölkerungen geben. Es wird niemals Gleichheit herrschen zwischen Werte verschwendenden Oberklassen und den Werte schaffenden arbeitenden Bevölkerungen.