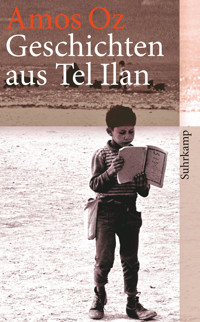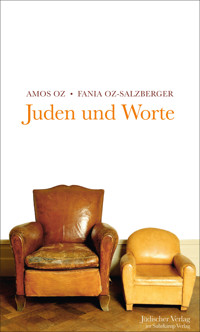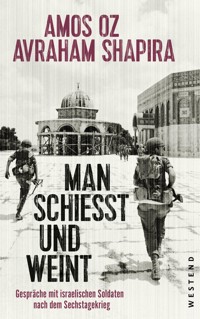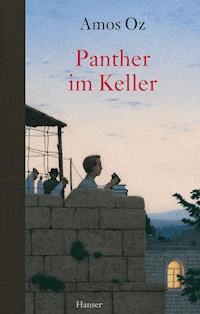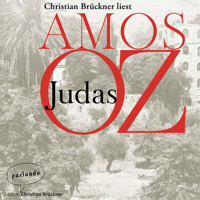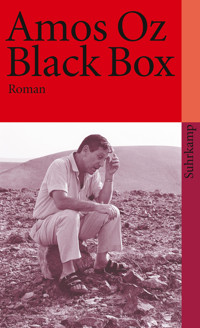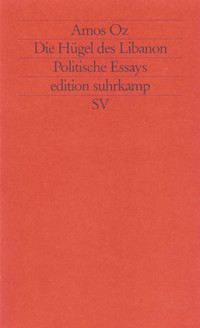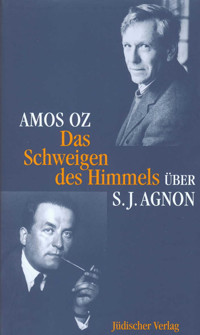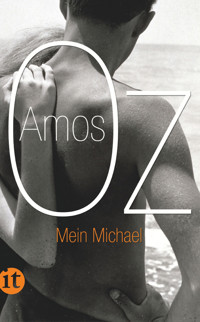
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hannah Gonen, 30 Jahre alt, trennt sich nach zehn Jahren Ehe von ihrem Mann Michael. Als Studentin hat sie den Geologen kennengelernt, sich in ihn verliebt. Sie hat für ihre Liebe ihr Studium aufgegeben, Mann und Kind ernährt, den Widerstand von Michaels Verwandtschaft ertragen – und seine Lieblosigkeit. Hannah erinnert sich, resümiert Stück für Stück eine Ehe, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Mit der Hoffnung, den Glauben an die Liebe nicht verloren zu haben. Amos Oz’ Roman erzählt nicht nur von einer Ehe, die nicht gutgehen konnte, sein Buch ist auch ein Stück israelische Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hannah Gonen, 30 Jahre alt, trennt sich nach zehn Jahren Ehe von ihrem Mann Michael. Als Studentin hat sie den Geologen kennengelernt, sich in ihn verliebt. Sie hat für ihre Liebe ihr Studium aufgegeben, Mann und Kind ernährt, den Widerstand von Michaels Verwandtschaft ertragen – und seine Lieblosigkeit. Hannah erinnert sich, resümiert Stück für Stück eine Ehe, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Mit der Hoffnung, den Glauben an die Liebe nicht verloren zu haben.
Amos Oz’ Roman erzählt nicht nur von einer Ehe, die nicht gutgehen konnte, sein Buch ist auch ein Stück israelische Geschichte.
Amos Oz, geboren 1939 in Jerusalem, ist einer der wichtigsten israelischen Schriftsteller unserer Tage. Das vielfach übersetzte und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag, u. a. liegen vor: Ein anderer Ort, Der perfekte Frieden, Black Box, Eine Frau erkennen, Der dritte Zustand, Nenn die Nacht nicht Nacht, Eine Geschichte von Liebe und Finsternis und zuletzt Geschichten aus Tel Ilan. 2008 erhielt er den Heine-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf, 2010 wurde ihm der Siegfried Unseld Preis verliehen.
Amos Oz
Mein Michael
Roman
Aus dem Englischen von Gisela Podlech-Reisse
Insel Verlag
Umschlagfoto: Fratelli Alinari, Florenz / Vincenzo Balocchi, »Il primo amore«
Das Vorwort wurde für die vorliegende Ausgabe von Ursula Gräfe übersetzt.
eBook Insel Verlag Berlin 2012
Insel Verlag Berlin 2011
Copyright © Amos Oz 1968
© der deutschen Übersetzung Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1989
© der vorliegenden Ausgabe Insel Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München www.hildendesign.de
eISBN 978-3-458-73165-8
www.insel-verlag.de
Vierzig Jahre später
Der Roman Mein Michael ist durchgehend aus der Ich-Perspektive einer Frau erzählt. Als ich ihn schrieb, war ich etwa sechsundzwanzig Jahre alt und überzeugt, alles zu wissen, was es über Frauen zu wissen gibt. Heute würde ich es nicht mehr wagen, einen ganzen Roman aus der Sicht einer Frau zu verfassen.
Nach dem Erscheinen des Buches erhielt ich zahlreiche Briefe, in denen erstaunte Frauen mich fragten: »Wie konnten Sie das wissen?« Ich bekam auch viele andere Briefe von Frauen, in denen sie mich für meine völlige Unkenntnis tadelten. Welche von ihnen recht hatten, werde ich wohl nie erfahren.
Um die Wahrheit zu sagen, ich schrieb Mein Michael beinahe unter Zwang. Die Figur der Hannah ergriff so stark von mir Besitz, daß ich begann, wie sie zu sprechen, nachts wurden ihre Träume zu meinen. Dabei ist sie keineswegs einer realen Person nachempfunden. Überhaupt nicht. Sie kam, woher auch immer sie kam, gelangte in mein Inneres und ließ mich nicht mehr los. Mehrere Monate widerstand ich ihr und schrieb nicht eine Zeile – wer war ich, über die Liebe, die Ehe und die Desillusionierung einer jungen Frau aus Jerusalem zu schreiben, die zehn Jahre älter war als ich? Hannah brachte ihren Michael, ihre und seine Eltern, ihren Sohn und ihre Nachbarn, eigentlich die ganze Nachbarschaft, ihr gesamtes Jerusalem und auch die arabischen Zwillinge aus ihren Träumen in mein Leben. Um sie loszuwerden und zu meinem Leben zurückkehren zu können, mußte ich das Buch in Angriff nehmen. Damals lebte ich als Kibbuznik in Hulda, und meine Zeit war in Unterrichten und Feldarbeit aufgeteilt. Mein Leben spielte sich also weit entfernt von Hannah Gonen ab, von ihrer gescheiterten Liebe und ihrem trostlosen Jerusalem.
Ich glaubte nicht, daß ich das Buch zu Ende schreiben würde. Wahrscheinlich würde ich ein paar Seiten über Hannah schreiben, vielleicht eine Kurzgeschichte und mich so von ihr befreien. Ich war weder an ihr noch ihrem Ehegelübde interessiert und schon gar nicht an ihren geheimen Phantasien, die mir besonders widerstrebten.
1965, noch vor dem Erscheinen meines ersten Romans Ein anderer Ort, begann ich mit dem Buch. Anfangs schrieb ich nur donnerstags (der Kibbuz gewährte mir in jenem Jahr einen Wochentag für meine literarischen Versuche). Doch bald zwang mich Hannah, jeden Tag an ihrer Geschichte zu arbeiten. Nily, unsere beiden Töchter und ich lebten damals in winzigen anderthalb Räumen neben der Kibbuz-Verwaltung und gegenüber der Bushaltestelle. Ich kam abends nach Hause, duschte und verbrachte den Abend mit meiner Familie. Wenn Nily und die Mädchen schlafen gegangen waren, schrieb ich noch zwei oder drei Stunden bis in die Nacht. Da ich kein Arbeitszimmer hatte und ohne eine brennende Zigarette zwischen den Fingern nicht in der Lage war zu schreiben, Nily aber nicht bei Licht in einem verrauchten Zimmer schlafen konnte, schloß ich mich in das winzige Bad ein, das in etwa die Größe einer Flugzeugtoilette hatte. Ich setzte mich auf den heruntergeklappten Toilettendeckel und legte mir einen Band mit van-Gogh-Reproduktionen auf die Knie, den wir zur Hochzeit bekommen hatten. Ich schlug mein Schreibheft auf dem Kunstband auf, zündete mir eine Zigarette an und schrieb, was Hannah mir diktierte, bis mir gegen Mitternacht oder ein Uhr vor Müdigkeit und Kummer die Augen zufielen.
Wenn ich höre, daß Autoren weite Reisen zu atmosphärisch aufgeladenen Orten mit atemberaubenden Landschaften unternehmen, um sich inspirieren zu lassen, denke ich oft daran, daß ich den größten Teil von Mein Michael auf der Toilette geschrieben habe (was sich vielleicht darin widerspiegelt, daß der Roman tatsächlich zum größten Teil in einer winzigen, überfüllten, düsteren Jerusalemer Wohnung mit niedriger Decke spielt).
Ich sagte gerade, daß ich alles niederschrieb, was Hannah mir diktierte. Aber das ist nicht ganz korrekt. In Wahrheit kämpfte ich mit aller Macht gegen sie an. Mehr als einmal, sogar mehr als zweimal hörte ich mich zu ihr sagen: »Das paßt nicht. So etwas entspricht nicht deiner Natur. Das schreibe ich nicht.« Dann schimpfte sie: »Sag du mir nicht, was meiner Natur entspricht und was nicht. Halt den Mund und schreib.« Ich hielt dagegen: »Ich werde das nicht für dich schreiben. Tut mir leid. Geh zu jemand anderem. Zu einer Frau. Ich kann so was nicht schreiben. Ich bin keine Frau und keine Schriftstellerin.« Sie blieb unerbittlich: »Schreib, was ich dir sage, und misch dich nicht ein.« – »Aber ich bin nicht dein Sekretär. Du bist nur eine Figur in meinem Buch, nicht umgekehrt.« Wir fochten diese Auseinandersetzungen nachts aus, sie und ich. Mitunter ließ ich ihr ihren Willen, dann wieder weigerte ich mich nachzugeben. Bis heute weiß ich nicht, ob das Buch besser oder schlechter geworden wäre, wenn ich Hannah öfter oder vielleicht auch seltener nachgegeben hätte, als ich es tat.
Als ich das Buch im April 1967 – einen Monat vor Ausbruch des Sechs-Tage-Kriegs – beendet und mich endlich von Hannahs Tyrannei befreit hatte, setzte ich mich hin und las es. Sogleich überkamen mich starke Zweifel. Ich hatte einen Roman geschrieben, in dem niemand getötet und niemand betrogen wurde, eine vorhersehbare Chronik einer mißglückten Ehe – eine leicht hysterische Frau, ein einsamer Mann, ein altkluges Kind, schmuddelige Nachbarn und ein geteiltes Jerusalem, das freudlos, düster und unheimlich erschien. Überdies blies man sechs Wochen später den Schofar an der Westmauer und beschwor ein goldenes Jerusalem, welches das Gegenteil von Hannahs und Michaels Jerusalem war. Hätte ich das Buch nicht einen Monat vor diesem Krieg vollendet, wäre es sicher niemals fertig geworden.
Ich sagte mir: Dieses Buch wird nur eine kleine Gruppe von empfindsamen Lesern ansprechen, die bereit sind, sich auf einen Roman einzulassen, der eigentlich keine Handlung hat, dessen Helden keine sind und der in einer Stadt spielt – dem geteilten Jerusalem –, die nicht mehr existiert.
Bedrückten Herzens übergab ich das Manuskript einem Lektor des Verlags Am Oved. Er las es und sagte, bedauerlicherweise sei das Buch nicht verkäuflich. Die Leser seiner beliebten People’s Library würde es jedenfalls nicht ansprechen. Eigentlich, so sagte er, erinnere es ihn an einen Gedichtband – empfindsam geschrieben, aber nicht für eine allgemeine Leserschaft geeignet. Dann machte er einige Verbesserungsvorschläge: Zum Beispiel sollte Hannah Michael zumindest einmal betrügen. Oder – eine andere Alternative – Michael sollte sich als genialer Wissenschaftler erweisen und internationale Anerkennung erlangen. Oder die beiden könnten Jerusalem verlassen und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen, beispielsweise in einem Kibbuz? Und vielleicht wäre es auch besser, den Titel des Buches von Mein Michaelin Hannahs Tagebücher zu ändern? Warum überhaupt so ein altmodischer Name? Vielleicht sollte ich meine Erzählerin Noa nennen oder Ruthie? Doch auch wenn ich mich weigern würde, Veränderungen vorzunehmen, so sagte der Lektor, würde Am Oved sich dennoch herablassen, den Roman so zu veröffentlichen, wie er war. Er habe mir nur etwas Stoff zum Nachdenken und ein paar Anregungen geben wollen, wie ich etwas mehr Leben in meine trübe Geschichte bringen könne.
Mich begeisterten vor allem seine Worte »empfindsam geschrieben«, und ich teilte seine Ansicht, was die allgemeine Leserschaft anging. Der Verlag beabsichtigte, den Roman in einer sehr kleinen Auflage zu veröffentlichen, doch wegen einer Panne mit einem anderen Titel erschien Mein Michael erst im April 1968 in der Reihe People’s Library, fast ein Jahr, nachdem ich das Manuskript eingereicht hatte. Zu meiner Überraschung, der des Verlags und der der Handvoll enger Freunde, die das Manuskript gelesen hatte, wurde Mein Michael fast über Nacht zum Bestseller, gelesen von Männern und Frauen gleichermaßen. Fast 130 000 Exemplare wurden in Israel verkauft. Hunderttausende Leser kauften das Buch in den achtundzwanzig Sprachen, in die es übersetzt wurde. Weltweit ist es bisher in insgesamt zweiundsiebzig Ausgaben erschienen. Vielleicht stimmt es wirklich, daß einige Bücher so universell sind, gerade weil sie so provinziell und minimalistisch sind und damit Raum für vieles lassen. Vielleicht.
Hin und wieder kehre ich in Gedanken zurück zu Hannah Gonen und ihrem Mann Michael in ihrer düsteren Wohnung, denke an ihr trost- und ereignisloses Leben. Ich erinnere mich, wie Hannah mir damals in der Toilette im Kibbuz Hulda vom Elend ihrer Gefangenschaft, ihrer ungestillten Sehnsucht nach fernen Ländern, Großstädten voller Leben und weiten Ausblicken erzählte. Ich sehe sie am Fenster stehen und in die für sie unerreichbare Ferne schauen. Und ich sage zu ihr und zu mir: Hannah, nun bist du überall, in Japan, in Korea und in China, in Bulgarien, Finnland und Brasilien – ist es jetzt ein bißchen besser? Ich wünsche dir eine friedliche Reise, sage ich zu ihr. Und dann wende ich mich wieder dem zu, was ich gerade schreibe, so fern und doch nicht fern von ihr.
Arad 2008
Amos Oz
I
Ich schreibe dies nieder, weil Menschen, die ich geliebt habe, gestorben sind. Ich schreibe dies nieder, weil ich als junges Mädchen erfüllt war von der Kraft der Liebe und diese Kraft der Liebe nun stirbt. Ich will nicht sterben.
Ich bin 30 Jahre alt und eine verheiratete Frau. Mein Mann, der Geologe Dr. Michael Gonen, ist ein gutmütiger Mensch. Ich liebte ihn. Wir lernten uns vor zehn Jahren im Terra-Sancta-College kennen. Ich studierte damals im ersten Studienjahr an der Hebräischen Universität, als die Vorlesungen noch im Terra-Sancta-College stattfanden.
Und so lernten wir uns kennen:
An einem Wintertag um neun Uhr morgens rutschte ich beim Hinuntergehen auf der Treppe aus. Ein junger Unbekannter packte meinen Ellenbogen und fing mich auf. Seine Hand war kraftvoll und beherrscht. Ich sah kurze Finger mit flachen Nägeln. Blasse Finger mit weichem schwarzem Flaum auf den Knöcheln. Er machte einen Satz, um meinen Sturz zu verhindern; ich stützte mich auf seinen Arm, bis der Schmerz verging. Ich war hilflos, denn es ist irritierend, Fremden plötzlich vor die Füße zu fallen: forschende, neugierige Blicke und boshaftes Lächeln. Und ich war verlegen, weil die Hand des jungen Fremden breit und warm war. Während er mich hielt, konnte ich die Wärme seiner Finger durch den Ärmel des blauen Wollkleides spüren, das meine Mutter mir gestrickt hatte. Es war Winter in Jerusalem.
Er fragte, ob ich mich verletzt hätte.
Ich sagte, ich hätte mir wahrscheinlich den Knöchel verstaucht. Er sagte, das Wort »Knöchel« habe ihm schon immer gefallen. Er lächelte. Ein verlegenes Lächeln, das verlegen machte. Ich wurde rot. Ich lehnte auch nicht ab, als er mich bat, ihn in die Cafeteria im Parterre zu begleiten. Mein Bein schmerzte. Das Terra-Sancta-College ist ein christliches Kloster, das man nach dem 1948er Krieg leihweise der Hebräischen Universität überlassen hatte, nachdem die Gebäude auf dem Skopusberg nicht mehr zugänglich waren. Es ist ein kaltes Gebäude mit hohen, breiten Korridoren. Verwirrt folgte ich diesem jungen Fremden, der mich immer noch festhielt. Glücklich ging ich auf seine Worte ein. Ich brachte es nicht fertig, ihn direkt anzusehen und mir sein Gesicht näher anzuschauen. Ich ahnte mehr als ich sah, daß sein Gesicht länglich war und mager und dunkel.
»Setzen wir uns doch«, sagte er.
Wir setzten uns, wir sahen einander nicht an. Ohne zu fragen, was ich haben wolle, bestellte er zwei Tassen Kaffee. Ich liebte meinen verstorbenen Vater mehr als jeden anderen Mann auf der Welt. Als mein neuer Bekannter sich umsah, fiel mir auf, daß er kurzgeschorene Haare hatte und schlecht rasiert war. Er hatte dunkle Stoppeln, besonders unterm Kinn. Ich weiß nicht, warum mir dieses Detail wichtig schien, mich sogar für ihn einnahm. Ich mochte sein Lächeln und seine Finger, die mit einem Teelöffel spielten, als hätten sie ein Eigenleben. Und dem Löffel gefiel es, von ihnen gehalten zu werden. Ich spürte in meinen eigenen Fingern den leisen Wunsch, sein Kinn zu berühren, da, wo er schlecht rasiert war und wo die Stoppeln sprossen.
Er hieß Michael Gonen.
Er studierte Geologie im dritten Studienjahr. Er war in Holon geboren und aufgewachsen. »Es ist kalt in deinem Jerusalem.« »Meinem Jerusalem? Woher weißt du, daß ich aus Jerusalem bin?« Es tue ihm leid, sagte er, wenn er sich dieses eine Mal geirrt haben sollte, er glaube allerdings nicht, daß er sich irre. Er habe mittlerweile gelernt, die Einwohner Jerusalems auf den ersten Blick zu erkennen. Während er redete, sah er mir zum ersten Mal in die Augen. Seine Augen waren grau. Ich bemerkte ein amüsiertes Funkeln in ihnen, aber kein fröhliches Funkeln. Ich sagte ihm, er habe richtig geraten. Ich sei tatsächlich aus Jerusalem.
»Geraten? Keine Spur.«
Er bemühte sich, beleidigt auszusehen, doch seine Mundwinkel lächelten: nein, er habe nicht geraten. Er könne mir ansehen, daß ich aus Jerusalem sei. »Ansehen?« Lerne er das etwa in seinem Geologiekurs? Nein, natürlich nicht. Eigentlich habe er das von den Katzen gelernt. Von den Katzen? Ja, es mache ihm Spaß, Katzen zu beobachten. Eine Katze würde niemals mit jemandem Freundschaft schließen, der nichts für sie übrig habe. Katzen irrten sich nie in einem Menschen.
»Du scheinst ein glücklicher Mensch zu sein«, sagte ich übermütig. Ich lachte, und mein Lachen verriet mich.
Anschließend lud Michael Gonen mich ein, ihn in den dritten Stock des Terra-Sancta-College zu begleiten, wo ein paar Lehrfilme über das Tote Meer und die Arava-Senke gezeigt werden sollten.
Als wir auf dem Weg nach oben an der Stelle vorbeikamen, wo ich ausgerutscht war, griff Michael erneut nach meinem Ärmel. Als drohe Gefahr, daß ich noch einmal auf dieser Stufe ausrutschte. Durch die blaue Wolle hindurch konnte ich jeden einzelnen seiner fünf Finger spüren. Er hustete trocken, und ich schaute ihn an. Als er merkte, daß ich ihn ansah, wurde sein Gesicht purpurrot. Sogar seine Ohren liefen rot an. Der Regen klatschte gegen die Fensterscheiben.
»Was für ein Wolkenbruch!« sagte Michael.
»Ja, ein Wolkenbruch«, stimmte ich begeistert zu, als hätte ich plötzlich entdeckt, daß wir verwandt seien.
Michael zögerte. Dann fügte er hinzu:
»Ich habe heute früh den Nebel gesehen, und es war sehr windig.«
»Winter ist Winter in meinem Jerusalem«, erwiderte ich fröhlich, wobei ich »meinem Jerusalem« besonders betonte, um ihn an seine ersten Worte zu erinnern. Ich wollte, daß er weitersprach, doch ihm fiel keine Antwort darauf ein. Er ist nicht witzig. Also lächelte er wieder. An einem Regentag in Jerusalem im Terra-Sancta-College auf der Treppe zwischen dem ersten und dem zweiten Stockwerk. Ich habe es nicht vergessen.
In dem Film sahen wir, wie man Wasser zum Verdunsten bringt, bis das reine Salz erscheint: weiße Kristalle leuchten auf grauem Schlamm. Und die Minerale in den Kristallen wie feine Adern, sehr zart und spröde. Der graue Schlamm teilte sich langsam vor unseren Augen, denn dieser Lehrfilm zeigte die natürlichen Abläufe im Zeitraffer. Es war ein Stummfilm. Die Rouleaus waren heruntergezogen, um das Tageslicht abzuschirmen. Das Licht draußen war ohnehin nur schwach und trübe. Ein alter Dozent gab gelegentlich mit schleppender, klingender Stimme Kommentare und Erklärungen ab, die ich nicht verstand. Mir fiel die angenehme Stimme Dr. Rosenthals ein, der mich mit neun Jahren von einer Diphterie geheilt hatte. Hin und wieder hob der Dozent mit Hilfe eines Zeigestocks die wichtigeren Details der Bilder hervor, um zu verhindern, daß die Gedanken seiner Studenten abirrten. Nur ich konnte es mir leisten, Einzelheiten ohne jeden pädagogischen Wert zu entdecken, wie die kläglichen, aber entschlossenen Wüstenpflanzen, die immer wieder rund um die Pottasche erzeugenden Maschinen auf der Leinwand auftauchten. Beim matten Glanz der Laterna magica hatte ich außerdem Zeit, mir Gesicht, Arm und Zeigestock des altehrwürdigen Dozenten genau anzusehen. Er hatte Ähnlichkeit mit einem Bild aus einem der alten Bücher, die ich so liebte. Ich dachte dabei an die dunklen Holzschnitte in Moby Dick. Draußen donnerte es einige Male schwer und dröhnend. Der Regen schlug wütend gegen die verdunkelten Fenster, als fordere er uns auf, aufmerksam einer wichtigen Botschaft zu lauschen, deren Überbringer er war.
II
Mein verstorbener Vater pflegte oft zu sagen: Starke Menschen können fast alles tun, was sie wollen, aber selbst die stärksten können sich nicht aussuchen, was sie tun wollen. Ich bin nicht besonders stark.
Michael und ich verabredeten uns noch am selben Abend im Café Atara in der Ben-Yehuda-Straße. Draußen tobte ein wahrer Sturm, der wild gegen die steinernen Mauern Jerusalems schlug.
Die Notstandsgesetze waren noch in Kraft. Man brachte uns Ersatzkaffee und winzige Papiertütchen mit Zucker. Michael machte einen Scherz darüber, aber sein Scherz war nicht komisch. Er ist kein witziger Mann – und vielleicht konnte er ihn auch nicht richtig erzählen. Ich freute mich, daß er sich so anstrengte. Ich war froh, daß er sich mir zuliebe ein bißchen Mühe gab. Meinetwegen schlüpfte er aus seinem Kokon und versuchte, heiter und amüsant zu sein. Noch mit neun Jahren hatte ich den Wunsch, ein Mann zu werden statt einer Frau. Als Kind spielte ich lieber mit Jungen und las nur Jungenbücher. Ich balgte mich herum, teilte Fußtritte aus und machte Klettertouren. Wir lebten in Qiryat Shemuel, am Rande eines Vororts, der Katamon heißt. Dort gab es ein herrenloses Stück Land an einer Böschung, das von Felsbrocken, Disteln und Schrott bedeckt war, und am Fuße der Böschung stand das Haus der Zwillinge. Die Zwillinge waren Araber, Halil und Aziz, Rashid Shahadas Söhne. Ich war eine Prinzessin und sie meine Leibwächter, ich war ein Eroberer und sie meine Gefolgsleute, ich war ein Entdecker und sie meine Eingeborenenträger, ein Kapitän und sie meine Mannschaft, ein Meisterspion und sie meine Zuträger. Gemeinsam erforschten wir abgelegene Straßen, durchstreiften hungrig und atemlos die Wälder, hänselten orthodoxe Kinder, drangen heimlich in den Wald um das St.-Symeon-Kloster ein, beschimpften die britischen Polizisten. Jagten und flüchteten, versteckten uns und tauchten wieder auf. Ich herrschte über die Zwillinge. Es war ein kaltes Vergnügen, schon so fern.
Michael sagte:
»Du bist ein verschlossenes Mädchen, nicht?«
Nachdem wir unseren Kaffee ausgetrunken hatten, holte Michael eine Pfeife aus seiner Manteltasche und legte sie zwischen uns auf den Tisch. Ich trug braune Kordhosen und einen dicken, roten Pullover, wie ihn Studentinnen damals zu tragen pflegten, um lässig auszusehen. Michael bemerkte schüchtern, ich hätte morgens in dem blauen Wollkleid viel weiblicher gewirkt. Auf ihn zumindest.
»Du hast heute morgen auch anders ausgesehen«, sagte ich.
Michael trug einen grauen Mantel. Er behielt ihn die ganze Zeit über an, die wir im Café Atara saßen. Seine Wangen glühten von der bitteren Kälte draußen. Sein Körper war mager und eckig. Er griff nach seiner kalten Pfeife und zeichnete mit ihr Figuren auf das Tischtuch. Seine Finger, die mit der Pfeife spielten, stimmten mich friedlich. Vielleicht bereute er plötzlich seine Bemerkung über meine Kleidung. Als wolle er einen Fehler wiedergutmachen, sagte Michael, er fände, ich sei ein hübsches Mädchen. Während er das sagte, blickte er starr auf seine Pfeife. Ich bin nicht besonders stark, aber stärker als dieser junge Mann.
»Erzähl etwas von dir«, sagte ich.
Michael sagte:
»Ich habe nicht in der Palmach* gekämpft. Ich war bei der Nachrichtentruppe. Ich war Funker bei der Carmeli-Brigade.«
Dann begann er, von seinem Vater zu sprechen. Michaels Vater war Witwer. Er arbeitete bei den Wasserwerken der Stadtverwaltung Holon.
Rashid Shahada, der Vater der Zwillinge, war unter den Briten in der technischen Abteilung der Stadtverwaltung Jerusalems beschäftigt. Er war ein gebildeter Araber, der sich Fremden gegenüber wie ein Kellner benahm.
Michael erzählte mir, daß sein Vater den größten Teil seines Gehalts in seine Ausbildung stecke. Michael war ein Einzelkind, und sein Vater setzte große Hoffnungen in ihn. Er wollte nicht einsehen, daß sein Sohn ein gewöhnlicher junger Mann war. Er pflegte zum Beispiel voller Ehrfurcht die Aufsätze zu lesen, die Michael für sein Geologiestudium anfertigte, um sie dann in wohlgesetzter Rede mit Sätzen wie »Das ist sehr wissenschaftlich. Sehr gründlich« zu kommentieren. Seines Vaters größter Wunsch war es, daß Michael einmal Professor in Jerusalem würde, denn sein Großvater väterlicherseits hatte Naturwissenschaften am hebräischen Lehrerseminar in Grodno gelehrt. Er war sehr angesehen gewesen. Es wäre schön, dachte Michaels Vater, wenn sich diese Tradition von einer Generation zur anderen fortsetzen ließe.
»Eine Familie ist kein Staffellauf, in dem ein Beruf wie ein Staffelholz weitergegeben wird«, sagte ich.
»Meinem Vater kann ich das aber nicht sagen«, erwiderte Michael. »Er ist ein sentimentaler Mensch, der hebräische Ausdrücke benutzt wie zerbrechliche Teile eines kostbaren Porzellanservices. Erzähl’ mir jetzt was über deine Familie.«
Ich erzählte ihm, daß mein Vater 1943 gestorben sei. Er war ein schweigsamer Mensch. Er pflegte mit Leuten zu reden, als gelte es, sie zu beruhigen und eine Zuneigung zu verdienen, die er eigentlich nicht verdiente. Er hatte einen Laden, in dem er Rundfunkgeräte und elektrische Artikel verkaufte und reparierte. Seit seinem Tod lebte meine Mutter mit meinem älteren Bruder Emanuel in Kibbuz Nof Harim. »Abends sitzt sie mit Emanuel und seiner Frau Rina zusammen beim Tee und versucht, deren kleinem Sohn Manieren beizubringen, denn seine Eltern gehören einer Generation an, die gute Manieren verabscheut. Tagsüber schließt sie sich in einem kleinen Zimmer am Rande des Kibbuz ein und liest Turgenjew und Gorki auf russisch, schreibt mir Briefe in gebrochenem Hebräisch, strickt und hört Radio. Das blaue Kleid, das dir heute morgen so gut gefiel – meine Mutter hat es gestrickt.«
Michael lächelte.
»Deine Mutter und mein Vater würden sich vielleicht gern kennenlernen. Sie hätten sich bestimmt viel zu erzählen. Nicht so wie wir, Hannah – wir sitzen hier und reden über unsere Eltern. Langweilst du dich?«, fragte er besorgt, und während er fragte, zuckte er zusammen, als hätte er sich mit dieser Frage verletzt.
»Nein«, sagte ich. »Nein, ich langweile mich nicht. Mir gefällt es hier.«
Michael fragte, ob ich das nicht nur aus Höflichkeit gesagt habe. Ich bestand darauf. Ich bat ihn, mehr über seinen Vater zu erzählen. Ich sagte, mir gefiele die Art, wie er redete.
Michaels Vater war ein einfacher, bescheidener Mann. Seine Abende verbrachte er aus freien Stücken damit, den Holoner Arbeiterklub zu leiten. Zu leiten? Er stelle nur Bänke auf, lege Schriftstücke ab, vervielfältige Informationen, sammle nach den Sitzungen die Zigarettenkippen auf. Unsere Eltern würden sich vielleicht gern kennenlernen... Oh, das hatte er bereits gesagt. Er bat um Verzeihung, daß er sich wiederhole und mich langweile. Welches Fach hatte ich an der Universität belegt? Archäologie?
Ich erzählte ihm, daß ich in einem Zimmer bei einer orthodoxen Familie in Achvah wohnte. Vormittags arbeite ich als Erzieherin in Sarah Zeldins Kindergarten in Kerem Avraham. Nachmittags besuche ich Vorlesungen über hebräische Literatur. Aber ich sei erst im ersten Studienjahr.
»Studentenmädchen, kluges Mädchen.« Bemüht, witzig zu sein, und ängstlich darauf bedacht, Gesprächspausen zu vermeiden, suchte Michael bei einem Wortspiel Zuflucht. Doch die Pointe blieb unklar, und er suchte nach einem besseren Ausdruck. Unvermittelt hörte er auf zu reden und machte einen neuen wütenden Versuch, seine störrische Pfeife in Brand zu setzen. Seine Verlegenheit machte mir Spaß. Damals fühlte ich mich noch abgestoßen vom Anblick jener rauhen Männer, die meine Freundinnen damals anzubeten pflegten: bärenstarke Palmach-Männer, die sich mit einem Sturzbach trügerischer Freundlichkeiten auf einen stürzten; grobschlächtige Traktorfahrer, die staubbedeckt aus dem Negev kamen wie Mordbrenner, die die Frauen einer gefallenen Stadt mit sich schleppten. Ich liebte die Verlegenheit des Studenten Michael Gonen an dem Winterabend im Café Atara.
Ein berühmter Wissenschaftler betrat das Café in Begleitung zweier Frauen. Michael beugte sich vor und flüsterte mir seinen Namen ins Ohr. Fast hätten seine Lippen mein Haar gestreift. Ich sagte:
»Ich durchschaue dich. Ich kann deine Gedanken lesen. Du fragst dich: ›Was wird als nächstes passieren? Wie wird es weitergehen?‹ Hab ich recht?«
Michael errötete plötzlich wie ein Kind, das man beim Stehlen von Süßigkeiten erwischt.
»Ich habe noch nie eine feste Freundin gehabt.«
»Noch nie?«
Gedankenverloren schob Michael seine leere Tasse weg. Er sah mich an. Tief verborgen unter seiner Schüchternheit lauerte versteckter Spott in seinen Augen.
»Bis jetzt!«
Eine Viertelstunde später verließ der berühmte Wissenschaftler mit einer der beiden Frauen das Café. Ihre Freundin setzte sich an einen Tisch in einer Ecke und zündete sich eine Zigarette an. Ihr Gesichtsausdruck war bitter.
Michael meinte:
»Die Frau ist eifersüchtig.«
»Auf uns?«
»Auf dich vielleicht.« Das war ein Rückzugsversuch. Er fühlte sich unbehaglich, weil er sich zu sehr anstrengte. Wenn ich ihm nur sagen könnte, daß ich ihm seine Anstrengungen hoch anrechnete. Daß ich seine Finger faszinierend fand. Ich konnte nicht sprechen, hatte aber Angst davor, zu schweigen. Ich sagte Michael, daß es mir Spaß mache, die Berühmtheiten Jerusalems, die Schriftsteller und Gelehrten kennenzulernen. Das Interesse an ihnen hatte ich von meinem Vater. Als ich klein war, pflegte er sie mir auf der Straße zu zeigen. Mein Vater war vernarrt in den Ausdruck »weltberühmt«. Aufgeregt flüsterte er mir zu, daß irgendein Professor, der gerade in einem Blumengeschäft verschwand, weltberühmt sei oder daß ein mit Einkäufen beschäftigter Mann internationales Ansehen genösse. Und ich sah dann einen winzigkleinen, alten Mann, der sich wie ein Wanderer in einer fremden Stadt vorsichtig seinen Weg ertastete. Als wir in der Schule das Buch der Propheten lasen, stellte ich mir die Propheten wie die Schriftsteller und Gelehrten vor, die mir mein Vater gezeigt hatte: Männer mit feingeschnittenen Gesichtern, Brillen auf den Nasen, mit sorgfältig gestutzten, weißen Bärten, der Gang ängstlich und zögernd, als hätten sie den steilen Hang eines Gletschers zu bewältigen. Und wenn ich mir auszumalen versuchte, wie diese gebrechlichen alten Männer über die Sünden der Menschheit zu Gericht saßen, mußte ich lächeln. Ich stellte mir vor, daß ihre Stimmen auf dem Höhepunkt ihrer Empörung versagen müßten und sie nur noch einen schrillen Schrei ausstoßen würden. Wenn ein Schriftsteller oder Universitätsprofessor seinen Laden in der Yafo-Straße betrat, kam mein Vater nach Hause, als hätte er eine Vision gehabt. Er wiederholte feierlich beiläufige Bemerkungen, die sie hatten fallenlassen, und nahm jede ihrer Äußerungen unter die Lupe, als seien es seltene Münzen. Er vermutete stets eine versteckte Bedeutung hinter ihren Worten, denn er betrachtete das Leben als eine Lektion, aus der man seine Lehren ziehen mußte. Er war ein aufmerksamer Mann. Einmal nahm mein Vater mich und meinen Bruder Emanuel an einem Samstagvormittag mit ins Tel-Or-Kino, wo Martin Buber und Hugo Bergmann auf einer pazifistischen Veranstaltung sprechen sollten. Ich erinnere mich noch gut an einen eigenartigen Zwischenfall. Als wir den Saal verließen, blieb Professor Bergmann vor meinem Vater stehen und sagte: »Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, Sie heute in unserer Mitte anzutreffen, verehrter Dr. Liebermann. Ich bitte um Entschuldigung – Sie sind nicht Professor Liebermann? Aber ich bin sicher, daß wir uns kennen. Ihr Gesicht, mein Herr, ist mir sehr vertraut.« Vater stotterte. Er erbleichte, als sei er einer schweren Tat verdächtigt worden. Auch der Professor war verwirrt und entschuldigte sich für seinen Irrtum. Vielleicht war es seiner Verlegenheit zuzuschreiben, daß der Wissenschaftler meine Schulter berührte und sagte: »Wie dem auch sei, verehrter Herr, Ihre Tochter – Ihre Tochter? – ist ein sehr hübsches Mädchen.« Und unter seinem Schnurrbärtchen breitete sich ein sanftes Lächeln aus. Mein Vater vergaß diesen Zwischenfall bis zu seinem Tode nicht. Er pflegte ihn immer voller Aufregung und Freude zu erzählen. Selbst wenn er, in einen Morgenmantel gehüllt, die Brille hoch in die Stirn geschoben und mit müde herabhängenden Mundwinkeln in seinem Sessel saß, erweckte mein Vater den Eindruck, als lausche er stumm der Stimme einer geheimen Macht. »Und weißt du, Michael, auch heute noch denke ich manchmal, daß ich einmal einen jungen Gelehrten heiraten werde, dem es bestimmt ist, weltberühmt zu werden. Beim Licht seiner Leselampe wird das Gesicht meines Mannes über Stapeln von alten deutschen Folianten schweben. Ich schleiche auf Zehenspitzen herein, stelle eine Tasse Tee auf den Schreibtisch, leere den Aschenbecher und schließe leise die Fensterläden, dann gehe ich wieder, ohne daß er mich bemerkt hätte. Jetzt lachst du mich sicher aus.«
* Palmach: Kampftruppe der jüdischen Verteidigungsorganisation Hagana, gegründet während der britischen Mandatszeit und später aufgelöst.
III
Zehn Uhr.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!