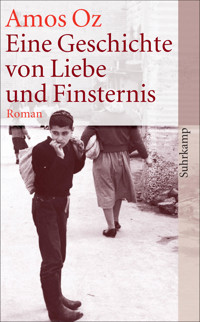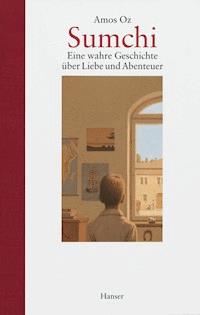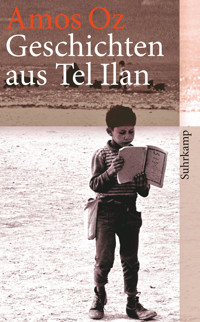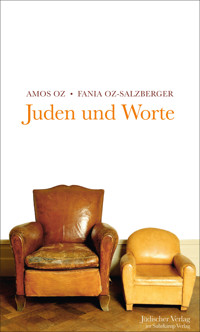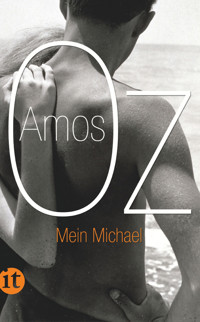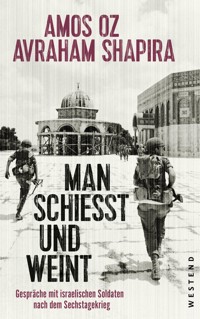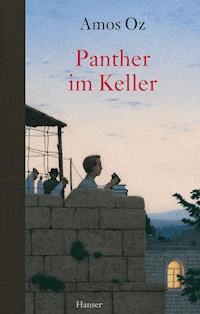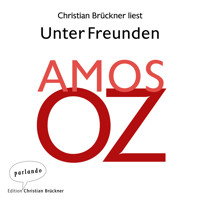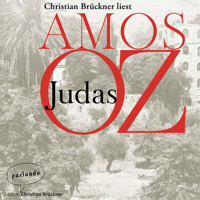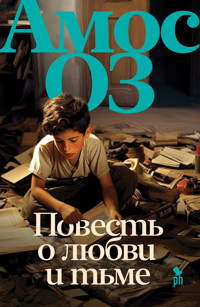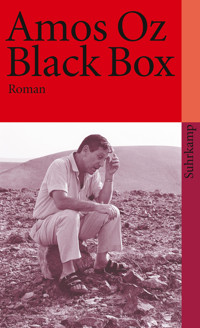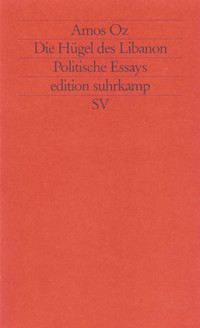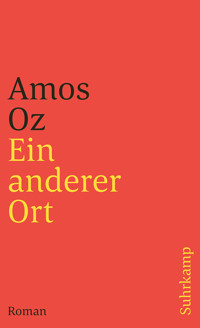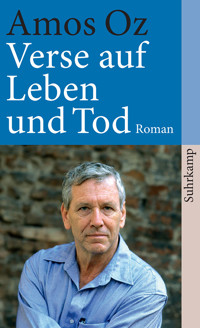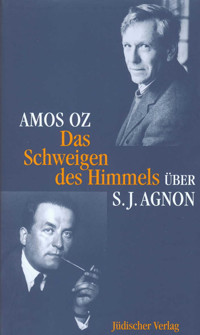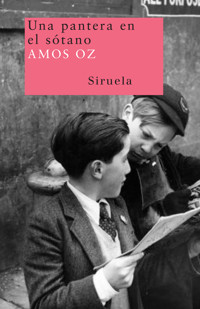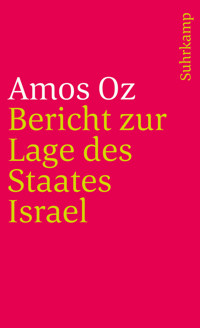
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die beiden im vorliegenden Band versammelten Texte aus den Jahren 1990 und 1991 präsentieren diese beiden Dimensionen des Autors Amos Oz, und sie machen zugleich deutlich, daß er zwischen beiden strikt unterscheidet: Wenn er mit sich selbst in Übereinstimmung sei, so Amos Oz, greife er in die politische Situation ein. Ziel seines politischen Engagements: Er kämpft für eine Zweistaatenlösung in Palästina, mit einem souveränen Israel und einem eigenen Staat für die Palästinenser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Amos Oz Bericht zur Lage des Staates Israel
suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 4. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 2192
© Amos Oz 1990, 1991
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 1992
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-78506-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
Brief aus Arad
Bericht zur Lage des Staates Israel
Brief aus Arad
3. Mai 1990
Hier in Israel genießen die Schriftsteller – oder soll ich lieber sagen, sie leiden darunter? – fast die soziale Stellung, die in anderen Ländern die Filmstars haben. Das ist eine jüdische und osteuropäische Tradition zugleich. Uns Schriftsteller betrachtet man als eine Art Propheten, obwohl wir natürlich nicht liefern können, was man von uns erwartet. Wir sollen die Antwort haben. Israel ist wahrscheinlich das einzige Land in der Welt, in dem eine führende Tageszeitung in einem Leitartikel mit einem Romanhelden polemisiert, weil dieser sich zu einer unpassenden Zeit in einen Araber verliebt hat. Wohlgemerkt in einem Leitartikel, nicht in der Literaturbeilage.
Israel ist ein Land, in dem es häufig vorkommt, daß der Ministerpräsident einen Dichter oder Schriftsteller zu einem spätnächtlichen, intimen Tête-à-tête einlädt, um zusammen mit ihm eine tiefe Gewissensprüfung vorzunehmen. Ich habe so etwas schon öfters mitgemacht. Der Ministerpräsident fragt dann den Schriftsteller, wo die Nation entgleist sei und wie es denn weitergehen solle. Er bewundert die Antworten des Schriftstellers und mißachtet sie selbstverständlich. Um realistisch zu bleiben: Es ist nicht so, daß Dichter und Schriftsteller einen großen Einfluß auf Politiker hätten. Israel ist das Land der Propheten, aber selbst die waren nicht besonders erfolgreich, was die Beeinflussung der Politiker betrifft. So wäre es unrealistisch, von uns Schriftstellern zu erwarten, wir sollten sogar besser sein als die Propheten.
Dennoch, die Schriftsteller sind präsent, sie haben eine gewisse Bedeutung, man achtet darauf, was sie sagen. Wenn ich morgen eine Erklärung über den Zustand der israelischen Straßen abgebe, wird das in allen Zeitungen ein Thema sein. Warum? Bin ich etwa ein Experte für den Straßenbau? Für das Transportwesen? Nein, nur weil es ein Schriftsteller gesagt hat. Jeder kennt hier die Namen der bedeutenderen Schriftsteller, und es ist sehr wahrscheinlich, daß ein Taxifahrer deine Bücher gelesen hat.
Die Bewegung »Peace Now«, der auch ich angehöre, ist keine Partei, eher eine »Stimmung«, sie wächst und schrumpft mit der Aktualität. Wenn es eine unmittelbare Aussicht auf Frieden gibt, dann wird »Peace Now« aktiv, dann machen wir Versammlungen und Demonstrationen, und man hört von uns im ganzen Land. Auch wenn die Gefahr eines Krieges droht, werden wir lebendig. Und zwischendurch gibt es ein kleines Ein-Zimmer-Büro in Jerusalem, mit einer Teilzeitkraft. Wir haben keine Mitgliederlisten, keine gewählte Führung. »Peace Now« ist ein Sammelbecken, das linke Radikale, Liberale der Mitte, konventionelle Zionisten, religiöse Leute und all die vereinigt, die der Meinung sind, daß Israel niemals versuchen sollte, die besetzten Gebiete zu annektieren. Auch dann nicht, wenn plötzlich, über Nacht, die arabischen Länder entdeckten, daß sie tief in ihren Herzen eigentlich Zionisten sind, und diese Gebiete uns auf einem silbernen Tablett als Geschenk präsentieren würden: Nehmt sie, sie gehören euch. Selbst dann sollten wir sagen: Nein danke, denn diese Gebiete sind dicht mit menschlichen Wesen besiedelt, die keine Israelis sein wollen. Und es hat keinen Sinn, das Israeli-Sein Leuten aufzuzwingen, die nichts davon wissen wollen.
Es ist in unserer Bewegung noch eine andere Sensibilität vorhanden: Wir sind nur dann bereit, einen umfassenden Krieg zu führen, wenn die Existenz der Nation auf dem Spiel steht. Nichts außer der Bedrohung der Existenz Israels rechtfertigt einen umfassenden Krieg. Natürlich gibt es eine Diskussion darüber, wie die jeweilige Gefahr einzuschätzen sei, die Israel droht, und darüber, was die Existenz Israels bedroht. Aber es gibt keine Diskussion darüber, daß die Kriege, die wir 1948, 1967 und 1973 geführt haben, Kriege auf Leben und Tod waren. Hätten wir sie verloren, gäbe es heute kein Israel. Der Libanonkrieg dagegen war optional. Begin, der damals Ministerpräsident war, hat den Begriff der optionalen Kriege eingeführt, im Gegensatz zu den Kriegen, die mit dem Rücken zur Wand ausgetragen werden. Auch die Falkenparteien und ihre Anhänger sind sich darüber einig, daß es im Libanonkrieg nicht um Leben und Tod ging. Sie sagen aber, vielleicht hätte mit der Zeit die Gefahr erheblich größer werden können und darum sei es dann doch richtig gewesen, den Krieg zu führen. Das freilich ist ein sehr windiges Argument, denn dann müßten wir auch gegen den Iran Krieg führen, der uns eines Tages auch sehr gefährlich werden könnte, und überhaupt müßte man gegen alle kämpfen, die sich wünschen, wir würden tot Umfallen.
»Peace Now« ist mit den europäischen Friedensbewegungen nicht vergleichbar. Wir sind »peaceniks«, aber keine Pazifisten. Gewiß waren alle an »Peace Now« Beteiligten irgendwann einmal auf dem Schlachtfeld, und wenn das denkbar Schlimmste passieren sollte und wir erneut mit dem Rücken an der Wand stehen sollten, dann werden wir wieder kämpfen. Und wir werden kämpfen wie die Teufel, wenn es um die Existenz Israels gehen sollte. Es gibt für uns keine Frage von »lieber rot als tot«. Es gibt diese westliche Einstellung von »make love not war« nicht. Es gibt auch die Tendenzen nicht, die es in der amerikanischen Friedensbewegung während des Vietnam-Krieges gegeben hat: die Vietcong als lauter gute Kerle zu feiern und sich selbst als die Bösen zu verdammen. Praktisch niemand ist in »Peace Now« der Meinung, daß im israelisch-arabischen Konflikt die Palästinenser die guten Kerle seien. Sie verdienen es, ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre nationale Unabhängigkeit zu erhalten, aber nicht als Orden für gutes Verhalten. Ich persönlich war nie der Ansicht, daß Unabhängigkeit etwas sei, was nur Leute verdienen, die sich anständig benehmen. Wenn das so wäre, müßte drei Vierteln der Menschheit die Unabhängigkeit für immer und ewig vorenthalten werden, Deutschland und Österreich vielleicht sogar für den Rest der Ewigkeit. Es tut mir leid, das sagen zu müssen.
Darum geht es aber nicht. Es geht um das Überleben, um das Überleben aller.
»Peace Now« ist also keine pro-palästinensische Bewegung. Sie ist keine »make-love-not-war«-Bewegung und keine pazifistische Bewegung. Sie ist ein Zusammenschluß von Leuten, die glauben, daß die Lösung unseres Konflikts mit den Palästinensern eine faire und nüchterne Scheidung sein muß, eine Scheidung wie nach einer gescheiterten Ehe. Scheidung bedeutet, daß wir die Wohnung teilen müssen. Und da dies ein kleines Land ist, müssen wir entscheiden, wer das eine und wer das andere Schlafzimmer bekommt und wie die Benutzungsordnung für die Toilette sein wird. Nach dieser Scheidung – und unter Scheidung verstehe ich die Gründung von zwei unabhängigen Staaten – wird es vielleicht möglich sein, miteinander eine Tasse Kaffee zu trinken. Vielleicht werden wir – nach geraumer Zeit – zusammen über die Vergangenheit lachen können. Vielleicht werden wir eines Tages sogar einen nahöstlichen gemeinsamen Markt, eine Art Konföderation gründen können. Aber es wird nicht möglich sein, gleich damit anzufangen. Die Berliner Mauer abzureißen und dann einander in die Arme zu fallen - so einfach ist es in unserem Lande nicht Hier geht es nicht um ein Volk, das durch eine Mauer getrennt ist. Hier handelt es sich um zwei Bevölkerungsgruppen, zwei Gemeinschaften, die siebzig Jahre lang das Blut voneinander vergossen haben, es gibt Mißtrauen, Frustrationen, und beide Gemeinschaften müssen eine Weile allein bleiben, zumindest fürs erste.
Es ist schwer zu sagen, wie groß der Einfluß von »Peace Now« in der Gesellschaft ist. Gewiß nicht marginal. Wenn wir einen Standpunkt öffentlich einnehmen, hat das keine unmittelbare politische Auswirkung. Aber das Auftauchen von »Peace Now« im Jahre 1978 hat es für Begin vielleicht erst möglich gemacht, den Friedensvertrag mit Ägypten zu unterzeichnen. Alles in allem repräsentiert »Peace Now« die Meinung von etwa der Hälfte der Bevölkerung.