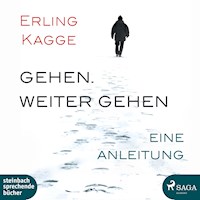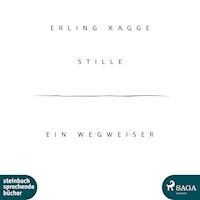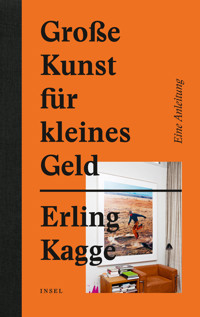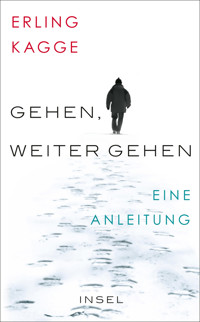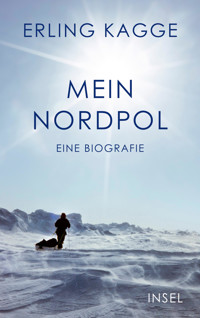
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erling Kagge hat seine eigene Biografie des Nordpols verfasst. Es ist eine höchst persönliche, philosophische, klimapolitische, lehrreiche – und vor allem spannende – Annäherung an den einen unvergleichlichen Ort.
Zum siebten Geburtstag bekam Erling von seinen Eltern einen Globus. Er drehte ihn, drehte und schaute auf Länder und Meere, bis sein Blick am obersten Punkt hängen blieb. Das war, inmitten einer blaugrauen Fläche, der Nordpol. Konnte man dort hinreisen? Und wer reiste dort hin?
Er las Abenteuerbücher, begleitete Thor Heyerdal auf seinen Expeditionen, war auf Skiern mit Fridtjof Nansen unterwegs. Befasste sich mit den Erzählungen der ersten erfolgreichen Polarreisenden und mit den Berichten über die Ungezählten, die von ihren Expeditionen nicht zurückkehrten.
Schließlich wurde er selbst zum Abenteurer. Am 4. Mai 1990 erreichte er zusammen mit Børge Ousland den Sehnsuchtsort seiner Kindheit. Nachdem sie 58 Tage lang ihre Schlitten durch Kälte, Eis und Schnee gezogen hatten. War er während der Vorbereitung besessen von der Vorstellung, es allen beweisen zu können, so änderte sich am Ziel seine Haltung. Ging es nicht vielmehr um den Weg dorthin? Um die besondere Beziehung zum Nabel der Welt, um das Eis, das der fortschreitende Klimawandel rasant zum Schmelzen bringt? »Die Geschichte des Nordpols ist die Geschichte unseres Verhältnisses zur Natur«, sagt Erling Kagge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Erling Kagge
Mein Nordpol
Eine Biografie
Aus dem Norwegischen von Ebba D.Drolshagen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Titel der Originalausgabe : Nordpolen. Natur, myter, eventyrlyst og smeltende is First published by Kagge Forlag, AS Oslo 2024Der Verlag dankt NORLA – Norwegian Literature Abroadfür die Förderung der Übersetzung.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
© der deutschsprachigen AusgabeInsel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth, Berlin
Umschlagfotos: Erling Kagge, fotografiert von Børge Ousland; Iakov Kalinin/shutterstock
eISBN 978-3-458-78133-2
www.insel-verlag.de
Widmung
Für meine drei Töchter Ingrid, Solveig und Nor, meine Großtante Tove Tau und meinen Freund Geir Randby
Motto
Die meisten Menschen geben zu früh auf; und daher kommt es, dass so wenig Weisheit in der Welt ist.
Fridtjof Nansen1
Mit Schmerz muss der Mensch sein künftiges Glück erkaufen.2
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Vorwort
I Die vier Nordpole der Welt
Die Entdeckung
Der himmlische Nordpol
Der magnetische Nordpol
Der geografische Nordpol
Der imaginäre Nordpol
Rigveda – Die früheste Quelle
Der Historiker, der eine Zivilisation am Nordpol beschrieb
Die Idee, dass Beobachtungen wichtiger sind als die Offenbarung
Wie in Ägypten die Idee vom Nordpol entstand
Die ersten Menschen auf der Welt
Der Nordpol als ein Bewusstseinszustand
II Die Welt neu sehen
Der Ursprung der modernen Expeditionen
Gerhard Mercator – Die Welt wird neu gezeichnet
Erste Gedanken an eine Reise zum Nordpol
Die Niederländer – Heroische und leidende Polfahrer
III Die Macht des Unbekannten über den Menschen
Eine feministische Ikone am Nordpol
Der Kommandeur, der Baron und der künftige Lord
Die Russen blicken nach Norden
Das Erhabene – und ehrbares Leiden
Frankensteins Reise zum Nordpol
Entdecker und Polfahrer
Englands goldenes Zeitalter
William Parry und John Franklin
Eine literarische Neuerung
Das Land, das nicht ist
IV Das Wettrennen zum Nordpol
Arktisfieber und Kannibalismus
Die Nachrichtenrevolution
Die Route der Amerikaner zum Nordpol
Die Obsession des Polfahrers Charles Francis Hall
Die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition
Der Glaube an ein eisfreies Polarmeer
Auf schwankendem Eis
Nie zurück
V Theorie und Wirklichkeit
Der erste Versuch einer internationalen Zusammenarbeit in der Arktis
Die »Jeannette«-Expedition – der Traum, der Meeresströmung zu folgen
Die Eisöde bei Franz-Josef-Land
Leo Tolstois Polfahrer
VI Das heroische Zeitalter
Fridtjof Nansen – Ein hochgebildeter Steinzeitmensch
Keine Möglichkeit zur Umkehr – drei Mal
Der lange Weg nach Süden
Geschichten aus dem Eis, die Norwegen prägten
Die Liebe zu einem am Nordpol Verschollenen
Mut
Der Todesmarsch zurück
Der Schriftsteller Thomas Pynchon und die Heldenrolle
Der Ehemann
Ein kleiner Anhang
Der bitterste Streit der Polargeschichte
Der Kampf um Glaubwürdigkeit
Wer war als Erster am Nordpol?
Eine letzte Expedition auf »herkömmliche«, schmerzvolle Weise
VII Das mechanische Zeitalter
Mit dem Flugzeug zum Nordpol
Ein scheinbares Wunder
Am besten liebt es sich aus der Ferne
Der korrumpierte Pol
Roald Amundsens letzte Reise
Peter Wessel Zapffe – der Philosoph der Polfahrer
Die Ersten, die mit Sicherheit am Nordpol waren
VIII Als der Traum vom Nordpol in Erfüllung ging
Der Nordpol ist kein Ort
IX Kvitøya, September 2023 . Nachwort über das Eis, unsere Väter und unsere Zukunft
Ein eisfreies Polarmeer
Neue imaginäre Nordpole
Väter und Söhne
Tausend Dank
Anhang
Abbildungen
Bildteil vorne im Buch
Abbildungen Innenteil
Bildteil Mitte des Buches
Bildteil hinten im Buch
Literatur
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Vorwort
Als Børge Ousland und ich am 4.Mai 1990 am Nordpol ankamen, waren wir die Ersten, die den Polpunkt auf Skiern ohne Hunde, Versorgungsdepots und motorisierte Hilfsmittel erreichten. Wir waren achtundfünfzig Tage unterwegs gewesen, manchmal haben wir uns unterhalten, meistens war es mehr als genug, jeden Tag früh aufzustehen und einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Ich habe viele Jahre geglaubt, das Wichtigste am Nordpol sei, zu Fuß dorthin zu gelangen. Ein Wettrennen zu gewinnen, einen Rekord aufzustellen. In den gut zwei Jahren unserer Vorbereitungen gab es für mich nur eines: Ich wollte zum Nordpol. Es mag eigenartig klingen, aber es war wie eine stürmische Verliebtheit – ich dachte morgens beim Aufstehen daran, und ich dachte den ganzen Tag an nichts anderes, bis zum Einschlafen. Bei Schnee lief ich Ski, wenn kein Schnee lag, lief ich auf Rollskiern und zog einen Traktorreifen hinter mir her. Ich war wie besessen. Polfahrer müssen besessen sein.
»Wir sehen uns in zwei Tagen hier wieder«, sagte der Pilot, als wir am 8.März am Eisrand im Norden der Ellesmere-Insel gelandet waren. Das Thermometer des Flugzeugs stand bei minus zweiundfünfzig Grad, er sagte das ohne eine Spur von Ironie. Nach fünfzehn Jahren als Pilot in der kanadischen Arktis war er es gewohnt, dass Expeditionen abgebrochen wurden und die Teilnehmer aufgaben. Wir wuchteten unsere Pulkas aus dem Flugzeug, es war früher Nachmittag, im Südsüdwesten ging bereits die Sonne unter. Im Licht der tiefstehenden Sonne schauten wir nach Norden, ins Dunkel, aufs Packeis. In dieser Richtung, siebenhundertsiebzig Kilometer von hier, lag der Nordpol, dort war die Sonne seit einem halben Jahr nicht mehr aufgegangen.
Anfang März ist es so weit im Norden immer gleich kalt, ob die Sonne scheint oder nicht. Selbst bei blauem Himmel ist das Licht schwach – wir warfen kaum Schatten. Die Sonne wärmte nicht. Bei so niedrigen Temperaturen gefrieren Partikel, die Gerüche, Bakterien, Verunreinigungen, Niederschläge oder Feuchtigkeit mit sich tragen, schnell zu Eis. Zu meiner Überraschung nahm ich plötzlich den Duft von Blumen wahr. Wenige Sekunden später begriff ich, dass es das Parfum der Copilotin Patricia war. Als das Flugzeug abhob, nahm es den Duft mit.
Auf unsere Pulkas hatten wir die Dinge gepackt, von denen wir annahmen, dass wir sie brauchen würden. Sechzig Tagesrationen Dörrfleisch, Haferflocken, Fett, Schokolade und Milchpulver, einen Siebzig-Tage-Vorrat gereinigtes Benzin – zwei Deziliter pro Mann und Tag – für den Primus. Wir wussten nicht, wie viele Tage die Expedition dauern würde, sollte uns aber der Proviant ausgehen, hätten wir – so unsere Überlegung – noch genug Benzin, um Eis zu schmelzen, so dass wir für die letzten Kilometer wenigstens Wasser haben würden. Jeder Schlitten wog einhundertzwanzig Kilo. Es gab einen Schlafsack für jeden sowie einen Doppelschlafsack für uns beide, damit wir uns gegenseitig warm halten konnten. Zu unserer Ausrüstung gehörten außerdem Isomatten, Landkarten, ein Zelt und zwei Smith & Wesson 44 Magnum Revolver, um mögliche Angriffe von Eisbären abzuwehren. Wir hatten keine Ersatzteile dabei, aber tausendzweihundertsechsundfünfzig Gramm Werkzeug.
Wie sich zeigen sollte, brauchten wir alles.
Achtundfünfzig Tage nachdem ich den blumigen Duft von Patricias Parfum in der Nase gehabt hatte, erreichten wir den Nordpol, erst da begriff ich, wie sehr ich mich in meiner Fixiertheit auf den Nordpol geirrt hatte. Meine anhaltende Verliebtheit hatte nicht dem Pol gegolten, sondern dem Weg dorthin.
Der Nordpol ist der Nabel der Erdkugel, der feste Punkt, um den sich Menschen, Meere, Landmassen und Kontinente nahezu unmerklich bewegen. Wenn wir nachts auf der nördlichen Halbkugel in das Sternenmeer im Nachthimmel blicken, stellen wir fest, dass nicht nur der Erdball, sondern auch alle Sterne um den Polpunkt kreisen – mit einer Ausnahme: dem Polarstern.
Aufgrund seiner Lage unterscheidet sich die Geschichte des Nordpols grundsätzlich von der Geschichte eines jeden anderen Ortes auf der Welt. Je mehr ich über den Nordpol höre, lese und lerne, umso klarer wird mir, dass die Geschichte des Nordpols die Geschichte unseres Verhältnisses zur Natur ist – unserer sich verändernden Gefühle und unseres Respekts für eine Umwelt, die nicht von Menschen geschaffen wurde. Die Geschichte des Nordpols ist die Geschichte unseres Verhältnisses zur Natur.
Sie handelt auch von der Schönheit und Brutalität dieser Natur, von der Liebe der Menschen zu Träumen und ihrem Wunsch, die Natur zu kontrollieren und auszubeuten.
Der Nordpol ist seit über 2,7 Millionen Jahren von einer Eisplatte bedeckt, die auf einem 4807 Meter tiefen Meer liegt. Wenn wir vom Eis am Nordpol sprechen, sprechen wir auch von seiner Fragilität – in keiner anderen Region der Welt ist die Erderwärmung so groß wie am Nordpol.
Der Kampf um Prestige und das Streben nach Ruhm treiben Menschen ins Eis an die Spitze der Welt. Auch Habgier und Betrug spielen eine Rolle. Diese Faktoren haben im Lauf der Zeit immer eine Rolle gespielt, sie waren mal stärker, mal schwächer ausgeprägt, aber in den letzten Jahrzehnten haben sie zugenommen – während das Packeis schmilzt.
Für mich geht es bei der Geschichte des Nordpols auch um zwei Einstellungen zum Leben. Staunen, sich wundern, Fragen stellen und zulassen, dass das der Motor des Lebens wird, ist die eine, Abenteuerlust die zweite. Abenteuerlust – dieses faszinierende Wort, das sich aus »Abenteuer« und »Lust« zusammensetzt.
Historiker stützen sich bei ihren Berichten meist auf das, was Menschen erlebt oder gesehen haben. Die Geschichte des Nordpols jedoch ist ungewöhnlich, denn die ersten Polfahrer reisten nicht persönlich, sondern nur in ihrer Fantasie zum Nordpol. Als die Geschichte begann, war niemand auch nur in der Nähe des Polpunktes gewesen.
In prähistorischer Zeit, der Steinzeit, der Bronze- und Eisenzeit und auch im Mittelalter versuchten die Menschen den Nordpol zu verstehen, indem sie den Sternenhimmel studierten, einander zuhörten und ihrer Fantasie freien Lauf ließen. Astronomen, Astrologen, Geografen und Philosophen hatten ein beeindruckendes Vorstellungsvermögen und stellten sich viele Fragen. Wie war das Licht da oben, die Farben, die Vegetation? Gab es dort Festland? Lebten dort Menschen und Tiere? Die Antworten auf diese Fragen ähnelten sich. Der Nordpol war ein hell leuchtender magnetischer Berg und der Ort auf Erden, der den Göttern am nächsten war. Manche hielten ihn für das verlorene Paradies, wo einmal Adam und Eva lebten. Die Region war früher einmal, war es vielleicht immer noch, hell, warm und fruchtbar.
In den folgenden Jahrhunderten, während der Renaissance und der Aufklärung, wuchs in Europa das Interesse an der Erkundung der unbekannten Welt. Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus (1473-1543) zog aus den Himmelsbewegungen Rückschlüsse auf die Bewegungen der Erde. Er ging davon aus, dass die Welt Naturgesetzen gehorcht, und wies nach, dass nicht die Erde der Mittelpunkt des Planetensystems ist, sondern die Sonne. Nicht mehr Gott war die Quelle aller Erkenntnis, sondern die menschliche Beobachtung. Der italienische Philosoph Giordano Bruno (1548-1600) wollte seine Zeitgenossen davon überzeugen, dass es zahllose Sonnensysteme gibt und das Universum unendlich ist. Dafür wurde er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Im 15. und 16.Jahrhundert kehrten portugiesische und spanische Seefahrer von ihren Reisen in die Heimat zurück und brachten Geschichten über fremde Länder, Meere und neue Handelsmöglichkeiten mit. Unbekannte, unentdeckte Teile der Welt wurden kartiert. Doch was am Nordpol war, blieb ein Geheimnis, und so spekulierten die Menschen weiterhin darüber, was sich im hohen Norden verbarg.
Wir haben uns zu allen Zeiten in Sachen Nordpol in fast allem geirrt.
Aber viele Männer wollten nicht nur staunen, sich wundern und Fragen stellen, sie folgten ihrer Abenteuerlust. Lange waren Nordpolfahrer ausschließlich Männer – Inuit, Europäer und Amerikaner. Sie versuchten, zu Fuß, auf Skiern, im Boot oder Flugzeug zum Nordpol zu kommen. Sie kämpften gegen Meeresströmungen, Kälte, Sturm, Regen, wilde Tiere, Schnee, Eis, den Lauf der Sonne und Veränderungen des Klimas. Es gab viele Entdeckungsreisen zu vielen Zielen, bei keinem anderen hat es ähnlich lange gedauert, bis jemand behaupten konnte, als Erster da gewesen zu sein – der erste Mensch auf der Spitze der Erdkugel. Die extreme Natur hat den Abenteurern ungeheure Qualen auferlegt, Eis, Wind, Wasser und Kälte forderten zahllose Menschenleben.
Jahrtausendelang haben Menschen Nacht für Nacht die Planeten studiert, niemand hatte den Nordpol gesehen oder war auch nur in seine Nähe gekommen. Bis Fridtjof Nansen und Hjalmar Johansen 1895 einen Rekord aufstellten, mit dem sie dem Nordpol so nah kamen wie nie ein Mensch vor ihnen, wusste die Menschheit mehr über Venus, Mars, Jupiter und die helle Seite des Mondes als über die Nordpolregion.
Fridtjof Nansen und der norwegische Forscher Hjalmar Johansen in Franz-Josef-Land. Im Juli 1886 fotografiert von Frederick George.
Wer zum Nordpol will, hat dafür mehrere Gründe. Ich wollte etwas Extremes tun, es war fast egal, was. An mir nagte ein wachsender Drang, mit der Schule, dem Studium und später dem Job zu brechen, um mich in der Natur auf die Probe zu stellen. Ich war Bergsteiger, machte immer längere Skiwanderungen, segelte über den Atlantik und in die Antarktis. Dann verliebte ich mich in den Traum vom Nordpol. Wie alle Polfahrer war ich getrieben von einem Bedürfnis nach Anerkennung, es gab aber auch noch andere Gründe, die ich bis heute nicht wirklich verstehe.
Seit ich denken kann, galten in der Familie Kagge männliche Werte. Nichts war wichtiger, als beim Skilanglauf die weiteste Strecke zurückzulegen. Das Ideal war, einen Rekord aufzustellen, für einen Tag, für eine Woche, für die ganze Saison. Wie meine Mutter einmal resigniert sagte: »Bei uns gibt es drei Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und dann gibt es noch die Saison.« Ich hoffte vor allem auf die Anerkennung meines Vaters. Damals dachte ich noch nicht so, aber inzwischen bin ich mit meiner Mutter solidarisch, die mit einem Ehemann und drei Söhnen lebte, deren Werte so völlig anders waren als die ihren.
Von ihm, der mir so wichtig war, wollte ich respektiert werden. Ich hoffte, dass ich mehr über ihn und über mich lernen würde, wenn ich fror, hungerte, kämpfte und mich großer Gefahr aussetzte. Über meinen Expeditionen lag immer der Schatten meines Vaters, das sagte ich ihm nicht, ich konnte es mir kaum selbst eingestehen. Die Reise wurde meine persönliche Version der ältesten Geschichte der Welt: Ein Sohn will ergründen, wer sein Vater ist, und von ihm geliebt werden.
MEINNORDPOL ist die fragmentarische und persönliche Betrachtung einer geografischen Region, die von egozentrischen, neugierigen Menschen aus (fast) der ganzen Welt entdeckt und wiederentdeckt wurde – Menschen wie mir. Ich bin weder Historiker, Religionswissenschaftler, Geologe, Astronom noch Kartograf, es gibt viele Dinge, die ich über den Pol nicht weiß. Daher ist dieses Buch keine lückenlose Geschichte des Nordpols, es handelt von den Träumen, Ideen, Büchern und Expeditionen, die mich beschäftigt haben.
Mein Vater und ich haben heute ein enges Verhältnis, auch mein Verhältnis zum Nordpol hat sich verändert. Wir waren dort, nun geht es nicht mehr darum, etwas Extremes zu tun oder jemandem zu imponieren. Ich schreibe aus Liebe zur Natur, weil ich unentwegt staune, weil ich unentwegt Abenteuerlust verspüre. Weil ich eine tiefe Zuneigung zu allen verspüre, die zum Horizont aufbrechen, um mehr über sich und die Welt zu erfahren.
Nicht nur Polarfahrer, wir alle sind schon von Geburt an mit zwei Instinkten unterwegs. Kaum haben wir den Mutterleib verlassen, wollen wir mehr Platz. Wir wollen Bewegungsfreiheit. Wir strecken Arme und Beine aus und schreien nach Luft. Der zweite Instinkt ist die Abenteuerlust, der Wunsch, die Welt zu erforschen. Kaum können wir laufen, stapfen wir beherzt durchs Zimmer und aus dem Haus, wir beginnen uns zu fragen, was zwischen uns und dem Horizont, und bald auch, was hinter dem Horizont liegen mag. Da sind wir schon auf dem Weg zur Entdeckung unserer eigenen Nordpole.
Solange wir leben, begleiten uns das Bedürfnis nach mehr Platz und der Drang, das Fremde zu erforschen. Aber ich fürchte, dass dieses Bedürfnis den Erwartungen unserer Gesellschaft zuwiderläuft: Wir sollen mit immer weniger Platz auskommen, zu Hause bleiben, die Welt von dort aus erforschen, indem wir auf einen Bildschirm starren. Als sollte der uns angeborene Drang, selbst herauszufinden, was hinter dem Horizont liegt, gebändigt werden.
Ich war in vielen Teilen der Welt zu Fuß und auf Skiern unterwegs, bin geklettert und gesegelt. Alle Berge, Hochebenen, Wälder und Meere, die ich gesehen habe, ließen sich mit anderen Orten vergleichen. Nur ein Ort war wie kein anderer: der Nordpol. Als ich den Polpunkt endlich erreicht hatte, begriff ich, dass es da kein DA gibt.
I
Die vier Nordpole der Welt
Die Entdeckung
Meinen ersten Globus bekam ich 1970 von meinen Eltern zum Geburtstag geschenkt. Ein Metallbügel bog sich im Halbkreis von unten nach oben um die Kugel. Die Landesgrenzen waren mit einer dünnen Linie markiert, während alle anderen Details unterschiedliche Farben hatten. Die Farben liefen ein bisschen ineinander. Meer und Flüsse waren blau, Gletscher weiß, Gebirge braun. Je tiefer die Meere, umso dunkler das Blau, und je höher die Berge, umso brauner wurden die Gipfel.
Der Globus veranschaulichte auf diese Weise, dass in der Natur alles – Wasser und Eis, Erde und Stein – miteinander verbunden ist. In der Mitte, wo der Globus am breitesten war, stand auf dem Bügel »0«. Von dieser Null aus gingen Zahlen in beide Richtungen, nach unten und nach oben, bis 90. Ich betrachtete diese Welt, dann sah ich auf den obersten Punkt. Was bedeutete dieser große, blau-weiße Fleck ganz oben? Zu welchem Land gehörte er? Wie kam man dorthin?
Ich sah mir den Globus genauer an. Das blau-weiße Areal um den eigentlichen Nordpol war von einer kleinen Chromscheibe verdeckt, die die Globusachse und den Metallbügel hielt. Ich fragte mich, was unter dieser Scheibe, am Nordpol, sein mochte. Was versteckte sich da? Dank des kleinen Globus verstand ich, dass die Erde sich dreht. Drehte ich die Kugel nach rechts, bewegte er sich nach Osten, der Nordpol blieb in der Mitte. Der Pol schien das Zentrum der Welt zu sein. Als meine Mutter sagte, dass sich die Erde am Äquator mit einer Geschwindigkeit von 1670 Stundenkilometern um sich selbst drehe, begann ich, den Globus so schnell wie möglich zu drehen. Das machte mich nicht viel klüger. Dann hatte ich eine andere Idee. Ich stellte mich in die Mitte des Raums und versuchte, mich mit geschlossenen Augen um mich selbst zu drehen. Dabei kam ich ziemlich schnell ins Torkeln und musste mich an der Wand abstützen, um nicht zu fallen.
Ich war sieben Jahre alt und hatte für mich gerade den geografischen Nordpol entdeckt. Den Ort, an dem die Kompassnadel immer nach Süden, zum magnetischen Nordpol, zeigt. Wo der Wind immer aus Süden kommt – und immer nach Süden weht. Den Ort, an dem die Zentrifugalkraft der Erde aufhört. Den Ort, an dem es im Jahr nur einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang gibt: Die Sonne geht am 22.September zur Tag-und-Nacht-Gleiche im Herbst unter und am 21.März zur Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühjahr wieder auf, wenn sie den Äquator erneut, nun von Süden nach Norden kreuzt.
Abenteurer, Menschen verschiedenster Nationen haben jahrhundertelang darum gewetteifert, zuerst an diesen Ort zu gelangen. Zu diesem Punkt ging ich knapp zwanzig Jahre später.
Ich verstand erst einige Jahre nach dem Globus-Geschenk, dass es nicht nur den Nordpol gibt, sondern noch drei weitere Nordpole.3 Sie sind sehr unterschiedlich, auch wenn sie in Beziehung zueinander stehen.
Der himmlische Nordpol befindet sich in einer geraden Linie direkt über dem Nordpol, wie eine unsichtbare Fortsetzung der Achse, die vom Südpol mitten durch den Erdball zum Nordpol verläuft. Er wird mit gutem Grund als Mittelpunkt des Himmels bezeichnet.4
Der magnetische Nordpol war für die Navigation zu Lande und zu Wasser von großer Bedeutung, seit die Menschen verstanden haben, dass ein Magnet nach Norden zeigt. Dieser Pol ist überlebenswichtig.
Der vierte Pol ist weniger bekannt und hat nie einen passenden Namen bekommen. Ich nenne ihn den imaginären Nordpol. Er befindet sich, wie der Name schon sagt, lediglich in den Köpfen der Menschen. Er entsprang dem Staunen, der Vorstellungskraft und mitunter auch den schriftlich und mündlich überlieferten Quellen unserer Vorfahren.
Der himmlische Nordpol
Nachdem ich auf dem Globus den geografischen Nordpol entdeckt hatte, begann ich mich zu fragen, was jenseits davon sein könnte. Erst dachte ich, dass da nichts ist, dass die Welt dort einfach zu Ende war. Später erkannte ich, dass da doch etwas war. Denn wenn man im Winterdunkel am Nordpol steht und in einem Neunzig-Grad-Winkel nach oben in den Sternenhimmel schaut, blickt man in den himmlischen Nordpol.
Dieser Pol ist ein imaginärer Punkt am Himmel, an dem sich die Rotationsachse vom Nordpol aus vertikal zum Polarstern und weiter ins Unendliche verlängert.
Der Polarstern, auch Polaris genannt, besteht aus drei Sternen, die wie einer erscheinen. Er gehört zum Sternbild Ursa Minor, auch bekannt als Kleiner Bär. Die sieben hellsten Sterne im Sternbild Ursa Major, des Großen Bären, bilden den Pflug. Zieht man von den beiden äußersten Sternen des Pflugs, Merak und Dubhe, eine Verbindungslinie nach oben, die etwa fünfmal so lang ist wie die Entfernung der beiden Sterne voneinander, kommt man zum Nordpolarstern. Diese Faustregel funktioniert immer, weil der Große Bär und der Kleine Bär um den Nordpol kreisen. Der hellste der drei die Deichsel bildenden Sterne des Kleinen Bären, Ursa Minor, ist der Nordpolarstern, er steht direkt über dem Nordpol.
Der Polarstern ist für die Navigation von großer Bedeutung. Er steht als fester Himmelspunkt immer im Norden, während alle anderen Sterne sich um den Polpunkt drehen. Allerdings ist es, unterwegs zum Nordpol, nicht einfach, nach dem Polarstern zu navigieren, denn so weit im Norden scheint er immer direkt über einem zu stehen. Und wenn im Frühjahr die Mitternachtssonne aufgeht, ist er gar nicht mehr zu sehen. Weiter im Süden jedoch, bei meinen Segeltouren über den Atlantik und den Pazifik, war der Polarstern immer ein treuer Begleiter. Auf dem Weg über den Pazifik zur Antarktis fühlte ich mich fast ein wenig verloren, als wir bei den Galapagosinseln den Äquator überquerten und der Polarstern verschwand.
Der Polarstern stand aber nicht immer genau im Norden. Seine Position hat sich im Laufe der Zeit langsam verändert, vor zweitausend Jahren war er zwölf Grad von dem himmlischen Nordpol entfernt. Damals war Kochab, ein anderer Stern im Kleinen Bären, dem Pol viel näher. Astronomen haben berechnet, dass der jetzige Polarstern im Verlauf der nächsten vierzehntausend Jahre so weit wandern wird, dass er nicht mehr der Stern sein wird, der den Himmelsnordpol markiert. Der Stern Wega, der sich in Richtung himmlischer Nordpol bewegt, könnte der neue Polarstern werden.
Für Homer war der Große Wagen der himmlische Referenzpunkt, weil das Sternbild nie unter den Horizont sank. Als Odysseus schließlich nach Hause zurücksegeln will, rät ihm die Meeresgöttin Calypso, bei seiner Fahrt den Bären, der immer im Kreis geht, zur Linken zu behalten.5 Hätte sie ihn getäuscht und gesagt, er solle die Sonne oder den Mond zu seiner Linken behalten, hätte er nie nach Hause gefunden.
☼
Der Große Bär ist auf der nördlichen Halbkugel so wichtig, weil er leicht erkennbar ist und immer um den himmlischen Nordpol, also auch den Nordpol, kreist. Das Sternbild ist durch die Geschichte hindurch mit einem Bären verbunden. Im Buch Hiob erschuf Gott zwar »den Wagen am Himmel«, aber in der Offenbarung des Johannes ist vom »Bären am Himmel« die Rede. Als sich Jesus im ersten Kapitel der Offenbarung auf Patmos in der Ägäis bei einer Grotte dem Johannes zeigte, hält er sieben Sterne in seiner rechten Hand.6 Der Bär taucht in vielen nördlichen Kulturen in Mythen auf, die von Generation zu Generation mündlich überliefert wurden.
In der römischen Mythologie wiederum wurden die Sternbilder Kleiner und Großer Bär vom Götterkönig Jupiter erschaffen. Jupiter war mit Juno verheiratet, hatte aber eine Affäre mit einer Frau namens Kallisto. Als Juno später erfährt, dass Kallisto einen Sohn hat, nimmt sie an, dass ihr Ehemann der Vater ist. Aus Rache verwandelt sie Kallisto in eine Bärin, damit Jupiter sie nicht mehr begehrt. Nach der Verwandlung wird Kallisto von ihrem Sohn, der auf Bärenjagd ist, fast getötet. Um eine Tragödie zu verhindern, verwandelt Jupiter nun auch den Sohn in einen Bären. Er setzt beide an den Himmel, so wurde Kallisto zum Großen, ihr Sohn zum Kleinen Bären. Dieser Bereich des Himmels wurde Helike genannt, was so viel wie drehen bedeutet, da die beiden Sternbilder eng um den Nordpol kreisen.
Es waren die Griechen, die der Region im Norden ihren Namen gaben. Arktos ist das griechische Wort für Bär. Das entgegengesetzte Ende der Erdkugel nannten sie Antarktis oder Anti-Bär, die Region ohne Bären.
Das Bärenmotiv spielt auch in der Tradition der amerikanischen Ureinwohner eine wichtige Rolle. Die Lakota nennen das Sternbild Wičhákhiyuhapi, was »Großer Bär« bedeutet. Die Mohawks, Seneca Oneidas, Onondagas und Cayuga sehen in den aufeinanderfolgenden Sternen Alioth, Mizar und Alkaid drei Jäger, die den großen Bären verfolgen. Alioth hat Pfeil und Bogen, um den Bären zu töten, Mizar trägt auf den Schultern einen großen Topf, um das Bärenfleisch zu kochen, und Alkaid schleppt ein Bündel Brennholz hinter sich her, um unter dem Topf ein Feuer zu machen.7
Für mich bleibt es ein Rätsel, warum der Große Bär an den verschiedensten Orten und auf den verschiedensten Kontinenten ein und denselben Namen trägt. Die üblichen Erklärungen leuchten mir nicht ein: dass der Große Bär und die Arktis so heißen, weil das Sternbild im Norden einem Bären ähnelt; dass das Land im Süden Land ohne Bären genannt wird, weil es über dem Südpol kein Sternbild gibt, das einem Bären ähnelt. Beim besten Willen kann ich in dem Sternbild nichts sehen, was einem Bären ähnelt.
Ich denke, wir unterschätzen die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen, die die beiden Sternbilder nach Bären benannten. Die Menschen in Europa und in Nordamerika lebten im Einklang mit der Natur und werden gewusst haben, dass es dort Bären gibt, wenn auch vielleicht nicht da, wo sie selbst lebten. Vielleicht hatten sie auch Geschichten über Eisbären gehört, die auf einer Eisscholle von Grönland nach Island trieben. Und reisende Händler und Abenteurer haben den Menschen im Norden vielleicht erzählt, dass es weit im Süden keine Bären gibt. Wenn das stimmt, könnten die Namen Großer Bär und Arktis auf dem Wissen um die Lebensräume der Bären beruhen und weniger auf dem Wunsch, in einem Sternbild einen Bären zu sehen. So wäre dann auch die bärenlose Antarktis zu ihrem Namen gekommen.
☼
Über dem Südpol gibt es keinen Polarstern, um den sich der südliche Sternenhimmel dreht und an dem sich Seeleute orientieren könnten. Vom 18.November 1992 bis zum 7.Januar 1993 ging ich allein zum Südpol. Dieses Mal war ich ohne meinen Freund BØrge unterwegs und nirgends gab es eine Spur von Leben. Ich benutzte weder Funkgerät noch Telefon und sprach deshalb kaum ein Wort. Oft schaute ich beim Gehen zum Himmel und zum südlichen Himmelspol. Wegen der Mitternachtssonne konnte ich keine Sterne sehen. Als BØrge und ich im März 1990 zum Nordpol gingen, waren die Bedingungen ganz anders, weil es in den ersten Wochen fast dunkel war. Wir hatten das Gefühl, den Sternen und dem ganzen Universum, das sich in immer größerer Geschwindigkeit und in alle Richtungen ausdehnt, näher zu kommen.
Wer den Blick hebt und in den Sternenhimmel schaut, blickt immer in die Vergangenheit. Das ganze Universum gehört zu unserer Geschichte, die Lichtgeschwindigkeit beträgt dreihunderttausend Kilometer in der Stunde, das Licht braucht acht Minuten von der Sonne zur Erde, eine Minute vom Mond, in einer Sekunde kann es den Erdball an den Polen achtmal umkreisen. Das Licht des Polarsterns ist so schwach, dass er nicht immer leicht auszumachen ist. Wenn ich nach ihm Ausschau halte, denke ich oft, dass er nicht so hell ist wie Mond und Sonne, was aber nicht stimmt. Der Polarstern ist dreihundertdreiundzwanzig Lichtjahre von uns entfernt, das, was wir von ihm sehen, war dreihundertdreiundzwanzig Jahre zur Erde unterwegs. Was uns in etwa zum Beginn des europäischen Zeitalters der Aufklärung zurückführt. Damals war das Licht des Polarsterns viertausend Mal so stark wie das der Sonne.8
Etwas zu wissen bedeutet nicht, es zu verstehen. Dazwischen liegt ein langer Weg. Und ich begreife all das heute kaum besser als an meinem siebten Geburtstag.
Der magnetische Nordpol
Auf unserem Weg zum Nordpol wies meine Kompassnadel nicht strikt nach Norden. Die Nadel ist ein Magnet, der zum magnetischen Nordpol zeigt, und der liegt bei Ellef Ringnes Island, einer der größten unbewohnten Inseln der Welt westlich von Grönland. Der magnetische Nordpol ist jener Punkt auf der Nordhalbkugel, an dem die magnetische Achse vom magnetischen Südpol zum magnetischen Nordpol die Erdoberfläche durchstößt. Im Gegensatz dazu trifft am geografischen Nordpol die Rotationsachse auf die Erdoberfläche.
Warum sind die magnetischen Pole so wichtig? Die Erde ist ein großer Magnet und hat, wie alle Magneten, einen Plus- und einen Minuspol. Von diesen Magnetfeldern hängen wir alle ab, denn ohne die magnetischen Polpunkte im Norden und im Süden und ohne das Magnetfeld dazwischen gäbe es vermutlich kein Leben auf der Erde. Auf dem Mars verschwanden vor 3,9 Milliarden Jahren mit der Kraft der Magnetfelder auch die Atmosphäre und das Wasser, seither ist der Planet öde.
Der Magnetismus entsteht durch flüssiges Eisen, das sich in dem äußeren Erdkern etwa dreitausend Kilometer unter der Erdoberfläche befindet. Anders als bei den Magneten, mit denen wir Fotos am Kühlschrank befestigen, verschieben sich der magnetische Nordpol und der magnetische Südpol mitunter, weil sich das Eisen als Folge von Temperaturschwankungen und der Erdrotation bewegt. Durch die Bewegung des Eisens entstehen Strömungen, die Magnetfelder erzeugen oder induzieren. In der Arktis ist daher nicht nur das Eis in ständiger Bewegung, sondern auch der magnetische Nordpol. In den gut dreißig Jahren, seit Børge und ich am Nordpol waren, ist der magnetische Nordpol von Ellef Ringnes Island etwa vierhundert Kilometer nach Norden ins Polarmeer gewandert.9 In einem Rhythmus von etwa dreihunderttausend Jahren kehren sich die magnetischen Pole um, was für alles Leben auf der Erde gravierende Konsequenzen hat.10
Das Phänomen der Pole und der Magnetfelder hat mich schon immer interessiert und ich nehme vielleicht mehr als andere Menschen wahr, wie die Magnetfelder das Leben um uns herum beeinflussen. Wenn ich meinen Hund von der Leine nehme und frei herumlaufen lasse, dreht er sich zunächst etwas unsicher um die eigene Achse, bevor er sein Geschäft erledigt. Als müsse er für den richtigen Standort zuerst sein eingebautes GPS konsultieren. Ich habe mich oft gefragt, warum ein Hund, wenn er sich selbst überlassen ist, parallel zum Magnetfeld der Erde in Nord-Süd-Richtung steht. Ist die Richtung für den Hund so wichtig?
2014 fand ein Forscherteam nach zweijähriger Recherche heraus, dass Hunde, wenn sie ihr Geschäft verrichten, »den Körper bevorzugt entlang der Nord-Süd-Achse ausrichten, wenn das Magnetfeld sich ruhig verhält«. Untersucht wurden siebzig Hunde aus zweiunddreißig Rassen, 1893-mal beim Stuhlgang und 5582-mal beim Urinieren.11
Die Forschung über Vögel und Magnetismus ist viel umfassender. Schon bevor ein Zugvogel das erste Mal nach Süden fliegt, weiß er, wo sich der Große Bär, der Kleine Bär und der Nordpolarstern befinden. Zugvögel können mit ihren Augen, Ohren und ihrem Schnabel Magnetfelder lesen und Nord und Süd unterscheiden. Zweimal im Jahr umrunden sie ein Viertel des Erdballs, um dorthin zu kommen, wo gerade Frühsommer ist. Vermutlich wissen sie gar nicht, dass es überhaupt Winter gibt. Das Protein Cryptochrom 4 (CRY4), das alle Vögel in der Netzhaut haben, könnte dafür sorgen, dass sie in der Lage sind, Tag und Nacht Magnetfelder zu »sehen« oder zu messen. Dank winziger Eisenpartikel im Innenohr spüren sie Magnetfelder auf, und Nerven im Schnabel ermöglichen es ihnen, den Winkel zum Magnetfeld abzuschätzen und so ihre eigene Position zu bestimmen.12
Meeresschildkröten und Wale benutzen das Magnetfeld der Erde, um mit faszinierender Präzision unter der Meeresoberfläche zu navigieren. Eine Biene, deren Gehirn die Größe eines Sesamkorns hat, findet dank der Magnetfelder zurück zu den Orten, an denen sie schon einmal Nahrung gefunden hat, und von dort wieder nach Hause. Rinder, Rehe und Rentiere stellen sich beim Grasen gern in Nord-Süd-Richtung. Natürliche Schwingungen des Erdmagnetfelds stören bei all diesen Tieren den Orientierungssinn, aber Sonne, Sterne und Fixpunkte wie Berge und Inseln helfen bei der Korrektur.
Wenn ich auf die Kompassnadel blicke, die immer nach Norden weist, frage ich mich manchmal, ob unser Verhältnis zum Norden auch von der Ausrichtung der Magnetfelder beeinflusst wird. Eisen ist für uns ein essenzielles Spurenelement, das sich auf Blutdruck, Puls und Stimmung auswirken kann. Forscher am California Institute of Technology vermuten, dass unsere Zellen sich wie die Kompassnadel bewegen und an das Gehirn Signale über unsere Ausrichtung senden können.13 Sie fanden solche Zellen bei Fruchtfliegen und vermuten, dass auch Schmetterlinge, Ratten, Wale und Menschen Zellen mit entsprechenden Eigenschaften haben.
»Wir sind Teil der magnetischen Biosphäre der Erde«, sagt der Geologe Joseph Kirschvink, Professor am California Institute of Technology. Er leitet ein Forschungsprojekt, mit dem er beweisen möchte, dass der magnetische Sinn, den unsere Vorfahren vermutlich schon vor mehreren Millionen Jahren besessen haben, bei uns immer noch vorhanden ist. Er kann das Ergebnis der Forschung noch nicht absehen, hofft aber auf Beweise, dass das Magnetfeld der Erde unser Bewusstsein und unser Handeln beeinflusst.14
Der geografische Nordpol
Auf dem Weg zum Nordpol habe ich mich nie gefragt, was ich eigentlich in diesem eisigen, weiß-grau-blauen Nichts wollte. Mir war zu kalt, ich war zu hungrig und zu erschöpft, um mich überhaupt etwas zu fragen. Im Alltag zu Hause muss man ständig etwas entscheiden. Auf dem Weg zum Nordpol ging es nur um eines: den nächsten Schritt.
Rein technisch gesprochen ist es ganz einfach, zum Nordpol zu kommen: Man muss sich nur lange genug in dieselbe Richtung bewegen. Er liegt mehr oder weniger in der Mitte des Nordpolarmeers, das den nördlichen Teil der arktischen Region umgibt und von drei Kontinenten – Europa, Asien und Nordamerika – begrenzt wird. Es ist das kleinste der fünf Weltmeere.
Wenn man sich am Nordpol auf dem Eis schlafen legt, treibt man fort und wacht an einer anderen Stelle auf. Am Nordpol angekommen, haben wir fünf Tage in einem Zelt verbracht. In dieser Zeit trieben wir rund fünfzig Kilometer nach Süden in Richtung Ellesmere-Insel. In der Antarktis, einem Kontinent, der von drei Meeren – Pazifik, Atlantik und Indischer Ozean – umgeben ist, ist es umgekehrt. Das Eis, das diesen Kontinent bedeckt, liegt auf Festland und bewegt sich fast nicht. Als ich am Südpol nach acht Stunden Schlaf wieder aufwachte, war ich gerade einmal 0,13 Millimeter nach Norden getrieben.
Je nach Jahreszeit und mit erheblichen Unterschieden von einem Jahr zum nächsten ist das Polarmeer von 3,4 Millionen bis zu 16 Millionen Quadratkilometern Eis bedeckt. Dieses Packeis, wie es genannt wird, besteht aus Eisschollen, die über das Polarmeer treiben. Wasser hat die seltene Eigenschaft, dass sich sein Gewicht – im Verhältnis zum Volumen – in fester Form reduziert. Wenn Wasser gefriert, wiegt es weniger, daher schwimmt Eis auf dem Wasser und sinkt nicht zum Meeresboden.
Dieses Eis bewegt sich unterschiedlich schnell, entscheidend sind lokale Strömungen und die beiden großen Arktis-Meeresströmungen, der Beaufort-Wirbel und die Transpolardrift. Das Packeis kann zwischen ein paar Zentimetern und mehreren Metern dick sein. Es kann, je nach Wetter und Windstärke, innerhalb von vierundzwanzig Stunden zehn bis zwanzig Kilometer weit treiben. Die Strömung zwischen dem Nordpol und Kanada geht immer nach Süden. Ich erinnere mich gut an das Gefühl der Verzweiflung, das uns an Tagen überkam, an denen wir fast so weit nach Süden abtrieben, wie wir nach Norden vorankamen. Wenn wir abends in unsere Schlafsäcke krochen, waren wir uns einig, dass es sich anfühlte, als würden wir auf einer riesigen Rolltreppe gegen die Laufrichtung gehen.
Weil das Eis ständig in Bewegung ist, drücken die Schollen gegeneinander und brechen auf. Sie werden nach oben in die Luft und nach unten ins Meer gedrückt, so entstehen große Eisblöcke, die zusammenfrieren und das Vorankommen zu Fuß oder auf Skiern sehr erschweren. Wir bezeichnen sie als Presseishügel.
Der amerikanische Polfahrer Robert Peary (1856-1920) berichtete, er sei auf Hügel gestoßen, die ihn in ihrer Höhe an Capitol Hill in seiner Heimatstadt Washington erinnert hätten. Das scheint mir ziemlich übertrieben zu sein. Die höchsten Presseishügel, auf die wir gestoßen sind, waren etwa zehn Meter hoch, wobei die Höhe oft nicht das Schlimmste war. Manche verlaufen wie Barrieren in Ost-West-Richtung. Wenn wir sie mit unseren Pulkas nicht überwinden konnten, mussten wir bis zu ihrem Ende nach Osten oder Westen zurückkehren, manchmal gingen wir einen Kilometer in die falsche Richtung.
Wenn man sich unterwegs allein auf den Kompass und die Augen verlässt, muss man die Magnetfelder beachten und sich zugleich von ihnen frei machen. Ich wusste das natürlich, bevor wir aufbrachen, aber als ich am 8.März 1990 zum ersten Mal sah, dass die Nadel direkt nach Westen zum magnetischen Nordpol wies und damit 90 Grad von unserem Kurs abwich, musste ich doch tief durchatmen.
Die Richtung des »wahren« geografischen Nordpols und die der wahren Süd-, Ost- und Westrichtungen sind einfach zu berechnen, wenn man die »Missweisung« des Kompasses kennt. Die Missweisung zeigt an, wie stark die Kompassnadel, die zum magnetischen Nordpol ausgerichtet ist, von der Lage des geografischen Nordens abweicht. Auf unserem Weg nach Norden veränderte sich diese Missweisung von Tag zu Tag. Auf der nördlichen Erdhalbkugel steht die Sonne um zwölf Uhr immer an ihrem höchsten Punkt, genau im Süden.15
Wenn die Sonne im Süden steht, ist der Längengrad 180°. Jeden Tag justierte ich unterwegs den Kompass nach der Sonne. Um sechs Uhr morgens steht die Sonne immer bei 90° Ost, um sechs Uhr nachmittags immer bei 270° West. Das heißt, dass sich die Sonne pro Stunde um 15 Längengrade nach Westen bewegt; sie steht also jeden Tag um neun Uhr im Südosten, um fünfzehn Uhr im Südwesten.16
Dieses Prinzip gilt natürlich für Längengrade und Uhrzeit weltweit. Schweden liegt etwa auf 15° Ost, die Zeit ist eine Stunde vor Greenwich Mean Time (GMT), New York liegt fast auf 75° West und damit fünf Stunden hinter GMT.
Wenn man es nicht eilig hat, kann man die Himmelsrichtungen und die Zeit bestimmen, ohne einen Blick auf die Uhr zu werfen. Man braucht dazu nur eine primitive Sonnenuhr. Man steckt einen Skistock aufrecht ins Eis oder in den Boden und wartet. Wenn der Schatten des Skistocks am kürzesten ist, steht die Sonne am höchsten im Süden. Vor und nach zwölf Uhr Ortszeit, wenn die Sonne tiefer am Horizont steht, ist der Schatten länger und am längsten bei Sonnenaufgang im Osten und bei Sonnenuntergang im Westen.
An den Polen münden alle Längengrade in einem Nullpunkt. Der Nordpol ist also der Ausgangspunkt, um weltweit die Uhrzeit zu bestimmen, und zugleich der Punkt, an dem die Berechnung des Vierundzwanzig-Stunden-Tages in Bezug auf die Umlaufbahnen von Erde und Sonne sinnlos wird. An beiden Polen kann man die Uhrzeit selbst bestimmen. Seit die Uhren Ende des 19.Jahrhunderts synchronisiert wurden, ist allgemein akzeptiert, dass die Pole überall auf der Welt die Ortszeit festlegen. Auch wenn sie die einzigen beiden Orte auf der Welt sind, die nicht von der Uhr bestimmt werden.
Als ich mit zwölf Jahren Henri Charrières Roman Papillon las, lernte ich so einiges über den Lauf der Sonne. Das Buch erzählt die Geschichte von Charrière, genannt Papillon, der für einen Mord, den er nicht begangen hat, auf der Teufelsinsel vor Französisch-Guayana zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Da Papillon keine Uhr besaß, benutzte er bei einem Fluchtversuch einen Stock, um die Uhrzeit zu bestimmen. Französisch-Guayana liegt auf 4° Nord, und am Äquator ist es zwölf Uhr mittags, wenn die Sonne direkt über einem steht. Papillon stieß den Stock in den Boden und wartete. Als er keinen Schatten mehr warf, wusste er, wie viel Uhr es war. Nachdem ich diese Lektion gelernt hatte, begleitete ich Papillon Tag und Nacht bei all seinen acht Fluchtversuchen, bis es ihm nach vierzehn Jahren schließlich gelang, auf einem kleinen selbstgezimmerten Floß aus Kokosnüssen von der Teufelsinsel zu entkommen. Ich war so fasziniert von seiner Beharrlichkeit, dass ich das Buch gleich nochmal las.17
Am Nordpol ist das anders. Man ist in keiner Zeitzone mehr, denn die eigene Position hat keinen Längengrad. Die Sonne steht vierundzwanzig Stunden lang gleich hoch über dem Horizont, sie bewegt sich weder nach oben noch nach unten, sondern wandert erst nach Westen und dann nach Osten, 15° pro Stunde, 360° insgesamt. Der Schatten, den der Skistock auf dem Schnee wirft, bleibt über vierundzwanzig Stunden gleich lang.
Sobald Børge und ich das Zelt verließen, verfolgten wir den Gang der Sonne. Das GPS zeigte, dass wir den Pol erreicht hatten, aber im Winter 1990 war GPS etwas Neues, vermutlich hatte vor uns noch keine Expedition diese Technologie auf dem Weg zum Nordpol genutzt. Um wirklich sicher zu sein, dass wir am Pol waren, nahm ich alle paar Stunden meinen Kompass heraus und maß die Sonnenhöhe über dem Horizont. Dafür legte ich mich flach aufs Eis und stützte mich mit den Ellbogen ab. Im unebenen Packeis kann man manchmal den Horizont nicht richtig sehen, aber wir hatten einen künstlichen Horizont dabei. Er bestand aus einem weißen, 10×10 Zentimeter großen Behälter aus gehärtetem Kunststoff. Robert Peary schrieb, er habe »in seinem besonderen Instrumentenkasten« einen Behälter gehabt, den er mit Quecksilber füllte. Dann habe er sich – mit einem Moschuspelz als Unterlage – bäuchlings aufs Eis gelegt, um die Sonnenhöhe mit Hilfe der horizontalen Fläche im Behälter zu messen. Statt Quecksilber haben wir gereinigtes Benzin verwendet, denn das hat weniger Gewicht.18 Wir konnten es nach Gebrauch wieder in die Flasche zurückgießen. Und wäre uns der Brennstoff ausgegangen, hätten wir das Benzin in den Primus füllen können.
☼
Ein oder zwei Jahre nachdem ich von meinen Eltern den Globus bekommen hatte, hörte ich zum ersten Mal das Wort Polfahrer. Es war Sommer, ich ging über einen jener Kirchfriedhöfe, auf denen auch die alten Gräber gepflegt werden. Das Gras war grün, die Grabstätten waren mit Blumen bepflanzt. Ich war mit meiner Großtante Tove Tau unterwegs, die mir die Inschriften auf den Grabsteinen und die Berufe der Verstorbenen vorlas. Das war eine gute Idee. Schiffsführer … Matrose … Richter … Und dann, mit schwarzer Schrift auf einem schlichten grauen Stein: Polfahrer. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete. Tove erklärte es mir, das sei jemand, der am Nordpol oder am Südpol gewesen sei. Damit hatte sie in mir einen vagen Wunsch geweckt, selbst Polfahrer zu werden.19
☼
Ich bin immer schon ein Träumer gewesen. Als Kind stellte ich mir vor, dass ich Thor Heyerdahl bei seinen Expeditionen begleitete. Auf der Kon-Tiki über den Pazifik, auf der Tigris über den Indischen Ozean und auf der Ra über den Atlantik. Ich war mit Fridtjof Nansen auf Skiern in Grönland unterwegs, schwang mich mit Tarzan von Liane zu Liane, strandete mit Robinson Crusoe auf einer Insel und floh mit Papillon von der Teufelsinsel. Als meine Altersgenossen eingeschult wurden, riet man meinen Eltern, in meinem Fall noch ein Jahr zu warten, als ich in die erste Klasse kam, war ich siebeneinhalb Jahre alt. Ich glaube, sie hielten mich für unreif, womit sie vermutlich recht hatten. Außerdem war ich Legastheniker und lernte erst mit zehn Jahren lesen. Zum Glück haben mir meine Eltern vorgelesen. Bei meinem Vater war es Tarzan, meine Mutter bevorzugte Homer. Odysseus wurde mein Held. Er hatte es geschafft, dem verführerischen Gesang der Sirenen zu widerstehen und an ihrer Insel vorbeizusegeln. Alles schien möglich, Träume waren spannender als der Alltag.
Tove, die Großtante, von der ich zum ersten Mal das Wort Polfahrer gehört hatte, kannte Thor Heyerdahl persönlich. Sie erzählte mir, dass er Angst vor Wasser habe, weil er als kleiner Junge einmal fast ertrunken sei. Ich begann zu verstehen, dass Abenteurer manchmal reisen, obwohl sie Angst haben, und nicht, weil sie keine Angst haben. Kaum hatte ich lesen gelernt, lieh sie mir ein Buch über den portugiesischen Entdecker Ferdinand Magellan (1480-1521) und die großen Wendepunkte in der Geschichte, jene schicksalsschweren Entscheidungen, die über ihre Zeit hinaus weitreichende Folgen haben würden. Das Buch hieß Der Eroberer des Stillen Ozeans, geschrieben hatte es der Schwede Mauritz Edström. Er beschreibt darin, wie Magellan den Seeweg zwischen dem Atlantik und dem Meer fand, das er Stiller Ozean nannte20 – »hoffend, dass es ruhig bleiben möge«, wie sein Mitreisender Antonio Pigafetta in seinen Aufzeichnungen erklärte. Die Meerenge, die Magellan durchfuhr und die heute seinen Namen trägt, liegt zwischen dem südamerikanischen Festland und Feuerland. Ich bin selbst dort gesegelt, die Passage ist an einigen Stellen sehr eng, mit schwierigen Untiefen, Gezeiten, Inseln und ständig wechselnden Winden. Im Unterschied zu Magellan hatten wir eine Karte dabei, die es uns ermöglichte, die Inseln und Untiefen sicher zu umsegeln, und wir wussten, dass auf der anderen Seite das offene Meer auf uns wartete. Zu Magellans Zeit lebten auf der Ostseite der Meerenge Menschen, die ihm vermutlich wertvolle Hinweise gaben, was ihn und seine Mannschaft erwartete. Magellan brauchte einen Monat für die Durchquerung der Meerenge. Wir dagegen nur achtundvierzig Stunden.
Als sie über den Stillen Ozean fuhren, ging Magellan davon aus, im Laufe weniger Wochen auf Land zu stoßen, aber sie segelten drei Monate und zwanzig Tage nach Westen. Am Ende musste die Mannschaft Ratten essen, Pigafetta notierte: »Ratten wurden für einen halben Dukaten pro Stück verkauft, so sie einer habhaft werden konnten.« Ich sehe es förmlich vor mir, wie die abgemagerten Männer in ihrer zerrissenen Kleidung hinter den Ratten herrannten oder herkrochen. Wie sie sie häuteten, brieten und das Fleisch aßen, viel kann es nicht gewesen sein und vermutlich war es zäh. Ein kleines, damals ungelöstes Rätsel der Wissenschaft war, warum Ratten nicht an Skorbut erkranken. Heute weiß man, dass sie, anders als Menschen, selbst C–Vitamine produzieren. Ohne es zu wissen, nahmen die Männer also mit den Tieren Vitamin C zu sich und verringerten so die Gefahr, der tödlichen Krankheit zu erliegen.21 Viele Jahre nachdem ich durch die Meerenge gesegelt war, wurde mir in Togo in einem Café Rattenfleisch angeboten. Ich dachte an Magellan und ließ mich darauf ein. Das Fleisch war faserig.
Magellan wurde auf der Insel Mactan erschlagen, was nicht weiter verwunderlich war. Die Eingeborenen sahen in Magellans Ankunft eine Kriegshandlung. Aber eines der Schiffe, die »Victoria«, konnte die Reise über den Indischen Ozean, um das Kap der Guten Hoffnung und zurück nach Spanien zu Ende bringen. Die erste Weltumsegelung war vollbracht. Fünf Schiffe und zweihundertsiebzig Mann waren ursprünglich aufgebrochen, zurück kam ein Schiff mit achtzehn Mann, darunter Pigafetta, dem wir den Bericht über diese Reise verdanken.
Als ich dieses Buch las, war mir nicht wichtig, wer woher kam und wohin segelte, solange es nur dramatisch und abenteuerlich genug war. Aber die Erzählungen weckten in mir den Traum, selbst mit einem Schiff über große Meere zu fahren. Diesen Traum erfüllte ich mir im Herbst 1983, als ich mit drei Freunden über den Atlantik in die Karibik segelte.22 Auf dem Rückweg nach Norwegen, im Winter 1984, wäre das 35 Fuß lange Segelboot fast im Nordatlantik gesunken. Ein Sturm hob das Boot aus den Wellen und drehte es so sehr, dass die Masten viermal nacheinander auf die Wasseroberfläche schlugen und das Boot voll Wasser lief. Der Motor, der Kochapparat und die Toilette gingen dabei kaputt. Zwölf Tage und Nächte lang war ich bis auf die Knochen nass, ich zog mir Erfrierungen zu, und noch bevor wir wieder zu Hause waren, hatte ich mir geschworen, dass ich mich nie mehr freiwillig in eine solche Kälte begeben würde.
Die ältesten Berichte über Menschen, die in die Welt zogen, und viele der Bücher, die ich seither über Polexpeditionen gelesen habe, ähneln der Geschichte von Magellan. Helden – oder Männer, die zu Helden werden – reisen in ein geheimnisvolles Land, und wenn sie dort nicht sterben, kehren sie zurück und erzählen, was sie erlebt haben. Für Paul Zweig, den Verfasser des Buches The Adventurer, scheint es sehr plausibel, »dass die Erzählkunst aus dem Bedürfnis entstand, von einem Abenteuer zu berichten; dass der Mensch, der in gefahrvollen Begegnungen sein Leben riskiert, die ursprüngliche Definition dessen war, worüber sich zu sprechen lohnt«.23 Zweig verweist auf das Gilgamesch-Epos, die vermutlich älteste schriftlich überlieferte Erzählung der Welt. Gilgamesch lebte in Babylon und baute eine Stadtmauer, die als eines der sieben Weltwunder galt. Aber er fühlte sich eingesperrt und krank.24 Er hatte ein rastloses Herz und beschloss, in die Welt zu reisen, er wollte den Kampf gegen Ungeheuer und Drachen wagen, berühmt und bewundert werden, das Geheimnis des ewigen Lebens entdecken. Er fand die Pflanze, die ihn unsterblich machen würde, doch eine Schlange fraß sie auf, während er schlief. Das war sein Glück, ist es doch ein gravierender Nachteil des ewigen Lebens, dass das Dasein schnell sinnlos wirkt, wenn Leben und Tod darin nicht mehr vorkommen. Das gilt nicht nur für den gewöhnlichen Alltag zu Hause, sondern auch für die Expeditionen der Polfahrer.
☼
Ende der 1980er Jahre gab es drei junge Norweger, die davon träumten, zur Spitze der Erdkugel zu gehen: Geir Randby, Børge Ousland und ich. Wir teilten diesen Traum, aber Geir hatte, anders als Børge und ich, eine Jahreszahl für den Beginn der Expedition im Kopf. Da ist etwas Magisches mit Zahlen und Expeditionen. Erst ein konkreter Zeitpunkt macht aus einem Traum ein Vorhaben. Geirs Termin war März 1990, wir begannen mit den Vorbereitungen. Dann erkannte ich, dass meine Tagträume einen Schwachpunkt hatten. Sie berücksichtigten nicht die Möglichkeit des Scheiterns. Das machte sie ärmer, denn die Gefahren einer solchen Tour sind nicht nur real, sie verleihen ihr überhaupt erst Sinn. Wäre es nicht gefährlich, könnten viele zum Nordpol gehen.
Am zehnten Tag unserer Expedition kippte Geirs Pulka von einem Eishügel, er erlitt einen Bandscheibenvorfall und musste aufgeben. Er war bei allen Vorbereitungen dabei gewesen und hatte den kältesten Teil der Expedition mitgemacht. Er tat mir furchtbar leid, ihm fehlte das Quäntchen Glück, das man zum Erfolg braucht. Ich konnte weiterträumen, Børge und ich konnten weitergehen, aber für Geir war es schlimm. Er konnte die Niederlage kaum akzeptieren, wieder in Norwegen, hatte er eine Zeitlang das Gefühl, dass das Leben kaum noch einen Sinn hatte. Selbst ein Jahr später bekam er allein beim Gedanken an den Nordpol so heftige Schmerzen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Es war offenbar eine größere Belastung, mit einem gescheiterten Traum leben zu müssen, als weiterzugehen, wie Børge und ich es taten. Vielleicht war es Geirs größte Leistung, dass er die Niederlage überwand und zu neuen Arktis-Unternehmungen aufbrach.
Der imaginäre Nordpol
Erst nachdem wir am Nordpol gewesen waren, begriff ich, dass die Menschen in Europa, Asien und Amerika seit Jahrtausenden zum imaginären Nordpol gereist waren. Ich war besessen davon gewesen, zum Nordpol zu kommen, in den zwei Jahren vor unserem Aufbruch ging es bei jedem Buch, das ich las, und jedem Gespräch, das ich führte, immer nur darum, mich vorzubereiten. Erst als die Besessenheit aufhörte und ich vom Nordpol nach Norwegen zurückkehrte, begriff ich, dass es bei der Geschichte vom Nordpol um sehr viel mehr ging als nur darum, dort anzukommen.
Die Geschichte kann in drei Abschnitte unterteilt werden. Der erste ist der längste, er reicht von den Anfängen bis ins 16.Jahrhundert. Die Menschen, die in diesem Zeitraum auf der nördlichen Halbkugel lebten, machten sich Gedanken, was es nördlich des sichtbaren Horizonts zu entdecken gab. Dorthin reisen konnten sie nicht, also imaginierten sie den Nordpol.
Abschnitt zwei begann im 16.Jahrhundert und dauerte fast vierhundert Jahre. In dieser Zeit hatten viele Männer bei ihrem Versuch, den Pol zu erreichen, in Kälte und Eis ihr Leben aufs Spiel gesetzt. In den folgenden einhundert Jahren bis heute, Abschnitt drei, wurde der Nordpol zwar von immer mehr Männern erreicht, aber das Eis ist nun im Schwinden. Der Klimawandel, ausgelöst durch das rücksichtslose Verhalten der Menschheit, fordert seinen Tribut.
Heute ist fast jede Information binnen Sekunden auf einem Bildschirm verfügbar, da mag es wunderlich wirken, wenn jemand viel Zeit, Staunen und Nachdenken auf die Frage verwendet, wie die Welt zusammenhängt. Aber das ist es nicht, im Gegenteil. Im Laufe der Geschichte haben sich die Menschen immer wieder gefragt, wie die Welt zusammenpasst. Kopernikus’ Voraussetzungen zur Entwicklung seiner Theorien waren nicht besser als die seiner Vorgänger. Und dennoch stellten er und seine Zeitgenossen bahnbrechende Theorien auf. Auch ohne Teleskop, das damals noch nicht erfunden worden war. Der griechische Astronom und Kartograf Anaximander (610-546) soll eine der ersten Weltkarten der Geschichte angefertigt haben, auf der der Nordpol übrigens fehlt. Er konnte seine Zeitgenossen von zwei revolutionären Theorien überzeugen: dass die Welt sich frei im Weltall bewegt und nicht auf einer Stütze ruht und dass die Erdoberfläche sich wölbt und der Himmel folglich unter unseren Füßen weitergeht.25 Zu diesem Ergebnis kam Anaximander mehr als zweitausend Jahre bevor Ferdinand Magellan mit seiner »Victoria« die Welt umsegelte und über zweitausendfünfhundert Jahre bevor Astronauten die Erdkugel, frei im Weltraum schwebend, fotografierten.
Doch Nordpolfahrer sind ein gutes Beispiel dafür, dass Nachdenken und Staunen allein nicht immer zu belastbaren Ergebnissen führen. Vom 16. bis ins 19.Jahrhundert haben sie sich den Nordpol vorgestellt, aber weder die Meeresströmungen noch die Kälte, weder die Dunkelheit noch das Eis antizipiert, auf die sie dort treffen würden. Vielleicht waren sie zu selbstsicher, vielleicht fehlte ihnen Anaximanders Neugier, vielleicht staunten sie zu wenig.
Rigveda – Die früheste Quelle
Zum ersten Mal wurde der Nordpol, soweit ich weiß, in den Veden, der ältesten Sammlung indischer Schriften, erwähnt. Veda bedeutet auf Sanskrit Wissen, das hinduistische Werk besteht aus vier Büchern – Rigveda, Samaveda, Yajurveda sowie Atharvaveda. Sie sind vermutlich über mehrere tausend Jahre hinweg entstanden und umfassen Mythen, Lehren und Geschichten. Über Generationen sind diese mündlich überliefert worden, bis sie im Norden von Indien aufgeschrieben wurden. Die Niederschrift begann eintausendfünfhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung und dauerte etwa bis zu deren Beginn. Diese Schriften bilden zwar die Grundlage des Hinduismus, haben für diesen heute aber keine große Bedeutung mehr.
Der erste Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, Lokmanya Bâl Gangadhar Tilak (1856-1920), war Lehrer und Veden-Experte. Der Ehrentitel Lokmanya bedeutet der vom Volk anerkannte Führer, für die englische Kolonialmacht hingegen war er »der Vater der indischen Unruhen«. Als die Briten ihn in den 1890er Jahren inhaftierten, nutzte er die Zeit im Gefängnis, um sich intensiver mit den Veden zu beschäftigen – und mit der Rolle, die der Nordpol darin spielte.
Im ältesten Veda, dem Rigveda, fand er die Bestätigung für seine Annahme, dass nicht nur die Veden, sondern auch ein Teil der Menschheit ihren Ursprung am Nordpol haben.26 Tilaks Theorien faszinieren mich, weil er sich auf Texte bezieht, in denen Menschen ihre Beobachtungen festhielten, nachdem sie den nächtlichen Himmel studiert und sich Gedanken über den himmlischen Nordpol gemacht hatten. Möglicherweise konnten sie sich auf Berichte von Menschen stützen, die schon damals bis in die Arktis vorgedrungen waren, wenn auch sicher nicht bis zum Polpunkt, denn der lag in einem eisbedeckten Meer.
Als Tilak aus der Haft entlassen wurde, erschien sein Buch The Arctic Home in the Vedas. Er schreibt, am Nordpol habe vor der letzten Eiszeit ein wärmeres Klima geherrscht, was stimmt. Als dann eine neue Eiszeit einsetzte, seien die Bewohner nach Süden gewandert und in Europa und Asien sesshaft geworden. Weil Inseln und Kontinente ständig in Bewegung sind, ging Tilak davon aus, dass es zwischen den beiden letzten Eiszeiten am Nordpol oder südlich davon, mit Sicherheit aber im Norden von Europa und Asien Festland gab.
Er war nicht der Einzige, der so dachte. Wenige Jahre später, 1906, behauptete der Polfahrer Robert Peary, er habe im Polarmeer nördlich der Ellesmere-Insel Land gesehen. Er nannte es Crocker Land. Ein paar Jahre lang galt es als »The Lost Atlantis of the North« und wurde in neue Landkarten eingezeichnet.
Noch 1926 schrieb Roald Amundsen (1872-1928) in der norwegischen Tageszeitung Arbeiderbladet, er träume davon, eines Tages weit draußen auf dem Polarmeer auf Zivilisation zu stoßen. »Ich habe mich oft gefragt, was geschehen wäre, wenn eines der vielen hundert Walfangboote, die im Eis der Beringstraße stecken blieben, […] vom Treibeis weitergetragen und auf eine kleine Insel gestoßen wäre.« An Bord eines solchen Schiffs waren mitunter bis zu fünfzig Menschen, darunter auch Inuit und Frauen. Sie könnten aus dem Holz der Boote Unterkünfte gebaut haben, vielleicht waren die Sommer mild. »Sie hätten dort weiterleben, sich fortpflanzen und glücklich sein können«, durch das Treibeis für immer abgeschnitten vom Rest der Welt. Amundsen wusste natürlich, wie abwegig das klang, »aber es ist etwas, worüber ich oft nachgedacht habe«.27
Was wie ein Tagtraum klingt, war Amundsen durchaus ernst. Als er 1926 von Spitzbergen über den Nordpol nach Alaska flog, hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dabei eine Insel oder neues Land zu entdecken.
Im Rigveda hält ein Pfahl den Sternenhimmel über der Erde, das Himmelsgewölbe schwebt nicht im Weltraum, es kreist wie ein Rad um den Pfahl. Der Sternenhimmel geht nie auf oder unter, er sinkt zum Horizont und steigt dann wieder nach oben. Der Schöpfer des Universums wohnt jenseits der sieben Sterne.28
Die hinduistische und buddhistische Kosmologie bezeichnet den Berg Meru als Mittelpunkt aller Universen, nicht nur der physischen, sondern auch der metaphysischen und spirituellen. Niemand kann sagen, wo genau der Berg liegt, aber Tilak fand Hinweise im Rigveda, wonach Meru sich am Nordpol befinden muss.29
Nicht nur in der indischen, sondern in fast jeder Kultur werden die Götter mit einem hohen Berg in Verbindung gebracht.30 Vom Gipfel eines Berges ist der Weg zum Himmel am kürzesten. Und manche Berge reichen bis in den Himmel. Es gibt eine Stelle im Rigveda, wo zwischen Himmel und Berg kein Unterschied gemacht wird, Astronomie und Poesie gehen ineinander über, Berggipfel und Himmel werden eins, wenn die Göttin Sarasvati aus dem Himmel oder von einem hohen Berg herabsteigt zu den Menschen, die sie verehren.31
In der hinduistischen Mythologie ist der Berg Meru der Mittelpunkt von allem, er liegt an der Spitze der Weltachse, wo die Götter wohnen. Sonne, Sterne und der Mond umkreisen den Meru von links nach rechts, »für die, die dort leben, entsprechen Tag und Nacht zusammen einem Jahr«, wie es ja am Nordpol der Fall ist.32 »Und der Berg überwindet durch seinen Glanz die Dunkelheit der Nacht.«
Auch die iranische Schrift Videvdad, wie der Rigveda vor unserer Zeitrechnung entstanden, erwähnt eine Gegend, in der eine Nacht und ein Tag zusammen ein Jahr dauern. »Es gibt Sterne, Mond und Sonne gehen nur einmal im Jahr auf und unter, ein Jahr erscheint nicht länger als ein Tag.«33 Dass sich die Beschreibungen in iranischen und indischen Schriften so sehr ähneln, belege, so Tilak, dass sich die Schriften auf eine gemeinsame Quelle stützen konnten, und die müsse aus einer Zeit stammen, als der Nordpol von Menschen besiedelt war.
Schon in der Arktis gab es eine lange Tradition, Geschichten zu bewahren und weiterzugeben. Der dänisch-grönländische Entdecker Knud Rasmussen (1879-1933) war mit dem Hundegespann neunundzwanzigtausend Kilometer in Grönland, Alaska und der kanadischen Arktis unterwegs. Er berichtete von einer Begegnung mit einem jungen Mädchen auf Grönland. Als er ihr eine Geschichte erzählte, die er von einem älteren Mann im Norden von Alaska gehört hatte, erkannte die Grönländerin sie wieder. Rasmussen berichtete auch, dass der Mann aus Alaska mit den Erzähltraditionen der Inuit in Nordwestgrönland vertraut gewesen sei.
Als wir uns auf unsere Nordpol-Tour vorbereiteten, verbrachten wir einen Monat in Iqaluit, der größten Siedlung der Baffininsel. Da hörte ich eine Geschichte, die mir klarmachte, wie wichtig es ist, dass Erinnerungen zu Papier gebracht werden, damit sie nicht verloren gehen. Der Amerikaner Charles Francis Hall kam in den 1860er Jahren nach Baffin. Er war einer der ersten Nordpolfahrer, die von den Inuit lernen wollten. Zu seiner Überraschung konnten ihm diese in allen Einzelheiten berichten, wie der englische Polfahrer Martin Frobisher mit Schiff und Besatzung bei ihnen angekommen war – dessen Besuch damals dreihundert Jahre zurücklag.
Schon zu Halls Zeiten hatten die kanadischen Behörden erste Schritte in die Wege geleitet, um die Inuit zu zivilisieren, die verschiedenen Assimilierungsprogramme erreichten Mitte des 20.Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Kinder und Jugendliche wurden von ihren Familien getrennt und in Internaten untergebracht, das Schulpensum wurde von den kanadischen Behörden vorgegeben, und ihre mündlich überlieferten Geschichten und ihre Kultur wurden dabei fast vollständig ausgelöscht.34