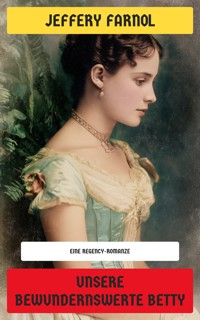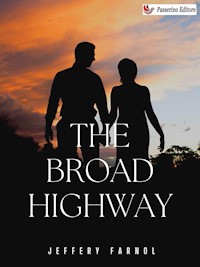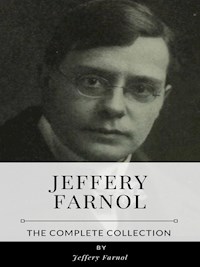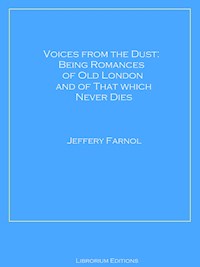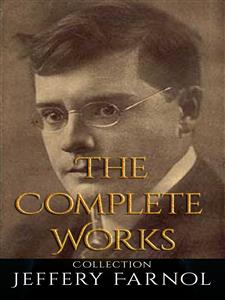0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meine Lady Kaprize von Jeffery Farnol ist ein lebendiger, von Humor und Eleganz durchdrungener Liebesroman, der das englische Landleben der Regency-Ära in betörenden Farben malt. Im Zentrum steht Sir Richard Vibart, ein junger, impulsiver Gentleman, der nach einem Streit mit seinem wohlhabenden Onkel dessen prächtiges Haus und den bequemen Lebensstil hinter sich lässt. Mit nichts als seinem Stolz und einer gehörigen Portion Sturheit im Gepäck sucht Richard nach einer neuen Bestimmung – und wird unversehens in ein Abenteuer verwickelt, das sein Herz und sein Schicksal herausfordern wird. Sein Weg kreuzt sich mit der faszinierenden Lady Sophie, einer Frau voller Widersprüche und Kaprizen: Sie ist schön und willensstark, verspielt und doch verletzlich, verführerisch und mit einem scharfen Verstand gesegnet. Ihr überraschendes Auftauchen in Richards Leben ist wie ein plötzlicher Sommersturm: heftig, unvorhersehbar, unwiderstehlich. Zwischen den beiden entspinnt sich ein funkelndes Wechselspiel aus neckischen Wortgefechten, gegenseitigen Herausforderungen und tiefen Blicken, die mehr verraten als jedes höfische Kompliment. Nicht weniger reizvoll ist das farbenprächtige Panorama aus Nebenfiguren, das Farnol mit leichter Hand zeichnet: skurrile Landadelige, verschrobene Hausmädchen, alte Freunde und erbitterte Rivalen. Die ländliche Kulisse mit ihren dichten Wäldern, alten Schlössern, verwunschenen Gärten und lauen Nächten voller Duft und Geheimnis ist mehr als bloße Dekoration – sie wird zum Spiegel der aufkeimenden Gefühle zwischen Richard und Lady Sophie. Farnol lässt die Funken sprühen: Die Spannung zwischen Stolz und Sehnsucht, zwischen Rollenspiel und echter Nähe, zieht sich durch jede Szene. Doch was ist stärker – die Launen des Herzens oder die Schranken der Gesellschaft? Die Antwort bleibt bis zum letzten Kapitel verlockend offen. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Meine Lady Kaprize
Inhaltsverzeichnis
I
SCHATZSCHATULLE
Ich saß beim Angeln. Natürlich hatte ich nichts gefangen – das hab ich selten, und ich mag Angeln auch nicht besonders, aber ich hab trotzdem fleißig weitergemacht, weil es die Umstände so wollten.
Das war alles Lady Warburton zu verdanken, Lisbeths Tante mütterlicherseits. Wer Lisbeth ist, erfahrt ihr, wenn ihr euch die Mühe macht, diese wahrheitsgetreuen Erzählungen zu lesen – für den Moment reicht es zu wissen, dass sie seit ihrer Jugend Waise ist und außer ihrer verheirateten Schwester Julia und ihrer Tante (mit großem T) – der oben erwähnten Lady Warburton – keine lebenden Verwandten hat.
Lady Warburton ist klein und etwas knochig, mit einem spitzen Kinn und einer noch spitzeren Nase, und sie benutzt immer eine Lorgnette; außerdem besitzt sie viel weltlichen Reichtum.
Genau vor einer Woche hatte Lady Warburton mich gebeten, sie zu besuchen – sie hatte mich mit einer merkwürdigen Genauigkeit durch ihre Lorgnette betrachtet und mir sanft, aber bestimmt (Lady Warburton ist immer bestimmt) zu verstehen gegeben, dass Elizabeth zwar ein liebes Kind sei, aber jung und dazu neige, ein wenig eigensinnig zu sein. Sie (Lady Warburton) sei der Meinung, dass Elizabeth die langjährige Freundschaft zwischen uns mit etwas Stärkerem verwechselt habe. Dass sie (Lady Warburton) zwar durchaus zu schätzen wusste, dass jemand, der Bücher und gelegentlich ein Theaterstück schrieb, nicht unbedingt unmoralisch sein musste – dennoch sei ich natürlich ein schrecklicher Bohemien, und die Luft der Boheme sei nicht dazu geeignet, jene eheliche Harmonie zu fördern, die sie (Lady Warburton) als Elizabeths Tante, die ihr anstelle einer Mutter nahestehe, sich wünschen könne. Unter diesen Umständen waren meine Avancen daher – usw., usw.
An dieser Stelle möchte ich meiner Selbstgerechtigkeit halber sagen, dass ich trotz ihrer wortreichen Rede zunächst versucht hatte, Widerstand zu leisten; aber wer hätte hoffen können, gegen eine Frau mit einer so unerschütterlichen Nase und einem so unerschütterlichen Kinn zu bestehen, die darüber hinaus mit einer Lorgnette mit tödlicher Präzision zielen konnte? Wäre Lisbeth an meiner Seite gewesen, hätte es vielleicht anders kommen können, aber sie war aufs Land gefahren – so hatte Lady Warburton mir mitgeteilt. So allein und ihr ausgeliefert, gelang es ihr, mir das halbe Versprechen abzuringen, dass ich meine Avancen für sechs Monate einstellen würde, „nur um der lieben Elizabeth Zeit zu geben, ihre eigenen Gefühle in dieser Angelegenheit zu erkennen“.
Das war letzten Montag. Am darauffolgenden Mittwoch, als ich ziellos durch Piccadilly schlenderte, im Streit mit dem Schicksal und vor allem mit mir selbst, fiel mein Blick auf die Herzogin von Chelsea.
Die Herzogin ist bekannt als „Redekünstlerin wie Bach“, weil sie, wenn sie einmal anfängt zu reden, nicht mehr aufhört. In meiner damaligen Stimmung gehorchte ich daher mit einem Gefühl des Aufstands der Aufforderung ihres Sonnenschirms und ging zu ihrem Brougham hinüber.
„Ist sie schon weg?“, war ihre Begrüßung, als ich meinen Hut hob. „Lisbeth“, nickte sie, „ich habe zufällig etwas über sie gehört, weißt du.“
Es ist vielleicht seltsam, aber die Herzogin „hört“ im Allgemeinen zufällig etwas über alles. „Und du hast dich tatsächlich dazu drängen lassen, dieses Versprechen zu geben – Dick! Dick! Ich schäme mich für dich.“
„Wie hätte ich mir helfen sollen?“, begann ich. „Sehen Sie ...“
„Armer Junge!“, sagte die Herzogin und tätschelte mich liebevoll mit dem Griff ihres Sonnenschirms. „Das war natürlich nicht zu erwarten. Weißt du, ich kenne sie – vor vielen, vielen Jahren war ich mit Agatha Warburton in der Schule.“
„Aber damals hat sie wahrscheinlich noch keine Lorgnetten benutzt, und ...“
„Ihre Nase war aber genauso spitz – ich habe sie immer ‚spitz‘ genannt“, nickte die Herzogin. „Und sie hat Lisbeth tatsächlich weggeschickt – das arme Kind – und das auch noch an einen so schrecklichen, ruhigen Ort, wo sie niemanden zum Reden hat außer diesem jungen Selwyn.
„Verzeih, Herzogin, aber ...“
„Horace Selwyn, aus Selwyn Park – Cousin von Lord Selwyn aus Brankesmere. Agatha hat das schon lange heimlich geplant, weißt du. Natürlich wäre es in gewisser Weise eine gute Partie – reich und so –, aber ich muss sagen, er langweilt mich furchtbar – so ernst und pedantisch!“
„Wirklich!“, rief ich aus, „meinst du etwa ...“
„Ich gehe davon aus, dass sie die beiden verheiratet hat, bevor sie sich versehen – Agatha ist furchtbar entschlossen. Ihr Charakter steht ihr in der Nase und am Kinn.“
„Aber Lisbeth ist kein Kind mehr – sie hat ihren eigenen Willen und ...“
„Stimmt“, nickte die Herzogin, „aber ist das ein Gegengewicht zu Agathas Kinn? Und außerdem ist es mehr als wahrscheinlich, dass du inzwischen zum Gegenstand ihrer bittersten Verachtung geworden bist.
„Aber, meine liebe Herzogin ...“
„Ach, Agatha ist eine geborene Diplomatin. Natürlich hat sie schon vorher geschrieben und es geschafft, dir zu vermitteln, dass du ein Monster der Hinterhältigkeit bist, ohne es direkt zu sagen; und Lisbeth, das arme Kind, weint wahrscheinlich hemmungslos oder bildet sich ein, dass sie dich hasst, und ist aus purer Trotzreaktion bereit, den ersten Heiratsantrag anzunehmen, den sie bekommt.“
„Du meine Güte!“, rief ich aus, „was soll ich denn jetzt tun?“
„Du könntest angeln gehen“, schlug die Herzogin nachdenklich vor.
„Angeln!“, wiederholte ich, „– äh, sicher, aber ...“
„Riverdale ist ein sehr hübscher Ort, wie man mir sagt“, fuhr die Herzogin in demselben nachdenklichen Ton fort; „dort gibt es ein Haus, ein schönes altes Anwesen namens Fane Court. Es liegt direkt am Fluss und grenzt, glaube ich, an den Selwyn Park.“
„Herzogin“, rief ich aus, während ich mir die Adresse auf meinen Ärmel notierte, „ich bin dir zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet ...“
„Aber, aber!“, sagte Ihre Gnaden.
„Ich denke, ich fange noch heute damit an und ...“
„Das ist wirklich das Beste, was du tun kannst“, nickte die Herzogin.
Und so kam es, dass ich an diesem Augustnachmittag im Schatten der Erlen saß und angelte, während der Rauch meiner Pfeife in der Sonne schwebte.
Durch geschicktes Fragen hatte ich vom Wirt der „Drei Fröhlichen Angler“ den genauen Standort von Fane Court, dem Wohnsitz von Lisbeths Schwester, in Erfahrung gebracht und, geleitet von seiner Beschreibung, diesen abgelegenen Ort gewählt, von dem aus ich, nur den Kopf wendend, einen Blick auf die hohen Schornsteine des Hauses erhaschen konnte, die sich über dem wogenden Grün der Baumwipfel erhoben.
Es ist schön, an einem heißen Sommernachmittag in einer schattigen Laube auf dem Rücken zu liegen und durch ein Netz aus Ästen in den unendlichen blauen Himmel zu starren, während die Luft erfüllt ist vom Rascheln der Blätter und dem Rauschen des Wassers im Schilf. Oder sich auf den faulen Ellbogen stützen, um verschwitzte, kurzatmige, purpurrote Elendsgestalten zu beobachten, die Boote stromauf oder stromab treiben und sich jeweils einbilden, dass es ihnen Spaß macht. Das Leben unter solchen Umständen mag, wie ich sage, sehr schön erscheinen, doch ich war nicht glücklich. Die Worte der Herzogin schienen mich überall zu umgeben.
„Du bist inzwischen zum Gegenstand ihrer bittersten Verachtung geworden“, schluchzte der Wind.
„Du bist geworden“, usw., usw., stöhnte der Fluss. Daher sah ich meiner Begegnung mit Lisbeth mit nicht geringer Beklommenheit entgegen.
In diesem Moment teilten sich die Büsche und ein Junge erschien. Er war ein etwas kleiner Junge, gekleidet in einen Samtanzug mit Spitzenkragen, die beide reichlich mit Schlamm bespritzt waren. Er trug seine Schuhe und Strümpfe unter einem Arm und schwang in der anderen Hand einen Haselnusszweig. Er stand mit seinen kleinen braunen Beinen weit auseinander und betrachtete mich mit kritischem Blick; aber als er endlich sprach, war seine Haltung ausgesprochen freundlich.
„Hallo, Mann!“
„Hallo“, antwortete ich, „und wer bist du?“
„Also, mein richtiger Name ist Reginald Augustus, aber alle nennen mich ‚Der Kobold‘.“
„Das kann ich mir gut vorstellen“, sagte ich und betrachtete seine schlammige Gestalt.
„Was ist denn bitte ein Kobold?“
„Ein Kobold ist eine Art Engel.“
„Aber“, wandte er nach kurzem Nachdenken ein, „ich habe keine Flügel und so – und auch keine Trompete.“
„Deine Art hat nie Flügel und Trompeten.“
„Ach so“, sagte er und setzte sich hin, um den Schlamm mit seinen Strümpfen von den Beinen zu wischen.
„Du bist aber ganz schön schmutzig“, sagte ich. Der Junge warf einen verstohlenen Blick auf seine zerzausten Kleider.
„Ich fürchte, ich bin auch ein bisschen nass“, sagte er zögernd. „Weißt du, ich habe ‚Römer‘ gespielt und musste durch das Wasser waten, weil ich der Fahnenträger war, der mit seinem Schwert in die See sprang und rief: ‚Folgt mir!‘ Du erinnerst dich doch an ihn, oder? Er steht im Geschichtsbuch.“
„Natürlich“, nickte ich, „eine wahrhaft heldenhafte Figur. Aber wenn du die Römer warst, wo waren dann die alten Briten?“
„Oh, die waren das Schilf, weißt du; du hättest sehen sollen, wie ich sie erschlagen habe. Das war toll; sie sind umgefallen wie – wie –“
„Wie Korn vor der Sichel“, schlug ich vor.
„Ja, genau!“, rief er. „Die Schlacht tobte stundenlang.“
„Du musst ziemlich müde sein.“
„Natürlich nicht“, antwortete er mit empörtem Blick. „Ich bin kein Mädchen – und ich bin fast neun.“
„Deinem Tonfall nach zu urteilen, bist du kein Fan des weiblichen Geschlechts – du magst keine Mädchen, was, Imp?“
„Natürlich nicht“, erwiderte er, „Mädchen sind doch albern. Da ist zum Beispiel Dorothy, weißt du, neulich haben wir Hinrichtungen gespielt – sie war Maria Stuart und ich war der Henker. Ich hab eine schöne Axt aus Holz und Silberpapier gebastelt, weißt du, und als ich ihr den Kopf abgeschlagen hab, hat sie schrecklich geweint, dabei hab ich ihr nur ganz leicht auf den Kopf geschlagen – und dafür hab ich um sechs Uhr ins Bett geschickt worden. Ich glaub, sie hat absichtlich geweint – das war gemein, oder?“
„Meine liebe kleine Teufelin“, sagte ich, „je älter du wirst, desto deutlicher wirst du die Verderbtheit des weiblichen Geschlechts erkennen.“
„Weißt du, ich mag dich“, sagte er und sah mich nachdenklich an, „ich finde dich toll.“
„Das ist aber nett von dir, Imp; wie alle meiner Art habe ich eine Schwäche für Schmeichelei – bitte fahr fort.“
„Ich meine, ich finde dich lustig.“
„Was das angeht“, sagte ich, den Kopf schüttelnd und seufzend, „der Schein trügt oft; in vielen schönen Blüten steckt ein Schädling.“
„Ich mag Würmer auch sehr“, sagte der Kobold.
„Wirklich?“
„Ja. Ich habe gestern eine ganze Tasche voll gefangen, aber meine Tante hat mich erwischt und mich gezwungen, sie alle wieder freizulassen.“
„Ah ja“, sagte ich mitfühlend, „das war die Frau.“
„Ich hab jetzt nur noch einen“, fuhr der Kobold fort; er steckte die Hand in die Tasche seiner Kniehose, zog einen etwa fünfzehn Zentimeter langen, schleimigen Wurm heraus und hielt ihn mir auf seiner kleinen, schmutzigen Handfläche hin.
„Der ist schön fett!“, sagte ich.
„Ja“, nickte der Kobold; „ich habe ihn unter den Stachelbeersträuchern gefangen.“ Er ließ ihn zurück in seine Hosentasche fallen und zog seine Schuhe und Strümpfe an.
„Ich fürchte, ich bin ein bisschen schmutzig“, sagte er plötzlich.
„Ach, es könnte schlimmer sein“, beruhigte ich ihn.
„Meinst du, sie werden es bemerken?“, fragte er und verrenkte sich auf schreckliche Weise, um seinen Rücken zu betrachten.
„Nun“, zögerte ich, „das kommt ganz darauf an.“
„Dorothy, Betty, die Köchin, oder die Gouvernante sind mir egal – ich mache mir nur Sorgen um Tante Lisbeth.“
„Tante – wer?“, rief ich, ohne auf die Grammatik zu achten.
„Tante Lisbeth“, wiederholte der Kobold.
„Wie ist sie denn so?“
„Oh, sie ist groß geworden, aber sie ist nett. Sie ist gekommen, um sich um Dorothy und mich zu kümmern, während Mutter weg ist, um schön und stark zu werden – oh, Tante Lisbeth ist fröhlich, weißt du.“
„Mit schwarzen Haaren und blauen Augen?“
Der Kobold nickte.
„Und ein Grübchen am Mundwinkel?“, fragte ich verträumt weiter. „Ein Grübchen, das einen Mann zum alten Herrn selbst führen würde.“
„Welcher alte Herr?“
„Oh, ein ziemlich zwielichtiger alter Herr“, antwortete ich ausweichend.
„Und kennst du meine Tante Lisbeth?“
„Das halte ich für sehr wahrscheinlich – ich bin mir sogar sicher.“
„Dann könntest du mir bitte dein Taschentuch leihen? Ich habe meins als Fahne an einen Busch gebunden, weißt du, und es ist weggeweht worden.“
„Komm lieber her, dann reibe ich dich trocken, mein kleiner Kobold.“ Er gehorchte und bedankte sich überschwänglich.
„Hast du auch Tanten?“, fragte er, während ich mich um seine schlammige Person kümmerte.
„Nein“, antwortete ich und schüttelte den Kopf, „leider habe ich nur Tanten, und das ist etwas ganz anderes.“
„Oh“, sagte der Imp und sah mich verwirrt an, „sind sie nett – ich meine, lesen sie dir manchmal aus dem Geschichtsbuch vor und helfen sie dir beim Bootfahren und Paddeln?“
„Paddeln?“, wiederholte ich.
„Ja. Meine Tante Lisbeth macht das. Neulich sind wir ganz früh aufgestanden und spazieren gegangen, und wir kamen an den Fluss, also haben wir unsere Schuhe und Strümpfe ausgezogen und gepaddelt; das war so lustig, weißt du. Und als meine Tante nicht hingesehen hat, habe ich einen Frosch gefunden und ihn in ihren Strumpf gesteckt.“
„Sehr strategisch, mein kleiner Kobold! Und?“
„Es war total lustig“, sagte er und lächelte verträumt. „Als sie ihn anziehen wollte, schrie sie so hoch wie Dorothy, wenn ich sie ein bisschen kneife – und dann warf sie beide weg, weil sie Angst hatte, dass in beiden Frösche waren. Dann zog sie ihre Schuhe ohne Strümpfe an, also habe ich sie versteckt.“
„Wo?“, rief ich gespannt.
„Reggie!“, rief eine Stimme in einiger Entfernung – eine Stimme, die ich mit einem Schauder erkannte. „Reggie!“
„Imp, möchtest du eine halbe Krone?“
„Natürlich möchte ich das, aber du könntest bitte meinen Rücken putzen“, und er begann, sich fieberhaft mit seiner Mütze zu reiben, wie mit einer Bürste.
„Hör mal“, sagte ich und zog die Münze heraus, „sag mir, wo du sie versteckt hast – schnell – und ich gebe dir das.“ Der Imp streckte seine Hand aus, aber in diesem Moment teilten sich die Büsche und Lisbeth stand vor uns. Sie stieß einen kleinen, leisen Schrei der Überraschung aus, als sie mich sah, und runzelte dann die Stirn.
„Du?“, rief sie aus.
„Ja“, antwortete ich und hob meine Mütze. Und da blieb ich stehen und versuchte verzweifelt, mich an die Worte zu erinnern, die ich so sorgfältig vorbereitet hatte – die Begrüßung, die mein Verhalten erklären und ihren Groll von Anfang an entschärfen sollte. Aber so sehr ich mir auch den Kopf zerbrach, mir fiel nichts ein außer dem Vorwurf in ihren Augen, ihrem verächtlichen Mund und Kinn und diesem einen Satz, der mir nicht aus dem Kopf ging:
„Ich nehme an, ich bin inzwischen zum Gegenstand deiner bittersten Verachtung geworden?“ hörte ich mich sagen.
„Meine Tante hat mir alles erzählt, und natürlich ...“
„Lass mich erklären“, begann ich.
„Wirklich, das ist überhaupt nicht nötig.“
„Aber Lisbeth, ich muss – ich bestehe darauf –“
„Reginald“, sagte sie und wandte sich dem Imp zu, der immer noch mit seiner Mütze beschäftigt war, „es ist fast Teezeit, und – was hast du dir denn da angetan?“
„In der letzten halben Stunde“, warf ich ein, „haben wir uns über das andere Geschlecht unterhalten.“
„Und über Würmer geredet“, fügte der Imp hinzu. „Dieser Mann mag auch Würmer, Tante Lisbeth – ich mag ihn.“
„Danke“, sagte ich, „aber ich bitte dich, diese sehr förmliche Anrede wegzulassen. Nenn mich einfach Onkel Dick.“
„Aber du bist doch nicht mein Onkel Dick“, wandte er ein.
„Vielleicht noch nicht, aber man weiß ja nie, was eines Tages passieren kann, wenn deine Tante uns für würdig hält – also nutze die Gunst der Stunde, mein kleiner Kobold, und nenn mich Onkel Dick.“
Was Lisbeth auch hätte sagen können oder nicht, wurde durch das Trippeln von Schritten erledigt, und ein kleines Mädchen kam ins Bild, mit einem kleinen, flauschigen Kätzchen im Arm.
„Oh, Tante Lisbeth“, begann sie, hielt aber inne und starrte mich über den Rücken des flauschigen Kätzchens hinweg an.
„Hallo, Dorothy!“, rief der Kobold. „Das ist Onkel Dick. Du kannst ihm die Hand geben, wenn du möchtest.“
„Ich wusste gar nicht, dass ich einen Onkel Dick habe“, sagte Dorothy zögernd.
„Oh ja, das ist in Ordnung“, antwortete der Kobold beruhigend. „Ich habe ihn gefunden, weißt du, und er mag auch Würmer!“
„Guten Tag, Onkel Dick“, sagte sie auf eine seltsame, altmodische Art. „Reginald findet immer irgendwelche Sachen, weißt du, und er mag auch Würmer!“ Dorothy reichte mir schüchtern die Hand.
Von irgendwoher in der Nähe erklang das silberne Läuten einer Glocke.
„Oh, es ist schon Zeit für den Tee!“, rief Lisbeth. „Und Reginald, du musst deine schmutzigen Kleider wechseln. Sagt Tschüss zu Herrn Brent, Kinder, und kommt mit.“
„Imp“, flüsterte ich, als die anderen sich umdrehten, „wo hast du die Strümpfe versteckt?“ Und ich steckte ihm die halbe Krone in seine bereitgehaltene Handfläche.
„Am Fluss steht ein Baum – ein sehr großer und mächtiger Baum, weißt du, mit vielen herausstehenden Ästen und einem Loch in der Mitte – da sind sie drin.“
„Reginald!“, rief Lisbeth.
„Flussaufwärts oder flussabwärts?“
„Da lang“, antwortete er und zeigte vage flussabwärts; und mit einem Nicken, das die gelben Locken über seine Augen fallen ließ, huschte er davon.
„Entlang des Flusses“, wiederholte ich, „in einem großen, fetten Baum mit vielen abstehenden Ästen!“ Das klang ein bisschen ungenau, fand ich – aber ich konnte es nur versuchen. Also packte ich meine Angelrute zusammen und machte mich auf die Suche.
Es war vielleicht seltsam, aber fast jeder Baum, den ich sah, schien entweder „groß“ oder „dick“ zu sein – und alle hatten „herausstehende“ Äste.
So stand die Sonne schon tief im Westen, und ich zündete gerade meine fünfte Pfeife an, als ich endlich den gesuchten Baum entdeckte.
Es war eine große, gekappte Eiche, die direkt am Ufer des Baches stand und durch ihre ungewöhnliche Größe und die Tatsache, dass sie irgendwann einmal vom Blitz getroffen worden war, leicht zu erkennen war. Die Beschreibung des Kobolds war im Großen und Ganzen richtig gewesen; sie war „fett“, unheimlich fett, und ich eilte freudig vorwärts.
Ich war noch ein Stück entfernt, als ich in der Ferne einen weißen Rock flattern sah, und – ja, tatsächlich, da war Lisbeth, die ebenfalls schnell ging und viel näher am Baum stand als ich.
Von einer plötzlichen Überzeugung getrieben, ließ ich meinen Stock fallen und begann zu rennen. Sofort begann auch Lisbeth zu rennen. Ich warf meinen Korb weg und sprintete, so schnell ich konnte. Ich hatte mir in meiner Zeit an der Universität einen kleinen Ruf in dieser Disziplin erworben, dennoch erreichte ich den Baum nur mit wenigen Metern Vorsprung. Ich warf mich auf die Knie und begann fieberhaft zu suchen, und bald – mehr durch Glück als durch Geschick – stießen meine wahllos tastenden Finger auf ein weiches, seidiges Bündel. Als Lisbeth errötet und keuchend herankam, hielt ich es in meinen Händen.
„Gib sie mir!“, rief sie.
„Es tut mir leid ...“
„Bitte“, flehte sie.
„Es tut mir wirklich leid ...“
„Herr Brent“, sagte Lisbeth und richtete sich auf, „ich bitte Sie um meine – um sie.“
„Entschuldige, Lisbeth“, antwortete ich, „aber wenn ich mich richtig an das Gesetz über Fundsachen erinnere, gehört einer davon der Krone und einer mir.“
Lisbeth wurde richtig wütend – eine ihrer wenigen schlechten Eigenschaften.
„Du gibst sie sofort zurück – sofort?“
„Ganz im Gegenteil“, sagte ich ganz sanft, „da die Krone für eine davon nichts gebrauchen kann, werde ich beide behalten, um in langen, einsamen Nächten davon zu träumen.“
Lisbeth stampfte tatsächlich mit dem Fuß auf, und ich steckte „sie“ in meine Tasche.
„Woher wusstest du, dass sie hier waren?“, fragte sie nach einer Pause.
„Ich wurde zu einem Baum mit ‚herausstehenden‘ Ästen geführt“, antwortete ich.
„Oh, dieser Kobold!“, rief sie aus und stampfte wieder mit dem Fuß auf.
„Weißt du, ich habe meinen Neffen schon ganz lieb gewonnen“, sagte ich.
„Er ist nicht dein Neffe“, rief Lisbeth ziemlich aufgebracht.
„Rechtlich gesehen vielleicht nicht, aber genau dabei könntest du uns so helfen, Lisbeth. Ein Junge, der nur eine Tante hier und da hat, ist sozusagen unausgeglichen; er braucht den stärkeren Einfluss eines Onkels. Nicht“, fuhr ich hastig fort, „dass ich Tanten herabwürdigen würde – übrigens hat er nur eine, glaube ich?“ Lisbeth nickte kühl.