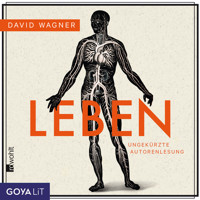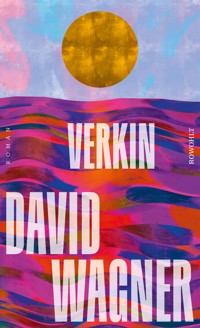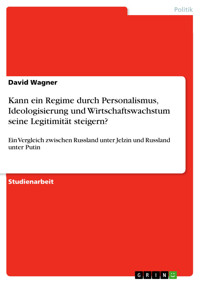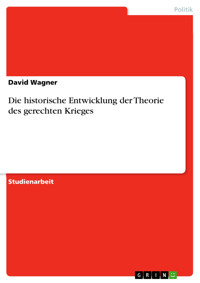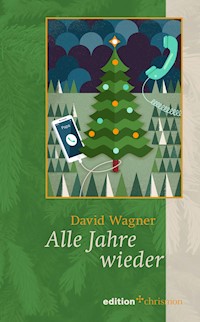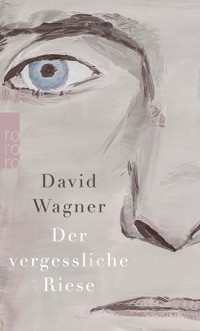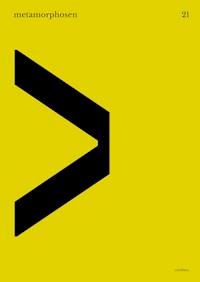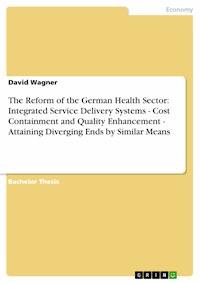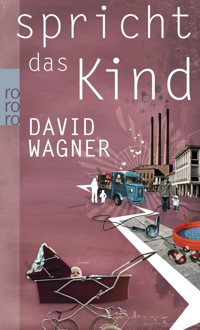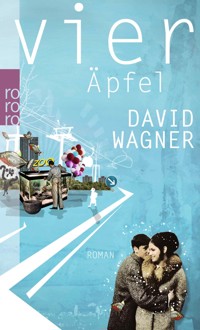7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus einem verschwundenen Zauberreich – dem Westdeutschland der siebziger und achtziger Jahre Für die allermeisten ist eine Hose nicht viel mehr als ein Stück Stoff. Nicht so für den Ich-Erzähler dieses außergewöhnlichen Romans. Vielleicht liegt es daran, daß er an jenem Tag, als er seine nachtblaue Hose erstmals trägt, eine junge Frau kennenlernt. Eine Berliner Liebesgeschichte schließt sich an, eine Reise an den Rhein und in die Kindheit einer Generation. «So war sie, die Bundesrepublik, so wie sie der Held in David Wagners Debütroman erinnert. Mit Leichtigkeit, Witz und großer sprachlicher Begabung erzählt.» (Die Welt) «Raffiniert konstruiert, sprachlich geschliffen und sehr unterhaltsam.» (Focus) «Ein nahezu perfektes Webstück, das den Leser bis zuletzt mit geschmeidiger Eleganz umhüllt.» (Der Spiegel) «Ein brillantes Debüt.» (Der Standard) «Alles, wovon Wagner erzählt, kennen wir genauestens: so ist es gewesen.» (Die Zeit) «In ‹Meine nachtblaue Hose› schlingen sich Erinnerungsfäden auf kunstvolle Weise in- und umeinander, bis kleine Muster entstehen und das Gewebe dicht und geschmeidig wird.» (Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
David Wagner
Meine nachtblaue Hose
Roman
Über dieses Buch
Aus einem verschwundenen Zauberreich – dem Westdeutschland der siebziger und achtziger Jahre
Für die allermeisten ist eine Hose nicht viel mehr als ein Stück Stoff. Nicht so für den Ich-Erzähler dieses außergewöhnlichen Romans. Vielleicht liegt es daran, daß er an jenem Tag, als er seine nachtblaue Hose erstmals trägt, eine junge Frau kennenlernt. Eine Berliner Liebesgeschichte schließt sich an, eine Reise an den Rhein und in die Kindheit einer Generation.
«So war sie, die Bundesrepublik, so wie sie der Held in David Wagners Debütroman erinnert. Mit Leichtigkeit, Witz und großer sprachlicher Begabung erzählt.» (Die Welt)
«Raffiniert konstruiert, sprachlich geschliffen und sehr unterhaltsam.» (Focus)
«Ein nahezu perfektes Webstück, das den Leser bis zuletzt mit geschmeidiger Eleganz umhüllt.» (Der Spiegel)
«Ein brillantes Debüt.» (Der Standard)
«Alles, wovon Wagner erzählt, kennen wir genauestens: so ist es gewesen.» (Die Zeit)
«In ‹Meine nachtblaue Hose› schlingen sich Erinnerungsfäden auf kunstvolle Weise in- und umeinander, bis kleine Muster entstehen und das Gewebe dicht und geschmeidig wird.» (Süddeutsche Zeitung)
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2011
Copyright © 2000 by Alexander Fest Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther
Umschlagillustration Peter Engels/www.cremecaramel.de
ISBN Buchausgabe 978-3-499-25640-0 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-01151-9
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
marmelade
goldfische
meine nachtblaue hose
Diese Geschichte begann ...
[Kapitel]
marmelade
Fast immer, wenn ich in einem Geschäft eine Umkleidekabine betrete, den Vorhang hinter mir schließe und eine Hose anprobiere, muß ich an Fe und unsere kurze Reise nach Köln denken. An dem Tag, an dem wir uns am Bahnhof Zoologischer Garten trafen, fing es mittags an zu regnen. Ihr Ex-Freund Anatol, mit dem sie damals noch zusammenwohnte, brachte sie zum Bahnsteig. Während er mir aus einiger Entfernung zuwinkte, wunderte ich mich, daß Fe einen Rock statt der gewohnten Hose trug.
Die Fahrt, die vor dem Ausbau der Strecke noch länger als sieben Stunden dauerte, verbrachten wir im Abteil und im Speisewagen. In Köln, wo wir ihre Eltern besuchen wollten, regnete es nicht weniger als in Berlin. Ihr Vater wartete nicht auf dem Bahnsteig, er saß in seinem Wagen auf dem Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof. Fe umarmte ihn und setzte sich auf den Beifahrersitz, ich stieg hinten ein und sah von der Rückbank zwischen den beiden Hinterköpfen, dem Haarkranz und den halblangen, mittelblonden Haaren, hindurch nach vorne. Der einarmige Scheibenwischer bewegte sich hin und her, das Auto erinnerte mich an den Mercedes meiner Mutter. Fes Vater stellte Fragen, wie fast alle Väter sie stellen. Es war Sonntag und zu spät für Kaffee und Kuchen.
Als wir über die abgesenkte Bordsteinkante auf den Stellplatz vor dem Garagentor fuhren, stand ihre Mutter, sie mußte das Motorengeräusch erkannt haben, schon in der Haustür. Fe, die ihre Brille und nicht ihre Linsen trug, sagte, Mama hat sich ja die Haare schneiden lassen. Von ihrer Mutter wußte ich, daß sie nachts nur mit Ohropax schlafen kann, daß sie keine Uhr ticken hören mag und jeden Morgen trotz Schlafbrille lange vor sechs Uhr aufwacht. Wenn sie aufsteht, gibt es selten Dringendes zu tun, nichts, was nicht warten könnte, hatte Fe mir erzählt, und ich wußte auch, daß das Bett ihres Vaters ein Zimmer weiter steht. Wochentags liest sie in aller Frühe mit halber Lesebrille Zeitung, schaut der portugiesischen Putzfrau auf die Finger und ruft ihr ab und an Anweisungen zu, die wie Vorschläge klingen sollen. So, wie ich sie von dem Photo her kannte, das in Fes Berliner Küche neben dem Herd hing – es zeigte sie auf einem Bahnsteig, die Haare fielen ihr auf die Schultern, und die Gesten, die man mit langen Haaren haben kann, fehlten ihr noch nicht –, gefiel sie mir besser, dachte ich. Aus dem Türrahmen schaute sie auf ihre Tochter, die ihr entgegenging, maß sie von oben bis unten und streifte mit ihrem Blick meine nachtblaue Hose, die meine Mutter mir in England gekauft hatte. Ich trat auf sie zu und gab ihr die Hand. Als ich auf der Fußmatte vor ihr stand, bewegten sich die Sohlen meiner Schuhe wie ferngesteuert hin und her. Fe führte mich, vorbei an dem Flügel im Eingang, auf dem Noten aufgeschlagen lagen, tiefer ins Haus hinein. Ihr Vater bot uns zu trinken an, ihre Mutter verschwand in der zum Eßzimmer hin offenen Küche.
An diesem Abend, ihre Mutter hatte gekocht, haben wir nicht mehr viel unternommen. Wir machten einen kleinen Spaziergang, überquerten die Rheinuferstraße und die Stadtbahngleise, auf denen ich, was ich nicht wollte, über Wesseling, Bonn Hauptbahnhof, Auswärtiges Amt bis zum Museum König und weiter nach Bad Godesberg hätte fahren können; wir schlenderten am Wasser entlang, ein wenig auf und ab und bald wieder zurück. Ihre Mutter schlief schon, sie geht immer früh schlafen, steht früh auf und liest die Zeitung, bevor die Putzfrau kommt, wie Fe mir wieder erzählte, ihr Vater war in seinem Schlaf- und Arbeitszimmer beschäftigt. Wir saßen noch eine Weile im Wohnzimmer vor dem Fernseher und stiegen dann die Treppe hinauf ganz nach oben, in Fes altes Zimmer unter dem schrägen Dach. Wir legten uns ins Bett, schliefen miteinander und schließlich nebeneinander ein. Irgendwann in der Nacht zog Fe auf das Feldbett in der schmalen Kammer, in der eigentlich ich, der Gast, hätte schlafen sollen. Am nächsten Morgen fand ihre Mutter nicht Fe, sondern mich in dem Bett ihrer Tochter liegen. Ich hörte sie, da war ich schon wach, hereinkommen und sah sie durch die Wimperntrübung meiner fast geschlossenen Lider auf dem Absatz kehrtmachen, statt sich auf den Drehstuhl vor dem Schreibtisch zu setzen und über die Lehne hinweg mit ihrer Tochter Morgengespräche zu führen, deren Verlauf sie sich, wie ich vermutete, schon lange vorher ausgedacht hatte. Sie schloß die bis dahin nur angelehnte Tür, ich wartete auf das Geräusch, das mir verriet, daß sie die Türklinke losgelassen hatte, dann ging sie, jeden Schritt auf den Holzstufen wie auf einer Tonleiter betonend, die Treppe hinunter. Ich drehte mich zur Wand und begann die Erhebungen auf der Rauhfasertapete zu zählen. An manchen Stellen hatte sich die Farbe von der bunten Bettwäsche abgerieben. Wenn ich früher im Haus meiner Eltern zu lange im Bett liegenblieb, kam Frau Ops in mein Zimmer und setzte sich zu mir auf die Bettkante, nicht ohne zuvor so laut gewesen zu sein, daß sie davon ausgehen konnte, mich geweckt zu haben. Sie öffnete die Zimmertür und sagte nach ihrem guten Morgen immer auch, aber du warst doch schon wach. Ich antwortete Unverständliches, sie setzte sich und erzählte mir Geschichten. Würde Frau Ops sich jetzt wie früher auf meine Bettkante setzen, dachte ich, würde sie sitzen bleiben und anfangen zu erzählen, Geschichten, in denen Namen auftauchten, an die ich mich dunkel erinnerte; ohne abzusetzen und nur in geheimen Pausen Luft schöpfend, würde sie Klatschgeschichten erzählen, die mich am Ende, wenn ich halbwegs wach war, sogar interessierten. Wozu hat man Sprache sonst erfunden, wenn nicht für Oppes, sagte meine Mutter, die ihr selbst gerne zuhörte, weil sie von ihr all das zu hören bekam, was sie sonst nie erfahren hätte. Frau Ops fragte, ob ich nachts wieder Nasenbluten gehabt hätte, obgleich sie wußte, daß ich seit Jahren kein Nasenbluten mehr hatte, und immer wenn ich Anstalten machte aufzustehen, ließ sie sich kurz unterbrechen und erlaubte mir, allein ins Badezimmer zu gehen, obwohl sie wahrscheinlich dort gerade ein wenig hatte wischen wollen. Ganz gleich, wie lange ich im Badezimmer brauchte, sobald ich mich unten an den Frühstückstisch setzte, tauchte sie wieder auf, und ich hörte die sich nahtlos anschließenden Fortsetzungen ihrer Geschichten, während ich versuchte, mich mit Filterkaffee zu wecken. Den Kaffee trank ich damals noch mit Dosenmilch, die Frau Ops mir aus einem Porzellankännchen in die Tasse goß, bis ich danke sagte, wobei die Klinge des Messers in meiner rechten Hand sich schon durch die Flanke bis in die flauschigen, weißen Weichteigteile des Brötchens bohrte, das ich mir aus dem Brotkorb gegriffen hatte. Einige Sätze später löffelte ich Marmelade, die mein Vater gekocht hatte, auf die gebutterte Brötchenhälfte. So sieht Blut im Kino aus, dachte ich, während Kirschmarmelade oder Johannisbeergelee von dem kleinen Marmeladenlöffel tropfte. Bei den Quantitäten, die du löffelst, ist es kein Wunder, daß ein Glas bloß ein paar Tage hält und deine Zähne nur noch gefüllte Scherben sind, hätte meine Mutter gesagt, aber sie war ja nicht da, und manchmal schickte sie mir, weil sie wußte, daß ich sie besonders gerne aß, Lemon & Lime oder Thick Cut Orange, die mein Vater nicht kochen konnte. Damals schaute ich in die Zeitung, während Frau Ops mir berichtete, wer gestorben war, sie tat das schwarzgerahmt mit einem Gesicht, dessen obere Hälfte zeigte, daß sie vom Verblichenen nur noch Gutes sagen sollte, während über ihre Lippen all das lief, was sie sonst noch von den Toten wußte, ich erfuhr, wer von früheren Klassenkameraden geheiratet hatte, wer vielleicht nach Holland gefahren war, wie vermutet wurde, und wer, wenn sie denn geboren wurden, die Kinder tatsächlich aufzog, ich erfuhr, wer wegen Drogengeschichten verurteilt worden war und trotzdem nicht im Gefängnis gesessen hatte, wo, was du auch noch nicht weißt, wie sie sagen konnte, er oder sie meinen Zahnarzt hätte treffen können, der seine Strafe wegen Steuerhinterziehung absaß, und stell dir vor, in seiner Küche wurden alle Kacheln abgeschlagen auf der Suche nach den versteckten Unterlagen, und dann hat man sie gefunden, in einem Luftschacht der Dunstabzugshaube eingewickelt und geräuchert, alles aufgeschrieben, was wo wieviel auf welchen Konten liegt, diese Dummheit, auch über die verbotenen Geschäfte Buch führen zu müssen, ich mußte die Zeitung, in der ich blätterte, gar nicht lesen. An Tagen, an denen ich als Kind früh aufstehen mußte und wirklich früh aufgestanden war, konnte ich Frau Ops morgens mit dem Fahrrad kommen sehen, denn bloß im Winter oder bei sehr starkem Regen kam sie mit ihrem Wagen, den sie nur Daimler, nie Mercedes nannte. Sie parkte in der kurzen Garageneinfahrt hinter dem Gittertor zum Bürgersteig, mein Vater mußte nicht an seinen Wagen, er ging zu Fuß über die Adenauerallee. An anderen Tagen, wenn ich noch schlief, weckte mich der Dieselmotor ihres Daimlers durchs offene Fenster, oder ich hörte bis in den Halbschlaf hinein das schmalere Tor in der Hecke hinter Frau Ops ins Schloß fallen und danach oft ein Geräusch, das wohl vom quietschenden Scharnier ihres Fahrradständers verursacht wurde, den sie gegen den Widerstand des Federzugs ausklappte. Es kam auch vor, daß ich genau in diesem Augenblick die Treppenstufen vor der Haustür hinunter- und ihr entgegensprang, und wenn mein Vater nicht da war und ich nicht gefrühstückt hatte, lag auf den Stufen noch die Tüte mit den Brötchen, die morgens vorbeigebracht wurden. Ich sagte hallo oder guten Morgen, sie grüßte zurück und fragte, willst du nicht wenigstens ein Brötchen mitnehmen, ich aber lief an ihr vorbei und rief, keine Zeit mehr, Frau Ops, wobei sich Frau Ops aus meinem Mund heraus zu einem Wort, zu einem langen Triphthong zwischen zwei Doppelkonsonanten zusammenzog, zu einer reibenden Silbe, die sich über ihren dunklen Selbstlaut hinweg zu der summenden Fermate bog, auf der sie liegenblieb. Das s ließ ich wie einen Türöffner länger oder doppelt so lange weitersummen, wie das Wort bis dahin gedauert hatte, bei Gelegenheit so lange, bis mir eingefallen war, welches Wort folgen sollte. Meine Mutter konnte, wenn sie wollte, den Namen auch ganz anders sagen, konnte aus Ops einen rheinischen Zweisilber machen, der sich in meinem Ohr auf Boppes reimte, vielleicht aber war das auch nur ein Echo in der Telephonleitung. Wenn ich nachmittags wieder nach Hause kam, fand ich in der Küche kleine Zettel mit Nachrichten, die mir in Schreibschrift Anweisungen gaben, was noch zu tun sei, vergiß nicht, den Hund zu füttern oder der Hund hat gefressen, gefolgt von ein bis drei Ausrufezeichen, deine Mutter hat angerufen, wenn es regnet, nimm bitte die Wäsche von der Leine. Die Küche war aufgeräumt, der Boden gewischt, die Hundehaare von den Teppichen gesaugt, Papas Hemden gebügelt, meine schmutzigen Strümpfe von vorgestern lagen wieder frisch gewaschen und von innen nach außen gewendet in der obersten Kommodenschublade, meine Hosen hingen im Schrank oder auf den Schnüren der aufgespannten Wäschespinne im Garten, was draußen trocknet, riecht immer besser, Heizungsluft trocknet hart, Wind trocknet weich, sagte Frau Ops. Fing es an zu regnen, nahm ich die Wäsche herein, bei Kälte oder Regen hing ohnehin alles im Keller oder lag im Trockner, dabei behauptete Frau Ops, wenn sie wasche, werde es schönes Wetter geben. Wenn ich wollte, daß eine Hose gewaschen wurde, hängte ich sie nicht wie sonst über die Lehne des Stuhls vor meinem Schreibtisch, sondern ließ sie abends einfach auf den Boden fallen, eine der nie ausdrücklich zwischen uns getroffenen Abmachungen, die ich erst später in meiner eigenen Wohnung zu schätzen lernte, als ich bemerkte, daß ich mir mit meinem Auszug die Möglichkeit geraubt hatte, bis ins allerletzte hinein faul zu sein. Was ich abends einfach fallen ließ, fand ich am übernächsten Tag frisch gewaschen, gebügelt und gefaltet in meinem Kleiderschrank wieder, dachte ich und löste meinen verhangenen Blick von der Hügellandschaft der Rauhfasertapete, auf der meine Fingerkuppen Gebirgsketten gefunden hatten. Ich drehte mich um, ließ einen Fuß unter der Bettdecke hervorschauen und betrachtete mit nun ganz geöffneten Augen Fes altes Zimmer, das ihre Mutter als Arbeitszimmer nutzte. Auf dem Schreibtisch stand eine Kugelkopfschreibmaschine, mit der sie, wie ich wußte, Überweisungsformulare ausfüllte und Mahnungen schrieb. Über der Lehne des Drehstuhls vor dem Schreibtisch hing meine nachtblaue Hose, worüber ich mich ein wenig wunderte, denn soweit ich mich erinnerte, hatten Fe und ich uns am Abend zuvor eher gierig und unbeherrscht ausgezogen. Ich stand auf und ging im Schlafanzug hinüber in die Kammer, in der Fe auf dem Feldbett zwischen leeren Staubsaugerkartons und abgestellten Gemälden und Drucken, für die im Haus an den Wänden kein Platz mehr war, lag. Ich küßte sie in ihr Morgengesicht und erzählte ihr von dem Besuch ihrer Mutter in meinem Zimmer. Fe, die Haut um ihre Augen ganz weichgeschlafen, sagte nur, das macht sie immer so. Im Badezimmer putzten wir uns nebeneinander die Zähne.
Unten im Wintergarten war der eckige Eßtisch gedeckt, es roch nach Kaffee. Fe setzte sich, wie schon beim Abendessen, auf ihren alten Platz im Blickfeld ihrer Mutter, sie hatte die große Fensterwand, an deren Außenseite kleine Tropfen klebten, im Rücken. Die Wiese hinter ihr glänzte, es war Montag, der Himmel war nicht aufgerissen, wahrscheinlich hatte es in der Nacht ganz dünn geregnet. Wären wir beim Frühstück allein gewesen, hätte ich sie wohl gefragt, ob sie glaube, daß ihr Vater eine Freundin habe, eine Assistenzärztin im Krankenhaus oder vielleicht eine Studentin, und ob sie es für möglich halte, daß auch ihre Mutter betrügen könne. Noch lieber hätte ich gefragt, warum haben deine Eltern sich nie scheiden lassen, sondern sich all die Jahre ausgehalten, aber weil ihre Mutter die ganze Zeit über in der Küche hinter der Durchreiche stand und aufgeschnittene Orangen auf den elektrischen Entsafter preßte, hielt ich den Mund, denn Lärm genug, meine Stimme zu übertönen, machte die Maschine nicht. Fes Mutter erzählte Geschichten, die sie aus der Zeitung kannte, Fe ergänzte sie ab und zu, und ich hatte den Eindruck, als könnte ich in ihrer Stimme eine Veränderung bemerken, von der ich noch nicht wußte, woher sie kam. Und warum wollen Sie nicht nach Hause fahren, Ihre Eltern wohnen doch nicht weit, fragte mich ihre Mutter, sie sagte, fahren Sie doch mit der Sechzehn, und meinte die Bahn. Sie siezte mich, obwohl sie mich mit meinem Vornamen anredete, und stellte uns die Gläser mit dem frischgepreßten Saft auf die Platzdeckchen, die auf der polierten Tischplatte lagen. Sie erwartete keine Antwort, sondern setzte ihre Feuilletonerzählung fort. Zeitung liest sie mit halber Lesebrille am Morgen, bevor die Putzfrau kommt, dachte ich, und außer Nicken und Staunen war dem Gespräch, das keines war, nichts hinzuzufügen. Fe hätte gesagt, wenn ich zu Hause bin, muß ich immer dreizehn sein, älter darf ich nie werden, und meine Mutter muß mir erklären, was in der Zeitung steht, aber sie mußte mir nichts sagen, weil ich sehen konnte, daß ihrer Mutter Sätze wie Kind, es ist kalt und wie du dich schon wieder angezogen hast und was bist du dünn geworden auf der Zunge lagen. Jede Wendung, jede Absatzdrehung – das wird Fe in soundsoviel Jahren sein, dachte ich einen Augenblick – holte nach, was sie ihre Tochter in dem meinetwegen versäumten Morgengespräch hatte fragen wollen und nun auf ein späteres Vieraugengespräch verschoben war. Bis dahin stellten allein ihre Augen und, wie ich vermutete, auch die für mich nicht zu entziffernde Familientaubstummenschrift ihrer Armbewegungen alle Fragen, die sie an ihre Tochter hatte. In einem schlechten Drehbuch würde es am Ende heißen, Mutter und Tochter alleine im Zimmer, Mutter, flehend: Kind, bist du auch glücklich, du mußt es doch sein. Warum haben sich deine Eltern nie scheiden lassen, hätte ich Fe nun gern noch einmal gefragt, bestimmt nicht, weil meine Eltern sich immer gut verstanden, heiß und innig geliebt haben, hätte sie geantwortet, viel eher wohl, weil eine Scheidung zu teuer geworden wäre, außerdem hätten sie das Haus mit der Sammlung verkaufen müssen, weil keiner dem anderen auch nur die Hälfte gegönnt hätte, und überhaupt, was sollte meine Mutter schon machen, ohne meinen Vater, und umgekehrt, was wäre er ohne sie, seit dem Tag, als ihr Großvater auf ihn geschossen habe, er versuchte über den Zaun in den Garten zu klettern, um näher am Fenster meiner Mutter zu sein, hatte Fe mir erzählt, ihr Großvater verfehlte den vermeintlichen Einbrecher nur knapp, eine Schrotkugel streifte ihn an der Schulter. Was für eine romantische Geschichte, hatte ich gesagt, als ich davon das erstemal hörte, und mir ihre Mutter im Dirndl und ihren Vater im Trachtenanzug ausgemalt, in frühem Agfacolor vor weißblauer Gebirgslandschaft. Ach so, hatte ich gesagt und würde ich anläßlich jeder Wiederholung dieses Filmausschnitts sagen, zusammensein und zusammenbleiben bedeutet, viele Geschichten gemeinsam zu haben, das klebt den einen an den anderen. Manchmal, legte ich Fe in den Mund, manchmal reicht es auch aus, wenn beide sehr verschieden sind und bei ihnen alles ganz anders war. Und wenn ich Fe während des Frühstücks am eckigen Eßtisch im Wintergarten wirklich so viel hätte sprechen hören, wie ich es mir ausdachte, vielleicht hätte ich dann festgestellt, daß die schon bemerkte fremde Färbung ihrer Sprechstimme nichts weiter war als die langsame Einstimmung auf den Tonfall ihrer Mutter, der sich, je länger die Mutter sprach, mehr und mehr auf und über und um sie legte wie ein aus seidigen Satzmelodien feingewobenes Tonfalltuch, es war, als schwimme Fe auf einmal in einem mütterlichen Stimmenäther, der mir unheimlich wurde, weil er die mir so bekannte Klangfarbe ihrer Stimme nach und nach überspielte. Mir lief Honig vom Brötchen über die Finger, und ich dachte an die Bienen, die Bienchen, wie mein Onkel sagte, die das alles schon einmal in ihrem Mund gehabt und durchgekaut hatten. Die Brötchen, die im Brotkorb lagen, waren aufgetaut und wieder aufgebacken worden, es gibt auch Bienen, die Hosenbienen heißen, dachte ich, sie tragen die Pollen wie Kleider an den Beinen. Ich wußte, daß ihre Mutter mich früher oder später nochmals fragen würde, warum ich nicht nach Bonn fahren wolle, wieso ich meine Eltern nicht besuchen wolle, sondern, wie sie schon wußte, von Fe schon wissen mußte, mich mit meinem Vater nur zum Essen verabredet hätte. Wie aber sollte ich ihr das erklären? Ich wollte nicht von meiner Mutter erzählen müssen, nicht erzählen, was mein Vater machte, welche Rolle meine Tante spielte und woher ich meinen Namen hatte. Ich hätte Fes Mutter gern gefallen und versuchte es, ich machte eine Bemerkung über ein Möbelstück oder lobte den Blick in den Garten, vielleicht fing ich sogar an, von einem Bild zu sprechen, das ich mir, enemenemeck, eine alte Frau muß weck, und das Zekah muß dabei schnalzen, zuvor leise ausgezählt hatte, ich sagte etwa, es steche aus allen anderen heraus, seine Farbe, seine stille Farblosigkeit, die vereiste, die verlandete, die verbaute, verblaute Flächigkeit und das Gewicht des Strichs. Was sich gut anhört, glaube ich am Ende selbst, ich könnte mich überreden, an den Bildern Gefallen zu finden, denn wenn ich nur lange genug an weiße Wände und Zimmerdecken starre, sehe ich, was ich sehen will, sehe ich, was du nicht siehst, dachte ich. Hätte ich dem, was ich über eines der Bilder sagte, zugehört, hätte ich mich lügen hören müssen. Vielleicht spürte sie, daß ich nicht ehrlich war, während ich die Wörter aus meinem Mund laufen und weiterlaufen ließ, weil eins ans andere paßte, sie klebten aneinander, klebrig wie der Honig an meinen Fingern, der von der zweiten Brötchenhälfte tropfte, das alte Fliegenpapiergefühl, dachte ich unter ihrem Blick, sie hatte Falten in den Augenwinkeln und neben den Nasenflügeln, ihre blauen Augen folgten meiner Handbewegung, ich klebe fest und kann nur noch zappeln, dachte ich und wischte mir den Finger, der die Honigfäden zog, an der Serviette ab, griff in den Henkel der Kaffeetasse und nahm einen großen Schluck. Für einen Augenblick konnte ich mich hinter der Tasse verstecken. Ich hätte gern den Kaffee wie ein Kontrastmittel auf einem Röntgenschirm aus meiner Speiseröhre fließen und in meinen Magen münden sehen, manchmal mischt sich in das Milchkaffeebraun ein Schuß Orangensaft, dachte ich, Honig und Erdbeermarmelade, die im Dunklen keine Farbe haben, setzen Punkte in Rot und Gold. Essen ist Malen von innen, dachte ich, eine Magenspiegelung und ein Blutbild, und ich hätte auch diese Gemälde sehen können: Frühstücksbilder, Fliegen und ihre Schatten, gespachtelt, gezogen, verklebt. Fes Mutter erzählte von diesem oder jenem jungen Künstler, von Vernissagen und Vorträgen im Kunstverein, und mein Blick blieb auf einem der geschliffenen Glasschälchen liegen, sie waren – wie ich nicht nur sehen, sondern auch schmecken konnte – mit gekaufter Kirschmarmelade gefüllt. Ein kurzes gebogenes Plexiglaslöffelchen ragte durch die Deckelaussparung nach oben. Mein Vater, fiel mir ein, machte sich nie die Mühe, seine selbstgemachte Marmelade umzufüllen, er stellte seine Marmeladengläser, wie sie waren, neben den Honig auf den Zinnteller, auf dem er all seine Brotaufstriche aufbaute. Sonntags, wenn mein Vater und ich zusammen frühstückten, stand die Batterie auf dem Tisch, und mein Vater sah durch die Wochenendausgabe seiner Zeitung hindurch, daß ich mein Brötchen mehr in Marmelade tunkte als dünn bestrich. Er sagte nichts, sondern murmelte nur etwas von Nachschub, just-in-time-production, Lieferung, Lagerhaltungskosten und Marmeladen-Optimum nach Pareto, vielleicht las er auch bloß halblaut im Wirtschaftsteil. Mit seiner Produktion hatte er sich saisonal unabhängig gemacht, die Beeren und Fruchtsäfte stapelten sich in quadratischen Kunststoffdosen in der Tiefkühltruhe. Er ließ sich gern darüber aus, daß er damit die eigentliche, historische Funktion der Marmelade umgekehrt habe: Er konserviere die Früchte, um frische Marmelade herzustellen, die nur noch im Kühlschrank haltbar sei, anstatt frische Früchte durch Einkochen haltbar zu machen, was mich als Endverbraucher, Schlußpunkt dieser Marmeladennahrungskette, sofern sie nicht unterbrochen war, nicht sonderlich beunruhigte. Mich interessierten Ergebnisse, seine Sorten, ob rote oder schwarze Johannisbeere, Stachelbeere, Brombeere, ob Johannisbeer-, Quitten- oder Apfelgelee, das mein Vater, solange es heiß war, in einem großen Topf auf dem Herd wie flüssigen Bernstein rührte, ab und zu ließ er den blasigen, brodelnden heißen Saft vom Kochlöffel tropfen, um die Konsistenz zu prüfen. Auf der Oberfläche bildete sich weißer Schaum, und es kam vor, daß mein Vater von seiner literarischen Erweckung zum Marmeladenkoch erzählte, ein Ereignis, das er dem Wiederlesen von Anna Karenina verdankte. In diesem Buch kommt es auf einer sonnigen Terrasse angeblich zu einem Streit, weil die Fürstin die Marmelade nach einem Rezept zubereiten will, das die alte Haushälterin Agafja nicht kennt. Alles entzünde sich an der Frage, sagte mein Vater, während er seine Fruchtsoße rührte, ob man den Wald- und Gartenerdbeeren vor dem Einkochen Wasser zusetzen müsse oder nicht. Die Alte, die von Wasser in ihren Früchten nichts wissen will, wird schließlich überstimmt und beobachtet mißtrauisch die Fürstin beim Rühren der Marmelade, die in einem Kessel über einem glühenden Kohlenbecken kocht. Sie frage sich, ob die Marmelade fest werde, sagte mein Vater, und ich fragte mich, ob das fürstliche Gewand der Fürstin, ich stellte sie mir im Reifrock vor, so nah am glühenden Kohlenbecken nicht Feuer fangen müsse. Mein Vater rührte seine Beeren und Beerensäfte unter sehr viel weniger romanhaften Umständen, nicht über glühenden Kohlen, weit entfernt vom nächsten russischen Landgut, sondern auf dem Keramikkochfeld einer westdeutschen Einbauküche. Nicht selten allerdings mußte auch er die bange Frage aussitzen, ob seine Marmelade gelieren werde, weil er auf der Suche nach dem verlorenen Marmeladengeschmack seiner Kindheit immer wieder bemüht war, Zuckeranteil und Kochzeit zu senken. Wenn einer seiner Versuche, was gelegentlich vorkam, mißlang, schwappte die nur noch im Kühlschrank haltbare Fruchtsoße auch abgekühlt in ihren Gläsern hin und her; versuchte ich sie zu essen, tropfte sie mir, sofern ich die Löcher in den Brotscheiben nicht mit Butter verstopft hatte, auf den Frühstücksteller. Traf ich statt dessen eine frischgewaschene Hose, war der Tag verdorben. Konfitüre braucht wie Kunststoff ihren Härter, sagte mein Vater, er schwor auf Pektin, Gelierzucker und Zitronensäure, du weißt ja, wie Epoxid- und Polyesterharze härten, frag deinen Onkel, ich aber interessierte mich mehr für das Schicksal der abgekochten Bakterien, was wird aus denen, bleiben die tot in der Marmelade