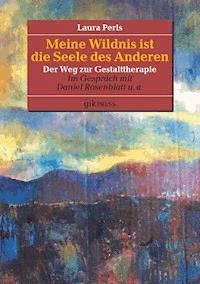
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Basis dieses Buches von und über Laura Perls, der Mitbegründerin der Gestalttherapie, bilden die Gespräche zu ihrem "Weg zur Gestalttherapie" mit dem amerikanischen Gestalttherapeuten Daniel Rosenblatt. Anlässlich ihres 100. Geburtstages erschien dieser Klassiker in einer erheblich erweiterten Ausgabe. Hinzugekommen sind weitere Interviews, besonders zum Selbstverständnis der Therapeutin, und zahlreiche Würdigungen der Persönlichkeit und der Arbeit Laura Perls durch Kolleg*innen und Schüler*innen. Laura Perls steht für einen ganz besonderen Stil: für liebevolle Aufmerksamkeit, für Wohlwollen, Einfühlungsvermögen und große Achtung vor den Klient*innen. Die Wendung »Meine Wildnis ist die Seele des Anderen« ist Laura Perls' Liebeserklärung an ihren Freund und Schüler Paul Goodman. Für ihn entsprechen nämlich unsere Straßen einer "Wildnis", und Laura Perls hat in Analogie zu seinem Denken die Seele zu ihrer Wildnis erklärt, wo sie abenteuern und explorieren konnte, soviel sie wollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vor einem Portrait ihres Mannes Fritz von Otto Dix (1966). Foto aus den 1970er Jahren
Laura Perls, 1905-1990, die Mitbegründerin der Gestalttherapie, steht für einen ganz besonderen Stil: für liebevolle Aufmerksamkeit, für Wohlwollen, Einfühlungsvermögen und große Achtung vor den Klient*innen. Anlässlich ihres 100. Geburtstages erschien der Klassiker »Der Weg zur Gestalttherapie« in einer erheblich erweiterten Ausgabe. Die Basis bilden die Gespräche des amerikanischen Gestalttherapeuten Daniel Rosenblatt mit Laura Perls. Hinzugekommen sind weitere Interviews, besonders zum Selbstverständnis der Therapeutin, und zahlreiche Würdigungen der Persönlichkeit und der Arbeit Laura Perls durch Kolleg*innen und Schüler*innen.
Die Wendung »Meine Wildnis ist die Seele des Anderen« ist Laura Perls’ Liebeserklärung an ihren Freund und Schüler Paul Goodman. Für ihn entsprechen nämlich unsere Straßen einer »Wildnis«, und Laura Perls hat in Analogie zu seinem Denken die Seele zu ihrer Wildnis erklärt, wo sie abenteuern und explorieren konnte, soviel sie wollte.
INHALT
Anke und Erhard Doubrawa: Vorwort
Stefan Blankertz und Erhard Doubrawa: Laura Perls’ Werkleben
Biografische Übersicht
Die Gespräche
Der Weg zur Gestalttherapie
Laura Perls im Gespräch mit Daniel Rosenblatt
Gestalttherapie ist immer politisch
Auszüge aus einem Werkstattgespräch mit Laura Perls im Gestalt-Institut Köln
Aus dem Schatten hervortreten
Laura Perls im Gespräch mit Edward Rosenfeld
Der Therapeut ist ein Künstler
Laura Perls im Gespräch mit Nijole Kudirka
Ein Trialog
Laura Perls im Gespräch mit E. Mark Stern und Richard Kitzler
Nachrufe und Erinnerungen
Daniel Rosenblatt: Nachruf auf Laura Perls
Kristine Schneider: Meine Wildnis ist die Seele des Anderen
Erinnerungen von Kollegen und Schülern
Anmerkungen
Index
ZUR KÜNSTLERIN DES COVERS
GEORGIA VON SCHLIEFFEN
Georgia von Schlieffen, geb. 1968. »Seit meiner Studienzeit intensive Beschäftigung mit der Malerei. Jedoch ging ich erst einmal ganz andere Wege über ein Studium der Vergleichenden Religionswissenschaft und der Internationalen Beziehungen und einer mehrjährigen Tätigkeit im Bereich Projektmanagement und Flüchtlingsarbeit für mehrere Nichtregierungsorganisationen. 2010 nahm ich an Studienwochen bei Markus Lüpertz und Gotthard Graubner an der Reichenhaller Akademie teil. Ab 2011 studierte ich Malerei bei Professor Jerry Zeniuk, Akademie für Farbmalerei, Kunstakademie Bad Reichenhall, und derzeit bei Heribert C. Ottersbach.«
Georgia von Schlieffen illustrierte zwei Lyrik-Bände von Stefan Blankertz, »Ambrosius: Callinische Hymnen« und »Ruan Ji: Zustandsbeschreibungen« sowie den Gedichtband »kleine gebete« von Paul Goodman, der in der gik PRESS erschienen ist.
Das Titelbild für dieses Buch ist nach einem Retreat auf Lampedusa entstanden, an dem die Künstlerin teilgenommen hat. Es ist uns eine Freude, dass sie es zur Verfügung stellte, da ja auch Laura Perls flüchten musste, nicht nach, sondern aus Europa.
Bitte besuchen Sie die Seite der Künstlerin auf theartstack.com oder verbinden Sie sich auf linkedin.com mit ihr.
ZUR ERWEITERTEN AUSGABE
ANLÄSSLICH
LAURA PERLS’ 100. GEBURSTAG
Wir freuen uns, Ihnen anlässlich des 100. Geburtstags von Laura Perls, der Mitbegründerin der Gestalttherapie, nun den Klassiker »Der Weg zur Gestalttherapie« in einer erheblich erweiterten Ausgabe vor legen zu können.
Die Basis dieses Buches bilden Gespräche des amerikanischen Gestalttherapeuten Daniel Rosenblatti mit Laura Perls. Hinzugekommen sind weitere Interviews, besonders zum Selbstverständnis der Therapeutin.
Zahlreiche Würdigungen der Persönlichkeit und Arbeit Laura Perls durch Kollegen und Schüler runden dieses Buch ab, das Besonderheit und Wirkung der Mutter der Gestalttherapie aufzeigt und auch erfahrbar macht.
Erweitert wurde das Buch zudem um seltene Bilddokumente aus ihrem Leben, die hier z. T. zum ersten Mal veröffentlicht werden.
An dieser Stelle möchten wir allen herzlich danken, die zum Erscheinen von »Meine Wildnis ist die Seele des Anderen« beigetragen haben.
Köln, im Januar 2005
Anke und Erhard Doubrawa, Gestalttherapeuten
Laura Perls Foto Mitte der 1980er Jahre © Theo Skolnik
(i) Daniel Rosenblatt (1925-2009), amerikanischer Gestalttherapeut. Infos zu seiner Person auf Seite 201.
VORWORT
»Gestalttherapie« ist heute kein exotischer Außenseiter im Bereich der Psychotherapie mehr. Das Verständnis der Gesellschaft ist größer geworden für einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper und Seele im Zusammenhang sieht, der den Therapeuten (und seine Befindlichkeit) nicht aus dem Blickfeld entfernt, der Verständnis für das Staunenswerte, Sinnliche und Spirituelle hat, der aber auch den sozialen und politischen Anteil an psychischen Problemen nicht leugnet.
Nicht nur das Verständnis der Gesellschaft für die Gestalttherapie ist gewachsen. Auch die Gestalttherapie hat sich gewandelt: Sie ist heute eher bereit, sich zu professionalisieren. Mit der Professionalisierung steigt auch das Interesse, sich der Wurzeln und Ursprünge, der Geschichte und der Theorien der Begründer dieser Therapieform zu vergewissern. Dabei stoßen wir zunehmend auf die Tatsache, dass die Begründer der Gestalttherapie – hauptsächlich Fritz Perls, Laura Perls und Paul Goodman – durchaus systematische, wissenschaftliche, klinische sowie philosophische, politische und soziologische Ansätze verarbeitet haben.
Mit dem vorliegenden Buch machen wir ein ebenso menschlich liebenswertes wie wissenschaftlich interessantes Dokument der »oral history« der Gestalttherapie zugänglich: Laura Perls, die Frau von Fritz Perls, schildert ihre Sicht der Dinge, behutsam geleitet durch die Fra gen von Daniel Rosenblatt, ihrem »Schüler«. Dan gehört zu der ersten Generation von Gestalttherapeuten nach den Begründern der Gestalttherapie.
Fritz Perls ist bis heute die Identifikationsfigur der Gestalttherapie. Der eigenständige Beitrag seiner Frau Laura bleibt häufig unerwähnt, obwohl sie von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung der Gestalttherapie beteiligt war. Nicht nur das. Laura Perls steht für einen ganz bestimmten, von Fritz durchaus abweichenden Stil: für liebe volle Aufmerksamkeit, für Wohlwollen, Einfühlungsvermögen und »Support« (Unterstützung) der KlientInnen in einer sehr bodenständigen Arbeit. Sie steht gleichsam für die »mütterliche« Dimension der Gestalttherapie. Sie leistete viel »Schattenarbeit«, wie es Ivan Illich nennt. (Illich ist übrigens stark von einem anderen Mitbegründer der Gestalttherapie, Paul Goodman, beeinflusst.) Illich versteht unter »Schattenarbeit« diejenige Arbeit, die erforderlich ist, damit man überhaupt arbeiten kann. Und die erstere bleibt häufig im Schatten – so wie Lauras Beitrag für die Gestalttherapie.
In den Jahren, in denen Fritz Perls zum erfolgreichen »Guru« einer psychotherapeutischen Bewegung an der amerikanischen Westküste wurde und sich zunehmend von den – früher selbst mitentwickelten – Grundlagen der Gestalttherapie distanzierte, hielt Laura diesen die Treue, arbeitete weiter an der Verdeutlichung dieser und lehrte weiter am New Yorker Institut für Gestalttherapie.
Laura fühlte sich mehr mit Fritz’ »Konkurrenten« verbunden, dem politisch aktiven Paul Goodman, dem Führer der amerikanischen Schüler- und Studentenbewegung der frühen 1960er Jahre und leidenschaftlichen Kämpfer gegen die Kriegshysterie der amerikanischen Regierung.
Laura knüpfte stets an ihre »deutsche Erfahrung« an und betonte nachdrücklich, dass Therapie immer politische Arbeit sei und den Kampf gegen die Barbarei von Krieg und Faschismus beinhaltet.
Sowohl an der theoretisch-philosophischen Fundierung der Gestalttherapie als auch an ihrer Körperorientierung hat Laura Perls entscheidend mitgewirkt. Als Studentin war sie von dem religiösen Anarchisten Martin Buber und dem religiösen Sozialisten Paul Tillich sehr beeindruckt. Sie brachte einen humanen Existenzialismus in die psychologische Theorie ein, wie sie ihn bei Buber und Tillich kennen gelernt hatte. In der Entstehungsphase der Gestalttherapie war auch die Bezeichnung »Existenzialistische Therapie« diskutiert, jedoch wegen der in jenen Jahren verbreiteten »nihilistischen« Ausprägung des Existenzialismus letztlich verworfen worden. Neben dem Existenzialismus wurde Laura Perls von der Phänomenologie Edmund Husserls beeinflusst. Sie hörte Vorlesungen von Husserl, und möglicherweise traf sie dabei mit der – inzwischen heilig gesprochenen – Mystikerin Edith Stein zusammen, die zu dieser Zeit Assistentin bei Husserl war.
Den Kopf frei für Philosophie bekam Laura durch ihre langjährige Begeisterung für den Modern Dance, Gindlers Bewegungsarbeit und durch ihre Leidenschaft für die Musik. Ihre Erfahrungen mit Bewegungsarbeit und Tanz und deren therapeutischen Wirkungen ließen Laura dann die Körper-Dimension der Gestalttherapie begründen. Die Leib-Seele-Einheit war keine abstrakte Forderung von Laura, sondern Ausdruck ihres positiven Lebensgefühls.
Zum ersten Mal werden hier eine Reihe von Gesprächen veröffentlicht, die Daniel Rosenblatt mit Laura zwei Jahre nach dem Tod von Fritz führte. Dan war Lauras zweiter Klient in New York, ihr späterer Schüler und Kollege und schließlich ihr engster persönlicher Vertrauter in ihren letzten Lebensjahren. Ihm verdanken wir, dass Lauras Erinnerungen für die Nachwelt bewahrt werden konnten.
Laura Perls antwortet offen, erzählt aus der spontanen Erinnerung heraus über ihre Kindheit und Jugend, ihre Studienzeit in Frankfurt, ihre Flucht als linke Jüdin aus Nazi-Deutschland nach Holland und später nach Südafrika, über ihre Ehe mit Fritz Perls und den gemeinsamen Weg von der Psychoanalyse zur Gestalttherapie und über die Gründung des New Yorker Instituts für Gestalttherapie.
Den Lesern dieses Buches wird Laura Perls’ besondere Bedeutung für die Gestalttherapie deutlich. Die Absicht dieses Buches besteht dagegen nicht darin, die Ereignisse in historiografischer Exaktheit zu rekonstruieren – es handelt sich um sehr persönliche, subjektive Erinnerungen.
Laura Perls engagierte sich besonders für zwei zentrale Aspekte der Gestalttherapie – »Support« (die Unterstützung des Klienten) und »Commitment« (die freiwillige Selbstfestlegung, auch die des Therapeuten). Sie lebte Support und Commitment auch vor. Dies wird sehr deutlich in einem ihrer schönsten Vorträge: »Commitment – Hin gabe und Selbstfestlegung in Freiheit«.1
Wir haben diesen bemerkenswerten Gesprächen Daniel Rosenblatts sehr persönlichen Nachruf auf Laura Perls beigefügt, den er unmittelbar nach ihrem Tod für die australische Zeitschrift für Gestalttherapie »At the Boundary« schrieb. Den Gesprächen aus den 1970 er Jahren angefügt haben wir kurze Ausschnitte aus einem Werkstattgespräch mit Laura Perls und Daniel Rosenblatt 1988 im Gestalt-Institut Köln.2 Mitveranstalter dieses Werkstattgesprächs war Milan Sreckovic, der sich wie kein zweiter im deutschen Sprachraum für Lauras Werke eingesetzt hat. Und so sollen diese Vorbemerkungen nicht schließen ohne den Hinweis auf Laura Perls erstes Buch (eine Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen), das von Anna und Milan Sreckovic herausgegeben wurde und ohne sie nicht entstanden wäre:
Laura Perls: Leben an der Grenze. Essays und Anmerkungen zur Gestalt-Therapie.3
Köln, im Januar 1997
Anke und Erhard Doubrawa, Gestalttherapeuten
LAURA PERLS’ WERKLEBEN
Stefan Blankertz und Erhard Doubrawa
Geboren wurde sie als Lore Posner 1905 in Pforzheim. Sie stammt aus einer jüdischen Juweliersfamilie. Sie hat eine Schwester und einen Bruder. Als einziges Mädchen besucht sie ein Gymnasium und fängt nach dem Abitur zunächst ein juristisches Studium an, wechselt jedoch schnell zu Philosophie und Psychologie.
In Frankfurt besucht sie Seminare und Vorlesungen u.a. von Max Scheler, Paul Tillich, Kurt Goldstein, Adhemar Gelb (der ihr Doktorvater wird) und Martin Buber.
In einem Kolloquium, das Goldstein und Gelb gemeinsam halten, lernt sie 1926 Fritz Perls kennen. Sie folgt ihm auf seinen verschlungenen Lebenspfaden, hält sich jedoch stets im Hintergrund.
Allerdings ist ihr Einfluss auf die Theorieentwicklung zunächst von Fritz und später von der gesamten Gestalttherapie enorm.
Nach der Geburt ihrer Tochter Renate 1931 beschäftigte sich Laura mit dem Verhalten von Säuglingen beim Stillen. Psychoanalytiker sprachen hier von »oral- sadistischen Impulsen«. Laura (und Fritz) versuchten, dieses Verhalten nicht (ab)wertend zu betrachten, sondern als erste Versuche einer sich die Umwelt zum eigenen Überleben aneignenden, natürlichen Auseinandersetzung, die sie im positiven Sinne Aggression nannten.
Dann wendeten sie sich dem Übergang vom Saugen zum Kauen zu. Dieser Übergang kennzeichnet eine neue Stufe der »Aggression«, die notwendig ist. Wenn an dieser Stelle die Aggression gehemmt wird, legt das den Grundstein für spätere Probleme des Individuums, sich der Umwelt aggressiv zu nähern. Zunächst sprachen sie von »oralem Widerstand« (später ist, bildlicher, von »Beißhemmung« die Rede).
Mit diesen Überlegungen schuf Laura die Grundlage der späteren gestalttherapeutischen Theorie der Aggression. In einem Vortrag 1939 formulierte Laura die zentrale Gleichung der neuen Aggressionstheorie: »Die Verdrängung der individuellen Aggression [führt] unweigerlich zu einem Anstieg der universellen Aggres sion« (Vortrag über Friedenserziehung in Johannisburg 1939, zit. n.: Laura Perls, Leben an der Grenze, S. 14f ). Sie half Fritz im südafrikanischen Exil, das Buch Das Ich, der Hunger und die Aggression (1944) zu schreiben. Sie bestand jedoch nicht darauf, als Mitautorin genannt zu werden.
Paul Goodman entwickelte in Anschluss an Freud und Reich ähnliche Überlegungen und benutzte dazu den Begriff »natürliche« oder »gesunde Gewalt«, deren Unterdrückung zum universellen Kriegs- und Zerstörungswunsch führe. Seine entsprechenden Aufsätze (und den Roman The Grand Piano) lasen Laura und Fritz Perls noch in Südafrika; so war es ganz folgerichtig, dass sie Paul Goodman aufsuchten, nachdem sie Ende der 1940er Jahre nach New York gingen. Paul Goodman wurde ihr Klient, Geliebter, Freund und Kollege.
Auch an dem Buch Gestalt Therapy von 1951 hat Laura einen großen, jedoch nicht ganz genau festzustellenden Anteil. Wieder verzichtet sie darauf, als Autorin in Er schei nung zu treten. Allerdings wählt man sie, um ihr Anerkennung und Respekt zu zollen, zur Präsidentin des »New York Institute for Gestalttherapy«, das sie in antibürokratischer und antiautoritärer Weise führt.
Laura und Fritz entfremdeten sich zunehmend. Fritz ging nach Kalifornien und Laura blieb in New York bei den Freunden der ursprünglichen Gestaltgruppe.
Anlässlich von Fritz’ Tod sorgte Laura für einen Eklat, als sie Paul Goodman die Rede auf der Trauerfeier in New York halten ließ. Goodman hatte zwar mit Laura am Telefon geweint, als sie ihm von seinem Tod berichtete, wollte es sich jedoch nicht versagen, bei der Rede auch Kritik an dem verstorbenen Mitstreiter zu üben.
Noch mehr als zwanzig Jahre setzte Laura ihre im Gegensatz zu Fritz »stille« Gestaltarbeit fort. Sie betonte die Vorsicht und Zurückhaltung bei der Arbeit, wies darauf hin, dass der Klient Unterstützung (»support«) benötige und betonte die Wichtigkeit von Theorie, Philosophie und Kunst bei der Ausbildung von Gestalttherapeuten.
Erving Polster:
»Bei Laura hatte ich meine allererste Einzelsitzung. Sie kam zu einem Workshop, in dem wir auch Einzelsitzungen hatten, und ich hatte eine bei ihr. Innerhalb sehr kurzer Zeit machte sie ein paar Sachen mit mir, die mir die Augen öffneten. Inzwischen weiß ich, dass es sehr einfache Dinge waren, aber mit weitreichenden Folgen.
Es ging um meinen Vater. Ich hatte etwas über meinen Vater gesagt, und dann machte ich einen Moment lang die Erfahrung, wie es war, mein Vater zu sein. Ich konnte fühlen, wie umfassend und stark sie in diesem Moment mit mir verbunden war. Sowohl bei ihr als auch bei den anderen spürte ich einen großen Reichtum an Erfahrung. Ich dachte, dass ich von ihr eine Menge über Sprache und Bewegung lernen könnte.
Als ich später einen ihrer Workshops besuchte, bemerkte ich, dass sie sich sehr fein und sehr genau auf bestimmte Dinge einstellte, die die Teilnehmer taten. Sie wusste, wie sie so etwas entwickeln konnte. Was mir bei ihr auffiel, und was ich bei Fritz oder Paul Weisz nicht gesehen hatte, vielleicht nicht einmal bei Isadore, war – wie soll ich es nennen? – eine bestimmte Art des warmen Einfühlens, ein Sich-Einwärmen in den anderen. Sie kam einem körperlich näher. Sie lächelte. Nebenbei sagte sie ermutigende Dinge. Und sie scheute sich nicht, durch ihre Gesten und Bewegungen ganz klar und deutlich Unterstützung zu geben« (in: Anke und Erhard Doubrawa [Hg.], Erzählte Geschichte der Gestalttherapie, Wuppertal 2003, S. 200f ).
Daniel Rosenblatt:
»[Therapie bei Laura Perls.] Ich erinnere mich, dass wir zusammensaßen und rauchten und dass sie strickte! Das war aber nicht feindselig, sie war immer da. Es ist ein Kontrast aus der Sicht der Gestalttherapie, weil kein Gestalttherapeut je stricken würde, aber das kriegte ich gar nicht mit, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie nicht aufmerksam war. Ich glaube, dass zu jener Zeit viele weibliche Analytiker strickten, einfach weil sie so viel Zeit mit rumsitzen verbrachten. Sie machte bzw. wir machten damals keine freien Assoziationen.
Die andere Sache, die mir natürlich sofort einfällt, ist, dass ich 23 war und Laura ungefähr 43, weil sie 20 Jahre älter ist als ich, und zu jener Zeit war sie eben für mich eine Frau mittleren Alters. Da ich nun fast 20 Jahre älter bin als sie damals, ist es schwer für mich, mir das vorzustellen. Ich meine, sie war damals wirklich eine junge Frau, wenn man so will, ungefähr in eurem Alter, und der Abstand zwischen 23 und 43 war sehr groß, aber ich habe aufgeholt. Sie erschien mir damals viel älter und mütterlicher; aber wahrscheinlich teilweise nur aus meiner damaligen Sicht.
Anna [Sreckovic]: Ich möchte etwas mehr darüber hören, wie es für dich nach deinen Erfahrungen mit der Psychoanalyse war, mit Laura zu arbeiten. Was war das Besondere an ihrer Arbeit in jenen Tagen?
Dan [Rosenblatt]: Nun, sie war sehr persönlich und direkt, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich wie ein Patient verhalten sollte. Sie arbeitete nicht nach einem medizinischen Modell, und ich fühlte mich immer als Person angesprochen und nie als jemand, der bewertet wurde, fühlte mich nie als Kranker. Ich konnte mit ihr über meine Erfahrung sprechen und hatte nie das Gefühl, dass sie mir nicht direkt antwortete. Ich hatte nie den Eindruck, mich zu unterwerfen, gezwungen oder von oben herab behandelt zu werden. In der Psychoanalyse muss man, selbst wenn der Analytiker ein warmherziger Mensch ist, die Position des Patienten hinnehmen. Die Couch benutzte sie (im Gegensatz zu Fritz) nicht mehr. In der Arbeit mit ihr erfuhr ich sehr deutlich, was es heißt, authentisch zu sein« (in: A. u. E. Doubrawa [Hg.], Erzählte Geschichte der Gestalttherapie, Wuppertal 2003, S. 267f ).
Quelle:
Stichwort »Perls, Laura« in: Stefan Blankertz und Erhard Doubrawa, Lexikon der Gestalttherapie, Wuppertal 2005 (Nachdruck in unserer neuen Edition gikPRESS, Kassel 2017).
BIOGRAFISCHE ÜBERSICHT
1905
Am 15. 8. 1905 wird Lore Posner in Pforzheim in einer wohlhabenden Juweliersfamilie geboren.
1908
Beginn einer lebenslangen Leidenschaft: der Musik. Ab ihrem fünften Lebensjahr erhält Laura dann Klavierunterricht. Sie musiziert täglich (bis ins hohe Alter).
1911
Einschulung in eine private Mädchenschule in Pforzheim.
1913
Ab 1913 Tanz- und Bewegungsunterricht (Dalcroze-Kurse, später Kurse in rhythmischer Gymnastik).
1916
Besuch des Gymnasiums in Pforzheim. Laura ist das einzige Mädchen in ihrer Schulklasse.
1923
Laura beginnt das Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt/Main.
1926
Studienwechsel zur Psychologie und Philosophie. Ihre Lehrer sind u. a.: die Gestaltpsychologen M. Wertheimer; K. Goldstein, A. Gelb; der Philosoph E. Husserl; die Existenzialisten P. Tillich und M. Buber. Aus dem Umfeld der (kritisch-marxistischen) »Frankfurter Schule« der Sozialwissenschaften heraus aktive Beteiligung am gesellschaftspolitischen Geschehen. Intensives Studium von Ausdruckstanz und rhythmischer Bewegungsarbeit. Begegnung mit dem Psychoanalytiker Fritz Perls (geb. am 8. 7. 1893 in Berlin) im Gelb-Goldstein-Seminar.
1927
Laura beginnt eine psychoanalytische Ausbildung: Psychoanalyse bei K. Landauer; Lehranalyse bei E. Fromm-Reichmann.
1929
Heirat mit Fritz Perls am 23. 8. 1929 und Umzug nach Berlin.
1931
Am 23. 7. 1931 wird ihr erstes Kind, Renate, geboren. Laura Perls macht bei Elsa Gindler in Berlin sensitive Körperund Bewegungsarbeit.
1932
Beginn der eigenen Psychoanalytischen Praxis unter Supervision von O. Fenichel. Promotion in Frankfurt/Main bei A. Gelb mit einer Dissertation zu einem gestaltpsychologischen Thema über visuelle Wahrnehmung. Politische Aktivitäten in der Antifaschistischen Liga.
1933
Aus politischen Gründen Flucht nach Holland. Laura Perls Schwester und Mutter sterben später im Konzentrationslager.
1934
Emigration nach Johannesburg in Südafrika auf Initiative von Ernest Jones. Zusammen mit Fritz Perls dort Gründung des ersten Südafrikanischen Instituts für Psychoanalyse und Beginn der Ausbildung von Psychoanalytikern.
1935
Am 23. 8. 1935 wird ihr zweites Kind, Steve, geboren.
1936
Fritz hält einen Vortrag über »Orale Widerstände« auf der Internationalen Psychoanalytischen Konferenz in Marienbad in der Tschechoslowakei. Dabei stützt er sich ausführlich auf Lauras Beobachtungen der Nahrungsaufnahme ihres ersten Kindes, Renate.
1937
Fritz und Laura Perls wird zusammen mit vielen anderen von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung die Ausbildungsbefugnis entzogen. Die Begründung für diese Maßnahme lautete: Sie seien vorher nicht als Trainer in Europa tätig gewesen.
1939
Laura hält einen Vortrag unter dem Titel
How to Train Children in Peace?
ii
im Rahmen der ersten Frauenfriedenskonferenz in Johannesburg, Südafrika.
1942
Erstveröffentlichung von
Ego, Hunger, and Aggression.
Untertitel der ersten Ausgabe: Eine Revision der Freudschen Analyse (dt. »Das Ich, der Hunger und die Aggression«). Das Buch haben Fritz und Laura Perls gemeinsam erarbeitet. Allerdings wird nur Fritz als Autor genannt, obwohl Laura ganze Teile selbst verfasst und andere ausformuliert hat. Im Vorwort zur ersten Ausgabe wird jedoch Lauras bedeutender Beitrag zum Buch von Fritz gewürdigt.
1947
Emigration in die USA (New York). Praxiseröffnung. Unter ihren ersten Klienten waren P. Goodman, I. From, D. Rosenblatt und andere spätere Mitarbeiter und Freunde.
1949
Anmerkungen zum Mythos des Leidens
ii
1950
Der Psychoanalytiker und sein Kritiker.
Zuerst erschienen unter dem Titel:
The Psychoanalyst and the Critic,
in: Complex, No. 2 (1959), S. 41-47
ii
1951
Erstveröffentlichung des Buches
Gestalt Therapy
(dt. in zwei Bänden
Gestalttherapie: Grundlagen
und
Gestalttherapie: Praxis
) von F. Perls - R. Hefferline - P. Goodman. Damit erhält ihre Psychotherapieform die offizielle Benennung. Laura bleibt auch hier ungenannt, obgleich sie am ganzen Diskussions- und Entstehungsprozess des Buches entscheidend mitgewirkt hat.
1952
Begründung des New Yorker Instituts für Gestalttherapie. Leitung einer der ersten Gestalttherapie-Ausbildungsgruppen.
1953
Über die Psychologie des Gebens und Nehmens.
Zuerst erschienen unter dem Titel:
Notes on the Psychology of Give and Take,
in: Complex, 9 (1953-54).
ii
Stützung (Support) – Anmerkungen zu den Grundlagen des Kontaktprozesses.
Vorlesungsnotizen aus den Anfangsjahren des New York Institute for Gestalt Therapy.
ii
1956
Zwei Beispiele für Gestalttherapie.
Zuerst erschienen unter dem Titel
Two Instances of Gestalt Therapy,
in: Case Reports in Clinical Psychology, 2 (1956).
ii
1957
Zum ersten Mal nach ihrer Flucht reisen Fritz und Laura Perls nach Deutschland. Laura besucht dabei u. a. Max Horkheimer; einen wichtigen Vertreter der »Frankfurter Schule«.
1959
Der Gestalt-Ansatz.
Auf der vierten jährlichen Konferenz der American Academy of Psychotherapy in New York wurden führende Psychotherapeuten fünf verschiedener Therapieschulen zu ihrer Praxis befragt. Laura Perls’ Aufsatz entstand aus ihren Antworten auf diese Befragung. Zuerst erschienen unter dem Titel:
The Gestalt Approach,
in: Annals of Psychotherapy, Vol. 1/2 (1961).
ii
1965
Bemerkungen zur Angst und Furcht.
Vorlesungsnotizen für die Trainingskurse am New York Institute for Gestalt Therapy.
1969
Von 1969 bis 1989 reist Laura jeden Sommer nach Europa. Zuerst leitet sie Workshops in England, Holland und Belgien; später auch in Düsseldorf, Frankfurt/Main, Kleinich, Köln und Pforzheim
1970
Am 14. 5. 1970 stirbt Fritz Perls im Weiss-Memorial-Krankenhaus in Chicago an einem Herzanfall nach einer Operation wegen eines Pankreas-Karzinoms.
1972
Im Jahr 1972 führt Daniel Rosenblatt mehrere intensive Gespräche mit Laura Perls über den Weg der Gestalttherapie. Sie werden auf Tonband aufgenommen und später transkribiert und noch einmal mit Laura Perls besprochen. Die Transkripte wurden 1997 zum ersten Mal in der Edition des Gestalt-Instituts Köln/GIK Bildungswerkstatt im Peter Hammer Verlag unter dem Titel
Der Weg zur Gestalttherapie
veröffentlicht und sind in dem vorliegenden Buch vollständig enthalten.
Einige Aspekte der Gestalt-Therapie.
Vortrag unter dem Titel
Some Aspects of Gestalt Therapy
gehalten bei der Konferenz der Mid-Atlantic Group Therapy Association, Washington, D. C., USA. Erschienen in Ortopsychiatric Association, 1973.
1974
Grundlegende Begriffe und Konzepte der Gestalttherapie.
Zuerst erschienen unter dem Titel
Comments on the New Directions,
in: E.W.L. Smith (Hg.), The Growing Edge of Gestalt Therapy, Seaucus, New Jersey, 1976.
1976
Laura Perls gibt ihre Privatpraxis in New York auf und widmete sich ausschließlich der Ausbildung.
1977
Begriffe und Fehlbegriffe der Gestalttherapie.
Vortrag anlässlich der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Transaktionsanalyse in Seefeld, Österreich. Erschienen unter dem Titel
Concepts and Misconceptions of Gestalt Therapy,
in: Voices, Vol. 14, 3.
ii
An Anniversary Talk.
Vortrag zum 25. Jahrestag der Gründung des New York Institute for Gestalt Therapy. Zuerst erschienen in: The Gestalt Journal, Volume XI II, Number 2, Fall, 1990.
iii
1980
Auf der Konferenz für Gestalttherapie in Boston wird Laura Perls als die Grand Old Lady der Gestalttherapie gefeiert. Ein Transkript eines Workshops mit Laura Perls, der von der American Academy of Psychotherapists anlässlich der jährlichen Konferenz in New York organisiert wurde. Zuerst veröffentlicht in: Voices, Vol. 18, No. 2 Summer 1982.
ii
1981
Laura hält einen Vortrag über wesentliche Aspekte der Gestalttherapie vor einem großen Auditorium an der J.W. Goethe-Universität in Frankfurt/Main.
1982
Verleihung der Goldenen Doktorwürde zum 50jährigen Jubiläum ihrer Promotion an der Universität Frankfurt/Main.
1984
In der Reihe »Wege zum Menschen« wird im deutschen Fernsehen der Film »Leben heißt wachsen. Gestalttherapie – Laura Perls« ausgestrahlt.
A Conversation with Laura Perls.
Gespräch mit Daniel Rosenblatt. Zuerst erschienen in: The Gestalt Journal, Volume XIV, Number 1 (Spring, 1991).
iii
1985
Commitment – Hingabe und Selbstfestlegung in Freiheit.
Eröffnungsrede über die Theorie und Praxis der Gestalttherapie, die von Gestalt Journal in Provincetown, Massachussets, USA organisiert wurde.
ii
1987
Laura Perls wird Ehrenmitglied der Deutschen Vereinigung für Gestalttherapie (DVG).
1988
Jeder Roman ist eine Falldarstellung.
Vortrag anlässlich der Mitgliederversammlung des New York Institute for Gestalt Therapy.
ii
Gestalttherapie ist immer politisch.
Die Mitbegründerin der Gestalttherapie im Gespräch mit Daniel Rosenblatt im Gestalt-Institut Köln. Auszüge aus diesem Gespräch finden sich auch im vorliegenden Buch.
Leben an der Grenze.
Laura Perls im Gespräch mit Milan Sreckovic.
ii
1989
Laura Perls wird in Pforzheim Ehrenbürgerin. Laura Perls’ erstes Buch erscheint:
Leben an der Grenze: Essays und Anmerkungen zur Gestalttherapie
(Köln 1989, herausgegeben von Milan Sreckovic).
1990
Laura Perls muss von Februar bis April 1990 in einem New Yorker Krankenhaus behandelt werden. Ihr Gesundheitszustand hatte sich seit Herbst 1989 sehr verschlechtert. Überraschend kehrt sie im Juni 1990 in ihren Geburtsort zurück und zieht dort in ein Altenheim. Laura Perls stirbt am 13. 7. 1990, einen Monat vor Vollendung ihres fünfundachtzigsten Geburtstags. Am 16. 7. 1990 wird ihre Urne zusammen mit der von Fritz im Familiengrab der Posners in Pforzheim beigesetzt.
Fritz und Lore (Laura) Perls Hochzeitsfoto, 23. 8. 1929, durch © geschützt
ii Die so gekennzeichneten Vorträge und Aufsätze sind enthalten in: Laura Perls, Leben an der Grenze: Essays und Anmerkungen zur Gestalttherapie, hg. v. Milan Sreckovic, Köln 1989
iii Diese Vorträge und Aufsätze sind enthalten in: Laura Perls, Living at the Boundary, hg. v. Joe Wysong, Highland NY 1992
DER WEG ZUR GESTALTTHERAPIE
Vorbemerkung des Übersetzers
Dem Interview »Der Weg zur Gestalttherapie« liegen Transkripte von Tonbandaufzeichnungen zugrunde, die Daniel Rosenblatt von seinen Gesprächen mit Laura Perls anfertigen ließ. Für die Übersetzungsarbeit bedeutete dies, einen spontan gesprochenen und nicht für die Schriftsprache entworfenen Text einem lesenden Publikum zugänglich zu machen. Da es sich zudem um ein historisches Dokument handelt, galt es also, möglichst nah am Original zu bleiben, ohne allzu große Einbußen für den Lesefluss in Kauf zu nehmen. Wenn derlei Unstimmigkeiten stellenweise dennoch kaum vermeidbar waren, bitte ich die Leser um Verständnis.
An verschiedenen Stellen wies das zur Übersetzung vorliegende Manuskript Lücken auf, die z. T. handschriftlich nachgetragen, aber dennoch nicht immer eindeutig erkennbar waren. Diese Stellen sind im Text als Lücken gekennzeichnet und in den Anmerkungen jeweils mit einem entsprechenden Hinweis versehen.
Der amerikanische Ausdruck »patient« wurde i. d. R. mit dem deutschen Wort »Klient« übersetzt, da das Amerikanische die im Deutschen geläufigere Unterscheidung zwischen Klient und Patient nicht vorsieht.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Kathryn Conklin für ihre liebe Unterstützung in heiklen Übersetzungsfragen bedanken. Ebenso möchte ich Bernd Bocian für die hilfreichen Erläuterungen einiger Namen und historischer Zusammenhänge herzlich danken.
Ludger Firneburg
Laura Perls und Daniel Rosenblatt am 14. 6. 1988 im Gestalt-Institut Köln/GIK Bildungswerkstatt (Reproduktion von einem Video-Film, © GIK)
Erstes Gespräch, 4. März 1972
Laura Perls’ Herkunft
Laura: Was soll ich dir erzählen, wo ich herkomme?
Dan: Ja.
Laura: Nun, ich stamme aus einer kleinen Stadt, aus der gehobenen Mittelschicht mit jüdischem Hintergrund, genauer: reformiert jüdisch, d. h. wir lebten sozial eher zurückgezogen, und die Menschen, mit denen wir Umgang hatten, waren sehr sorgsam ausgewählt.
Dan: Was meinst du mit: sozial zurückgezogen?
Laura: Wenn du den Film The Garden of the Finzi-Continis4 gesehen hast, weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Man erregte kein Aufsehen, wir waren gut gekleidet, wir hatten alles, aber es musste alles unauffällig bleiben. Mein Vater zum Beispiel hatte sich hochgearbeitet und besaß ein großes Geschäft, eine Fabrik; er war sehr wohlhabend, aber er hatte nie einen eigenen Wagen. Es gab nur einen Firmenwagen, und als er älter wurde, wurde er abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Mein Bruder hatte später ein eigenes Auto.
Dan: Wieviel Kontakt hattet ihr zu Nichtjuden?
Laura: Also, in der Schule natürlich. Außerdem hatte mein Vater geschäftlich Kontakte mit Nichtjuden. Mit einigen verstand er sich wirklich gut, vor allem mit seinen Geschäftspartnern. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgend jemand, der kein Jude war, meine Eltern besucht hätte, z. B. sonntags. Zu unseren Kreisen gehörten eher die Juden der gehobenen Schicht.
Dan: Und woher kam die Familie deiner Mutter?
Laura: Meine Mutter stammte aus Hamburg, ebenfalls aus der gehobenen Mittelschicht. Sie war ziemlich wohlhabend als sie heiratete. Mein Vater kam aus der unteren Mittelschicht, und er sagte, sein Vater sei Lehrer gewesen. Er hatte mit seiner Familie einige Jahre in England gelebt, und ich glaube nicht, dass er als gewöhnlicher Schullehrer dorthin gegangen wäre, wohl aber als jüdischer Lehrer. Ich habe Gründe für die Annahme, dass er ein Rabbi war, was mein Vater allerdings nie erwähnte. Die Sache mit dem Judentum wurde immer etwas heruntergespielt.
Dan: Welche Interessen gab es in deiner Familie?
Laura: Meine Mutter war eine sehr gebildete Frau. Sie hatte ihren Schulabschluss in Brüssel gemacht und sprach fließend englisch und französisch. Sie übersetzte Bücher und sie war sehr musikalisch. Mein musikalisches Talent habe ich wohl von ihr. Schon von der Wiege an war ich mit dem Klavier vertraut. Ich hörte sie spielen, und als ich fünf war, begann ich selbst zu spielen.
Dan: Hast du frühe Erinnerungen an das Klavierspiel?
Laura: Ja. Ich weiß, dass ich spielen wollte, und ich bat sie solange, bis sie es mir beibrachte. Und ich erinnere mich noch, dass ich als Fünf- oder Sechsjährige kleine Stücke vierhändig mit ihr spielte. Ich erinnere mich auch noch gut an die Begeisterung, die ich verspürte, als ich zum ersten Mal bemerkte, dass ich mehr als einen Ton gleichzeitig spielen konnte, ja, dass ich richtige Akkorde zustande brachte; dieses Gefühl von Überraschung und Stolz ist noch ganz wach in mir. Und im Alter von zehn oder zwölf war ich schon eine ziemlich weit fortgeschrittene Pianistin. Mit fünfzehn hatte ich mich bereits durch das ganze klassische Repertoire gespielt, auch wenn ich technisch nicht alles beherrschte. Aber natürlich hatte ich damals auch sehr gute Lehrer. Meine Mutter unterrichtete mich bis ich ungefähr sieben war, aber dann konnte sie es wirklich nicht mehr.
Dan: Erinnerst du dich an das Lernen mit ihr? Wie war das?
Laura: Es ist eigenartig; obwohl wir dieselben Interessen und Neigungen hatten – meine Mutter las sehr viel, sie schrieb Gedichte, malte ein wenig und war eine ausgezeichnete Musikerin – empfand ich eine Menge Geringschätzung für sie, fast Verachtung. Ich denke, das hat damit zu tun, dass sie diesen Hang zum Rückzug hatte. Sie stand nie wirklich für sich selbst ein und machte nicht viel aus ihrer Begabung. Meinem Vater gegenüber, den ich sehr verehrte, spielte sie immer die zweite Geige – wenn überhaupt. Er hatte es aus eigener Kraft geschafft, er war zwar nicht sehr gebildet, aber immerhin sehr belesen in den Bereichen, die ihn interessierten: vor allem Politik und Wirtschaft. Während des Ersten Weltkriegs war er für die Regierung als Berater tätig gewesen.
Dan: Was ist deine früheste Erinnerung?
Laura: Über meine erste Erinnerung schrieb ich später eine Geschichte, viele Jahre später in Südafrika. Es war meine erste Geschichte überhaupt, sie handelt von dieser ersten, eigentlich eher kinästhetischen Erinnerung. Es ging um eine Begegnung mit meiner Mutter. Sie lag im Bett, ich glaube es war nach der Geburt meiner jüngeren Schwester. Mutter ließ einen Fingerhut fallen und wollte, dass ich ihn aufhebe. Aber ich wollte ihn nicht aufheben. Ich lief herum, und sie fasste meine Hand und zwang mich, den Fingerhut aufzuheben. Sobald sie lockerließ, riss ich mich los und schlug sie. An die Folgen kann ich mich nicht erinnern. Damals war ich ungefähr zwei Jahre alt. Aber ich erinnere mich sehr deutlich, dass ich zu nichts gezwungen werden wollte.
Dan: Während des Erzählens hast du deine Hand auf deinen Unterarm gelegt – kinästhetisch.
Laura: Ja.
Dan: Erinnerst du dich, wie du sie schlugst?
Laura: Das einzige, woran ich mich erinnere, ist die Bewegung von Schlagen oder Stoßen.
Dan: Du sagtest, deine Mutter sei sehr zurückgezogen gewesen und hätte die zweite Geige gespielt; ich möchte dich fragen, wann in deiner Kindheit dir zum ersten Mal klar wurde, dass es so etwas wie Psychologie gibt, dass Menschen unterschiedlich sind in ihrer Art.
Laura: Dass die Menschen verschieden sind, wurde mir sehr früh klar, und ich war immer an Menschen interessiert, die einen anderen Lebensstil hatten als ich. Das führte später zu einer Menge Konflikte zwischen mir und meinem Vater, den ich so sehr verehrte und bewunderte. Aber dann, mit ungefähr vierzehn ging ich in eine jüdische Jugendgruppe. Ursprünglich war diese Gruppe von B’nai B’rith5 gegründet worden, aber sie hatte auch einige mehr zionistisch orientierte Mitglieder. Teilweise kamen die Leute aus der unteren Mittelschicht, einige studierten Ingenieurwesen und arbeiteten in Eisenwarenläden; am besten verstand ich mich mit denen, die arbeiteten.
Dan: Hattet ihr ein Hausmädchen?
Laura: Oh, ja. Wir hatten immer eine Köchin, ein Zimmermädchen und ein »Fräulein«, eine Gouvernante.
Dan: Was hast du von solchen Unterschieden gehalten, als du klein warst?
Laura: Ich erinnere mich an fast alle, seit ich vier war, sowohl an die Hausmädchen als auch an die Fräuleins. Die Fräuleins waren durchweg sehr nett, bis auf eine, die war ziemlich dumm und konnte mit uns nichts anfangen. Sie stellte überhaupt keine Autorität dar. Wenn jemand ihr widersprach, fing sie an zu weinen; sie war nur sehr kurz bei uns. Nach dieser kam eine, die acht Jahre blieb, und wir wurden richtige Freunde.
Dan: Wie war das für dich, dass diese Frauen da waren, im Haus arbeiteten, aber nicht zur Familie gehörten?
Laura: Das Fräulein aß mit uns am selben Tisch; in gewisser Weise war sie schon Teil der Familie. Die Mädchen hielten sich natürlich in der Küche auf, und damals dachte ich mir nichts dabei. Es war einfach so, von Anfang an. Später dachte ich mehr darüber nach. Als ich selbst verheiratet war, hatte ich auch ein Hausmädchen und zeitweise eine Kinderfrau, die nach dem Kleinen sah. Sie waren Kommunisten, wie wir selbst auch zu der Zeit, und ich behandelte sie genau wie meine Freunde und Bekannten.
Dan: Auch noch später in Südafrika?
Laura: Nun, in Südafrika waren die Bediensteten natürlich Schwarze. Eines der Hausmädchen meiner Mutter kam später zu uns und kümmerte sich um die Kinder. Sie war Halbjüdin und wollte raus.
Dan: Also, ich habe dich gefragt, ob du dir der Unterschiede bewusst warst und wir sprachen über soziale Unterschiede, aber ich möchte auch wissen, ob du Unterschiede in der Persönlichkeit der Menschen wahrgenommen hast.
Laura: Ja, zu bestimmten Zeiten durften wir nicht auf die Straße, z. B. wenn die Arbeiter aus den Fabriken kamen. Pforzheim ist eine Industriestadt, in der Schmuck hergestellt wird, Modeschmuck, aber auch wertvoller Schmuck, und jeder hat in irgendeiner Weise damit zu tun. Wenn die Arbeiter also aus den Fabriken kamen oder zur Arbeit gingen oder wenn sie zum Bahnhof gingen, um mit dem Zug in die umliegenden Dörfer zu fahren – die meisten kamen vom Land und betrieben noch Landwirtschaft. Während des Ersten Weltkriegs z.B. brachten sie von ihren Höfen Eier mit, und so hatten wir immer ein paar Eier oder Butter oder andere Lebensmittel, die man kaum bekam.
Dan: Erinnerst du dich an den Ersten Weltkrieg?
Laura: Ja natürlich. Als der Krieg ausbrach – ich war acht oder neun – war ich in der Schule und wir lachten über irgend etwas und machten Spaß. Einer der Lehrer kam sehr aufgeregt aus dem Lehrerzimmer in unsere Klasse und sagte: »Seid still. Wie könnt ihr lachen, wir haben Krieg!« Als ob Kinder einfach aufhören könnten lebendig zu sein.
Dan: Das erinnert mich an diese frühe Erinnerung an deine Mutter, die dich zu etwas zwingen wollte. In diesem Fall versuchte der Lehrer, euch eine bestimmte Haltung vorzuschreiben.
Erinnerst du dich daran, wie du feststelltest, dass es handfeste Unterschiede zwischen deinem Vater und deiner Mutter gab?
Laura: Oh, mir war wohl bewusst, dass mein Vater sehr aus sich herausgehen konnte, und zwar mit seiner Rührung, aber auch mit seinem Ärger. Wahrscheinlich hatte ich Angst vor ihm, obwohl ich seinen Ärger mir gegenüber nie wirklich direkt erfahren habe.
Dan: Wer hat dich beim Lesen am meisten interessiert?
Laura: Ich nahm alles, was ich kriegen konnte. Ich hatte einige Kinderbücher, aber ich las alles, was ich fand: Zeitungen, Magazine, die Bücher meiner Mutter; und natürlich gab es Bücher, die ich eigentlich noch nicht lesen durfte, aber ich las sie trotzdem. Und sobald ich schreiben konnte, begann ich zu schreiben. Zuerst schrieb ich kleine Gedichte, mit denen sie mich dann aufzogen, und dann begann ich so eine Art Roman. Es war eine Liebesgeschichte so wie ich sie irgendwo in den Illustrierten gelesen hatte.
Dan: Erinnerst du dich an eine solche Geschichte?
Laura: Ich weiß keine Einzelheiten mehr, aber ich weiß noch, dass ich sie dem Zimmermädchen zeigte. Sie musste mir versprechen, es nicht meiner Mutter zu zeigen, denn die hielt bestimmt nichts von diesem Zeug. Aber das Mädchen war so beeindruckt, dass sie die Geschichte doch meiner Mutter zeigte, und die ging an die Decke. Das war eines der wenigen Male, wo sie aktiv eingriff, und zwar sehr drastisch. Sie nahm es mir einfach weg und sagte, sie könne sich überhaupt nicht vorstellen, wie ich an dieses Zeug käme, das sei nichts für kleine Kinder, davon verstünde ich nichts. Sie nahm es weg, und sie nahm mehr als nur das, was ich geschrieben hatte, denn von diesem Moment an konnte ich überhaupt nicht mehr auf deutsch schreiben, jedenfalls nicht mehr über meine Gefühle, sondern nur noch rational und schulmäßig. Ich war tief gekränkt. Als ich neun war, sollten wir in der Schule eine Geschichte schreiben, einen Aufsatz. Ein Mädchen, das ich gar nicht mochte und das ich für ziemlich dumm und ungebildet hielt, schrieb eine sehr schöne, phantasievolle Geschichte über Tiere und so, und ich schrieb eine langweilige, schwerfällige Beschreibung über das Weihnachtsfest. Verglichen mit ihrer Geschichte war meine wirklich gar nichts und ich war sehr verletzt und unglücklich.
Meine Mutter hatte also nicht nur die Anfänge meines Romans weggenommen, nein, damals ging auch meine Fähigkeit, aus meiner Phantasie heraus zu schreiben verloren. Seitdem schreibe ich nur noch in einem wissenschaftlichen Stil oder Aufsätze, und sehr rational. Meine Phantasie gewann ich erst zurück, als ich lernte, in einer anderen Sprache zu funktionieren. Als ich in Südafrika lebte, sprach ich acht oder neun Jahre lang Englisch, und es war nicht nur eine Gebrauchssprache, nein, ich las eine ganze Menge an englischer Literatur. Damals begann ich wieder zu schreiben.
Dan: Hast du all diese Dinge in deiner Analyse bearbeitet?
Laura: Ja, obwohl die Analyse auch sehr rational war und auf eine bestimmte Art meine Rationalität betonte.
Dan: Und in Südafrika hast du wieder geschrieben?
Laura: Ja. Ich fing an zu schreiben, als ich herausfand, dass meine gesamte Familie vernichtet worden war, damals musste ich einfach schreiben. Und dann, 1944 bis 1946, und während der ersten paar Jahre hier schrieb ich viele Gedichte und Geschichten.
Dan: Hast du später noch jemals deutschsprachige Gedichte geschrieben?
Laura: Nein, nicht auf deutsch. Ich habe einige englische ins Deutsche übersetzt. Aber wenn ich Gedichte schreibe, dann auf englisch. Und ich kann mich auf englisch sehr viel herzlicher und unmittelbarer ausdrücken, als ich das jemals im Deutschen konnte. Wahrscheinlich könnte ich das heute auch, aber ich habe tatsächlich niemanden, den ich so ansprechen würde. Ich könnte kaum auf deutsch: »Ich liebe dich« sagen, dagegen kann ich sehr leicht: »I love you« sagen.
Dan: Wie war das mit Fritz in der ersten Zeit?
Laura: In der ersten Zeit waren wir sehr liebevoll, aber nicht so sehr mit Worten. Er war auch etwas gehemmt. Aber er brachte es ganz gut ins Englische rüber.
Dan: Erinnerst du dich daran, welche Charaktere dir beim Lesen am meisten bedeuteten bevor du – sagen wir – zehn warst?
Laura: Das ist schwierig zu sagen. Also was mich zu Anfang tatsächlich am meisten packte, war die griechische Mythologie.
Dan: Weißt du noch, welche Helden dir am meisten bedeuteten?
Laura: Helden – keine Ahnung. Irgendwie der ganze Zusammenhang. Naja, Athene, die in ihrer ganzen Größe Zeus’ Gedanken entspringt, das ist natürlich sehr kunstvoll.
Dan: Aber sie ist auch die Weise und Kostbare.
Laura: Ja, und dann die Geschichte der Niobe. Niobe hat vierzehn Kinder und macht sich über Latona lustig, die nur zwei hat. Latona verflucht daraufhin Niobe, und alle vierzehn Kinder sterben oder werden getötet. Und Latonas Kinder sind Apollo und Diana.
Dan: Und du identifizierst dich mit …?
Laura: Beiden.
Dan: Mit allen Dreien.
Laura: Und dann habe ich natürlich schon sehr früh viele deutsche Gedichte gelesen, ich konnte wirklich darin versinken.
Dan: Weißt du noch welche dir besonders wichtig waren?
Laura: Wer mir viel bedeutete waren die Mystiker des 17. Jahrhunderts, dann später: Hölderlin, Goethe, Schiller weniger, obwohl zu einer bestimmten Zeit auch Schiller sehr wichtig war, vor allem vor und während meiner Jugend.
Dan: Welche Schriftsteller haben dir außerdem etwas bedeutet?
Laura: Das ist sehr schwierig, weil ich alles Mögliche gelesen habe. Rilke hat mich – zumindest von den modernen deutschen Dichtern – am meisten beeindruckt. […]
Dan: Du hast keinen einzigen russischen Schriftsteller erwähnt.
Laura: Ja, richtig. Es gab eine Zeit, da waren die Russen sehr wichtig, vor allem Dostojewski. Tolstoi weniger, obwohl ich Tolstoi wieder auf deutsch gelesen habe, als ich letztes Jahr in Österreich war.
Dan: Und Nietzsche hast du auch nicht erwähnt.
Laura: Natürlich. Es gab so viele Autoren […]
Lauras Schulzeit
Dan: Und wie war das während deiner Jugend?





























