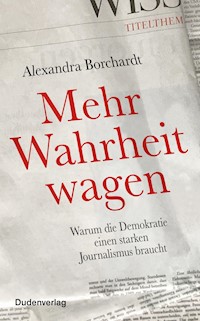8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ob die digitale Welt uns freier macht, bestimmen wir.« (Alexandra Borchardt)
Die digitale Welt verändert nicht nur Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sie schafft auch einen neuen Menschen. Ständig vernetzt scheint er der Mittelpunkt eines selbst gestalteten Universums zu sein. Tatsächlich aber werden wir manipulierbar, abgelenkt und getrieben. Wie verändern die neuen Technologien unsere Sicht auf die Welt? Können wir mehr mitbestimmen, oder werden wir zu nützlichen Idioten ökonomischer und politischer Interessen? Diesen Fragen geht Alexandra Borchardt in ihrem Buch nach und zeigt: Es ist nötig und auch möglich, die digitale Welt selbstbestimmt zu gestalten.
- Was Digitalisierung aus uns macht
- Die aktuellen Trends der digitalen Welt verstehen
- Amazon, Google & Co. – die Macht der Algorithmen erkennen
- Wege zu mehr Freiheit finden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexandra Borchardt
Mensch 4.0
Frei bleiben in einer
digitalen Welt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2018 by Alexandra Borchardt
Copyright Deutsche Erstausgabe © 2018 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Covergestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See
Covermotive: © donskarpo/shutterstock.com
ISBN 978-3-641-21728-0V002
www.gtvh.de
Für Jakob und Rebecca
EINLEITUNG: ALARM AUS DER TASCHE
Was von jenem Abend bleiben wird, vielleicht für immer, sind diese Augen. Vor Schrecken geweitet, einen anflehend aus dem Gesicht eines vielleicht sieben, acht Jahre alten Jungen, der sich an der Hand seiner Mutter in den Hinterhof des kleinen Hotels geflüchtet hat: »Da draußen wird geschossen«, sagt er und meint damit die Münchner Innenstadt. Gerade waren die Straßen rund um den Marienplatz noch Ort fröhlicher Freitagabendstimmung. Der warme Julitag verheißt ein sommerliches Wochenende, die letzten Eifrigen verlassen ihre Büros, die anderen sind schon angekommen zwischen all den Touristen in den Straßencafes, den Wirtshäusern, auf Last-Minute-Streifzügen durch die großen Kaufhäuser. Und plötzlich: überall Panik. Sollte die gefühlt sicherste Millionenstadt der Welt Schauplatz eines nach Pariser Vorbild orchestrierten Terrorangriffs geworden sein?
Es wird noch fast sechs Stunden dauern, bis klar ist: Es war kein Großanschlag in der City, sondern – dramatisch genug – ein einzelner Amokschütze, gut zehn Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens, der Flaneure zum Rennen, Kneipengäste zum Sprung aus dem Fenster veranlasst, Berufspendler, Einheimische und Ortsfremde in Panik versetzt hatte. Und noch viel später wird man sich die Augen reiben ob der Bilanz: Anstelle eines einzigen hatte die Polizei 67 vermeintliche Anschlagsorte gemeldet bekommen.1 Wie konnte das geschehen?
Angst, die sich schneller verbreitet als das gefährlichste Grippevirus, gewachsen auf falschen Informationen – selten zuvor konnte man diesen Prozess so hautnah erleben wie in der Amoknacht von München am 22. Juli 2016. Viele Menschen hatten die Terrorbilder von Nizza noch im Kopf, wo wenige Tage zuvor ein Attentäter seine Opfer mit einem Lastwagen auf der Strandpromenade niedergemäht hatte. Und sie hielten die Möglichkeit buchstäblich in der Hand, ihre schlimmsten Befürchtungen anderen mitzuteilen. Die Suggestionskraft von Twitter und Facebook, ausgespielt auf Hunderttausenden Computern im Hosentaschenformat, hatte auch jene ergriffen, die normalerweise eher einen kühlen Kopf bewahren, routinierte Polizisten, erfahrene Journalisten.
Das Smartphone, sonst Retter aus jeder vermeintlichen Not, war plötzlich gar nicht mehr so smart. Und hätte das Social-Media-Team der Münchner Polizei nicht so beherzt mitgespielt in der Kakophonie der Stimmen und es geschafft, letztlich eine Art beruhigende Melodie in das Ganze zu bringen, die Situation wäre womöglich weiter eskaliert. Selten zuvor wurde offensichtlicher als an diesem Abend, dass die in der digitalen Welt so gewichtige Weisheit der Vielen auch das potenzierte Unvermögen der Vielen sein kann, die Lage um sie herum richtig einzuschätzen.
Neue Technologien verändern den Menschen, das haben sie schon immer getan. »Das Medium ist die Botschaft«, schrieb Marshall McLuhan 1964 in einem heute noch beachteten Werk.2 So wie über die Jahrhunderte hinweg der Buchdruck, das Radio und schließlich das Fernsehen die Sinne anders forderten und damit die Welt umformten, so prägen auch die digitalen Technologien das Leben neu – allein tun sie das drastischer und schneller als viele Erfindungen zuvor. Denn während Innovationen früherer Jahrhunderte stets zunächst lange nur einem kleinen Kreis von Nutzern vorbehalten waren, den Wohlhabenden, dem Militär, den gebildeten Eliten, hat das Smartphone binnen eines Jahrzehnts quer durch alle Gesellschaftsschichten selbst entlegene Winkel der Erde erobert.
Wo das stationäre Telefon nie eine Chance hatte, massentauglich zu werden, ersetzt das Smartphone nun Bankfilialen, Kaufhäuser, hält den Kontakt zum Rest der Welt. Weniger begüterte Eltern gönnen ihren Kindern zuweilen eher den Kleincomputer als eine warme Winterjacke. Flüchtlinge mögen ihre Schuhe durchgelaufen, ihre Habseligkeiten auf dem Weg über das Meer verloren haben, am Smartphone hängen sie, denn es ist ihre Nabelschnur.
Seitdem Apple die Welt im Januar 2007 mit dem ersten iPhone überraschte, ist nicht alles anders geworden, aber vieles. Denn es war eben nicht nur ein um eine Tastatur und einen hochklassigen Fotoapparat erweitertes Mobiltelefon wie andere Taschen-Kommunikationsgeräte zuvor. Binnen zehn Jahren hat sich das Smartphone zu einer Art erweitertem Gehirn entwickelt. Es verbindet den Menschen jederzeit mit der Welt, ja er wird ein Teil von ihr. Für so gut wie alles, was er braucht, sich wünscht, erledigt haben will, gibt es nun eine App, und auch diese Applikationen könnten schon wieder überflüssig werden, wenn uns erst einmal elektronische, sprachgesteuerte Assistenten jeden Wunsch zu erfüllen versuchen.
Rund um die Uhr und von überall aus kann man nun über das Telefon einkaufen, sich die Zeit vertreiben, ein Auto oder ein Zimmer mieten, mit Freunden und Feinden kommunizieren, sich informieren, eine Sprache lernen, einen Partner finden. Bald wird es normal sein, über die App seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren, von Ferne elektronische Geräte in seiner Wohnung zu steuern oder sich – mit Hilfe von virtueller Realität – in Fernen zu begeben, von denen man bislang nur geträumt hatte.
All das klingt nach Freiheit, es schmeckt nach einer herrlichen Welt voller Autonomie. Wir sind die Chefinnen und Chefs unseres kleinen Universums, wir können uns mit allem und allen verbinden und von unserer kleinen Kontrollzentrale aus die Läufe der Welt ein winziges bisschen beeinflussen. Noch nie standen den Menschen in so großer Zahl so viele Möglichkeiten offen, Wissen über die Welt zu sammeln und damit das Abenteuer Leben in den Griff zu bekommen, das lange in weiten Teilen als unberechenbar galt. In den verschiedensten Religionen billigte man allein den Göttern die Fähigkeit zu, Schicksale zu bestimmen. Möchte man das Bild strapazieren, könnte man sagen, Steve Jobs hat ordentlich dazu beigetragen, Gott arbeitslos zu machen.
Doch die große Frage ist: Gehen wir nun in eine Zukunft voller kleiner Götter? Wird Macht auf Milliarden Individuen verteilt, so wie es die Internet-Idealisten der ersten Stunde als Vision eines perfekt demokratischen Lebens skizziert hatten? Oder sind in Wahrheit gar nicht wir die Steuernden, sondern sitzen in der Schaltzentrale andere, und wenn ja, wer? Und werden das am Ende noch Menschen sein oder von Algorithmen gelenkte virtuelle Instanzen der Macht? Denn je stärker wir das Smartphone oder seine Nachfolger füttern mit allem, was uns ausmacht: unseren Wünschen, Vorlieben, Bewegungen, Handlungen, desto stärker wird es uns steuern.
»Es« ist natürlich nicht die Maschine als solche, sondern es sind die Datenpakete und Algorithmen, die uns Vorschläge machen, uns sanft motivieren, dieses zu tun und anderes lieber zu lassen – nudging heißt das in der Fachsprache. Das Smartphone wird deshalb nicht zur elektronischen Fußfessel werden. Es gleicht eher der Mutter oder dem Vater, die immer alles besser wissen, nur das Beste wollen, immer einen Tipp parat haben und das Kind auf diese Weise in Abhängigkeit halten. Es könnte ein Elternhaus werden, aus dem man nie ausziehen kann.
Philosophen und Neurowissenschaftler führen eine spannende Debatte darüber, ob der Mensch einen freien Willen hat oder eher von Impulsen seines Gehirns getrieben wird, dem Produkt seiner Erfahrungen und Erlebnisse; die Gehirnforschung hat gerade erst damit begonnen, das zu erkunden. In der digitalen Welt stellt sich diese Frage noch einmal ganz neu, wer eigentlich der Herr im geistigen Haus ist. Denn weil das Smartphone praktisch als erweitertes Gehirn funktioniert, das uns füttert, unseren Standort funkt, unsere Vorlieben speichert, uns überwacht, lockt, treibt, stimuliert und enttäuscht, bekommt das handelnde Ich eine neue Konkurrenz: Künftig werden Taten lauter sprechen als Worte. Wir müssen nicht reden und damit unseren Willen kundtun, wir müssen nur etwas tun, um durchschaut zu werden.
Vernetzt durch winzige Rechner, die in jedem Haus, jedem Auto, in jeder Tasche, jedem T-Shirt und womöglich sogar in unter der Haut eingepflanzten Chips stecken, werden wir kommunizieren, auch wenn wir schweigen. Sensoren und Ortungssysteme werden erfassen, wann wir schlafen und wachen, wohin wir gehen, was wir begehren und was uns langweilt. Wir werden Wissen schaffen, ohne es zu wollen. Und gleichzeitig wird uns das Unwissen überschwemmen. Schon sät die Ausbreitung von »Fake News« in allen Schattierungen Misstrauen. Was ist wahr, was ist falsch, wem kann man noch vertrauen? Dennoch gilt: Noch nie zuvor war der Mensch so vernetzt, so sehr Teil eines Rädchens in der Weltmaschine, und noch nie hat er sich dabei so autonom gefühlt. Während er noch denkt, er sei in seinem Cockpit der Kapitän, hat schon längst der Autopilot übernommen.
Sich dem zu entziehen, wird immer schwieriger, denn wir sind längst gefangen: Auf jedes Blinken und Summen, das eine neue Nachricht anzeigt, reagieren wir, ebenso auf unsere Impulse, man könnte doch jetzt noch mal schnell das Postfach checken, die sportliche Leistungskurve abrufen, nach dem Wetter schauen. Der moderne Mensch greift mindestens 150 mal am Tag nach seinem Smartphone, haben verschiedene Studien ergeben, Amerikaner verbringen täglich mehr als vier Stunden netto mit ihrem Gerät. Wir sind der Neugier erlegen und unseren Impulsen, denn Smartphones machen süchtig.
Würde jemand nach Jahren aus dem Koma erwachen, er verstünde die Welt nicht mehr: Menschen halten den Kopf geneigt, den Blick gesenkt und ihr Mobiltelefon in der Hand. Auf diese Weise entrückt prägen sie selbst dort das Bild, wo früher munteres Plaudern Standard war, auf Parties, am Restauranttisch, in der Kollegenrunde. Wir verlieren die Fähigkeit zum Zuhören, zum Gespräch, zur Konzentration, warnen Wissenschaftler wie die Psychologin Sherry Turkle von der amerikanischen Eliteuniversität MIT. Die weite Welt draußen und in den Tiefen der Datenräume scheint stets spannender zu sein als das, was um uns herum geschieht. Etwas zutiefst Menschliches könne dabei verloren gehen, sorgen sich Experten: die Empathie.
Wie immer gibt es auch Licht neben solcher Düsternis. Denn es verbinden sich große Hoffnungen mit dem sekündlich wachsenden Datenschatz, dem zunächst schmerzfreien Experiment am lebenden Objekt. Wieviel angenehmer, bequemer und an den Bedürfnissen des Einzelnen ausgerichtet wird sich die Welt gestalten lassen, wenn man sie endlich genauer kennen und jeden Bürger an das große Ganze angeschlossen haben wird? Jeder werde Zugang zu Dienstleistungen haben, die heute vielen verwehrt sind: Kommunikation, Geldgeschäfte und der Handel werden keine Privilegien mehr sein. Hunger werde sich bekämpfen, bösartige Krankheiten heilen, ja das Leben sich verlängern lassen.
Der Antrieb dieser Revolution ist der Glaube daran, dass jedes Problem lösbar ist. Man muss es nur in winzigste Einzelteile zerlegen – in die Einsen und Nullen der Digitalsprache – und dann angereichert mit neuem Wissen wieder zusammensetzen. Das ist ganz ähnlich wie damals, als die Standardisierung und das Zerlegen von Aufgaben in überschaubare Prozesse die industrielle Revolution befeuert hat. Die Sehnsucht nach dem guten Leben, nach Unsterblichkeit, schwingt mit in der Begeisterung der Digital-Propheten, tatsächlich kann sie ansteckend sein.
Auf der anderen Seite stehen die Ängste: Werden wir noch unbeschwert leben, lästern, lieben können, wenn wir rund um die Uhr zwangsweise kommunizieren und damit unser Dasein offenlegen? Wer oder was steuert uns, und was können wir selbst noch steuern, wo Algorithmen doch so viel schneller berechnen, was uns zum Glück noch fehlen, was uns lieb und teuer sein sollte? Wie verarbeiten wir den Druck, der sich aus der Lücke ergibt, die auf ewig zwischen Perfektion und Wirklichkeit klafft? Wem gehören wir, wenn wir das Produkt unserer Daten sind? Können wir noch abschalten, in jedem Sinn des Wortes? Was zu der großen Frage führt: Werden wir noch frei sein und die Läufe dieser Welt mitgestalten können? Oder verwandeln wir uns in nützliche Idioten, die ein System füttern, das allein dem wirtschaftlichen Nutzen unterworfen ist? Und sollte das doch klappen mit der Freiheit, wie könnte sie aussehen in der digitalen Welt?
Wie er sein wird und sein könnte, der Mensch 4.0, damit beschäftigt sich dieses Buch. Es trägt Erkenntnisse aus der Psychologie und der Gehirnforschung zusammen, zieht Philosophen, Ingenieure, Soziologen und Politikwissenschaftler zu Rate. Es reflektiert über Macht und den freien Willen, entwirft ein Bild des künftigen Alltags.
Und es kommt zu der Erkenntnis: Es gibt sie nicht, die Blaupause des Menschen der Zukunft. So wie George Orwell in seinem Zukunftsroman »1984« erstaunlich viel vorausgesehen hatte und doch sehr deutlich danebenlag, wird auch Dave Eggers mit seinem Google-kritischen Werk »The Circle« nur eine Variante von Zukunft entworfen haben. Die Realität entwickelt sich mit Sicherheit anders. Denn tatsächlich haben wir es in der Hand. Die digitale Welt lässt sich gestalten, und zwar von uns. Um das aber zu können, müssen wir ihre Gesetze, die herrschenden Machtverhältnisse und ihr Potenzial zunächst einmal kennen. Die folgenden Kapitel bieten Aufklärung.
1. WIR SIND IMMER »ONLINE – DIGITALISIERUNG VERSTEHEN
Was ein Segen sein soll, wird zuweilen zum Fluch. Die Atomkraft zum Beispiel sollte die Menschheit von Energiesorgen und schlechter Luft befreien, heute steht sie für unkalkulierbare Gefahren und ein gigantisches Altlastenproblem. Das Auto hat die Stadtentwicklung revolutioniert, seinen Besitzern Bewegungsfreiheit geschenkt, heute ersticken Großstädte und ihre Bewohner in Staub- und Abgaswolken und ertauben unter Lärmteppichen. Stadtbilder und Landschaften verkümmern ob des Zwangs zum Parkplatz- und Straßenbau. Einmal entfesselt lassen sich viele Technologien, die Probleme lösen, nur noch schwer einfangen, auch wenn sie andere, womöglich folgenreichere Schwierigkeiten erst kreieren. Was eigentlich befreien sollte, hat neue Zwänge geschaffen. Es sind dann neue Erfindungen gefragt, die den alten ihren Charme nehmen, solche technischer, aber auch politischer Art. Menschen, die sorglos schädliche Produkte gebraucht haben, müssen umlernen.
Auch das Internet sollte ein Segen sein. Als großartige Befreiungstechnologie hatten es seine Erfinder betrachtet, die das Individuum an die Welt anschließt. Auf diese Weise sollte es erstmals jedem Menschen mit Netzanschluss möglich sein, die Welt auch zu beeinflussen. Was den Anschluss angeht, hat das überraschend gut funktioniert. Zwar gibt es immer noch einen beträchtlichen digitalen Graben: Von den ungefähr 7,5 Milliarden Erdbewohnern hat bislang erst ungefähr jeder zweite Zugang zum Internet.1 Aber Dank des Smartphones, das den Computer auf Jackentaschenformat geschrumpft hat, haben Menschen in manchen armen Ländern mehr Schwierigkeiten, an sauberes Trinkwasser zu kommen als an eine Internet-Verbindung.
Die revolutionäre Technologie löst allerdings derart gewaltige Nebenwirkungen aus, dass heute selbst ihre Erfinder entsetzt sind. Tim Berners-Lee, einer der Väter des World Wide Webs, äußerte sich im März 2017 – fast 30 Jahre nachdem er die erste Website freigeschaltet hatte – entsetzt über die Auswüchse der digitalen Welt. Menschen hätten die Kontrolle über ihre persönlichen Daten verloren, falsche Informationen verbreiteten sich rasant und Wähler würden durch Werbung an der Nase herum geführt, wetterte er in einem Gastbeitrag.2 Aus der Demokratisierungs-Maschine ist eine Maschine geworden, die Demokratie und Menschenrechte aushöhlen kann. Staaten und mächtige Konzerne missbrauchen persönliche Daten, Hassrede traumatisiert ihre Opfer. Eine neue Klassengesellschaft entsteht: Die Welt teilt sich in die Besitzer der Daten und die von ihnen Abhängigen, in die Ausspäher und die Ausgespähten. Wie konnte es dazu kommen?
Um das zu begreifen, muss man zunächst die Prinzipien der Digitalisierung verstehen, die sich über mehrere Stufen entwickelt hat. Zunächst bedeutete Digitalisierung nicht viel mehr, als dass Maschinen mit Hilfe digitaler Software gesteuert wurden. Dabei übernahmen die Rechenoperationen die Rolle des Menschen. Gab es einen Software-Fehler, funktionierte die Maschine nicht, sonst passierte nicht viel. Verbindet, »vernetzt« man softwaregesteuerte Maschinen allerdings über das Internet, bekommt das Ganze eine neue Qualität. Jetzt können die Geräte nicht nur von Ferne gesteuert werden wie ein Modellflugzeug, sondern sie beginnen zu kommunizieren und melden permanent Daten zurück. Auf diese Weise lassen sich Fehler ausmerzen, unnötige Aktionen streichen, Leerlauf vermeiden. Die Steuerung wird besser und besser.
Als Beispiel kann man das beliebte vom Kühlschrank nehmen, der meldet, wenn keine Milch mehr da ist, eine Innovation, die vermutlich zu den eher überflüssigen gehört und trotzdem viele Menschen fasziniert. Den Milch-Mangel kann der Kühlschrank nun entweder als Nachricht an seinen Nutzer aufs Smartphone oder direkt an den Lebensmittel-Lieferdienst melden. Ist die Software ein lernender Algorithmus, erkennt sie irgendwann, dass die Milch womöglich immer dienstags alle ist oder dass am Freitag besonders viel gebraucht wird; entsprechend bereitet sich der Lieferant darauf vor.
Sind Maschinen und Geräte miteinander vernetzt, können also miteinander »kommunizieren«, spricht man in Deutschland von »Industrie 4.0«. Hängt die gesamte Wirtschaft erst einmal am digitalen Netz, lässt sich die Verknüpfung von Angebot und Nachfrage voll automatisieren. Keine Lager quellen mehr über mit Waren, die niemand will; jeder Wunsch, jeder Befehl am einen Ende setzt eine Kettenreaktion in Gang, um an einem anderen Ende das Gewünschte zu produzieren. Allerdings macht eine solche Vernetzung Systeme auch leichter angreifbar. Denn theoretisch kann alles, was mit dem Internet verbunden ist, von außen gehackt und damit manipuliert oder lahmgelegt werden. Schon so manch ein Unternehmen musste erleben, dass gegen Cyberspionage kein Nachtportier und keine Zugangskontrolle helfen. Industrie 4.0 funktioniert nicht ohne Sicherheit 4.0.
Um diese neue Welt zu verstehen, muss man sich eines vergegenwärtigen: Digitale Geräte, die miteinander vernetzt und eingeschaltet sind, können nicht nicht kommunizieren. Wer also ein Smartphone benutzt oder auch nur eingeschaltet mit sich herumträgt, sendet ständig Informationen: über seinen Standort, seine oder ihre Vorlieben, ihre Meinungen oder Gewohnheiten. Und natürlich empfängt sie gleichermaßen viel.
Sekündlich laufen auf diese Weise neue Nachrichten auf: Botschaften von Freunden, Meldungen über aktuelle Ereignisse, Wetterdaten, Angebote von Unternehmen, für deren Produkte man sich irgendwann einmal interessiert hat, Tipps für Aktivitäten rund um den Standort, an dem man sich gerade aufhält.
Um Fragen beantwortet zu bekommen, bedarf es nicht mehr des mühevollen Suchens nach einem Menschen oder einer anderen Quelle, die möglicherweise eine Antwort parat hat, man braucht nur noch Google. Oder man nutzt persönliche Assistenten wie »Alexa« von Amazon Echo, die ihre Nutzer kennen und verstehen wie Dienstboten, die ihren Arbeitgebern in jahrelanger Treue verbunden sind. Mehr als acht Millionen Amerikaner haben sich im ersten Quartal 2017 bereits auf Echo verlassen, das waren fast dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und das obwohl bekannt ist, dass man sich mit Echo und seinen Geschwistern die perfekte Abhörtechnologie freiwillig ins Wohnzimmer holt.
All diese Möglichkeiten haben binnen weniger Jahre menschliches Verhalten zutiefst verändert, und das betrifft nicht nur die Generationen, die in die neue Welt hineingeboren werden und ganz selbstverständlich mit dem Smartphone aufwachsen. Was also ist anders am Menschen 4.0?
Individualisierung: Es geht um mich
Digitalisierung treibt die Individualisierung voran. Es geht um mich, und zwar auf Schritt und Tritt. Unternehmen vermitteln ihren Kunden das, indem sie ihnen rund um die Uhr vermeintlich passgenaue Produkte anbieten. Von der Stange war einmal, persönlich konfiguriert muss es sein. Und die Technologie macht es möglich. Die automatische Analyse der Daten, die der Kunde auf Schritt und Tritt sendet, ermöglicht es, ein immer detaillierteres Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Man will aber nicht den Bürger genau kennen, sondern den Konsumenten.
Vordergründig geht es dabei darum, das Individuum zufriedenzustellen, indem Software seine vermeintlichen Wünsche in den Mittelpunkt rückt. Ziel ist es aber natürlich, Bedürfnisse erst zu wecken. Der Hunger nach Mehr, nach einer noch schöneren Reise, einer lukrativeren Karriere, einem noch beeindruckenderen Haus wächst im Leben des Menschen, dem ständig suggeriert wird, alles sei nur ein paar Tastenklicks oder Wischbewegungen entfernt.
Ein ähnlicher Mechanismus wirkt in der Welt der so genannten sozialen Netzwerke. Jeder, der sich dort hineinbegibt, wird in der großen Ich-Maschine Internet Täter und Opfer zugleich. Schließlich geht es stets um das persönliche Profil, je detaillierter, desto besser. Und kaum jemand, der erst einmal eingestiegen ist, kann sich dem Sog entziehen, möglichst viele Follower und Likes auf der Plattform seiner Wahl einzusammeln. Gelingt das, dann ist man drin in der Spirale. Denn wenn einen viele mögen, muss man ja irgendwie bedeutend sein, ein gutes Gefühl. Bald aber stellt man fest, dass andere offenbar noch viel mehr gemocht werden. Also geht es ans Eskalieren: ein noch witzigerer Tweet, ein noch schlauerer Verweis auf ein kluges Essay, ein noch cooleres Urlaubsbild müssen her.
Wer Mädchen im Teenageralter schon einmal dabei beobachtet hat, mit welcher Hingabe und Ausdauer sie über die App Musically Tanzszenen von sich selbst aufzeichnen und hochladen, um sie dann mit der Performance von Freundinnen abzugleichen, begreift den perfiden Mechanismus dieser Ich-Welt: Einerseits wird die eigene Bedeutung überhöht – auch du kannst ein Superstar sein, andererseits nagt der permanente Vergleich am Selbstwertgefühl. Ist jemand anderes womöglich cooler, beliebter, fantasievoller als man selbst?
Nicht jedem gelingt es dabei, Online-Persönlichkeit und Offline-Leben auseinanderzuhalten. Wer sich in der Netzwelt als Superstar fühlt, mag sich in der Familie, im Freundes- oder Kollegenkreis womöglich nicht mehr damit abfinden, ein ganz normales Mitglied einer Gemeinschaft zu sein. Die Frustrationstoleranz sinkt, denn die Erfahrung schmerzt: Geht es womöglich doch nicht nur um mich?
Nun ist Individualisierung im hiesigen Kulturkreis grundsätzlich etwas Positives. Eine freiheitliche Gesellschaft baut darauf, dass sie den Wert und die Würde des Einzelnen anerkennt: seine Bedürfnisse, Talente, Fähigkeiten, Meinungen und ganz eigenen Prägungen, mit denen er durchs Leben geht. Die Digitalisierung lässt sich ein auf diese Besonderheiten. Sie nimmt sie viel besser wahr und berücksichtigt sie, wie keine Technologie zuvor. Lernprogramme können darauf zugeschnitten werden, wie ein Mensch Dinge am besten versteht, ob er sie lieber sieht, hört, liest oder sich praktisch erarbeitet. Mit individualisierter Medizin hofft man, Patienten passgenauer behandeln zu können und auf diese Weise ihre Lebensqualität zu steigern.
Wird es dem Einzelnen erleichtert, sich zu Wort zu melden, entstehen deutlich mehr Innovationen als in einer Welt, in der Erfindungen von zentralen, hierarchischen Organisationen angestoßen und gesteuert werden. Die vom Silicon Valley geprägte, innovativ-eigensinnige Vordenkerin Nilofer Merchant spricht in ihrem jüngsten Buch von »Onlyness«, der Einzigartigkeit, als einem Grundprinzip der digitalen Welt.3 Und natürlich steigt die Produktivität, wenn Arbeitnehmer als Individuen mit Bedürfnissen wahrgenommen werden, man auf ihre Stärken und Schwächen, ihre Rhythmen und ihre Belastbarkeit Rücksicht nimmt. Möchte man nicht nur, dass Beschäftigte gesund und motiviert bleiben, sondern auch ihre Innovationskraft ausschöpfen, gilt es, den Job dem Menschen anzupassen statt den Menschen dem Job.
Was aber geschieht, wenn die Sache kippt? Wenn es nur noch um den Einzelnen geht und nicht mehr um die Gemeinschaft? Und entsteht da nicht unter den am Smartphone klebenden Händen eine Gesellschaft voller Narzissten? Ohne Zweifel, das Silicon Valley ist durchsetzt von libertären Ideologen wie dem Großinvestor Peter Thiel, deren Freiheitsideal ein extremer Individualismus ist.Doch sie verkennen: Die Freiheit des Einen kann zum Gefängnis der anderen werden.
Der Hyperindividualist neigt dazu, seine eigene Bedeutung weit zu überschätzen, bis hin zu dem Bedürfnis, sich unsterblich zu machen. Man mag die Versuche, das eigene Leben mit Hilfe von Technologie in ein ewiges umzuwandeln, belustigend finden. In seinem Buch »To Be a Machine« hat der Journalist Mark O’Connell einige Menschen besucht, die das alles – man muss das jetzt so schreiben – todernst meinen.4 Aber wer sich selbst überschätzt, unterschätzt die anderen, zum Beispiel auch nachfolgende Generationen.
Nun muss Narzissmus nicht grundsätzlich schlecht sein. Natürlich ist die Welt voll von Menschen, deren Ich-Bezogenheit anderen das Leben zur Qual macht. Andererseits können Narzissten auch Großartiges leisten. Sie schaffen fantastische Kunstwerke, kreieren, komponieren, erfinden Bahnbrechendes. Mozart, Picasso oder Frank Lloyd Wright waren auch deshalb so genial, weil sie rücksichtslos ihre eigenen Ziele verfolgt und die Bedürfnisse anderer ignoriert haben. Ohne Narzissten wäre die Welt ärmer.
Andererseits werden die Leistungen von Narzissten überschätzt. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur verstehen es zwar, den Scheinwerfer stets auf sich zu lenken. Langzeitstudien belegen aber zum Beispiel, dass Unternehmen auf Dauer besser dastehen, wenn sie von eher bescheiden auftretenden Persönlichkeiten geführt werden, die das Wohl der Firma über ihr eigenes stellen. Man kann das immer wieder bei Mannschaftssportarten beobachten: Die Summe an Stars macht noch keinen Sieg. Große Errungenschaften sind in den allermeisten Fällen Teamarbeiten.
Narzissten brauchen Grenzen, weil sie dazu neigen, ihre eigene Freiheit auf Kosten anderer auszuleben. Bekommen sie aber Werkzeuge wie soziale Medien in die Hand, die gefühlte Grandiosität ständig spiegeln, verschlimmern sich Größenwahn und Allmachtsfantasien. Nie zuvor wurde das so deutlich wie unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump, der zunächst annahm, er könne Institutionen ignorieren und über Twitter durchregieren.
Der Zweifel an der Glorifizierung des Individuums macht sich aber nicht nur an Macht und Machtmissbrauch oder an Leistungsstudien fest. Eine große Frage beschäftigt Philosophen und Psychoanalytiker schon seit Jahrhunderten: Wie viel Freiheit verträgt der Mensch? Menschen wollen sich wertgeschätzt, aber auch geborgen fühlen. Sie brauchen Luft, um sich zu verwirklichen, aber auch Halt in der Gemeinschaft. Freiheit positiv zu erleben heißt auch, Sinn darin zu finden. Im Überfluss der Möglichkeiten lässt es sich leicht ertrinken. Ist jeder allein seines Glückes Schmied, dann ist dort kein Glück mehr, wo nicht ständig geschmiedet wird. Was für ein Druck!
Carlo Strenger hat in seinem Buch »Abenteuer Freiheit« entlang der Ideengeschichte gut dargelegt, in welche Spirale der Mensch gerät, wenn er immer neuen Bedürfnissen hinterherjagt.5 Radikale Bewegungen und Religionsgemeinschaften rekrutieren ihre Anhänger häufig aus dem Kreise jener, die Freiheit nur noch als Leere empfinden. Es geht um innere Freiheit, und die muss jeder für sich selbst erringen.
Individualisierung kann deshalb nur glücken, wenn sie Grenzen setzt. Menschen sind sehr unterschiedlich darin, wie viel Freiheit sie brauchen, schätzen und ertragen können. Was der einen Flügel verleiht, verschafft dem anderen nichts als Panik. Was den einen zu Experimenten anspornt, versetzt die andere in Lethargie. Wer Kinder erzieht, weiß, wie wichtig klare Strukturen sind. Erst, wenn man an Grenzen stößt, kann man darum kämpfen, sie zu überwinden.
Simplifizierung: Ich will es sofort
Wenn das Smartphone immer greifbar ist, immer auf Empfang und Sendung steht, heißt das auch: Alles scheint sofort möglich zu sein. Jedes Bedürfnis kann theoretisch umgehend befriedigt werden. Man muss sich nicht mehr lange mit Fragen quälen, denn man kann googeln, wie der Text des neuen Adele-Songs wirklich lautet, wer das Internet erfunden hat oder ob es im August noch einen erschwinglichen Flug nach New York gibt. Natürlich kann man die Reise auch gleich buchen, und danach die Turnschuhe bestellen, die der Sohn gerade bei einem Freund gesehen hat und unbedingt haben will. Warten, Geduld, Ausharren, sich Dinge mühsam erarbeiten – all das erscheint dem Menschen 4.0 als Zumutung. Was nicht jetzt, gleich, hier und sofort passiert, rückt in die Ferne, das Interesse schwindet. Das Bedürfnis nach schneller Belohnung ist zügig antrainiert.
Dank des elektronischen Versandhandels muss sich niemand mehr mit Ladenschlusszeiten abfinden. Und war man in den Anfangsjahren von Amazon noch froh, wenn Bücher einem drei Tage nach Bestellung an die Haustür geliefert wurden, ist auch diese Geduldsprobe nicht mehr nötig, so man sich denn mit E-Books angefreundet hat. Macht einem eine gute Rezension Appetit auf mehr, lässt sich das Buch sofort auf den E-Reader laden. Sollte der Drei-D-Druck irgendwann massentauglich werden, muss man auch auf andere Dinge nicht mehr lange warten. Das, was einem noch fehlt zum Konsumentenglück, lässt sich dann jederzeit ausdrucken.
Jedes Unternehmen ist gut beraten, sich einzustellen auf den Kunden 4.0. Produkte und Dienstleistungen müssen zügig und unkompliziert verfügbar sein. Wer es nicht zum One-Klick-Shopping schafft, wird abgehängt. Denn Kunden werden die Geduld verlieren, wenn sie komplizierte Passwörter eingeben, Kreditkartennummern heraussuchen und Sicherheitsfragen beantworten, geschweige denn ausführliche Gebrauchsanweisungen lesen müssen.
Man kann sich gut vorstellen, dass der Zugang zur digitalen Welt bald zuverlässig über Fingerabdruck, Iris- oder Stimmerkennung oder eine Kombination von all dem und anderen individuellen Merkmalen erfolgen wird. Das iPhone X mit seiner umstrittenen Gesichtserkennung ist ein Schritt dorthin. Die von Dave Eggers in seinem Roman »The Circle« beschriebene Idee, nach der jedem Baby ein Chip eingepflanzt wird, damit es sein Leben lang getrackt werden kann wie ein Joghurt, wird dagegen hoffnungslos altmodisch erscheinen.6
Kaum jemand hat so gut verstanden wie Apple, dass Bequemlichkeit eine menschliche Grundeigenschaft ist. Schnelle Erfolgserlebnisse machen zufrieden. Und was nützen die vielen zusätzlichen Features eines Produkts, wenn sie so tief in dessen Innenleben versteckt sind, dass sie niemand findet?
Dass (manche) Menschen dennoch bereit sind, stundenlang vor einem Apple-Store auf den Launch eines neuen iPhone-Modells zu warten, hat eher mit einem fast religiösen Ritual zu tun denn mit der Wiederentdeckung der Geduld. Man huldigt inmitten einer Gruppe gleichgesinnter Jünger einem Kultprodukt, das Erlösung verspricht. Wer ein Produkt kreiert, das solche Verhaltensweisen hervorbringen kann, hat es wirklich geschafft in einem Zeitalter, in dem Konsum zur Religion geworden ist.
Was aber macht all die Atemlosigkeit mit den Konsumenten? Die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben, sich die Belohnung für später aufzusparen, trägt wesentlich zu sozialer Intelligenz und Lebenserfolg bei, das ist erwiesen. Am bekanntesten in diesem Zusammenhang ist das Marshmallow-Experiment, das der amerikanische Persönlichkeitspsychologe Walter Mischel entwickelt hat.7 Vorschulkindern wurden in diesem Versuch Marshmallows angeboten. Ihnen wurde gesagt, sie könnten sofort einen davon essen, würden sie jedoch auf die Rückkehr des Versuchsleiters warten, bekämen sie danach zwei. In Langzeit-Beobachtungen stellte Mischel fest, dass sich die Kinder, die eine längere Wartezeit in Kauf genommen hatten, später besser in der Schule und im Leben schlugen als jene, die sofort zugegriffen hatten. Selbstkontrolle, die Fähigkeit, abzuwarten und mit klarem Kopf zu kalkulieren, mache Menschen widerstandsfähiger gegen Stress und letztlich erfolgreicher, so der Schluss des Psychologen.
Womöglich tut uns die Digitalisierung also keinen Gefallen damit, uns zu Wesen zu erziehen, die ihren Impulsen jederzeit und sofort folgen, sich umgehend Belohnung verschaffen wollen. Denn tatsächlich entsteht dann, wenn ein Bedürfnis erfüllt worden ist, immer ein Raum für einen neuen Wunsch. So wie das Kind womöglich in dem Moment eine kurze Leere verspürt, in dem alle Geburtstagsgeschenke ausgepackt sind, selbst wenn das ersehnte dabei war, fragen wir uns sofort: Was kommt als Nächstes?
Natürlich liegt nichts näher, als diese Leere sofort mit irgendetwas zu füllen, das man per Smartphone erreichen kann. Nachrichten oder die Timeline checken, einen Schnipsel lesen, einem Freund antworten, nach den Wetterdaten googeln, auch wenn sich diese höchstwahrscheinlich seit dem letzten Blick darauf nur unwesentlich verändert haben.
Innere Freiheit entsteht allerdings nur dann, wenn man sich solcher Zwänge entledigt. Dazu braucht man weder ein Wellness-Hotel noch ein Kloster, auch wenn sich aus solchen Angeboten für Offline-Zeit schon wieder eine ganze Industrie entwickelt hat. Einfach mal ohne Smartphone spazierengehen (ja, dann hat man die Kamera nicht dabei), ein Gespräch führen mit dem Handy außer Reichweite, auf einer Bahnfahrt den Gedanken nachhängen statt einen Film zu schauen – auch das kann man trainieren. Womöglich braucht der Mensch 4.0 Fastenzeiten, in denen er ausprobieren kann, was noch alles geht, wenn man nicht permanent »online« ist.8
Mobilisierung: Ich will mitmachen
Wer erinnert sich noch an die Tage und Wochen, die man »arabischer Frühling« nannte? Ein junger Tunesier hatte sich aus Protest gegen die Diktatur in seinem Land selbst angezündet und damit Aufstände ausgelöst, die sich mit Hilfe sozialer Netzwerke in einer Art Domino-Bewegung über die arabische Welt verbreiteten. Damals hofften viele, hinter jedem gefallenen Domino-Stein sprich Diktator würde wie von magischer Hand ein demokratischer Staat entstehen. Es müssen die Wünsche gewesen sein, die den Blick auf die Realität vernebelt hatten. Denn aus der Geschichte, speziell aus der deutschen, hätte man wissen müssen, dass Demokratie nur mit starken Institutionen wächst, die mühsam aufgebaut, verankert und verteidigt werden müssen. Die Lektion, die uns der »arabische Frühling« gelehrt hat, ist ernüchternd: Das Internet ist keine Demokratisierungs-Maschine, wohl aber eine Mobilisierungsmaschine.
»Ich will mitmachen« – dieser Reflex entsteht auch, wenn man mit dem Smartphone einen Lautsprecher in der Hand hält, der potenziell die ganze Welt beschallen kann. Manchmal provoziert ein Kommentar eine Antwort, manchmal ein Bild einen Kommentar. Wer viele Freunde und Follower in den sozialen Netzwerken hat, dessen Stimme übertönt zuweilen die derjenigen, die gemessen an formalen Hierarchien ungleich mächtiger sind.
Ein Video vom April 2017, in dem man sah, wie die Fluggesellschaft United Airlines einen Passagier von Sicherheitsleuten aus einem überbuchten Flug zerren ließ, weil er seinen Platz nicht räumen wollte, demonstrierte, welche Macht Kunden bekommen können, wenn ihr Anliegen dramatisch in Szene gesetzt wird. Unternehmen wie zum Beispiel der häufig von Konsumenten angefochtene Lebensmittelkonzern Nestlé haben deshalb War Rooms eingerichtet, um Social-Media-Aktivitäten rund um die Uhr überwachen und notfalls einschreiten zu können, wenn jemand allzu deutlich quengelt.
Mitmachen können ist die eine Seite, mitmachen sollen die andere. Der Konsument 4.0 wird praktisch zur Beteiligung erzogen, denn dahinter steckt ein Geschäftsmodell. Bucht er online ein Hotelzimmer, kauft er einen Eierkocher, liest er ein Buch, wird er prompt nach seiner Meinung dazu gefragt. Natürlich etablieren Unternehmen diese Mitmach-Ökonomie nicht aus Liebe zum Konsumenten. Sie sind auf dessen Daten aus. Jede Interaktion dient ihnen dazu, ihre Algorithmen zu verbessern und den Kunden für neue Aktivitäten zu ködern.
Diese neuen Beteiligungsmöglichkeiten haben mehrere Effekte. Zum einen provozieren sie Nutzer dazu, immer lustigere, verstörendere, drastischere oder anderweitig aufsehenerregende Inhalte zu posten. Denn je interessanter der Beitrag, desto größer wird die persönliche Anhängerschaft, und je mehr Follower man hinter sich versammeln kann, umso mehr Einfluss hat man theoretisch über die Netz-Kanäle. Allerdings zieht ein lustiges Kleinkind-mit-Hund-Video üblicherweise mehr Augen auf sich als ein politischer Kommentar; da ist die Online-Welt der Regenbogenpresse recht ähnlich. Das Netz spricht den Voyeuristen im Menschen stärker an als den Staatsbürger. Die bekanntesten Helden der Online-Welt sind deshalb eher nicht Revolutionsführer – was man nicht unbedingt bedauern muss –, sondern gänzlich unpolitische Youtuber.
Und dann gibt es die Opfer. Wenn es die einen drängt, sich mit besonders drastischen Beiträgen Popularität zu erkaufen, stehen auf der anderen Seite jene, auf deren Kosten Witze gerissen werden, auf die mit dem Finger gezeigt wird. Jeder, der schon mal Opfer eines Shitstorms wurde, weiß, wie schnell aus Voyeuristen Mitmacher werden und wie es sich anfühlt, von einer Masse von solchen Mitmachern überrollt zu werden.
Schon eine kleine Ungeschicklichkeit kann drastische Folgen haben. Um die Welt ging zum Beispiel die Geschichte einer Managerin, die vor einem Südafrika-Flug einen geschmacklosen Tweet zum Thema AIDS absetzte. Während sie in der Luft war, wurde der so häufig geteilt und kommentiert, dass ihr Arbeitgeber sie bei ihrer Landung mit einer fristlosen Kündigung konfrontierte.9
Trauriger noch sind die vielen Fälle, in denen sich Teenager das Leben genommen haben, nachdem sie in sozialen Netzwerken gemobbt wurden. Keine Frage, Mobbing gab es schon immer und auf jedem Schulhof. Aber heute lassen sich peinliche und verletzende Inhalte mit Hilfe sozialer Netzwerke in bisher nicht gekannter Reichweite verbreiten. Das traumarisiert die Opfer nicht nur, sondern Konsequenzen wie Schulwechsel und Umzüge wirken nur noch eingeschränkt. Das ruinierte Bild in der Online-Welt wird allgegenwärtig, die Demütigung grenzenlos.
Die vermeintliche Mitmach-Gesellschaft vermittelt dem Einzelnen allerdings auch ein falsches Gefühl von Macht. Denn sein Einfluss wird im richtigen Leben selten so gespiegelt, wie er das empfinden mag. Selbst Donald Trump hat es nicht per Twitter ins Weiße Haus geschafft, auch wenn das gerne so dargestellt wird. Ihm half ein ganzes Bündel von Faktoren: eine schwache, zerstrittene, dennoch nach Macht dürstende Partei der Republikaner, eine bei vielen Amerikanern unbeliebte, bei einigen verhasste Gegenkandidatin, ein guter Anteil an Protestwählern und ein Gemisch aus latentem Rassismus und Sexismus in einigen Teilen der Bevölkerung, die nach acht Jahren Obama endlich mal wieder »the real thing« im Weißen Haus haben wollte, nämlich einen weißen Mann.
Punktuell mag ein Nutzer im Netz mit einem Beitrag die Welt aufrütteln. Aber je stärker er sich online offenbart, umso schneller wird er Opfer kommerzieller Interessen und staatlicher Überwachung. In den Konsumwelten der Marktwirtschaften sind »Influencer« nämlich Gold wert für Unternehmen, die mit ihrer Hilfe auf billige Weise Profite einfahren können. Schließlich ist es viel günstiger und wirksamer, ein paar beliebte Youtuber mit exklusiven Artikeln auszustatten, als selbst teure Marketing-Kampagnen zu finanzieren. Perfide ist, dass diejenigen, die sich ihren Followern als kultige Individualisten präsentieren, in Wahrheit Büttel einer Image-Ökonomie sind. Sie suggerieren Freiheit, unterwerfen sich und andere aber dem Diktat des Konsums.
In politisch repressiven Systemen wiederum können besonders aktive Internet-Nutzer ohne ihr Wissen ausgenutzt werden, um kritische Geister ausfindig zu machen und zu überwachen. Es ist doch viel interessanter, beispielsweise einen aktiven oppositionellen Blogger gewähren zu lassen und dann zu überprüfen, wie viele Freunde und Follower ihm nahestehen und seine Ideen positiv kommentieren. Je mehr der Mensch 4.0 mitmacht, desto gläserner wird er. Es wird in der digitalen Welt eine wichtige staatliche Aufgabe sein, die Freiheit der Bürger zu schützen.
Ökonomisierung: Lohnt sich das für mich?
Die Digitalisierung treibt den Kapitalismus auf eine neue Stufe. Mit ihrer Hilfe lässt sich praktisch alles, was menschengemacht ist, dem Diktat der Effizienz unterwerfen. Ist im Bayerischen Wald noch irgendwo ein Zimmer frei? Fehlt das Schoko-Müsli im Regal? Produziert das Windrad Energie, ohne dass sie abgerufen wird? Wenn alles mit allem vernetzt ist, lassen sich auch noch die letzten ungenutzten Kapazitäten aufspüren. Prozesse werden auf ihre Wirtschaftlichkeit hin abgeklopft, Leerlauf oder Überfluss müssen bekämpft werden. Das kann positiv sein, zum Beispiel für die Umwelt. Werden Ressourcen optimal ausgenutzt und der Energieverbrauch optimiert, kann man wenigstens hoffen, dass die Effekte nicht wieder durch ein Mehr an Konsum an anderer Stelle zunichte gemacht werden. Interessant ist aber in diesem Zusammenhang, wie der Trend zur Ökonomisierung den Menschen formt.
Unternehmen der so genannten Sharing-Economy, der Tausch- und Teil-Wirtschaft, haben es zum Beispiel über lange Zeit wunderbar verstanden, das Optimierungsdiktat als ökologisches Zauberkonzept zu verkaufen. Wer seinen Besitz teile, wenn er ihn gerade nicht selbst brauche, helfe jenen, die sich weniger leisten können, und schütze gleichzeitig die Umwelt, hieß es da gerne. Unternehmen wie der Fahr-Service Uber und der Zimmer-Anbieter Airbnb haben sich mit dieser Story zu milliardenschweren Firmen entwickelt, die sich um das Wohl ihrer Beschäftigten und der Gemeinden, in denen sie tätig sind, wenig scheren. Der amerikanische Autor Steven Hill beschreibt das gut in seinem Buch: »Die Start-up Illusion: Wie die Internet-Ökonomie unseren Sozialstaat ruiniert«.10
Zunächst erweckt es den Anschein von Freiheit, wenn Dienstleistungen und Produkte ohne Vermittler privat über eine Plattform und damit unreguliert vermarktet werden können. Die Konzepte hören sich unkompliziert und nachbarschaftlich an (ein Airbnb-Slogan: »Welcome home«), und irgendwie wirkt es cool, den lästigen Bürokraten eine lange Nase zeigen und damit auch noch Geld sparen zu können. In der Konsequenz bedeutet die Sharing-Economy eben aber auch, dass lange erkämpfte Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzrechte geschickt umgangen werden können.11
Zudem entstehen im Windschatten solcher Firmen schnell kommerzielle Anbieter, die unter dem Deckmantel angesagter Plattform-Firmen Spekulationsgeschäfte betreiben, zum Beispiel Immobilien über Airbnb viel teurer vermieten, als dies auf normalem Wege möglich wäre. Es hat eine Weile gedauert, aber viele Städte und Kommunen erkennen das mittlerweile und reglementieren die Tätigkeit speziell großer Anbieter wie Airbnb und Uber erheblich.
Man könnte das als einen Sieg der Hotel-, Taxifahrer- und anderen Lobbys werten, die sich von den neuen Konkurrenten bedroht fühlen. Prosaischer kann man aber auch sagen: Die Demokratie schlägt zurück gegen einen Turbo-Kapitalismus, der sich ein Hipster-Image verpasst und sich hinter dessen Fassade sämtlicher sozialer Errungenschaften zu entledigen versucht.
Die Möglichkeit, alles irgendwie Werthaltige über eine Plattform vermarkten zu können, hat aber auch einen psychologischen Effekt. Wer früh lernt, dass man Sämtliches zu Geld machen kann, wird seine Bohrmaschine möglicherweise nicht mehr umsonst verleihen oder den Hund der Nachbarin aus purer Freundlichkeit ausführen. Verkaufsplattformen wie Ebay halten nicht nur den Handel mit gebrauchten Waren am Laufen, was prinzipiell ökologisch sinnvoll ist, sondern sie lehren auch, dass man für jeden Skianzug, aus dem das Kind herausgewachsen ist, noch Geld verlangen kann. Jede Handreichung, jede Dienstleistung, jedes für einen selbst längst wertlose Produkt bekommt auf diese Weise ein Preisschild.
Was zunächst wie eine soziale Wohltat wirkt, führt deshalb dazu, dass Reichtum weiter zugunsten der Besitzenden umverteilt wird. Wer viel hat, kann viel verleihen oder weiterverkaufen und so Gewinn daraus ziehen. Wer wenig hat, muss nun womöglich auch noch für Dinge zahlen, die er zuvor umsonst bekam.
Allzu leicht wird der Arbeitnehmer zudem selbst Opfer der Ökonomisierung. Was am Fließband schon lange üblich ist, zieht dank der digitalen Vernetzung nun auch in Büros, Home Offices, womöglich sogar Klassenzimmer ein. Es wird Firmen künftig ein Leichtes sein, ihre Mitarbeiter nur noch nach Stückzahl, nach abgelieferten Mengen und Ergebnissen zu bezahlen. Schließlich ist schon heute leicht nachvollziehbar, wie lange jemand an seinem Rechner eingeloggt war, was er in der Zeit getan und wie viele Aufgaben er erfolgreich erledigt hat. Das Vertrauen, jemand werde in den acht Stunden seiner Anwesenheit am Arbeitsplatz schon irgendetwas Produktives geleistet haben, wird ersetzt durch digitale Kontrolle und Auswertung. Man kann das Arbeiten von unterwegs als große Freiheit betrachten, die es einem ermöglicht, Beruf, Familie, Leidenschaften und Hobbys besser zu vereinbaren als je zuvor. Die lange Leine, an der Arbeitnehmer dann hängen, kann aber auch zu einer Art elektronischer Fußfessel werden.
Die so genannte Crowdwork, auch Cloud- oder Clickwork genannt, führt die Idee der Ökonomisierung von Arbeit ins Extrem, wenn Freelancer nur noch für jene Arbeitspakete bezahlt werden, die sie abliefern.12 Man kann diese Gig-Economy lieben, weil sie einem suggeriert, ein selbstständiger Unternehmer zu sein. Aber diese Liebe erkaltet meistens schnell, wenn eine Familie zu versorgen oder ein Bankkredit abzubezahlen ist. Für Firmen ist diese organisierte Verantwortungslosigkeit bequem, zumindest vordergründig. Sie sparen sich alle Kosten, die mit einer Festanstellung entstehen. In der Konsequenz aber könnten sie das Nachsehen haben, denn Talente vergrault man auf diese Weise eher, als dass man sie hält.
Das Diktat der Effizienz und des Nutzwerts hat noch viel gravierendere Folgen. Denn die Natur, und dazu zählt auch der Mensch, ist nicht auf Effizienz ausgerichtet. Ganz wunderbar hat das der Chemiker Michael Braungart beschrieben, der gemeinsam mit dem amerikanischen Architekten William McDonnough das Cradle to Cradle-Konzept erfunden hat.13 Braungart verwendet das Bild eines Kirschbaums, um klar zu machen: Die Natur funktioniert nicht nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Der Kirschbaum blüht üppig, kurz und wunderschön, aber ohne Sinn für Effizienz. Nur ein Bruchteil der Blüten wird zu Früchten und nur ein Bruchteil der Früchte erreicht die Reife. Fruchtbarkeit und Blüte seien Sinnbilder für Überfluss und Verschwendung.