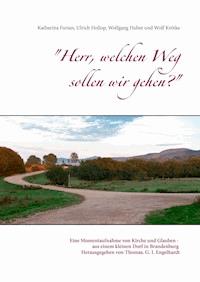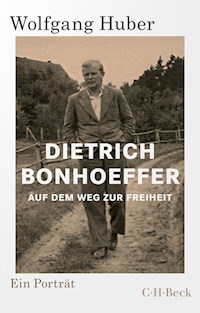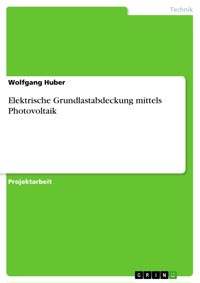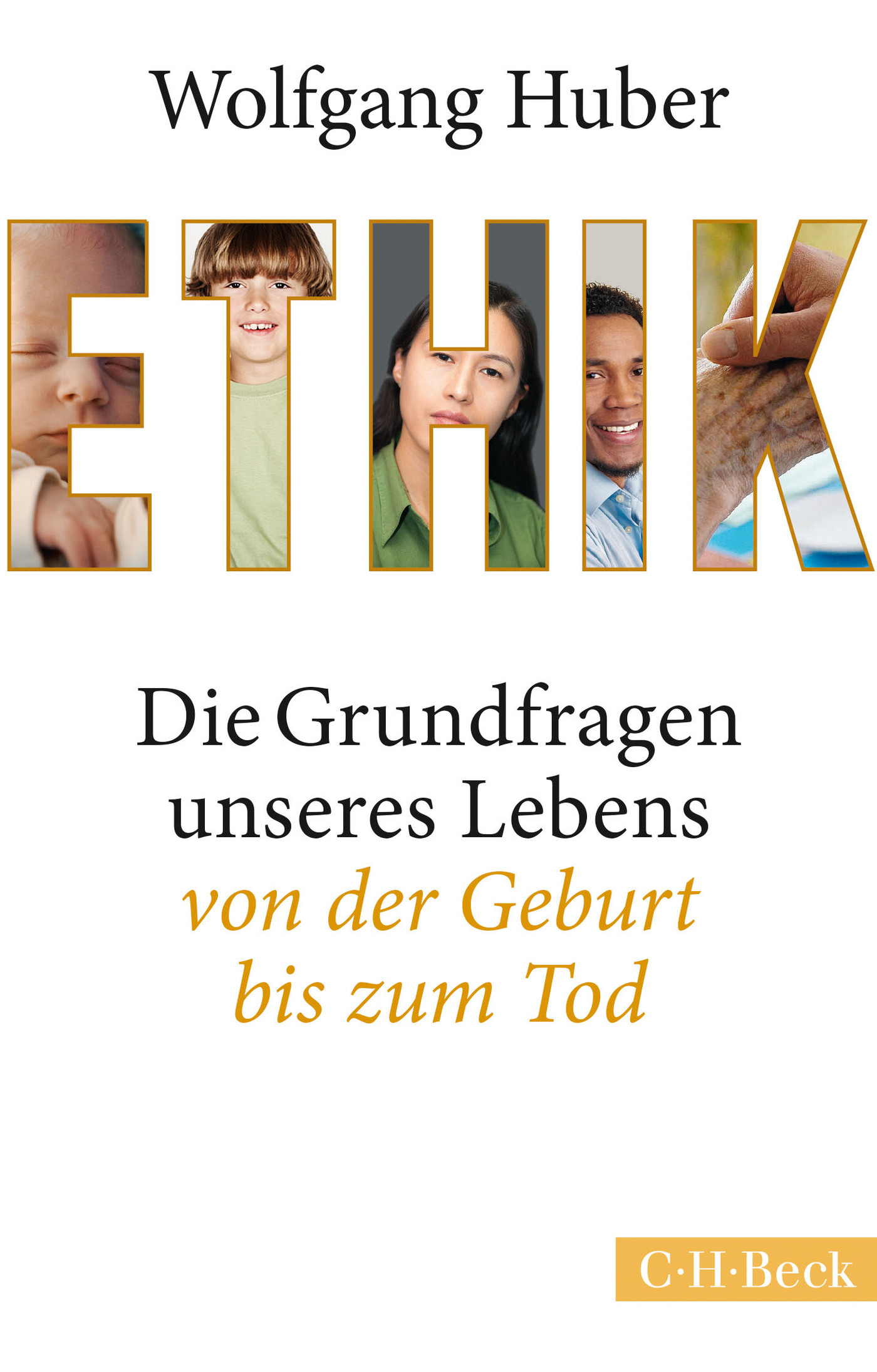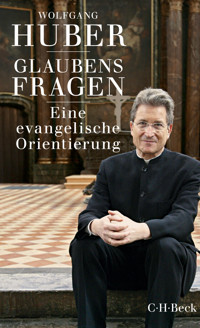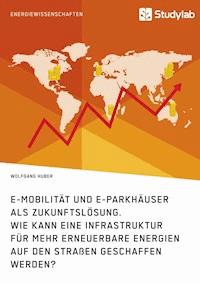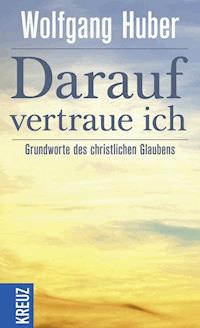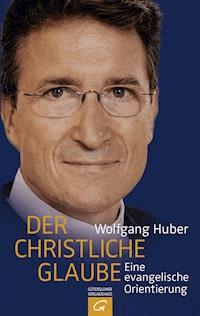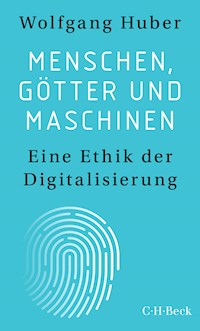
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Digitalisierung hat unsere Privatsphäre ausgehöhlt, die Öffentlichkeit in auseinanderdriftende Teilöffentlichkeiten zerlegt, Hemmschwellen gesenkt und die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge aufgeweicht. Der bekannte Theologe Wolfgang Huber beschreibt pointiert diese technische und soziale Entwicklung und zeigt an vielen anschaulichen Beispielen, wie und nach welchen Maßstäben wir die Digitalisierung selbstbestimmt und verantwortlich gestalten können. Die Haltungen zur Digitalisierung schwanken zwischen Euphorie und Apokalypse: Die einen erwarten die Schaffung eines neuen Menschen, der sich selbst zum Gott erhebt. Andere befürchten den Verlust von Freiheit und Menschenwürde. Wolfgang Huber wirft demgegenüber einen realistischen Blick auf den technischen Umbruch. Das beginnt bei der Sprache: Sind die «sozialen Medien» wirklich sozial? Fährt ein mit digitaler Intelligenz ausgestattetes Auto «autonom» oder nicht eher automatisiert? Sind Algorithmen, die durch Mustererkennung lernen, deshalb «intelligent»? Eine überbordende Sprache lässt uns allzu oft vergessen, dass noch so leistungsstarke Rechner nur Maschinen sind, die von Menschen entwickelt und bedient werden. Notfalls muss man ihnen den Stecker ziehen. Wolfgang Huber zeigt in seinem wunderbar klar geschriebenen Buch, wie sich konsensfähige ethische Prinzipien für den Umgang mit digitaler Intelligenz finden lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wolfgang Huber
MENSCHEN, GÖTTER UND MASCHINEN
Eine Ethik der Digitalisierung
C.H.Beck
ZUM BUCH
Die Digitalisierung hat unsere Privatsphäre ausgehöhlt, die Öffentlichkeit in auseinanderdriftende Teilöffentlichkeiten zerlegt, Hemmschwellen gesenkt und die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge aufgeweicht. Der bekannte Theologe und Ethiker Wolfgang Huber beschreibt pointiert diese technische und soziale Entwicklung und zeigt an vielen anschaulichen Beispielen, wie und nach welchen Maßstäben wir die Digitalisierung selbstbestimmt und verantwortlich gestalten können.
Die Haltungen zur Digitalisierung schwanken zwischen Euphorie und Apokalypse: Die einen erwarten einen neuen Menschen, der sich selbst zum Gott erhebt. Andere befürchten den Verlust von Freiheit und Menschenwürde. Wolfgang Huber wirft demgegenüber einen realistischen Blick auf den technischen Umbruch. Das beginnt bei der Sprache: Sind die «sozialen Medien» wirklich sozial? Fährt ein mit digitaler Intelligenz ausgestattetes Auto «autonom» oder nicht eher automatisiert? Sind Algorithmen, die durch Mustererkennung lernen, deshalb «intelligent»? Eine überbordende Sprache lässt uns allzu oft vergessen, dass noch so leistungsstarke Rechner nur Maschinen sind, die von Menschen entwickelt und bedient werden. Notfalls muss man ihnen den Stecker ziehen. Wolfgang Huber zeigt in seinem wunderbar klar geschriebenen Buch, wie sich konsensfähige ethische Prinzipien für den Umgang mit digitaler Intelligenz finden lassen.
ÜBER DEN AUTOR
Wolfgang Huber, Professor für Theologie in Berlin, Heidelberg und Stellenbosch (Südafrika), war u.a. Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Er engagiert sich im Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik sowie im Beirat des Deutschen Krebsforschungszentrums und wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Max-Friedländer-Preis, dem Karl-Barth-Preis und dem Reuchlin-Preis. Bei C.H.Beck erschien von ihm zuletzt die Biographie «Dietrich Bonhoeffer. Auf dem Weg zur Freiheit» (C.H.Beck Paperback 2021).
INHALT
VORWORT
1. DAS DIGITALE ZEITALTER
Zeitenwende
Die Vorherrschaft des Buchdrucks geht zu Ende
Wann beginnt das digitale Zeitalter?
2. ZWISCHEN EUPHORIE UND APOKALYPSE
Digitalisierung. Einfach. Machen.
Euphorie
Apokalypse
Verantwortungsethik
Der Mensch als Subjekt der Ethik
Verantwortung als Prinzip
3. DIGITALISIERTER ALLTAG IN EINER GLOBALISIERTEN WELT
Vom World Wide Web zum Internet der Dinge
Mobiles Internet und digitale Bildung
Digitale Plattformen und ihre Strategien
Big Data und informationelle Selbstbestimmung
4. GRENZÜBERSCHREITUNGEN
Die Erosion des Privaten
Die Deformation des Öffentlichen
Die Senkung von Hemmschwellen
Das Verschwinden der Wirklichkeit
Die Wahrheit in der Infosphäre
5. DIE ZUKUNFT DER ARBEIT
Industrielle Revolutionen
Arbeit 4.0
Ethik 4.0
6. DIGITALE INTELLIGENZ
Können Computer dichten?
Stärker als der Mensch?
Maschinelles Lernen
Ein bleibender Unterschied
Ethische Prinzipien für den Umgang mit digitaler Intelligenz
Medizin als Beispiel
7. DIE WÜRDE DES MENSCHEN IM DIGITALEN ZEITALTER
Kränkungen oder Revolutionen
Transhumanismus und Posthumanismus
Gibt es Empathie ohne Menschen?
Wer ist autonom: Mensch oder Maschine?
Humanismus der Verantwortung
8. DIE ZUKUNFT DES HOMO SAPIENS
Vergöttlichung des Menschen
Homo deus
Gott und Mensch im digitalen Zeitalter
Veränderung der Menschheit
LITERATUR
PERSONENREGISTER
VORWORT
Die Stille – so heißt ein Roman des US-amerikanischen Erfolgsschriftstellers Don DeLillo. Das Buch erschien 2020, die Handlung spielt an einem Sonntag im Februar 2022. Es ist der Super Bowl Sunday, an dem das Meisterschaftsendspiel im American Football ausgetragen wird, eine der größten sportlichen Einzelveranstaltungen nicht nur in den USA, sondern weltweit. Landauf, landab wird dieser Sonntag wie ein nationaler Feiertag begangen. In einer New Yorker Wohnung haben sich eine emeritierte Physikprofessorin, ihr Mann und ein ehemaliger Student zusammengefunden, um das Ereignis im Fernsehen zu verfolgen. Sie warten noch auf ein befreundetes Paar, das nach der Rückkehr aus Paris direkt vom Flughafen zu ihnen stoßen will. Doch bevor das Flugzeug in New York ankommt, ereignet sich ein dramatischer Zwischenfall: Alle Bildschirme werden schwarz, kein Smartphone funktioniert. Das Super-Bowl-Finale kann nicht übertragen werden. Die beiden Reisenden erleben diesen digitalen Zusammenbruch noch während ihres Flugs, der mit einer beängstigenden Notlandung endet.
Der Schock dieses digitalen Kollapses wirkt nach DeLillos Beschreibung noch unheimlicher als die Corona-Pandemie. Denn dieses Ereignis hat, wie er eine Krankenhausmitarbeiterin sagen lässt, «unsere Technologie platt gemacht. Die ganze Welt kommt mir überholt vor, verschollen im Weltraum. Kann alles in der Datensphäre Verfälschung und Diebstahl zum Opfer fallen? Und sollen wir einfach dasitzen und unser Schicksal beklagen?»
Dieses Zukunftsszenario wird denkbar dicht an unsere eigene Gegenwart herangerückt. Die Fiktion eines digitalen Kollapses wird mit der Realität der Covid-19-Pandemie verknüpft. Während ich an diesem Buch schrieb, prägten die Einschränkungen des täglichen Lebens durch das Corona-Virus und die Sorgen um einzelne Menschen wie um die Zukunft unserer Gesellschaft jeden Tag.
Den Herausforderungen durch die Corona-Krise trat seit dem 24. Februar 2022 das Erschrecken über den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine zur Seite. Von Anfang an zeigte sich die Gefahr einer Verschärfung des Konflikts durch digitale Mittel, aber auch die Möglichkeit, die Logik militärischen Handelns durch den Einsatz digitaler Kommunikation zu unterlaufen. Cyberkriegsführung ist schon länger ein fester Bestandteil militärischer Auseinandersetzungen. Doch mit dem Ukraine-Krieg erreichte die Digitalisierung des Krieges eine neue Dimension. Gleich zu Beginn des Krieges störte Russland mit Hackerangriffen 30.000 Satellitenterminals des amerikanischen Satellitenbetreibers Viasat. Dass 5800 Windräder in Norddeutschland nicht mehr zu erreichen waren, bildete nur einen kleinen Teil des Schadens. Gegen eine flächendeckende Störung ist die Ukraine durch die Dezentralität des Internets – eine Folge früherer russischer Hackerangriffe – geschützt. Um gegen die physische Zerstörung von Servern gefeit zu sein, lässt sich die Ukraine von Elon Musk beim Aufbau des Satelliten-Internets helfen.
Die ukrainische Regierung versucht ihrerseits, ihre militärische Unterlegenheit durch den Einsatz digitaler Mittel auszugleichen. Sie fordert, das russische Internet vom Rest der Welt zu trennen, und bemüht sich um einen Boykott Russlands durch internationale Plattformunternehmen. Die für den digitalen Kampf der Ukraine Verantwortlichen – der Digitalminister Mykhailo Fedorow und sein Stellvertreter Oleksandr Bornyakow – sprachen im März 2022 von einer eigenen «IT-Armee» mit 300.000 Angehörigen. Den Versuch, in der russischen Bevölkerung mit digitalen Mitteln Widerstand gegen den Angriffskrieg zu mobilisieren, beantwortete Russland mit der Sperrung von Twitter und Facebook sowie der Webseiten internationaler Medien.
Nicht nur als rücksichtsloser, das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und die Regeln des Kriegsvölkerrechts missachtender Angriffskrieg wird der Ukraine-Krieg in die Geschichte eingehen, sondern auch wegen der Eskalation der digitalen Kriegsführung und der zivilen Interventionen mit digitalen Mitteln. Wie kein Krieg zuvor zeigt er, wie angreifbar zentrale Lebensbereiche – von der Kommunikation über die Energieversorgung bis zu medizinischer Infrastruktur – durch die Digitalisierung des täglichen Lebens werden. Wie anfällig Teile der kritischen Infrastruktur in Deutschland sind, zeigt beispielhaft eine Untersuchung, die bei einem Drittel der überprüften Krankenhäuser Defizite in der IT-Sicherheit feststellte.
Es kommt darauf an, die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, ohne sich der Macht dieser Technologie zu unterwerfen. Dabei geht es um grundlegende Fragen des Menschenbilds. Werden wir die begrenzte, endliche Freiheit, durch die das menschliche Leben geprägt ist, weiter zu schätzen wissen? Oder meinen wir, der Endlichkeit in einer transhumanistischen Wendung der Menschheitsgeschichte entkommen zu können? Wiederholt sich auf neue Weise, was der Soziologe Max Weber in seinem Vortrag über Wissenschaft als Beruf im Jahr 1917 so formulierte: «Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf.» Werden die digitalen Maschinen oder der von der Sterblichkeit befreite Mensch zu solchen Göttern?
Der digitale Wandel ist nicht nur in seiner technischen Dynamik, sondern auch in seiner ethischen Brisanz eine der enormen Herausforderungen unserer Zeit. Er bestimmt unseren Alltag, beeinflusst alle Lebensbereiche, prägt ein neues Zeitalter. Nutzungsmöglichkeiten, die das Menschsein stärken, stehen Entwicklungen gegenüber, die das humane Zusammenleben gefährden. Aufgaben, die an digitale Instrumente delegiert werden können, müssen von der Verantwortung unterschieden werden, die beim Menschen verbleibt. Um solche Klärungen geht es in diesem Buch.
Zu jeder Zeit hat meine Frau Kara Huber mich auf dem Weg zu diesem Buch ermutigt, seine Thematik mit mir diskutiert und mich auf vielfältige Weise unterstützt. Tilman Asmus Fischer hat das Vorhaben mit Recherchen und Korrekturen gefördert. Heiko Beier, Lukas Gast, Wilfried Gast und Hans Joas haben das Manuskript oder Teile davon gelesen und mit hilfreichen Hinweisen und Vorschlägen darauf reagiert. Mein Lektor Ulrich Nolte hat diesem Vorhaben zusammen mit allen Beteiligten im Verlag C.H.Beck Gestalt verliehen. Ihnen allen bin ich dankbar verbunden.
Mein Bruder Gerhard Huber hat mir den Roman von Don DeLillo geschenkt. Nicht nur dafür, sondern für lange Jahrzehnte brüderlicher Freundschaft danke ich ihm von Herzen. Ihm widme ich dieses Buch.
1. DAS DIGITALE ZEITALTER
Zeitenwende
Wir leben in einer Zeitenwende. Es geht um mehr als nur um eine Fortsetzung des Wandels, der sich schon immer vollzogen hat. Es geht auch nicht nur um die wissenschaftlich-technische Beschleunigung dieses Wandels, die als charakteristisch für die Neuzeit gilt. Es geht um eine «Verwandlung der Welt».
Unter diesem Titel hat der Historiker Jürgen Osterhammel 2009 die Globalgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts mit ihren imperialistischen Ausbrüchen beschrieben. Im zwanzigsten Jahrhundert schlug sich der Kampf um politische Vorherrschaft in beispiellosen Weltkriegen und totalitären Diktaturen nieder. Aus dem Grauen dieser Zeit zogen die Vereinten Nationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Konsequenz, die Völkergemeinschaft feierlich auf die Bewahrung des Friedens, die Achtung der Menschenrechte und nicht zuletzt: die Ächtung des Völkermords zu verpflichten. Damit begann, mit einem Wort des Soziologen Ulrich Beck, die Kosmopolitisierung der Welt im Ganzen wie der Lebensverhältnisse aller Einzelnen. Die Globalisierung der Wirtschaft sowie die weltweit wachsenden Wanderungsbewegungen tragen auf ihre Weise dazu bei. Zugleich wächst die Welt vor allem durch den rasanten Wandel der Kommunikationstechnologien zusammen. Dadurch wird allerdings nicht nur die wechselseitige Kenntnis vermehrt und die Möglichkeit geschaffen, am Schicksal von Menschen auf anderen Kontinenten Anteil zu nehmen. Auch die Gegensätze in der einen Welt gewinnen dadurch zusätzlich an Brisanz. Weltweite Kommunikation kann nicht nur das wechselseitige Verständnis stärken, sie kann auch Vorurteilen Nahrung geben.
Die Kosmopolitisierung bezieht sich nicht nur auf individuelle und kollektive menschliche Schicksale, deren Zeugen wir in der globalen Informationsgesellschaft werden. Eine Kosmopolitisierung vollzieht sich auch durch einen die Erde umspannenden Transformationsprozess, in dem menschliches Handeln einen beunruhigenden Klimawandel befördert, die geologische Beschaffenheit der Erde verändert und die Biodiversität bedroht. Diese dramatischen Entwicklungen wurden als Eintritt in ein neues Erdzeitalter beschrieben. Der Vorschlag, die neue erdgeschichtliche Epoche, die auf das Holozän folgt, als Anthropozän zu bezeichnen, wurde im Jahr 2000 durch den Meteorologen und Atmosphärenchemiker Paul Crutzen gemeinsam mit dem Biologen Eugene F. Stoermer zur Diskussion gestellt. In Paul Crutzens Todesjahr 2021 wurde durch die dafür zuständige International Commission on Stratigraphy die erdgeschichtliche Epoche des Anthropozäns in aller Form ausgerufen und ihr zeitlicher Beginn festgestellt. Die Gründe, die für eine solche Entscheidung sprechen, haben sich in den zwei Jahrzehnten seit Crutzens Vorstoß weiter verstärkt. Doch noch immer ist es ungewiss, ob es gelingt, das 2015 im Pariser Vertrag festgelegte Ziel verantwortlicher Klimapolitik – die Begrenzung der globalen Erwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius – zu erreichen. Die Bewegung Fridays for Future protestiert, von den Scientists for Future unterstützt, zu Recht dagegen, dass die politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen hinter den Notwendigkeiten weit zurückbleiben. Nach der weltweiten Konzentration auf die Bekämpfung des Corona-Virus und seiner Folgen wird es einer großen Kraftanstrengung bedürfen, um der Begrenzung des Klimawandels und der Durchsetzung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise die nötige Priorität einzuräumen. Die Zeit drängt.
Doch dies sind keineswegs die einzigen großen Herausforderungen unserer Zeit. So sind auch neue Kriegsgefahren und Krisen in der globalen Finanz- und Wirtschaftsentwicklung in den Blick zu nehmen. All diese schwerwiegenden Themen sind auf unterschiedliche Weisen mit der Digitalisierung verschränkt. Zu den neuen Kriegsgefahren gehören Angriffe auf die gegnerische Hardware, gegebenenfalls sogar aus dem Weltraum, aber ebenso auch Angriffe auf die Software, zum Beispiel mit dem Ziel, Zugang zu den gegnerischen Computernetzwerken zu bekommen oder Krankenhäuser und andere Einrichtungen der kritischen Infrastruktur lahmzulegen. Für die Waffenentwicklung ist die Digitalisierung von zentraler Bedeutung. Hochautomatisierte Waffen sind in diesem Zusammenhang mit großer Sorge zu betrachten, weil sie möglicherweise die Bereitschaft zu militärischen Interventionen erhöhen, mitsamt einer Neigung dazu, die Verantwortung für deren tödliche Wirkungen an die als «autonom» angesehenen Waffensysteme zu delegieren.
Im Blick auf das globale Finanzsystem ist die digitale Automatisierung ebenfalls von großer Bedeutung. Die globalen Finanzströme sind schon jetzt in hohem Maß automatisiert, was steuernde Eingriffe schwer und deren eventuelle Nebenwirkungen unter Umständen unkalkulierbar macht. Ebenso drängt sich die Frage auf, welche Folgen sich aus der Entwicklung von Kryptowährungen für das Weltfinanzsystem ergeben werden. Die Auskunft, dass die addierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen von November 2020 bis Mai 2021 von 500 Milliarden auf 2,5 Billionen US-Dollar gestiegen sei, weist auf eine dramatisch anwachsende Bedeutung für Wirtschaft und Finanzen hin (Wikipedia 2022).
Schließlich sind auch die Auswirkungen der Digitalisierung auf Umweltbelastung und Klimaentwicklung zu bedenken. Herstellung und Verschrottung von digitalen Geräten schädigen die Umwelt, und der Energieverbrauch, der sich aus der Nutzung solcher Geräte sowie aus der weltweiten Inanspruchnahme des Internets ergibt, ist immens. Der digitale Sektor setzt mehr Treibhausgase frei als der globale Flugverkehr – wohlgemerkt zu seinen bisherigen Spitzenzeiten vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise. Dennoch treten die ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung nur selten in den Blick. In diesem blinden Fleck zeigt sich auf paradoxe Weise der Respekt vor der verwandelnden Kraft der neuen Technologien. Dabei ist auch anderes vorstellbar: Mit digitaler Prozesssteuerung lassen sich Emissionen reduzieren, indem Produktionsabläufe und Dienstleistungen effizienter organisiert werden.
Die Digitalisierung gilt global als die entscheidende technologische Innovation unserer Zeit. Sie verändert die Kommunikationsformen in ungleich größerer Geschwindigkeit als die Einführung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern vor mehr als einem halben Jahrtausend. Im Jahr 1993 waren lediglich 3 Prozent der globalen Informationskapazität digital, bis zum Jahr 2007 war dieser Anteil auf 94,5 Prozent gestiegen. Das Jahr 2002 wird als das Jahr angesehen, in dem zum ersten Mal mehr als die Hälfte der global verfügbaren Informationen in digitaler Form gespeichert war.
Mit dieser Wasserscheide lässt sich der Übergang zum digitalen Zeitalter plausibel kennzeichnen. Seitdem nimmt die Konzentration von Macht und Kapital in den Händen einer kleinen Zahl digitaler Riesen dramatisch zu. Sie entwickeln nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen Einfluss und scheinen damit die Macht nahezu aller Staaten und Staatenbünde auf der Erde zu überragen. Das Geschäftsmodell der Verknüpfung von Kommunikation und Werbung hat auf beiden Seiten gigantische Auswirkungen. Durch den kostenlosen Zugang zu digitalen Plattformen und Diensten werden gewaltige Nutzerzahlen erreicht, aus denen sich hohe Werbeeinnahmen generieren lassen. Die Nutzer sind in diesem Geschäftsmodell nicht Kunden, die für die erlangte Dienstleistung einen Kaufpreis zahlen. Ihre Daten sind vielmehr Produkte, die in einer umfangreichen, schnell wachsenden Werbeindustrie gewinnbringend eingesetzt werden. Das hat der Vorstandsvorsitzende von Apple, Jim Cook, schon 2014 eingeräumt: «A few years ago, users of internet services began to realise that when an online service is free, youʼre not the customer. Youʼre the product.» (Cook 2014) Die digitalen Plattformen und Dienste, deren kostenloser Gebrauch auf diese Weise ermöglicht und milliardenfach genutzt wird, erleichtern die Kommunikation auf allen Ebenen: zwischen Einzelpersonen ebenso wie zwischen großen Gruppen, im Nahbereich ebenso wie global. Einerseits werden diese Möglichkeiten vielfach zu guten Zwecken genutzt, andererseits breiten sich durch sie Hass und Verachtung in Windeseile aus. Die Kultur des Zusammenlebens verändert sich tiefgreifend – und keineswegs nur zum Besseren.
Der gleiche und freie Zugang zu dieser Art von Technologie wird von vielen als eine derart große Chance angesehen, dass sie es hinnehmen, von digitalen Plattformen und Internetfirmen in einem bisher unbekannten Maß kontrolliert und überwacht zu werden. Nicht nur durch den Gebrauch ihrer PCs, Tablets und Smartphones, sondern ebenso durch die Verwendung von Bank-, Kredit- und Kundenkarten machen sie ihre Aktionen und Transaktionen überprüfbar und voraussehbar. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer verweisen in ihrer Abwägung von Kosten und Nutzen die Risiken ins zweite Glied oder ignorieren sie gänzlich. Das aufklärerische Potential, das mit der erleichterten Zugänglichkeit zu Informationen und Diskussionen verbunden sein kann, wird vielfach dadurch überlagert, dass Nutzerinnen und Nutzer sich in Filterblasen und Echokammern unter Gleichgesinnten einnisten und sich gegen unliebsame Einsichten abschirmen. Auf diese Weise hat das Internet ein gewaltiges Polarisierungspotential, das besonders in Hate Speech und Fake News zum Ausdruck kommt. Das Schüren von Streit ist charakteristisch für die Tätigkeit von Trollen. Trolling bezeichnet ursprünglich das Fischen mit Schleppangeln, bei dem Köder von einem fahrenden Boot aus durch das Wasser gezogen werden. Gemeint ist damit im übertragenen Sinn die vorsätzliche Störung des Austauschs innerhalb einer online community. Die Interventionen von Trollen zielen darauf, unsachliche Antworten zu provozieren und Konflikte innerhalb einer community herbeizuführen oder zu verstärken.
Nicht nur die Kommunikation in einem umfassenden Sinn, sondern weitere wichtige Gebiete wie Arbeit, Bildung, Konsum, Öffentlichkeit, Politik, Mobilität, Gesundheit, Sport, Liebe, Religion, Wissenschaft, Kultur und Konflikt sind in wachsendem Maß durch Digitalisierung, Robotik, Big Data und digitale Intelligenz beeinflusst und geprägt. Die Digitalisierung führt eine Welt herauf, in der jede einzelne Information grundsätzlich an allen Orten des Globus im selben Augenblick präsent ist. Mit digitalen Mitteln lässt sich ein Börsenzusammenbruch ebenso hervorrufen wie eine humanitäre Initiative. Wahlentscheidungen können durch externe Interventionen genauso beeinflusst werden wie Kaufentscheidungen. Wellen von Massenmigration in wirtschaftlichen Krisensituationen können ebenso mit digitalen Mitteln gefördert werden wie demokratische Aufstände gegen Diktaturen. Medizinische Diagnosen lassen sich durch Big Data in einem staunenswerten Maß präzisieren, doch persönliche Freiheit und Selbstbestimmung lassen sich mit denselben Instrumenten aushöhlen. Viele schauen mit einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung auf eine mögliche Integration von Digitalisierung und Neurochirurgie oder Gentechnik und sind dabei durch enorme Möglichkeiten genauso verwirrt wie durch enorme Risiken.
Solche Prozesse sind in verschiedenen Teilen des Globus von unterschiedlicher Aktualität. Die Differenzen ergeben sich aus dem unterschiedlichen Maß wirtschaftlicher und wissenschaftlich-technischer Entwicklung in den verschiedenen Regionen der Erde. Aber die Auswirkungen dieser Prozesse sind auf die eine oder andere Weise global. Wie eine technologische Disruption dieser Größenordnung in eine bewusst gestaltete gesellschaftliche Transformation eingebettet werden kann, ist deshalb eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Bleibt sie unbeantwortet, wird eine unabsehbare Zahl von Menschen durch solche Prozesse abgehängt oder ausgegrenzt, nicht nur sozial, sondern auch emotional und politisch.
Besteht überhaupt die Möglichkeit zu einer solchen gesellschaftlichen Transformation? Manche Debattenbeiträge laufen darauf hinaus, dass die technologische Disruption Veränderungen in der Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens und in unserem Bild vom Menschen nach sich zieht, die ebenfalls einen disruptiven Charakter haben. Autoren wie der US-amerikanische Futurist Ray Kurzweil oder der israelische Historiker Yuval Noah Harari erklären, dass die digitalen Technologien zusammen mit gentechnologischen Verfahren wie der Genomchirurgie das Zeitalter des Homo sapiens beenden und ein transhumanes Zeitalter eröffnen werden (vgl. Kapitel 8).
Die Vorherrschaft des Buchdrucks geht zu Ende
Um die digitale «Verwandlung der Welt» zu beschreiben, wird häufig an die These angeknüpft, das Zeitalter des Buchdrucks sei an sein Ende gekommen und habe einer grundlegend anderen Form der Kommunikation Platz gemacht. Der Medienwissenschaftler Marshall McLuhan hat die Epoche des Buchdrucks nach dessen Erfinder als Gutenberg-Galaxis bezeichnet und schon 1962 behauptet, deren Zeit sei vorbei (vgl. Grampp 2011). Warum er die Epoche des Buchdrucks als eine Galaxie, eine Ansammlung von Sternen, Gasnebeln und Dunkler Materie, bezeichnet hat, ist unklar. Er ordnete die Gutenberg-Galaxis in die Abfolge von vier Epochen ein: Mündlichkeit, Manuskript, Buchdruck und Elektronik heißen die Stichworte dafür. Der Gutenberg-Galaxis gingen nach McLuhans Auffassung also zwei Epochen voraus: Auf eine lange Phase der vorwiegend mündlichen Kommunikation folgte seit dem achten bis fünften Jahrhundert v. Chr. eine in erheblichem Maß durch die Schriftlichkeit geprägte Manuskriptkultur. Die Epochen des Buchdrucks und der elektronischen Kommunikation schlossen sich an.
Der Wunsch, Texte und Bilder zu vervielfältigen, reicht weit zurück. Solange die sprachliche Kommunikation nur mündlich möglich war, war die Reproduktion von Texten auf Gedächtnisleistung und Rezitation angewiesen. Mit der Entwicklung der Schrift wurde es möglich, sie in Manuskripten niederzulegen und durch Abschriften weiterzuverbreiten. Dafür war die Verfügbarkeit von Papier entscheidend. Dass ein Text zur Vervielfältigung nicht jedes Mal neu geschrieben werden musste, war ein wichtiger weiterer Schritt. In China, Korea und Japan begegnen seit dem sechsten Jahrhundert n. Chr. Beispiele für Holztafel- oder Blockdrucke. In Europa wurden spätestens seit dem zwölften Jahrhundert Stempeltechniken eingesetzt, die sich jedoch nur für relativ kurze Texte und niedrige Stückzahlen eigneten. In aller Regel wurden Texte weiterhin durch Abschriften vervielfältigt. Literalität war auf diejenigen beschränkt, die zu solchen mit der Hand geschriebenen oder abgeschriebenen Texten Zugang hatten. Die Mehrzahl der Menschen war weiterhin auf mündliche Kommunikation angewiesen.
Johannes Gutenbergs Verdienst erschöpfte sich nicht in seinem Interesse an beweglichen Lettern und deren technischer Verbesserung. Seine Leistung bestand darin, dass er alle Komponenten von den beweglichen Lettern bis zur Druckerpresse zusammenfügte, um Druckerzeugnisse in hoher Anzahl herstellen zu können. Dabei handelte es sich nicht nur um Texte. Von Anfang an bemühte man sich ebenso darum, Bilder zu vervielfältigen. Die Bedeutung von Gutenbergs Erfindung ließ sich schon zu seinen Lebzeiten wahrnehmen. Die zwischen 1452 und 1454 gedruckte lateinische Gutenberg-Bibel war das erste mit beweglichen Lettern hergestellte Druckwerk der westlichen Welt.
Gerade im Bereich der Religion beschränkte sich die praktische Auswirkung der neuen Technik nicht auf den Druck von Bibeln und anderen Büchern. Von großer Bedeutung waren insbesondere Flugblätter und Flugschriften, die neue Ideen schnell verbreiteten. Der Ablasshandel, ein entscheidender Auslöser für die Konflikte in der spätmittelalterlichen Kirche, wurde dadurch erheblich erleichtert, dass die Ablassbriefe, mit denen die Befreiung von Sündenstrafen gegen eine Gebühr bestätigt wurde, gedruckt und auf diese Weise in weit höherer Stückzahl verbreitet werden konnten, als dies ohne den Buchdruck möglich gewesen wäre. Alle gesellschaftlichen und politischen Veränderungen im Übergang zur frühen Neuzeit waren durch diese Medienrevolution geprägt. Ohne den Buchdruck können wir uns die reformatorischen und gegenreformatorischen Kämpfe des sechzehnten Jahrhunderts genauso wenig vorstellen wie den Ausbau des modernen Staatswesens, die Verbreitung neuzeitlicher Literatur, die Entwicklung der Wissenschaft und den Siegeszug des Kapitalismus. Die Idee der Öffentlichkeit und Gutenbergs Technologie verknüpften sich unlöslich miteinander. Für alle Bereiche der Kommunikation hatte der Buchdruck umwälzende Folgen.
Gutenbergs Erfindung wurde von Anfang an nicht nur für Bücher, sondern auch für eine Vielfalt von Kommunikationsformen des alltäglichen Bedarfs eingesetzt. Gerade wegen ihrer vielfältigen Nutzbarkeit wurde Gutenbergs komplexe Leistung von dem US-amerikanischen Magazin Time-Life 1997 zur wichtigsten Erfindung des zweiten Jahrtausends nach Christi Geburt erklärt. Konsequenterweise wurde Gutenberg selbst zwei Jahre später durch das A&E-Network, einen amerikanischen Fernsehsender für Kunst und Unterhaltung, zum «Mann des Jahrtausends» gewählt. Man entschied sich nicht für Thomas Newcomen, den Konstrukteur der ersten funktionsfähigen Dampfmaschine, für Thomas Alva Edison, den Erfinder der Glühbirne, oder für Henry Ford, der das Fließband einführte. Man entschied sich für Johannes Gutenberg: Der Druck mit beweglichen Lettern wurde zur wichtigsten Erfindung des zweiten Jahrtausends erklärt.
Dass der Buchdruck an Bedeutung verloren habe, behauptete McLuhan schon 1962. Nach seiner Auffassung wurde die Gutenberg-Galaxis durch das elektronische Zeitalter abgelöst. Dessen Beginn datierte er auf die Erfindung der drahtlosen Telegrafie durch Guglielmo Marconi um 1894. Für die daran anschließende Entwicklung wies er dem Rundfunk eine besondere Bedeutung zu. Ihren Höhepunkt erreichte sie mit dem Fernsehen, einem «idealen Agenten globaler Vernetzung» (Grampp 2011: 103). Da McLuhan selbst keinen mit der Bezeichnung des Buchdruckzeitalters als «Gutenberg-Galaxis» vergleichbaren theatralischen Namen für das elektronische Zeitalter vorschlug, kam «McLuhan-Galaxis» dafür ins Spiel. Doch dieser Vorschlag hat sich schon deshalb nicht durchgesetzt, weil sich das elektronische Zeitalter als eine Zwischenphase erweisen sollte.
McLuhan verstand den Übergang vom Buchdruck, der den Druck von Zeitungen und Zeitschriften einschloss, zu elektronischen Medien, insbesondere dem Fernsehen, als einen Wechsel von der Schriftlichkeit zu globaler Mündlichkeit. Darin entdeckte er ein Anzeichen für eine Regression, nämlich eine erneute Zuwendung zu den Kennzeichen früher Stammesgesellschaften. Er hielt es für möglich, dass sich mit der Krise der Schriftlichkeit ein neuer, globaler Tribalismus ausbreiten könne. Das «globale Dorf» wurde dafür zum Symbolbegriff.