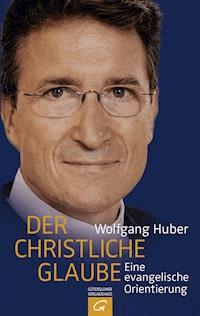
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dem Evangelium treu, den Menschen nah, der Zukunft zugewandt.
- Für die, die religiöse Orientierung suchen und das Zweifeln nicht verlernt haben
- Ein sehr persönliches Buch über den Glauben als Lebenshaltung in der Welt
- Eine evangelische Orientierung - Protestantismus für die Gegenwart
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Rückwärts beten – oder: Wo stehen wir heute?
Das habe ich bei den Menschen als großes Wunder erfahren:dass es die Erde nicht gab und nicht den Himmel,es gab nicht den Baum und auch nicht den Berg,es schien nicht ein einziger Stern, nicht die Sonne,es leuchtete weder der Mond noch die glänzende See.Als es da also nichts gab,was man als Anfang oder als Ende hätte verstehen können,gab es schon lange den einen allmächtigen Gott,den reichsten an Gnade.Bei ihm waren auch viele Geister voll Herrlichkeit,früher als sie aber war der heilige Gott.
Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffenund den Menschen so manches Gut verliehen:verleihe mir rechten Glauben an deine Gnadeund guten Willen, Weisheit, Klugheit und Kraft,den Teufeln zu widerstehenund das Böse zu meidenund deinen Willen zu tun.
Wessobrunner Gebet, aus dem 9. Jahrhundert
Rückwärts beten. Wenn ich nicht schlafen könne, solle ich rückwärts beten. Das riet mir ein wohlmeinender Mensch ungefragt. Dass es gegen Einschlafschwierigkeiten hilft, vierstellige Zahlen rückwärts zu zählen, wusste ich schon. Dann und wann praktiziere ich das auch, jeweils bei einer willkürlich gewählten Zahl beginnend, zum Beispiel 7668, 7667 und so fort. Dass es hilfreich ist, zu beten und die Sorgen des Tages in Gottes Hände zu legen, weiß ich auch. Aber rückwärts beten?
Das Vaterunser war das Beispiel meines Gesprächspartners. Er wollte mir die Konzentrationsübung nahe bringen, die darin liegt, die Worte des Gebets von hinten nach vorn zu sprechen. Eines Nachts, als ich in unbekannter Umgebung zur Unzeit aufwachte, probierte ich es aus. »Amen Ewigkeit in Herrlichkeit die und Kraft die und Reich das ist dein.« Das bei Tage aufzuschreiben ist leichter, als es nachts aus dem Kopf vor sich herzusagen.
Zunächst hatte ich die Artikel vergessen. »Amen. Ewigkeit in Herrlichkeit und Kraft und Reich: das ist dein.« So klang das Ende des Herrengebets für mich. Mit dem Wort Amen das Bekenntnis zu Gottes Wahrheit an den Anfang zu stellen, seine Ewigkeit in aller Herrlichkeit, aller Kraft und aller Macht zu sehen, die uns begegnet, weil er in allem wirkt – für das Beten kann das ein guter Anfang sein.
Auch die Fortsetzung hielt eine Überraschung bereit. »Denn Übel dem von uns erlöse.« Wieder hatte ich in Gedanken den Artikel übergangen. »Denn Übel! Von uns erlöse!« So hieß der durchaus provozierende Text. Böses ist in der Welt, so dachte ich. Oft wird es von uns Menschen selbst in sie hineingetragen. So weit wir Ursache des Bösen sind, richtet sich die Bitte an Gott, die Welt von uns und unserer Missetat zu erlösen. Eine denkbar radikale Bitte.
Alles war verflogen, was mich am Schlafen gehindert hatte; ich konnte Ruhe finden. Der Lobpreis am Ende des Gebets und die letzte Bitte hatten sich mir von einer neuen Seite gezeigt. Das Gebet, das ich in meinem Leben so oft gebetet habe wie kein anderes, war mir neu entgegengetreten. Erst viel später erfuhr ich, dass mein Gesprächspartner mir den Rat eines ostkirchlichen Mönchs weitergegeben hatte, der es richtig fand, »das Vaterunser immer beim letzten Wort anstimmen zu lassen, damit man würdig werde, das Gebet mit den Anfangsworten – ›Unser Vater‹ – zu beenden«.
Ein Gebet rückwärts zu verstehen, kann nicht verkehrt sein. Vom menschlichen Leben sagt ein dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard zugeschriebenes Wort, es werde vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Manches, was lange ein Rätsel blieb, erschließt sich vom Ende her. Die Lebensgeschichte vieler Menschen tritt durch ihren Tod in ein neues Licht. Christen vertrauen darauf, dass das Fragment ihres Lebens von der Zukunft her zusammengefügt wird, die Gott für uns bereithält.
Darin, die Worte eines Gebets rückwärts zu meditieren, sah ich nach der geschilderten Erfahrung weit mehr als nur eine Technik, in den Schlaf zu finden. Für mich lag darin ein Hinweis darauf, wie hilfreich es ist, einfache Schritte des Verstehens zu gehen. »Wir sind auf die Anfänge des Verstehens geworfen«, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, Theologe und Märtyrer zur Zeit der Hitler-Diktatur. Aus seiner Zeit in Hitlers Gefängnissen stammt dieser Satz. Er macht deutlich, welche klärende Bedeutung es haben kann, wenn man geläufige Deutungen hinter sich lässt und mit dem Verstehen wieder neu anfängt. »Wir müssen immer wieder mit dem Anfang anfangen«, heißt es einmal bei Karl Barth, einem der bedeutenden evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts; es geht also darum, die großen Worte und Bilder des christlichen Glaubens in unverstellter Frische wahrzunehmen.
Was heute nötig ist. Viele Menschen fragen heute neu nach dem christlichen Glauben. Die Zeit, in der man meinen konnte, Wohlstand und Konsum beantworteten die entscheidenden Fragen des Lebens schon von selbst, ist vorbei. Auch die Zeit, in der man mit den Mitteln der Wissenschaft oder eines Wissenschaftsglaubens allein die nötige Orientierung finden konnte, ist vorüber. So sehr wir auf ein auskömmliches Leben hoffen und so wichtig die Fortschritte wissenschaftlicher Erkenntnis sind: als Halt im Leben und im Sterben reicht das allein nicht aus. Da wird vielmehr nach einer Liebe gefragt, die auch dann trägt, wenn wir selbst keinen Ausweg mehr wissen. Gefragt wird nach einer Hoffnung, die am Tod nicht zerschellt. Gefragt wird nach Glauben.
Was ist Glaube? Unter Glauben verstehe ich die Gewissheit, die mein Leben trägt. Diese Gewissheit bezieht sich auf Gott und die Welt zugleich. Sie äußert sich in einem Vertrauen auf Gott, in dem alle Dinge ihren Ursprung und ihr Ziel haben; und sie äußert sich in einem Vertrauen auf die Welt, in der ich zu Hause sein kann, weil ich mich auf Gott verlasse. Unter Glauben verstehe ich zuallererst nicht ein Gebäude von Lehrsätzen, sondern einen Lebensvollzug. Genauer gesagt ist der Glaube ein Aspekt dieses Lebensvollzugs. Denn zu der Gewissheit, die mein Leben trägt, muss eine Zuversicht treten, die mir hilft, mit der Endlichkeit meines Lebens umzugehen. Und schließlich brauche ich eine Kraft, von der mein Verhältnis zu mir selbst wie zu meinen Mitmenschen, zu der Welt, in der ich lebe, wie zu Gott bestimmt ist. Diese drei Hinsichten hatte schon der Apostel Paulus im Sinn, wenn er vom christlichen Leben sagte: »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen« (1.Korinther 13,13). Um diesen Dreiklang von Glaube, Hoffnung und Liebe geht es in diesem Buch.
Wo stehen wir heute? Manche sagen, mit dem Christentum seien sie fertig. Damit können sie entweder meinen, der christliche Glaube sei ihnen ein sicherer, abgeschlossener Besitz. Oder sie wollen damit sagen, der christliche Glaube bedeute ihnen nichts, denn mit dieser Frage hätten sie abgeschlossen. Auf die eine wie auf die andere Weise ist die Aussage gleich beunruhigend. Sie signalisiert, dass ein Mensch nicht verstanden hat, was der Glaube ist: ein Weg, eine Wanderung, ein bis zu unserem Tod nie abgeschlossener Prozess – und zugleich: der entscheidende Halt, ohne den wir ins Bodenlose versinken, der wichtigste Trost, der entscheidende Impuls.
Manche behaupten, unsere Zeit habe mit dem Christentum abgeschlossen. Sie sagen, Europa sei in den letzten zweieinhalb Jahrhunderten durch eine Säkularisierung hindurchgegangen, in deren Folge die christliche Religion ihre Bedeutung für das Leben der Einzelnen wie für das Leben der Gesellschaft verloren habe. Zwar stoße man noch auf die Spuren eines »christlichen Erbes«; eine wirkmächtige Orientierungskraft erwachse daraus jedoch nicht mehr. Sehr oft verbindet sich eine solche Einschätzung mit der Diagnose, Religion spiele allenfalls noch als »Privatsache« eine Rolle; für das öffentliche Zeitgespräch habe sie dagegen an Gewicht eingebüßt.
Gewiss kann man niemandem das Recht absprechen, die Frage der Religion für sich selbst als erledigt anzusehen. Jeder hat das Recht, die Religionsfreiheit für sich selbst als Freiheit von der Religion und nicht als Freiheit zur Religion zu betrachten. Aber niemand sollte eine solche persönliche Entscheidung verallgemeinern. Denn die gegenläufigen Tendenzen sind unübersehbar. Die Bedeutung religiöser Themen für die Lebenswirklichkeit der Menschen und für die Tagesordnung der Gesellschaft wird neu entdeckt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hält die Mehrzahl der Menschen in Europa, auch im deutschen Sprachraum, religiöse Themen für wichtig. Ebenso sind die Menschen mehrheitlich davon überzeugt, dass der christliche Glaube ungebrochen aktuell ist; in wachsendem Maß bejahen sie den Wunsch nach einer religiösen Erziehung, sowie die Bedeutung des Gebets für das persönliche Leben.
Doch was ist das Gebet? Worauf gründet sich ein christliches Leben und worin zeigt es sich? In der Beantwortung solcher Fragen sind viele Menschen unsicher. Der christliche Glaube, dem sie eine fortdauernde Relevanz zuerkennen, ist ihnen zugleich weithin unbekannt geworden. Christliche Traditionen haben an Selbstverständlichkeit verloren. Die Rituale der Frömmigkeit haben im Leben vieler Familien keinen Raum mehr. Die Verankerung in den Ortsgemeinden hat in unserer mobilen Gesellschaft nicht mehr den Rang, der ihr für frühere Generationen zukam. Es wandelt sich vieles; auch die Zugänge zum christlichen Glauben und die Weisen, sich am kirchlichen Leben zu beteiligen, sind von diesem Wandel betroffen.
Auf der Suche nach Klarheit. Der Wunsch, Klarheit zu finden, meldet sich bei vielen Menschen deutlich an. Auch die Begegnung mit anderen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen trägt dazu bei. Soll der Gewohnheitsatheismus das letzte Wort behalten? So fragen sich manche, die auf die gesellschaftliche Wirklichkeit im Osten Deutschlands und in manchen Nachbarländern schauen. Was unterscheidet den christlichen Glauben vom Islam? So heißt eine Frage, die sich aufdrängt, seit der Islam nicht nur weltweit, sondern auch in den europäischen Gesellschaften eine wachsende Rolle spielt. Wer auf den Islam schaut, wird ganz gewiss nicht sagen können, dass Religion bloß eine »Privatsache« ist. Aber er wird zugleich den Tatbestand würdigen, dass sich in der westlichen Welt eine säkulare Rechtsordnung herausgebildet hat, die allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit die gleichen Rechte zuerkennt. Um der Freiheit willen muss es dabei bleiben. Zugleich aber ist es angezeigt, aufmerksamer auf die Bedeutung der Religion für das persönliche Leben wie für das Zusammenleben in der Gesellschaft zu achten.
Deshalb wächst die Zahl der Menschen, die mit der Frage nach der Religion – und genauer: nach dem christlichen Glauben – nicht fertig sind. An solche Menschen wendet sich dieses Buch. Manche schieben die Frage einer persönlichen Glaubensentscheidung lange auf – im äußersten Fall so lange wie der römische Kaiser Konstantin zu Beginn des vierten Jahrhunderts n. Chr., der sich erst auf dem Sterbebett taufen ließ. Andere geben der Frage nach dem Glauben immer wieder Raum; aber die Forderungen des Tages decken sie auch immer wieder zu. Viele haben einen festen Glaubenshalt; aber viele Fragen stellen sich trotzdem immer wieder neu: nach Herkunft und Zukunft der Welt, nach Anfang und Ende des Lebens, nach persönlicher Verantwortung und gemeinsamem Geschick.
Meine Klärungsversuche und Klärungsvorschläge gelten besonders den zweifelnden und suchenden Menschen. Seit Jahren lebe ich in einer Umgebung, in der viele Menschen sogar das Zweifeln verlernt haben. Sie meinen, sie hätten mit der Gottesfrage abgeschlossen, weil das materialistische Lebensgefühl, in dem sie sich im Westen unseres Landes eingerichtet haben, oder die materialistische Weltanschauung, wie sie in den Schulen der DDR gelehrt wurde und in vielen Familien heute noch weitergegeben wird, dafür keinen Raum mehr lassen. Oder sie denken, in einer Welt, in der nur zählt, was sich rechnet, habe es keinen Sinn mehr, nach Gott zu fragen. Gerade ihnen wünsche ich mehr Zweifel. Auch sie möchte ich dazu verlocken, wieder nach Gott zu fragen.
Die allzu selbstgewiss Glaubenden will ich an einen Satz des Neuen Testaments erinnern, der mich sehr berührt hat, als ich auf ihn stieß: »Erbarmt euch derer, die zweifeln« (Judas 22). Wann immer über den Glauben geredet wird, sollte nicht vergessen werden, dass eines der stärksten Glaubensbekenntnisse im Neuen Testament so heißt: »Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben« (Markus 9,24).
Der Glaube ist ein Weg, der den Zweifel einschließt. Es handelt sich zugleich um einen Weg, auf dem Glaube und Lebensführung sich nicht voneinander trennen lassen. Zusammen mit dem Grund und Inhalt des Glaubens soll deshalb in diesem Buch auch in einigen Aspekten von der Lebensform des Glaubens die Rede sein. Das Bemühen um verlässliche Formen der persönlichen Frömmigkeit wie des gemeinsamen Gottesdienstes tritt dabei genauso in den Blick wie die Frage nach der ethischen Verbindlichkeit des christlichen Glaubens. Auf diese Weise soll der christliche Glaube als eine Lebensgewissheit und als eine Lebenshaltung zugleich vor Augen treten.
Evangelische Orientierung ist das Ziel dieses Buches. Damit ist natürlich zuallererst eine Orientierung am Evangelium gemeint, an der biblischen Botschaft, an der guten Nachricht von Gottes Nähe in Jesus Christus. Zugleich ist damit eine Orientierung an der reformatorischen Wiederentdeckung des Evangeliums gemeint, an der überwältigenden Begegnung mit Gottes Gnade, an der befreienden Entdeckung, dass Gott uns Menschen ins Recht setzt und nicht wir selbst. Der Versuch, diese Entdeckung zum Leuchten zu bringen, ist der Beitrag einer evangelischen Stimme zum ökumenischen Miteinander der Christen.
Glaube
I. Gott – Schöpfer der Welt
1. Gott sei gelobt
Ich glaube an Gott, den Vater,den Allmächtigen,den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Was ist das?
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen,mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder,Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält,dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken,Haus und Hof, Weib und Kind,Acker, Vieh und alle Güter;mit allem, was not tut für Leib und Leben,mich reichlich und täglich versorgt,in allen Gefahren beschirmtund vor allem Übel behütet und bewahrt;und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güteund Barmherzigkeit,ohn’ all mein Verdienst und Würdigkeit:für all das ich ihm zu danken und zu lobenund dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.
Das ist gewisslich wahr.
Erklärung zum Ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses in Martin Luthers Kleinem Katechismus (1529)
Auf die Natur als gute Gabe Gottes weist im christlichen Jahreslauf kein Fest so nachdrücklich hin wie das Erntedankfest. Es trägt eine so bezwingende Logik in sich, dass es sich sogar dort hält, wo der christliche Bezug weithin verschwunden ist.
In der Zeit der DDR hat man aus dem Erntedankfest den Dank einfach gestrichen und das Erntefest behalten. Die Freude an der eingefahrenen Ernte wollte man auch noch zum Ausdruck bringen, als nicht mehr davon die Rede sein durfte, wem man dafür zu danken habe.
Das Evangelische Johannesstift, eine große, im ehemaligen Westteil Berlins gelegene diakonische Einrichtung, hat an die Bereitschaft der Menschen, sich aus Anlass der Ernte an Gottes Schöpfung zu freuen, auf andere, listige Weise angeknüpft. Man hat das Erntedankfest einfach um einen Sonntag vorverlegt, um der Konkurrenz mit anderen Veranstaltungen zu entgehen. Zehntausende treffen sich nun Jahr für Jahr am letzten Sonntag im September zu munterem Treiben; ob in diesem Fall allen bewusst ist, wem wir Menschen für Speis und Trank Dank schuldig sind, mag offen bleiben.
Der Dank für die Gaben der Schöpfung und in ihnen für das eigene Leben ist wohl der ursprüngliche Ort für die Rede vom Schöpfer, dem Geber dieser guten Gaben. Doch diese Rede suchte nach Anschaulichkeit und Plausibilität. So entstanden Schöpfungserzählungen und Schöpfungsmythen. Sie nutzten die Weltbilder ihrer jeweiligen Zeit, wie sie auch sonst die Sprache ihrer Zeit nutzten. Auch in den biblischen Schöpfungserzählungen geschieht das. Für sie gilt wie für die Bibel generell: Sie sind Gotteswort im Menschenwort. Auch demjenigen, der in seinem Vertrauen auf Gott in der Bibel Gottes Offenbarung erkennt, begegnet diese Offenbarung in menschlichen Worten. Deshalb hat der Umgang mit diesen Erzählungen seinen Sinn nicht darin, sie wortwörtlich für wahr zu halten, sondern in ihnen eine Wahrheit zu entdecken, die über ihre zeitgebundene Gestalt hinausweist.
Die biblischen Schöpfungstexte haben für Juden und Christen die gläubige Sicht der Welt geprägt; dies bedeutet nicht, dass man im Bild von der Welt bei ihnen stehen bleiben muss. Deshalb soll zunächst von der Sicht der Welt in den biblischen Schöpfungserzählungen, dann von unserem heutigen Bild der Welt die Rede sein. Abschließend soll erwogen werden, wie sich beides zueinander verhält.
Die biblische Sicht der Welt
Die erste Schöpfungserzählung. Die ersten Kapitel der Bibel fügen zwei Schöpfungserzählungen zusammen. Von ihnen ist die erste Schöpfungserzählung (1. Mose 1,2 – 2,4) die jüngere. Ihrem Stil entsprechend wird sie der sogenannten Priesterschrift zugeordnet. Diese entstand um 500 v. Chr.; den Hintergrund bildeten babylonische Weltentstehungsmythen der damaligen Zeit. Vieles verbindet diesen Text mit dem babylonischen Denken. Wie dieses konfrontiert er uns mit dem Bild eines Himmelsozeans, dessen Wasser wie eine Sintflut auf die Erde stürzen könnten, wenn sie nicht durch das Firmament daran gehindert würden. Doch anders als diese Mythen lässt er die Welt nicht aus einem Kampf rivalisierender Götter hervorgehen, sondern aus der souveränen Schöpfertat des einen Gottes. Er versteht die Gestirne nicht als Gottheiten, sondern als von Gott geschaffene Himmelslichter. In den Menschen sieht er nicht Diener der Götter, sondern Gottes Ebenbild. Und die Welt betrachtet er nicht als Chaos, sondern als eine von Gott diesem Chaos abgerungene Ordnung. Die Souveränität des Schöpfers, die Würde des Menschen und die Einheit der Schöpfung treten uns als bestimmende Züge dieser Erzählung entgegen.
Vielen ist sie allerdings eher aus einem andern Grund in Erinnerung. Sie gliedert das Schöpfungshandeln Gottes in ein Sechstagewerk; die Ruhe des siebten Tages gibt dem Wirken Gottes seine Vollendung. Das Bild der Woche als Raum menschlichen Tätigseins wird also auf das Schöpfungshandeln Gottes übertragen; man mag darin einen frühen Beleg für die Projektion menschlicher Kategorien auf das Handeln Gottes sehen. Doch es geht nicht darum, das schöpferische Handeln Gottes auf die Zeit von sechs Tagen zu begrenzen, denen als siebter Tag ein Ruhetag zur Seite tritt. Der Sinn dieser Gliederung besteht auch nicht darin, Perioden in der Entwicklung des Kosmos voneinander zu unterscheiden, deren Vereinbarkeit mit unserem heutigen Wissen von der Entstehung und Entwicklung der Welt dann zu prüfen wäre. Sondern in zweimal drei »Tagen« werden grundlegende Erfahrungen beschrieben, mit denen der Mensch als Teil der Schöpfung konfrontiert ist.
Die Erfahrung des Lichts in seiner Unterscheidung von der Finsternis, die Bewahrung der Welt vor den chaotischen Mächten des Himmelsozeans und die Beheimatung des Menschen auf der Erde als Raum der Fruchtbarkeit sind die drei Erfahrungen, die in der Beschreibung der drei ersten Schöpfungstage zum Ausdruck kommen.
In der zweiten Gruppe von drei Schöpfungstagen werden diese Erfahrungsräume ausgestaltet. Der erste Tag stand unter der Aufforderung »Es werde Licht«; der vierte Tag ermöglicht dem Menschen durch die Erschaffung der Sterne, der Sonne und des Monds Orientierung. Der zweite Tag hatte die Welt in ihrer Weite im Blick; die Tiere, die den Himmel wie das Meer bevölkern, sind das Thema des fünften Tags. Der dritte Tag war der Erde in ihrer Fruchtbarkeit gewidmet; die Tiere auf der Erde werden am sechsten Tag geschaffen – und in ihrer Mitte der Mensch, den Gott zu seinem Ebenbild erwählt. Das alles klingt weniger nach einer Theorie der Weltentstehung, sondern mehr nach einer Beschreibung der Welt, in welcher der Mensch sich vorfindet, die er sich aneignet und die er als Gottes Schöpfung achtet.
Besonders beeindruckend ist, dass diese Welt durch das schöpferische Wort Gottes ins Leben gerufen wird – »und Gott sprach« heißt es immer wieder. Dem entspricht, dass jedem Schöpfungselement die Vollzugsformel »und es geschah so« zugeordnet ist. Besonders wichtig aber ist das Urteil, mit dem Gott die Elemente der Schöpfung versieht. Verschiedentlich begegnet bei der Beschreibung der einzelnen Schöpfungstage der Hinweis: »Und Gott sah, dass es gut war.« Beim Abschluss des sechsten Schöpfungstages aber heißt es dann zusammenfassend: »Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut« (1. Mose 1,31).
Von Anfang an ist Gott mit der Güte der Schöpfung verbunden. Von Anfang an ist Gott als der verstanden, der es mit seiner Welt und dem Menschen in ihr gut meint. Der Mensch soll in einer Welt Heimat finden, die von Gott nicht einem satanischen Gegenspieler abgerungen, sondern gut geschaffen ist.
Die zweite Schöpfungserzählung (1. Mose 2,4 – 25) führt uns in eine ältere Zeit; ihr Verfasser wird gewöhnlich Jahwist genannt, weil er von Anfang an das Tetragramm JHWH für Gott verwendet, das freilich erst bei der Begegnung Gottes mit Mose im brennenden Dornbusch ausdrücklich mitgeteilt wird (2. Mose 3,15). Sein Bericht ist ganz und gar auf die Erschaffung des ersten Menschenpaars ausgerichtet. Nicht wie die beiden geschaffen werden, sondern als was sie geschaffen werden, ist dabei entscheidend. Sie werden einander zum Gegenüber geschaffen, so wie sie miteinander Gott gegenüber stehen. Sie werden einander zu Gehilfen bestimmt, weil das Leben nur gemeinsam gelingen kann.
Der Auftrag zur Herrschaft über die Erde, von dem in der ersten Schöpfungserzählung deutlich die Rede ist, erfährt in der älteren zweiten Erzählung eine klärende Verdeutlichung. »Sich die Erde untertan zu machen« (1. Mose 1,28) bedeutet nicht – wie es überhaupt erst unter neuzeitlichen wissenschaftlichen und technischen Voraussetzungen vorstellbar wird –, die Natur der Herrschaft des Menschen zu unterwerfen und in seinem Interesse auszubeuten. Es bedeutet vielmehr, die Erde zu bebauen und zu bewahren (1. Mose 2,15).
Damit wird schon in den biblischen Schöpfungstexten selbst einem idyllischen Naturverständnis eine Absage erteilt. Die Vorstellung, die Natur sei dort am schönsten, wo sie unberührt geblieben ist, enthält ja weithin nur abstrakte Theorie. Denn sie lässt sich, aufs Ganze gesehen, gar nicht überprüfen – ist doch die Natur, wo immer wir sie sehen können, zumeist auch schon von uns Menschen mitgestaltet. Wir bahnen uns einen Weg oder gestalten die Natur auf andere Weise um. Wir nutzen sie als Lebensraum, indem wir Lebensmittel anbauen. Wir nutzen ihre Ressourcen, weil wir in ihnen wichtige Rohstoffe erkennen. Wir versiegeln sie dadurch, dass wir Häuser und Straßen bauen.
Ein Raum des gemeinsamen Lebens wird die Natur nur dadurch, dass wir sie kultivieren. Wir sind also immer schon schöpferisch in ihr tätig, wenn wir Gottes Schöpfung als Basis unseres eigenen Lebens fruchtbar machen. In dieser Einsicht stimmen die beiden Schöpfungserzählungen am Anfang der Bibel, unbeschadet ihrer unterschiedlichen Akzentsetzung, überein. Wenn der eine dieser Texte sagt: »Macht euch die Erde untertan« (1. Mose 1,28), dann unterstreicht er die Notwendigkeit, die Natur zu bearbeiten. Wenn der andere sagt, es komme darauf an, den Garten Eden »zu bebauen und zu bewahren« (1. Mose 2,15), dann wird damit genauso nüchtern deutlich gemacht, dass der Mensch die Natur bewahren muss, wenn er sie langfristig nutzen will.
Unser heutiges Bild der Welt
Noch immer ist es leichter, frühere Weltbilder zu beschreiben, als das Bild von der Welt kurz und bündig zu skizzieren, das sich aus dem heutigen Stand naturwissenschaftlicher Einsichten und den damit verbundenen Hypothesen ergibt. Wir konzentrieren uns auf die drei Fragen, wie die Entstehung der Welt erklärt wird, was wir über den Anfang des Lebens wissen und wie der Übergang zum Menschen zu verstehen ist.
Zunächst also die Entstehung der Welt. Noch immer fällt es uns schwer, uns auf eine dynamische Sicht des Universums einzustellen. Aber vieles spricht dafür, dass wir uns das Universum zeitlich nicht ewig und auch räumlich nicht statisch vorstellen dürfen. Es hat einen zeitlichen Anfang, der mit der Hypothese eines »Ur-Atoms« oder mit dem Bild eines »Urknalls« beschrieben wird. In räumlicher Hinsicht dehnt das Universum sich kontinuierlich aus.
Die heutige Kosmologie geht von einer zeitlichen Schätzung aus, nach welcher das Universum vor ungefähr 13,7 Milliarden Jahren entstand. In unvorstellbar kurzer Zeit bildete sich mit der Schwerkraft, dem Elektromagnetismus sowie den Kernkräften die physikalische Voraussetzung für die Strukturen des Kosmos. Dann entstand mit den Elementarteilchen das »Material der Materie«. Vieles ist uns noch immer unbekannt. Unbekannt ist beispielsweise, ob es vielleicht viele andere Urknalle gegeben hat, die nicht dazu geeignet waren, eine Welt entstehen zu lassen, weil – beispielsweise in Folge einer zu starken Gravitation – das sich bildende Universum sofort wieder in sich zusammenfiel. Wenn man dieser Vorstellung nachhängt, dann gewinnt der Gedanke des Philosophen Leibniz, dass wir in der »besten aller möglichen Welten« zu Hause sind, einen überraschenden Sinn. Nur haben sich diese anderen Welten, so meinen manche, eben nicht als möglich erwiesen, weil sie nicht stabil genug waren, um auf Dauer zu existieren. Und deshalb hat niemand, wie ein Forscher einmal heiter feststellte, »die fehlgeschlagenen Versuche gezählt« (Alan Guth).
Andere Astronomen gehen davon aus, es gebe eine Vielzahl von Universen, von denen sich eines für die Ausbildung von Leben als besonders günstig erwiesen hat. Martin Rees verdeutlicht diesen Gedanken durch den Vergleich mit einem großen Bekleidungsgeschäft: »Wenn ein sehr großer Vorrat von Kleidungsstücken vorhanden ist, wundert man sich nicht, wenn man einen passenden Anzug findet. Findet man viele Universen, […], dann gibt es auch eines, dessen Kombination sich für das Leben eignet. Und in diesem einen befinden wir uns.«
Zwei Fragen schließen sich an diese Überlegung an. Auch sie beziehen sich auf die zeitliche sowie die räumliche Struktur des Universums.
In zeitlicher Hinsicht heißt die Frage so: Muss man sich, da unsere Welt einen Anfang hat, auch vorstellen, dass sie auf ein zeitliches Ende zugeht? Eine Antwort auf diese Frage besagt, dass die Schwerkraft sich auf lange Zeit vielleicht als zu stark erweisen könne, so dass die Ausdehnung des Universums schließlich doch an ein Ende kommt und es in sich zusammenbricht. Daraus könnte eine neue Singularität entstehen, die vielleicht den Ausgangspunkt zur Bildung einer anderen Welt darstellen könnte. Eine gegenläufige Überlegung geht von der Vermutung aus, die Gravitation könnte sich als zu schwach erweisen und alles strebe unaufhaltsam auseinander – bis dahin, dass die Wechselwirkungen zwischen den Teilen des Universums zum Stillstand kommen. Aber es ist auch möglich, dass sich die Gravitation auf Dauer als richtig erweist; das würde eine Fortexistenz des Universums auf unabsehbare Zeit zur Folge haben. Versucht man, diese drei Möglichkeiten zusammen zu denken, so kann man folgern, dass die zeitliche Entwicklung des Universums offen, aber nicht ewig ist.
In räumlicher Hinsicht aber muss man die Frage stellen, ob es denn überhaupt denkbar ist, dass man an den Rand des Universums gelangen und dann auch über diesen Rand hinausschauen könnte. Die Antwort heißt: Da das Universum, Einsteins Relativitätstheorie zu Folge, gekrümmt ist, ist es zwar endlich, aber grenzenlos. Wenn wir uns vornehmen würden, uns in diesem Universum so lange wie denkbar in gerader Richtung zu bewegen, um an seinen Rand zu geraten, würden wir nicht etwa diesen Rand erreichen, sondern irgendwann an den Ausgangspunkt zurückkommen.
Sodann die Entstehung des Lebens. Will man von der Entstehung des Lebens sprechen, muss man sagen, was man unter Leben versteht. Stoffwechsel, Vermehrungsfähigkeit und Veränderbarkeit gelten nach heutiger naturwissenschaftlicher Einsicht als Kennzeichen des Lebens. In diesem Sinn beginnt Leben auf der Ebene der Protein-Moleküle. In jüngster Zeit ist das an den Prionen zum Bewusstsein gekommen, die Erreger des Rinderwahnsinns sind. Für alles Leben sind drei Stoffe grundlegend: die Nukleinsäuren, in denen die genetische Information enthalten ist, auf der die identische Selbstreproduktion beruht, die Proteine, denen die Steuerung des Stoffwechsels zu verdanken ist, und die Lipide, die einen Elementarorganismus entstehen lassen.
Der Begriff des Lebens, der Stoffwechsel, Vermehrungsfähigkeit und Veränderbarkeit als seine Kennzeichen hat, ist so elementar, dass auch das Leben von Bakterien in ihn eingeschlossen ist. Gleichwohl ist der Schritt von der unbelebten Natur zum Leben gewaltig; das zeigt sich auch daran, dass es bisher noch nicht gelungen ist, ihn künstlich zu wiederholen. Die Entstehung des Lebens ist insofern ebenso ein Übergang zu etwas ganz Neuem wie die Entstehung der Welt. In mikrofossilen Überresten von Bakterien können wir diesen Schritt nachweisen, der sich auf der Erde vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren vollzogen hat. Man nimmt heute zumeist an, dass das Leben auf der Erde selbst entstand und nicht etwa von außen zur Erde transportiert wurde. Aber offen ist nach wie vor, ob es Leben nur auf der Erde oder auch in anderen Teilen des Universums gibt.
Die Erforschung des Lebens richtet sich besonders auf seine Geschichte. Die Aufgabe, diejenigen Mutationen zu rekonstruieren, aus denen höhere Stufen des Lebens hervorgegangen sind, weckt die Leidenschaft vieler Forscherinnen und Forscher. Unter jeweils zufälligen Mutationen, so heißt die vorherrschende wissenschaftliche Auskunft, hat sich jeweils diejenige durchgesetzt, die am leistungsfähigsten war. Das bedeutet aber nicht, dass schon die Mutationen selbst in einer erkennbaren Weise zielgerichtet gesteuert waren. Doch im Ergebnis sehen wir eine Entwicklung zu immer höheren Formen des Lebens. Das bloße Leben geht über in ein Leben, das seiner bewusst ist und sich darüber mit dem Mittel der Sprache Rechenschaft ablegen kann.
Schließlich der Mensch. In der endlichen, aber grenzenlosen Welt entsteht Leben. Das ist das Wunder, das unsere Existenz bestimmt. Doch darin liegt kein Grund dafür, die Existenz des Menschen zu überschätzen. Bescheidenheit drängt sich vielmehr auf, wenn man das Auftreten des Menschen in die Geschichte des Kosmos einzeichnet. Vor 13,7 Milliarden Jahren ist das Universum entstanden; seit etwa 4,5 Milliarden Jahren gibt es den Planeten Erde. Vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren haben sich die ersten komplexen Lebensformen ausgebildet; aber die ersten Frühmenschen mit aufrechtem Gang lassen sich erst vor 1,5 Milliarden Jahren nachweisen (homo erectus). Von Menschen in dem uns vertrauten Sinn (homo sapiens) aber können wir erst seit 200.000 Jahren sprechen. Hans Küng kommentiert das zu Recht so: »Der Kosmos existierte also fast die ganze Zeit ohne die Menschheit, er könnte selbstverständlich ohne diese Menschheit weiterexistieren, die in ihrer kurzen Geschichte sogar die Fähigkeit erlangte, sich selber zu vernichten. «
Wer sich überhaupt dem Gedanken einer Geschichte des Kosmos öffnet, braucht keinen gewaltigen Schritt zu unternehmen, um sich in die Vorstellung hineinzufinden, dass sich auch die Entstehung des Menschen einem evolutionären Prozess verdankt. Dennoch löste Charles Darwin (1809 – 1882) mit seiner Theorie über die »Entstehung der Arten« (1859) und über die »Abstammung des Menschen« (1871) eine tiefe Erschütterung des menschlichen Selbstbewusstseins aus. Dass der Mensch, Krone und Herr der Schöpfung, sich aus niedrigeren Stufen des Lebens heraus entwickelt habe und »vom Affen abstamme«, wie man immer wieder verkürzend sagte, wurde als kränkend empfunden. Sigmund Freud hat deshalb Darwins Evolutionstheorie neben der Entdeckung von Nikolaus Kopernikus, dass die Erde nicht den Mittelpunkt der Welt bildet, und neben Freuds eigener psychoanalytischer Entdeckung, dass der einzelne Mensch nicht »Herr im eigenen Hause« ist, als eine der drei großen Kränkungen des menschlichen Selbstbewusstseins durch die moderne Wissenschaft bezeichnet.
Ungefähr zur Zeit Darwins wurde auch die Vorstellung, Tier-und Pflanzenarten blieben bei ihrer Fortpflanzung gleich, durch die Vererbungsgesetze Gregor Mendels (1822 – 1884) verabschiedet. Doch Darwin wandte die Einsicht in die mögliche Veränderung der Arten auf den Menschen selbst an. Dabei ließ er sich von dem Gedanken leiten, dass es im »Kampf ums Dasein« – oder besser: im Ringen um Existenz – zu einer natürlichen Auswahl derjenigen käme, die sich am besten in die jeweiligen Lebens- und Umweltbedingungen einfügen (»survival of the fittest«). Darwin war davon überzeugt, dass auf diesem Weg immer besser angepasste Lebewesen zu Stande kämen. Seine Beschreibung des Ringens um Existenz hatte nicht nur das Leben des Individuums, sondern ganz besonders die Dauerhaftigkeit durch Fortpflanzung im Auge. Besonders wichtig war ihm die Einsicht, dass Vermehrung auch Sterben bedeutet – einschließlich des Umstands, dass die fleischfressenden Tiere andere Tiere fanden, von denen sie sich ernährten.
Darwin beschrieb eine Natur, zu deren Grundzügen es gehört, »über Leichen zu gehen«. Die Ambivalenz dieser Betrachtungsweise trat hervor, als seine Gedanken auf das Zusammenleben der Menschen und die Konkurrenz der Nationen übertragen wurden. Der »Sozialdarwinismus« behauptete auch im Blick auf gesellschaftliche Gruppen wie auf ganze Gesellschaften, nur der Stärkste könne überleben, und rechtfertigte auf diese Weise rücksichtslosen Wettbewerb oder kalte Machtpolitik als unvermeidliche Mittel, das eigene Überleben zu sichern. Seitdem ist die Beschäftigung mit der Evolutionstheorie immer von dem berechtigten Argwohn begleitet, zur Rechtfertigung für die Durchsetzung des Stärkeren zu dienen.
Doch mit der notwendigen Kritik am Sozialdarwinismus hat man Darwins Entdeckung selbst keineswegs widerlegt. Ich formuliere ihren Kern so: Geschichtlich zu sein, ist ein Teil der menschlichen Natur. Denn der Mensch erfährt nicht nur das eigene Leben als Geschichte. Er ist auch nicht nur als Individuum in die Geschichte verflochten, sondern die Gattung Mensch ist das Produkt einer Geschichte. In die Geschichte des Kosmos tritt der Mensch erst spät ein; doch die Vorstufen, die schließlich zur Entstehung der Gattung Homo sapiens führen, lassen sich Schritt für Schritt und mit wachsender Präzision beschreiben.
Kann man auch weiterhin so hoch vom Menschen reden, wie es die biblischen Schöpfungserzählungen tun? Lässt er sich auch dann als Gottes Ebenbild beschreiben, wenn er in einer kontinuierlichen Linie mit anderen, noch nicht menschlichen Lebewesen gesehen wird?
Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft
Unser heutiges Bild der Welt haben wir im Blick auf die Entstehung der Welt, des Lebens und des Menschen betrachtet. Nun müssen wir uns der Frage zuwenden, in welchem Verhältnis dieser heutige Kenntnisstand zum Schöpfungsgedanken steht. Weder die zeitliche und räumliche Endlichkeit der Welt noch der Gedanke, dass diese Welt unter allen möglichen diejenige ist, in der Leben entstehen konnte, bilden eine hinreichende Begründung dafür, aus diesen Einsichten einen Glauben an die Erschaffung der Welt abzuleiten. Aber unser Wissen über die Geschichte des Universums schließt das Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer auch nicht aus. Im Gegenteil: In einer bestimmten Hinsicht tritt die Berührung zwischen beiden deutlicher hervor.
Beide berühren sich in der Einsicht: Alles Geschaffene ist endlich, also vergänglich. Deutlicher als die Menschen in früheren Zeiten kennen wir heute Gründe dafür, dass diese Aussage nicht nur für Lebewesen, sondern auch für die Welt im Ganzen gilt. Denn auch das Universum ist endlich, also vergänglich. Die Vorstellung von Unendlichkeit und Ewigkeit kann nicht mit der Welt verbunden werden; man muss sie vielmehr mit einem der Welt gegenüber Anderen verbinden, mit Gott.
Deshalb wenden wir uns noch einmal den biblischen Schöpfungstexten zu. Wir richten unsere Aufmerksamkeit jetzt auf das in ihnen vorausgesetzte Weltbild. Denn entscheidende Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Texten haben gerade mit ihren weltbildhaften Voraussetzungen zu tun.
Wandel der Weltbilder. Mit der neuzeitlichen Einsicht, der zufolge der Mensch sein Verstehen der Welt nicht an vorgegebenen Dogmen ausrichten, sondern es von der eigenen Beobachtung ableiten muss, gerieten die Bilder ins Wanken, die sich mit dem Schöpfungsglauben scheinbar unlöslich verknüpft hatten. Der Umsturz begann schon, als man erkannte, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Doch unbefragt ging man weiterhin davon aus, die Erde bilde das Zentrum des Universums; denn unwillkürlich sah sich der erkennende Mensch im Zentrum der Welt; der Planet, auf dem er lebte, bildete deshalb den Mittelpunkt des Kosmos.
Entsprechend dramatisch war der Einschnitt, als Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) diesem nach Ptolemäus benannten Weltbild den Abschied gab. Die »kopernikanische Wende« rückte nicht nur die Sonne statt der Erde ins Zentrum, sondern sie setzte zugleich ein offenes Weltmodell an die Stelle des vorangehenden geschlossenen Modells der Welt. Die Präzisierung dieses Modells durch Johannes Kepler (1571 – 1630) und seine Verteidigung durch Galileo Galilei (1564 – 1642) verhalfen ihm zu einem Siegeszug, der sich durch keinerlei kirchliche Einsprüche aufhalten ließ. Doch gerade dieser Erfolg trug zu einer wachsenden Konkurrenz zwischen dem biblischen Schöpfungsgedanken und dem naturwissenschaftlichen Weltbild bei, in der sich – so schien es – der Schöpfungsgedanke unweigerlich in der Defensive und auf dem Rückzug befand. Was man in der jüdisch-christlichen Tradition unmittelbar auf das Schöpferwirken Gottes zurückgeführt hatte, wurde immer detaillierter aus Kräften und Gesetzen der Natur erklärt. Die Schöpfung der Welt wurde zur Weltentstehung; und die Erschaffung der Lebewesen – mit dem Menschen als »Krone der Schöpfung« – wurde zur Evolution.
Glaube und Wissen. Der grundlegende Fehler, der in dieser Entgegensetzung zum Ausdruck kommt, liegt darin, dass der Schöpfungsgedanke mit den weltbildhaften Vorstellungen gleichgesetzt wird, in denen die biblischen Texte ihn präsentieren. Die Schöpfung wird nicht als Thema des Glaubens, sondern des Wissens angesehen. Der Glaube richtet sich auf die Wirklichkeit im Ganzen; er hat es mit dem Grund der Welt wie meines persönlichen Lebens zu tun, dem ich die Weltgewissheit und die Daseinsgewissheit verdanke, die meinem Leben Sinn verleihen. Unter Wissen dagegen ist in solchen Fällen das Erfahrungswissen zu verstehen, das wir mit den Mitteln von Beobachtung und Experiment erwerben. Dieses Erfahrungswissen ist an die Bedingungen von Raum und Zeit gebunden; der Glaube dagegen richtet sich auf die Wirklichkeit Gottes, die Raum und Zeit umgreift und übersteigt. Zwar bleibt der Glaube auf das Wissen bezogen, ja angewiesen. Aber er ist nicht mit ihm identisch. Glaube und Wissen sind also bewusst voneinander zu unterscheiden; sie treten freilich nicht beziehungslos auseinander, sind also nicht vollständig voneinander zu trennen.
Das hat beispielsweise unmittelbare Konsequenzen für die häufig diskutierte Frage, ob im Biologieunterricht auf den biblischen Schöpfungsglauben und ob im Religionsunterricht auf die Evolutionstheorie Bezug zu nehmen sei. Am günstigsten wäre es ohne Zweifel, wenn das Verhältnis zwischen beiden Betrachtungsweisen in interdisziplinären Unterrichtsprojekten geklärt würde. Dann könnten biologische und theologische Perspektiven jeweils in ihrer Eigenbedeutung anerkannt werden. Man könnte lernen, dass man die Beziehung zwischen diesen beiden Betrachtungsweisen nur dann zureichend bestimmen kann, wenn man bereit ist, sie voneinander zu unterscheiden. Wer aus biologischer Perspektive über den biblischen Schöpfungsglauben spricht, braucht dafür entsprechende theologische Kenntnisse. Insbesondere muss er es vermeiden, die biblischen Schöpfungserzählungen zu konkurrierenden Welterklärungsmodellen zu machen und das eine gegen das andere auszuspielen. Sowohl das Ergebnis: »Darwin beweist, dass es Gott nicht gibt«, als auch das Ergebnis: »Gott beweist, dass Darwin Unrecht hat« wären eine unterrichtliche Fehlleistung. Ebenso klar ist, dass der Biologieunterricht die Grenze zur weltanschaulich-religiösen Bildung nicht überschreiten darf; er darf nicht unter der Hand zum Religionsunterricht – auch nicht in einem antireligiösen Sinn – werden.
Wer aus theologischer Perspektive über die Evolutionstheorie reden will, braucht dafür entsprechende naturwissenschaftliche Kenntnisse. Insbesondere muss er vermeiden, die Evolutionstheorie zu einer konkurrierenden Weltanschauung oder gar Glaubenslehre zu machen. Die Aussage: »Wir glauben an Gott, nicht an Darwin« wäre ebenso eine unterrichtliche Fehlleistung wie die Aussage »Wir glauben an Darwin, nicht an Gott«. Klar ist auch, dass der Religionsunterricht nicht zum Biologieunterricht werden darf, in dem Texte zur Evolutionstheorie ausführlicher analysiert werden als die biblischen Schöpfungserzählungen.
Nun gibt es keineswegs nur die Forderung, den Unterricht über die Evolutionstheorie und denjenigen über den biblischen Schöpfungsglauben miteinander zu verbinden. Weiter geht die Forderung, das eine durch das andere zu ersetzen. Soweit in deutschen Bundesländern, in denen der Ethikunterricht den Religionsunterricht weithin verdrängt (wie derzeit in Berlin und in etwas schwächerer Form auch in Brandenburg), dieser Ethikunterricht den Darwinismus als die richtige und den christlichen Glauben als die falsche Weltanschauung darstellt, geschieht genau dies. Soweit allerdings umgekehrt gefordert wird, dass in den Schulen nicht die Evolutionstheorie, sondern eine biblische Weltanschauung, »Kreationismus« (abgeleitet von dem lateinischen Wort creatio, zu deutsch: Schöpfung) genannt, unterrichtet wird, geschieht das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen. Der Glaube an den Schöpfer wird dann zu einer pseudowissenschaftlichen Weltanschauung; dieser Glaube selbst soll nämlich das zutreffende Wissen über die Entstehung und Entwicklung der Welt vermitteln.
Damit wird der Schöpfungsglaube aber als eine Form der Welterklärung betrachtet. Der Glaube an den Schöpfer wird nicht als Grundlage einer Daseinsgewissheit angesehen, die unserem Leben verlässlichen Halt gibt. Sondern der Schöpfer wird als eine in der Natur wirkende Kraft verstanden; der Schöpfungsglaube wird dadurch als eine wissenschaftliche Hypothese behandelt, die mit neueren wissenschaftlichen Einsichten in Konkurrenz tritt. Ein solches Konkurrenzverhältnis liegt zu Grunde, wenn in manchen Bundesstaaten der USA, vereinzelt aber auch in Deutschland gefordert wird, dass nicht die Evolutionstheorie Darwins, sondern der biblische Schöpfungsglaube gelehrt werden solle.
Mit dieser Verkehrung des Glaubens an den Schöpfer in eine Form der Welterklärung, die mit wissenschaftlichen Theorien in Konkurrenz treten will, hat die Christenheit immer wieder Schiffbruch erlitten. Die Auseinandersetzung über das kopernikanische Weltbild oder der »Fall Galilei« sind Beispiele dafür. Indem ein zur Weltanschauung missdeuteter Glaube an die Stelle der wissenschaftlichen Vernunft treten wollte, wurde das Bündnis von Glaube und Vernunft in Wahrheit aufgekündigt. Genau dasselbe vollzieht sich gegenwärtig dort, wo ein vermeintlich auf ein wörtliches Verständnis der Bibel gestützter »Kreationismus« in Konkurrenz zu wissenschaftlichen Theorien der Weltentstehung und der Evolution gesehen wird. Natürlich bedürfen solche Theorien der kritischen Prüfung; doch diese Prüfung hat mit wissenschaftlichen Mitteln und nicht entlang ideologischer Vorgaben zu erfolgen. Deshalb ist aus Gründen des Glaubens ein klarer Widerspruch notwendig, wenn die biblischen Schöpfungserzählungen in einem solchen Sinn missbraucht werden.
Intelligent Design. Neuerdings wird der Evolutionstheorie auch eine Auslegung der Schöpfungslehre entgegengesetzt, der man den Namen »Intelligent Design« gibt. Weil man die innere Folgerichtigkeit der Evolution nicht anders begründen könne, müsse man aus wissenschaftlichen Gründen, so wird gesagt, einen Welturheber annehmen, der die Welt von Anfang an so intelligent konzipiert hat, dass es zur Entstehung des Lebens und zur Entwicklung des Menschen als der Krone der Schöpfung kam. Man hält also nach »Intelligenzsignalen« (»signs of intelligence«) Ausschau, die als Auswirkungen »intelligenter Ursachen« (»intelligent causes«) verstanden werden müssen (William A. Dembski). In der Konzeption des »Intelligent Design« will man sich nicht damit abfinden, die Mutationen, also die Veränderungen, die zu neuen Arten von Lebewesen führen, als zufällig anzusehen. Man hält stattdessen daran fest, dass die Schritte in der Entwicklung des Lebens vom Ergebnis her, also teleologisch gesteuert sind. Mit den Mitteln der Naturwissenschaft selbst soll nachgewiesen werden, wie der Wiener Kardinal Christoph Schönborn sich ausgedrückt hat, dass »eine gestaltende übergeordnete Intelligenz bei jedem Schritt der Natur als Triebfeder wirkt«.
Damit wird freilich Gott den Ursachen in Raum und Zeit gleichgesetzt, wie sie sich sonst mit Hilfe empirischer Forschung ermitteln lassen. Gott wird zum Gegenstand des Erfahrungswissens, das seinerseits zwingend an die Kategorien von Raum und Zeit gebunden ist. Solchen Vorstellungen liegt eine Denkweise zu Grunde, die der Philosoph Immanuel Kant (1724 – 1804) gerade überwinden wollte, als er in der Vorrede zu seiner »Kritik der reinen Vernunft« erklärte, er habe »das Wissen aufheben« müssen, »um zum Glauben Platz zu bekommen«. Er wollte den Gottesbegriff aus der Umklammerung durch das an die Kategorien von Raum und Zeit gebundene Erfahrungswissen befreien, damit der Begriff Gottes als der alles umfassenden Wirklichkeit überhaupt wieder zur Geltung kommen konnte. Hinter diese Befreiung Gottes aus der Vorherrschaft des Erfahrungswissens fällt man wieder zurück, wenn man die Notwendigkeit des Gottesbegriffs auf der Ebene des Erfahrungswissens festzuhalten oder zu beweisen versucht. Ein solcher Versuch führt unweigerlich zu Inkonsequenzen.
Von solchen Inkonsequenzen sind, wie Kant im Einzelnen nachgewiesen hat, alle Arten von Gottesbeweisen, ganz besonders aber der kosmologische Gottesbeweis geprägt. Er legt das Kausalprinzip zu Grunde und schließt aus der Existenz dessen, was ist, auf eine erste Wirkursache, der sich alles verdankt. Warum diese erste Wirkursache Gott genannt werden soll, lässt sich durch eine solche kausale Erklärung jedoch nicht begründen. Der Wissenschaft lässt sich nicht verbieten, dass sie die Ursache für die Entstehung der Welt in anderen als in theologischen Kategorien erklärt. Der Glaube an Gott aber muss so gefasst werden, dass er an solchen Erklärungen nicht zerschellt. Deshalb kann er sich nicht auf einen kosmologischen Gottesbeweis stützen.
Die Theorie des »Intelligent Design« ist nichts anderes als eine neue Spielart dieses kosmologischen Gottesbeweises. Die Inkonsequenzen, die mit dieser neuen Spielart verbunden sind, zeigen sich beispielhaft daran, dass man zwar den Übergang zum kopernikanischen Weltmodell akzeptiert, aber die Zustimmung zur Darwinschen Evolutionstheorie verweigert. Denn niemand wagt es heute noch, ein geozentrisches Weltbild aus Gründen des Glaubens für verpflichtend zu erklären. Vielmehr wird das heliozentrische Weltbild auch von denen akzeptiert, die ansonsten den Buchstaben der Bibel mit einer wissenschaftlichen Welterklärung verwechseln. Doch die Evolutionstheorie soll aus Gründen tabuisiert werden, die nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern durch weltanschauliche Vorgaben bestimmt sind. Das ist inkonsequent; es kann deshalb für ein christliches Verständnis der Schöpfung nicht leitend sein.
Neuer Atheismus. Es kann nicht verwundern, dass dem ideologischen Missbrauch des christlichen Schöpfungsglaubens, wie er im Kreationismus und in der Lehre vom »Intelligent Design« vorliegt, spiegelbildlich ein Missbrauch entspricht, der meint, aus den Einsichten der modernen Naturwissenschaften zwingend eine Leugnung Gottes und die Verpflichtung auf einen kämpferischen Atheismus ableiten zu können. Beispielhaft ist dafür der Evolutionsbiologe Richard Dawkins, der sich mit seinem Buch »Der Gotteswahn« (»The God Delusion«) an die Spitze dieser Bewegung gesetzt hat. Im Vorwort erklärt der Autor seine Absicht, mit diesem Buch zum Atheismus zu bekehren; das wissenschaftliche Material, das er entfaltet, steht also von vornherein in einem weltanschaulichen Zusammenhang, der die Grenzen der Wissenschaft überschreitet. In gewisser Weise arbeitet ein solches Vorgehen den Kreationisten in die Hände; denn sie wollen gerade beweisen, dass die Evolutionstheorie über die Grenzen der Wissenschaft hinausgeht und selbst den Charakter einer weltanschaulichen Ideologie trägt. Dawkins fügt damit, wie ein Kritiker bemerkt hat, selbst der Evolutionstheorie und dem Vorhaben, sie zu unterrichten, den denkbar schwersten Schaden zu.
Aber sein Vorhaben passt sich in eine Entwicklung ein, in der religiöser Fundamentalismus und kämpferischer Atheismus sich wechselseitig hochschaukeln. Der kämpferische Atheismus sammelt sich seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts unter dem Namen »The Brights« (»Die Aufgeweckten«). Der »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«, als den Immanuel Kant die Aufklärung bezeichnet hat, muss nach der Auffassung dieser »Aufgeweckten« notwendigerweise eine Absage an den Glauben an Gott einschließen. Ein Weltbild wird restauriert, nach welchem die Religion einem vorwissenschaftlichen Zeitalter angehört und mit dem Siegeszug des wissenschaftlichen Bewusstseins zum Verschwinden kommt. Weil sich dieses Verschwinden nicht von selbst einstellt, muss es durch einen weltanschaulichen Kampf vorangetrieben werden; für diesen Kampf sucht man die Unterstützung prominenter Wissenschaftler.
Doch diese überschreiten damit die Grenzen der Wissenschaft. Sie werden dadurch zu dem, was sie verachten: zu Vertretern eines Glaubens, ja zu dessen Priestern und Propheten. Doch auch das ist inkonsequent; es sollte deshalb für den Umgang mit den Einsichten der modernen Naturwissenschaft nicht leitend sein.
Wenn derartige Kontroversen hinter uns liegen, konzentrieren die Schwierigkeiten mit dem biblischen Schöpfungsgedanken sich auf zwei Fragen. Es geht zum einen um die Vorstellung von einer Schöpfung, die innerhalb von sechs Tagen vollendet war; und es geht zum anderen um den Gedanken einer eigenständigen Erschaffung des Menschen.
Zunächst also das Sechstagewerk. Die erste Schwierigkeit bezieht sich auf die Vorstellung von einer Schöpfung, die innerhalb von sechs Tagen vollendet war. Deren Sinn wurde bereits an früherer Stelle erläutert. Hier ist ein weiterer Gesichtspunkt hinzuzufügen.
Die Darstellung des Schöpferwerks Gottes in sechs Tagen soll deutlich machen, dass Gott mit der Welt auch die Zeit geschaffen hat. Deshalb schildert die erste Schöpfungserzählung das Schöpfungswerk in der Zeitstruktur des Tages – mit der Unterscheidung von Tag und Nacht – sowie in der Zeitstruktur der Woche, in der auf sechs Arbeitstage als siebter Tag der Sabbat, der Tag der Arbeitsruhe, folgt. Damit wird anschaulich gemacht, was der Kirchenvater Augustin abstrakter ausgedrückt hat: Die Welt wird nicht in der Zeit (in tempore), sondern mit der Zeit (cum tempore) geschaffen. Insofern braucht man auch nicht danach zu fragen, welche Zeit der Erschaffung der Welt vorausgeht. Vielmehr ist es allein Gottes Ewigkeit, die jenseits der mit der Schöpfung geschaffenen Zeit liegt. Augustin sagt das in der Form einer Anrede an Gott: »Nein, du gehst den Zeiten nicht in der Zeit voraus; sonst gingest du nicht all und jeder Zeit voraus. Sondern du gehst allen Zeiten voraus, durch die zeitlose Erhabenheit stets gegenwärtiger Ewigkeit, und du stehst auch über allen Zukunftszeiten. «





























