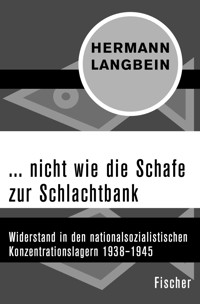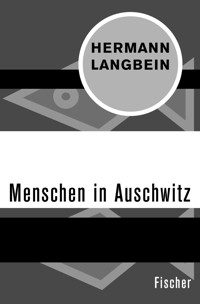
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nahezu emotionslos und darum mit um so eindrücklicherer Sachlichkeit dokumentiert Hermann Langbein mit den Aussagen von Opfern und Tätern den Alltag in Auschwitz. Bei seinen Protokollen hat er sich von dem Grundsatz leiten lassen, daß die Wahrheit über den Massenmord im zwanzigsten Jahrhundert genauso den Verzicht auf die Dämonisierung der Mörder wie auf die Apotheose der Opfer verlange. »Die Anklage gilt der unmenschlichen Situation, die das nationalsozialistische System bewirkt.« (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1138
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hermann Langbein
Menschen in Auschwitz
FISCHER Digital
Inhalt
Ich fühle mich gegenüber den Ungezählten, die selbst in Auschwitz den Kampf gegen die Unmenschlichkeit aufgenommen und dabei ihr Leben verloren haben, verpflichtet, diese Studie zu schreiben; besonders meinen Freunden Ernstl Burger und Zbyszek Raynoch gegenüber.
Die »New-Land Foundation« (New York) ermöglichte diese Arbeit.
Einführung
Rechtfertigung des Autors
»Was Auschwitz war, wissen nur die Häftlinge. Niemand sonst«, schrieb Martin Walser unter dem Eindruck des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. »Weil wir uns also nicht hineindenken können in die Lage der Häftlinge, weil das Maß ihres Leidens über jeden bisherigen Begriff geht und weil wir uns deshalb auch von den unmittelbaren Tätern kein menschliches Bild machen können, deshalb heißt Auschwitz eine Hölle und die Täter sind Teufel. So könnte man sich erklären, warum immer, wenn von Auschwitz die Rede ist, solche aus unserer Welt hinausweisende Wörter gebraucht werden.« Walser schließt diese Betrachtung knapp: »Nun war aber Auschwitz nicht die Hölle, sondern ein deutsches Konzentrationslager.«
Auschwitz wurde vom Apparat eines Staates mit alten kulturellen Traditionen in der Mitte des 20. Jahrhunderts geschaffen – es war eine Realität.
In diesem Lager waren die Menschen extremen Verhältnissen ausgesetzt. Wie sie darauf reagierten, sowohl die Gefangenen als auch deren Bewacher, soll hier dargestellt werden. Denn die Menschen, die außerhalb des Stacheldrahtes in Auschwitz lebten, waren ebenfalls in eine extreme Situation gestellt worden, wenn auch in eine ganz andere als jene, in welche die Häftlinge gezwungen wurden.
»So genau, wie die Geschehnisse selbst verliefen, kann sie kein Mensch sich vorstellen … das alles wird nur einer von uns … aus unserer kleinen Gruppe, aus unserem engen Kreis übermitteln können, wenn jemand zufällig überleben sollte …« Der polnische Jude Zelman Lewental, der zur Arbeit in den Gaskammern von Auschwitz gezwungen wurde, hat diese Worte geschrieben. Ihn hat der Gedanke gequält, der Nachwelt könnte unbekannt bleiben, was er erleben mußte. Da er keine Hoffnung hatte, Auschwitz zu überleben, vergrub er seine Aufzeichnungen neben einem der Krematorien. Sie wurden im Jahr 1961 ausgegraben. Nur Satzfetzen können noch entziffert werden.
Viele Gefangene wurden von der gleichen Sorge wie Lewental gepeinigt, die Welt werde nie erfahren, was in Auschwitz verbrochen worden ist; und wenn Kunde davon zu ihr dringen sollte, werde diese nicht geglaubt werden, so unwahrscheinlich mußte die Schilderung der Geschehnisse auf Außenstehende wirken. Manches Gespräch darüber ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Freunde, die derlei befürchtet hatten, fanden in Auschwitz ihr Ende; ich habe das Lager überlebt. Und trage an der Verpflichtung, die seither auf mir lastet. Denn man soll aus Auschwitz Lehren ziehen – darauf immer wieder zu drängen, empfinden wir als unsere Aufgabe.
Viele haben darum ihre Erlebnisse niedergeschrieben. Viktor Frankl forderte bereits bald nach seiner Befreiung: »So einfach dürfen wir es uns nicht machen, daß wir die einen für Engel und die anderen für Teufel erklären.« Diese Forderung hat noch mehr Gewicht bekommen, nachdem ein Vierteljahrhundert verstrichen ist. Trotzdem bin ich mir der Grenzen bewußt, welche der Bemühung eines Überlebenden gesetzt sind, die Menschen in Auschwitz und deren Probleme objektiv darzustellen.
Jeder von uns trägt seine sehr persönlich gefärbte Erinnerung mit sich, jeder hat »sein« Auschwitz erlebt. Die Perspektive des ewig Hungrigen unterschied sich stark von der eines Funktionshäftlings; das Auschwitz des Jahres 1942 war ein wesentlich anderes als das des Jahres 1944. Jedes einzelne Lager des großen Komplexes war eine Welt für sich. Darum wird mancher Überlebende von Auschwitz bei einzelnen Schilderungen einwenden können: So habe ich das nicht empfunden – das ist mir völlig neu. Da ich auch über heikle Fragen nicht hinweggegangen bin, könnte Kritik von seiten derer laut werden, die meinen, man sollte diese Themen besser nicht publik machen. Weil ich mir zu einzelnen Problemen, die in der Fachliteratur diskutiert werden, keine Theorie zurechtgelegt und aus dem reichen Material nicht Beispiele ausgewählt habe, um diese oder jene Theorie zu bestätigen, könnten Engagierte die Darstellung mit Mißbehagen aufnehmen.
Habe ich daher meinen Entschluß zu rechtfertigen, mich trotz all dieser möglichen Einwände und meiner subjektiven Einstellung, die ich nicht unterdrücken konnte und wollte, um eine zusammenfassende Darstellung zu bemühen? Vielleicht können ihn folgende Umstände rechtfertigen:
So wie alle österreichischen Gefangenen galt ich im KZ als Deutscher. Diese waren in Auschwitz noch mehr als in anderen Lagern privilegiert, weil dort der Prozentsatz der Deutschen geringer war als in Dachau, Buchenwald oder anderen in Deutschland errichteten Lagern. Ich wurde daher vom täglichen Kampf um das Elementarste nicht erdrückt. Als Schreiber des SS-Standortarztes hatte ich keine schwere körperliche Arbeit, stets ein Dach über dem Kopf, keinen Hunger, konnte mich waschen und sauber kleiden. Wir Österreicher unterschieden uns von vielen gleichermaßen privilegierten deutschen politischen Häftlingen, die zwar den Nationalsozialismus von Herzen haßten, aber Siege der Hitlerarmeen nicht selten begrüßt oder zumindest mit zwiespältigen Gefühlen verfolgt haben, während sich die politisch verfolgten Österreicher auch als national Unterdrückte fühlten. Nur in der Niederlage der deutschen Armeen sahen wir unsere Zukunft. Unser Blick wurde nicht durch die Hemmung derjenigen eingeengt, die sich sagten: Das hier geschieht im Namen meines Volkes, eine Zerschlagung des Nationalsozialismus wird ihm unvorstellbares Elend bringen und es der Rache der jetzt Gepeinigten ausliefern. Darum übten die Privilegien, welche die Lagerführung deutschen Häftlingen mit Bedacht einräumte, eine geringere korrumpierende Wirkung auf Österreicher mit politischem Bewußtsein aus. Kraft meiner Funktion konnte ich hinter die Kulissen sehen. Ich hatte jedoch nie der Lagerführung gegenüber Verantwortung für Mithäftlinge zu tragen wie jeder Capo oder Blockälteste. Die Probleme, die mit der Position eines Häftlingsfunktionärs verbunden waren, kann ich daher ohne persönliches Engagement analysieren.
Gehörte ich zur Oberschicht der Lagerprominenz, so hatte ich doch stets zu fürchten, die Lagerleitung könnte erfahren, daß ich nach nationalsozialistischer Regelung kein »Arier«, sondern »Mischling« war. Solange »Mischlinge« wie Juden behandelt wurden, mußte ich daher damit rechnen, die lange Stufenleiter vom privilegierten Deutschen bis zu dem auf der untersten Stufe befindlichen Juden hinuntergestürzt zu werden. Dadurch war ich gegen das herablassende Mitleid des Selbstsicheren gegenüber dieser Unterschicht gefeit, in das sich so leicht Verachtung mischen konnte.
Ich wurde als Spanienkämpfer und Kommunist interniert und kenne daher aus eigenem Erleben auch diejenigen Probleme, die sich für Mitglieder dieser Partei zusätzlich ergeben haben. Da ich mich später von ihr trennte, gewann ich Freiheit und Distanz, die mir gestatten, auch zu Fragen Stellung zu nehmen, welche das Verhalten der Kommunisten in den Konzentrationslagern betreffen und auf die in der Fachliteratur unterschiedliche Antworten gegeben werden, je nach dem politischen Engagement der Autoren.
Ich gehörte der Leitung der internationalen Widerstandsbewegung in Auschwitz an. Die Aufgaben, die wir uns stellten, verlangten von uns, sich mit vielen Problemen des Lagerlebens auseinanderzusetzen und über unsere Person und den Tag hinauszudenken. Infolge meiner Arbeit als Sekretär eines SS-Führers bestand meine spezielle Aufgabe darin, die SS-Angehörigen so genau wie nur möglich zu beobachten und unter ihnen zu differenzieren, damit Gegensätze ausgenützt und Möglichkeiten der Einflußnahme eröffnet werden könnten.
Ich war zwar nur zwei Jahre in Auschwitz interniert, aber gerade in der ereignisreichsten Zeitspanne – vom August 1942 bis zum August 1944. Schließlich wurde ich neun Wochen im Bunker von Auschwitz festgehalten und lernte dort die extremste Situation des Gefangenen kennen – sieht man von denjenigen ab, die dem Sonderkommando zugeteilt waren.
All das zusammen hat mir dennoch nicht von Anfang an den Mut gegeben, eine Darstellung der menschlichen Probleme in Angriff zu nehmen. Lange trug ich mich mit dem Gedanken – das erste Exposé zu diesem Buch trägt das Datum vom 30. Januar 1962. Doch immer wieder zögerte ich. Meine Zweifel daran, ob ich schon die erforderliche Distanz zu meinen Erlebnissen erreicht hatte, um sie sachlich darstellen zu können, wurden endlich während des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt überwunden.
Unmittelbar nach seiner Verhaftung wurde mir dort im Herbst 1960 der SS-Sanitäter Josef Klehr gegenübergestellt, dessen Untaten ich genau kannte. Damals sind schmerzhaft alle Erinnerungen wach geworden. Lang verfolgten mich die Eindrücke, die durch diese Begegnung ausgelöst wurden. Als der große Frankfurter Auschwitz-Prozeß, in dem auch Klehr angeklagt war und den ich beobachtet habe, fünf Jahre später zu Ende gegangen war, sah ich in Klehr, dessen Verhalten ich besonders aufmerksam registriert hatte, nicht mehr einen Allmächtigen, den Schrecken des Krankenbaus, sondern einen gealterten, überaus primitiven Verbrecher, der sich ungeschickt verteidigte. Als mir dieser Wandel bewußt wurde, traute ich mich an die Arbeit. Im Februar 1966 begann ich mit Quellenstudium.
Die Auschwitz-Literatur ist umfangreich. »Das Bedürfnis, den ›anderen‹ zu berichten, die ›anderen‹ teilnehmen zu lassen, war in uns zu einem so unmittelbaren und drängenden Impuls angewachsen, daß es den übrigen elementaren Bedürfnissen den Rang streitig machte. Und aus diesem Bedürfnis wurde das Buch geschrieben, also hauptsächlich der inneren Befreiung wegen« – mit diesen Worten leitet Primo Levi seinen Bericht über seine Auschwitzer Erlebnisse ein. Mit Recht gebraucht er dabei die Mehrzahl; denn viele Überlebende von Auschwitz haben aus demselben Drang zur Feder gegriffen.
Daß diese Berichte in der Regel sehr subjektiv verfaßt wurden, bildet ihren Wert. So unterschiedlich das Leben die Verfasser vor ihrer Deportation geformt hatte, so verschiedenartig ihre Erlebnisse im Lager waren, ihre Fähigkeit und Möglichkeit zur Beobachtung, ihre Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, so unterschiedlich ihre Ausdruckskraft ist – so sehr unterscheiden sich die Berichte voneinander, jeder einzelne ein Mosaikstein für das Gesamtbild, das niemand aus eigener Sicht übermitteln kann.
Nur ganz wenige Überlebende der Konzentrationslager verfügten über die Voraussetzungen, um sofort nach der Befreiung nicht bloß ihre Erlebnisse darzustellen, sondern das System der Konzentrationslager des Nationalsozialismus. Eugen Kogon, Benedikt Kautsky und David Rousset hatten dazu Kraft. Irrtümer in Einzelheiten, die damals unvermeidlich waren, mindern nicht im geringsten die Bedeutung ihrer Pioniertat.
Eine kritische Würdigung der verschiedenen Erlebnisberichte ist nur möglich, wenn man sie mit inzwischen dokumentarisch belegten Tatsachen vergleicht; ein Vergleich mit dem eigenen Erleben wäre zu subjektiv.
Beschreiben Autoren Vorgänge, die sie nicht selbst beobachtet haben, dann sind Irrtümer verständlich; denn Gerüchte schmückten im Lager Ereignisse, die aus dem Alltag hervorstachen, mit Vorliebe aus. Kaum ein Autor konnte ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, als er seinen Bericht – nur auf das eigene Gedächtnis gestützt – verfaßte.
Wenn Autoren Irrtümer bei der Beschreibung von Fakten unterlaufen, die sie selbst erlebt haben, dann hat das dem kritischen Leser als Warnung zu dienen. Henry Bulawko will bei seiner Ankunft auf dem Bahnhof die Aufschrift »Oświecim« gelesen haben. Da die Stadt Oswiecim jedoch zu Oberschlesien geschlagen worden war, stand auf dem Bahnhof nur der inzwischen so schrecklich bekannt gewordene verdeutschte Name dieser Stadt: Auschwitz. Miklos Nyiszli gibt genaue Zahlen und die Dienstgrade der bei dem Aufstand des Sonderkommandos, dem er damals angehörte, am 7. Oktober 1944 getöteten SS-Männer an: ein Obersturmführer, 17 Oberschar- und Scharführer und 52 Sturmmänner. Den Dokumenten, die erhalten geblieben sind, zufolge sind damals drei SS-Männer – alle Unterscharführer – getötet worden. Zwölf sollen verwundet worden sein. Bernhard Kliegers Beschreibung des sexuellen Problems steht im Gegensatz zu allen anderen Berichten. Er spricht von tierischem sexuellem Heißhunger, dessen Folgen er so ausmalt: »Männlein und Weiblein taten es fast den Hunden gleich. Wo und wann immer sich eine Gelegenheit bot, stürzten sie sich einander in die Arme.« Diese kraß verallgemeinernde Darstellung ist so zutreffend, wie es die wäre, jeder hätte nach langer Internierung bei der Evakuierung von Auschwitz das Gewicht Kliegers gehabt: 85 Kilo.
Daß am ehesten in der Darstellung des zeitlichen Ablaufes der Ereignisse Irrtümer unterlaufen, ist sehr verständlich. Auch wenn ehemalige Häftlinge bei Prozessen ihre Erlebnisse schildern müssen, sind sie in der Regel bei der Angabe von Daten am unsichersten; denn dafür gab es im Alltag des Lagerlebens zu wenig Anhaltspunkte. Elie Wiesels Feststellung, er hätte das Zeitgefühl vollständig verloren, darf verallgemeinert werden. Wiesel irrt sich bereits bei dem Datum seiner Deportation: Er glaubt sich zu erinnern, er wäre im April nach Auschwitz eingeliefert worden. An seiner Häftlingsnummer ist abzulesen, daß er dort am 24. Mai angekommen war.
Fanatische parteipolitische Fixierung kann einen Autor zu einseitigen Darstellungen verleiten. Oszkár Betlen gibt seine parteiliche Einstellung zu erkennen, wenn er schreibt: »Von den sechs Schreibern des Häftlingsbüros waren nur Walser und ich Kommunisten, doch auch die anderen vier waren anständige Menschen …« Trotz dieser so sichtbar demonstrierten Einseitigkeit kann jedoch Betlen manches Allgemeingültige sagen. Das betrifft alle Erlebnisberichte, die Irrtümer und Verzeichnungen aufweisen. Wahrscheinlich kann ein kritischer Leser, der Auschwitz selbst erlebt hat, eher als ein Außenstehender beurteilen, was Gültigkeit hat und was nicht akzeptiert oder verallgemeinert werden darf.
Methoden, wie sie Bruno Baum angewendet hat, müssen freilich jeden mißtrauisch machen. Sein Büchlein über den Widerstand in Auschwitz ist in der DDR in drei Auflagen erschienen; in den Jahren 1949, 1957 und 1961. Personen, die in der ersten Ausgabe als Widerstandshelden gefeiert wurden, bleiben später ungenannt, weil sie inzwischen mit der kommunistischen Partei gebrochen haben, andere sind hingegen erst in der dritten Auflage als Leiter der Widerstandsbewegung entdeckt worden, offenbar, weil sie sich zu dieser Zeit der Gunst der kommunistischen Parteiführung erfreuten.
Wenn ich auf meine Erlebnisse Bezug nehme, so ziehe ich in der Regel meinen Bericht »Die Stärkeren« heran, den ich im Winter 1947/48 geschrieben habe, als ich zwar bereits eine gewisse Distanz zu den Ereignissen, aber noch ein frisches Gedächtnis hatte. Es wäre mir unmöglich, Jahrzehnte später Gespräche und Vorkommnisse mit anderen Worten treffender zu rekonstruieren, als ich es damals tat. Diesen Bericht habe ich als gläubiger Kommunist geschrieben und daher manches verschwiegen, was für Kommunisten nicht angenehm zu lesen wäre. Probleme diesen Charakters berichte ich nun in Ergänzung. Die Ansicht Betlens, der Menschen in Kommunisten einteilt und in andere, die »auch anständig« sein können, teilte ich allerdings schon in Auschwitz nicht.
Begreiflicherweise verspürten SS-Angehörige nicht denselben Drang wie die überlebenden Gefangenen, ihre Erinnerungen an Auschwitz zu Papier zu bringen. Trotzdem existieren einzelne Darstellungen von historischem Wert: In erster Linie die Aufzeichnungen des Kommandanten Höß, die dieser im Krakauer Gefängnis niedergeschrieben hat und in denen er zwar sein Verhalten wiederholt beschönigt, davon abgesehen jedoch ein beklemmend genaues Bild von der Organisation des Vernichtungslagers und gleichzeitig ungewollt ein eindringliches Selbstporträt entwirft; ferner der Bericht von Pery Broad, der in englischer Kriegsgefangenschaft schriftlich fixiert hat, was er als Angehöriger der Politischen Abteilung erfahren hatte. Wenn er auch seine eigenen Handlungen mit Stillschweigen übergeht, erweist er sich als scharfer Beobachter. Von dokumentarischem Wert sind auch die knappen Tagebuch-Eintragungen des Universitätsprofessors und SS-Arztes Johann Kremer, die den Vorzug haben, nicht erst nachträglich in Haft, sondern an Ort und Stelle geschrieben worden zu sein.
Penetrante Beschönigungsversuche mindern den Wert der Niederschriften, welche der Rapportführer Wilhelm Claussen und der Leiter der Politischen Abteilung, Maximilian Grabner, in der Haft verfaßt haben. Grabners Bericht wird zusätzlich auch dadurch entwertet, daß er SS-Angehörigen nachträglich eins auswischen will, die zu ihm in Auschwitz in Konflikt geraten waren und ihn vor dem SS-Gericht, vor das er gestellt worden war, belastet hatten. In dem Absatz, in dem sich Grabner mit mir befaßt, kann ich seine falsche Darstellung nachweisen.
Je größer die zeitliche Distanz wurde und je mehr Quellen bekannt wurden, desto häufiger befaßten sich Autoren, die Auschwitz selbst nicht kennengelernt hatten, mit Themen, die mit diesem Lager in Verbindung stehen. Die erste Darstellung dieser Art ist die des polnischen Untersuchungsrichters Jan Sehn, der die großen polnischen Auschwitz-Verfahren vorbereitet hat. Selbst seine sachlich-nüchterne Skizze konnte sich trotz großer Gewissenhaftigkeit des Autors von Irrtümern nicht ganz freihalten; so schreibt Sehn, Anfang 1942 sei allen Häftlingen mit Ausnahme der Deutschen ihre Nummer in den linken Unterarm eintätowiert worden. Tatsächlich wurde der Befehl dazu am 22. Februar 1943 erteilt. Die Ausführung nahm geraume Zeit in Anspruch, so daß zum Beispiel Häftlinge, die am 13. März desselben Jahres von Auschwitz nach Sachsenhausen überstellt worden waren, noch keine tätowierten Nummern trugen.
Als erste zusammenfassende Darstellung der nationalsozialistischen Judenvernichtung erlangte das im Jahr 1953 erschienene Buch »Die Endlösung« von Gerald Reitlinger den Ruf eines Standardwerkes. Deshalb wurden darin enthaltene Fehler von anderen Autoren unkritisch übernommen, häufig ohne Hinweis auf die Quelle. Auf einzelne kleine Irrtümer sei hier hingewiesen: Reitlinger schreibt von »zwei aus Polen stammenden Ärzten Entress und Zinkteller«. Tatsächlich stammen beide aus Polen, Entress war jedoch als Volksdeutscher in der Uniform eines SS-Arztes in Auschwitz, Zenkteller (nicht Zinkteller) als polnischer Häftlingsarzt. Reitlingers zusammenfassende Erwähnung kann irreführen.
An anderer Stelle schreibt Reitlinger, der Kommandant Liebehenschel hätte Auschwitz bis zum Februar 1944 geleitet. Tatsächlich war er bis zum 9. Mai desselben Jahres Kommandant von Auschwitz. Ferner schreibt Reitlinger, der SS-Lagerarzt »Kremer und seinesgleichen, in der Befürchtung, einmal zur Rechenschaft gezogen zu werden, setzten in die Totenscheine Phantasie-Diagnosen« ein. Ich mußte als Häftling sowohl Kremer als auch Kollegen von ihm Stöße von Totenmeldungen zur Unterschrift vorlegen. Weder Kremer noch ein anderer SS-Arzt hat dabei jemals eine Diagnose eingesetzt, das mußten die Häftlingsschreiber bereits vorher tun. In den meisten Fällen handelte es sich tatsächlich um Phantasie-Diagnosen, doch die unterschreibenden SS-Ärzte lasen diese kaum, sie stöhnten nur über die vielen Unterschriften, die ihnen abverlangt wurden. Kremer war im Herbst 1942 in Auschwitz. Daß vor der deutschen Niederlage bei Stalingrad irgendein SS-Angehöriger Angst davor hatte, wegen seiner Tätigkeit in Auschwitz jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden, haben weder ich noch jemand anderer, der damals mit SS-Ärzten zu tun hatte, bemerkt.
Weiß man von diesen unbedeutenden Irrtümern Reitlingers, dann wird man auch dem von ihm publizierten Zahlenmaterial kritischer gegenüberstehen, das von vielen Autoren übernommen wurde und zur allgemeinen Verwirrung bezüglich der Zahl der in Auschwitz Getöteten beigetragen hat.
Der Historiker Joachim C. Fest stützt sich bei einer Charakteristik von Höß offenbar nur auf dessen Autobiographie, ohne andere Quellen zu berücksichtigen, und nennt infolgedessen »ein ausgeprägtes Moralverlangen« ein hervorragendes Charaktermerkmal des Kommandanten von Auschwitz. Obwohl sich Höß selbst als sorgenden Familienvater zeichnet, ist er in Auschwitz ein Verhältnis mit einer Gefangenen eingegangen, die er im Stehbunker verhungern lassen wollte, als diese Beziehung ruchbar wurde. So wenig das mit »ausgeprägtem Moralverlangen« vereinbar ist, so wenig kann man Höß Uneigennützigkeit zusprechen, was Fest ebenfalls tut. Er hat sich Güter aus dem Besitz der Deportierten in so großem Maßstab angeeignet, daß zwei Eisenbahnwaggons benötigt wurden, als Höß mit seiner Familie Auschwitz verließ.
Kurt R. Grossmann zitiert in seinem Buch »Die unbesungenen Helden« eine reichlich ausgeschmückte Schilderung von Heinz Kraschutzki über den SS-Arzt Dr. Moench, der der SS nur beigetreten sei, um seine jüdische Frau zu retten. Als er sich vor einem Krakauer Gericht zu verantworten hatte, soll der ganze Saal aufgeschrien haben: »Laßt ihn frei!« Die Frau von Dr. Münch (so lautet der Name richtig) ist keine Jüdin. Er war der SS beigetreten, weil er sich dort bessere Wirkungsmöglichkeiten als Hygieniker erhofft hat. Im Krakauer Prozeß wurde er zwar als einziger freigesprochen, weil Häftlinge zu seinen Gunsten ausgesagt hatten. Von einem dramatischen Aufschrei aller konnte jedoch sonst niemand berichten.
Auch Christine Klusacek übernimmt in ihrem Büchlein »Österreichische Wissenschaftler und Künstler unter dem NS-Regime« eine Legende. Sie schreibt, die bekannte Künstlerin und Dirigentin des Frauenorchesters in Birkenau, Alma Rosé, sei freiwillig auf einen Lastwagen gesprungen, der Selektierte zur Gaskammer zu führen hatte, als man von ihr verlangt hat, während des Abtransportes der Selektierten aufzuspielen. »Sie spielt das große Lied der Freiheit, die Marseillaise« auf dem fahrenden Lastauto – so schließt Klusacek ihre Schilderung ab. Rosé ist in Auschwitz gestorben, aber nicht so melodramatisch.
Über Publikationen wie die von Paul Rassinier ist kein Wort zu verlieren; wer wie er in Zweifel zieht, daß es überhaupt in Auschwitz Gaskammern gegeben hat, und die Aufzeichnungen von Höß, in denen der Vergasungsvorgang genau beschrieben wird, durch die Behauptung zu entwerten sich bemüht, sie wären nur wie Hieroglyphen zu entziffern, stellt sich außerhalb jeder Kritik. Kein angeklagter SS-Angehöriger hat das Vorhandensein von Vergasungseinrichtungen in Auschwitz abzuleugnen versucht; die Schrift von Höß ist einwandfrei leserlich.
Leider war mir nicht die gesamte Fachliteratur zugänglich. Da sie an keiner Stelle auch nur annähernd vollständig gesammelt ist, mußte ich suchen und reisen. Berichte, die in mir nicht bekannten Sprachen verfaßt und nicht übersetzt sind, konnte ich nur in Einzelfällen übersetzen lassen. So mußten viele in polnischer Sprache abgefaßte Schilderungen unberücksichtigt bleiben. Dafür kam es meiner Arbeit zustatten, daß mir mehrere unveröffentlichte Manuskripte zur Verfügung gestellt wurden, ich meine kaum überblickbare Korrespondenz mit Überlebenden von Auschwitz heranziehen und eine Vielzahl von Gesprächen verwerten konnte. Schließlich habe ich während der Arbeit an diesem Buch fragmentarische Berichte von Personen überprüfen lassen, welche die dort dargestellten Episoden in Auschwitz kennengelernt hatten. Dabei kam mir zugute, daß sich bei Gesprächen auch mit solchen ehemaligen Häftlingen von Auschwitz, die ich im Lager nicht kennengelernt hatte, schnell eine Atmosphäre der Vertraulichkeit einstellte, während Außenstehende nicht selten über die Schwierigkeit klagen, ehemalige KZ-Häftlinge zu einer freimütigen Aussprache zu bewegen.
Während meiner Arbeit ließ ich mich von einem Grundsatz leiten, den Andrzej Wirth in seinem Nachwort zu den Auschwitz-Erzählungen von Tadeusz Borowski in folgende Worte gekleidet hat: »Die Wahrheit über den Massenmord im zwanzigsten Jahrhundert verlangt genauso den Verzicht auf die Dämonisierung der Mörder wie auf die Apotheose der Opfer. Die Anklage gilt der unmenschlichen Situation, die das faschistische System bewirkt.« Nur das Wort »faschistisch« würde ich durch den präziseren Ausdruck »nationalsozialistisch« ersetzen, denn es gab und gibt verschiedene faschistische Systeme, jedoch nur ein Auschwitz. Darin stimme ich Günter Grass zu, der sagte:
»Was vor Auschwitz sich ereignete, unterliegt anderen Kategorien, sofern es beurteilt wird; obgleich es den Vernichtungsmechanismus schon immer gegeben hat: erst die Perfektion ließ ihn zur Kategorie werden. Nicht die namentliche Grausamkeit einzelner Personen, sondern die anonyme Reibungslosigkeit fleißig zu nennender Schreibtischarbeit war das Neue und noch nicht Dagewesene in seiner menschlichen Blässe, die wir, uns distanzierend, unmenschlich nennen.«
Das Lager und sein Jargon
Um die Menschen in Auschwitz mit ihren Problemen beschreiben zu können, muß zuerst das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager skizziert und der Jargon, der sich dort gebildet hatte, erklärt werden; ferner Begriffe, die speziell für Auschwitz typisch waren und in die Sprache dieses Lagers eingegangen sind. Wem das bekannt ist, der möge dieses Kapitel überblättern.
Unmittelbar nachdem die Nationalsozialisten im Jahr 1933 zur Macht gekommen waren, haben sie die ersten Konzentrationslager errichtet. Im Lauf der Jahre entwickelten sie ein System der kontrollierten Häftlings-Selbstverwaltung, das nach ihrem »Führerprinzip« aufgebaut war. Jeder Wohneinheit – die Block genannt wurde – stand ein Blockältester vor, jeder Stube ein Stubenältester. Ein Lagerältester war der Vorgesetzte aller Blockältesten. Grundsätzlich hatten alle Gefangenen zu arbeiten. Sie wurden in Arbeitskommandos zusammengefaßt, die von Capos – bei großen Kommandos auch Ober- und Untercapos – geleitet wurden. Diese Bindenträger – wie sie genannt wurden, da ihre Funktion durch eine Armbinde mit entsprechender Aufschrift kenntlich gemacht war – waren selbst von Arbeit befreit. Ihnen ist weitgehende, häufig unumschränkte Vollmacht gegenüber den Unterstellten eingeräumt worden. Sie wurden aber zur Rechenschaft gezogen, wenn in ihrem Lager, auf ihrem Block oder in ihrem Kommando nach Ansicht der Lagerführung etwas nicht in Ordnung war.
Eine Episode, die durchaus nicht vereinzelt dastand, möge veranschaulichen, wie dieses System nach dem Willen der SS wirksam werden sollte. Als eines Tages der Lagerführer meinte, die allgemeine Disziplin hätte nachgelassen, ließ er nach dem Abendappell alle Capos vortreten und jedem fünf Stockschläge geben. »Sorgt nun dafür, daß künftig der Einmarsch der Kommandos besser klappt«, kommentierte der Lagerführer diese Strafe. Nicht wenige Capos gaben die Schläge an die ihnen Unterstellten weiter.
Die Capos hatten nicht nur dafür zu sorgen, daß möglichst »zackig« marschiert wurde – die Schikanen der preußischen Kaserne sind dabei bis zum Exzeß gesteigert worden; sie waren auch für das Arbeitspensum ihres Kommandos verantwortlich. Entsprach dieses Pensum nicht der Norm, dann mußten die Capos »über den Bock«, wie Willi Brachmann – ein deutscher Capo – bezeugt hat. »Das wurde befohlen, damit wir dafür sorgen, daß die Arbeit gut geht«, erklärte Brachmann diesen Brauch.
Richard Böck ist einer von den ganz wenigen aussagewilligen SS-Angehörigen. Als er nach Frankfurt als Zeuge geladen wurde, hat er sich schriftlich vorbereitet. In dem Manuskript steht unter anderem: »Wenn einer (bei der Strafarbeit) nicht mehr mitkam, dann hatten die Capos und Untercapos zu schlagen. Wenn dann noch ein Kommandoführer oder Blockführer dazukam, dann ging es abscheulich zu: ›Capo, komm mal her!‹ – Bums!! – ›Kannst du nicht besser schlagen?‹ Nun schlug der Capo, anscheinend um sein Leben. Wieder: ›Capo, komm mal her! Mach den fertig!‹ Meistens bekam der Capo ein paar ins Gesicht oder mit der Stiefelspitze, wenn er nicht genug schlug.«
Anderseits räumte die Lagerführung den Bindenträgern Privilegien ein, von denen ein einfacher Häftling nicht einmal zu träumen wagte. Unterkunft, Kleidung, Essen erhielten sie bevorzugt und konnten sich Rechte herausnehmen, die sie weit aus der grauen Masse heraushoben. Jede Beschwerdemöglichkeit eines Unterstellten gegen einen Capo oder Blockältesten war ausgeschlossen. Dieser konnte nach Belieben strafen, ja selbst töten. Meldete ein Häftlingsfunktionär einen »Abgang durch Tod«, dann wurde in der Regel gar nicht danach gefragt, woran der Häftling gestorben war. Die Nummer mußte stimmen, der Appell mußte in Ordnung sein, das war alles, was die Lagerführung an einer solchen Meldung interessierte.
Systematisch wurde auf diesem Weg eine Hierarchie unter den Gefangenen ausgebaut, die als verlängerter Arm der Lagerführung den Terror bis in den letzten Winkel des Lagers tragen und ihn auch dann wirken lassen sollte, wenn – wie zum Beispiel nachts – kein SS-Angehöriger im Lager war. Es gab ein einfaches Mittel, Bindenträger zu gefügigen Werkzeugen zu machen, wenn sie erst einmal im Dienst ihrer Herren schuldig geworden waren: Jederzeit konnte ein Capo oder Blockältester seine Binde verlieren und die Stufenleiter in der Hierarchie hinuntergestoßen werden. Sobald er aber mit der Binde den Schutz der Lagerführung verloren hatte, war er der Rache derer ausgeliefert, die er gepeinigt hatte. Es genügte häufig eine Drohung mit dem Entzug des Schutzes.
Vorzugsweise wurden deutsche Häftlinge zu Funktionen herangezogen. Jeder Gefangene hatte neben seiner Nummer ein Dreieck – Winkel genannt – zu tragen, welches die Haftart anzeigte. Bei Nichtdeutschen war der Anfangsbuchstabe ihrer Nationalität im Winkel aufgezeichnet: also ein »P« bei Polen, ein »F« bei Franzosen, ein »T« bei Tschechen und so fort. Die Farbe des Winkels zeigte den Haftgrund an. Politische Gefangene trugen einen roten Winkel; sie wurden daher allgemein »Rote« genannt. Kriminelle, die wegen ihrer Vorstrafen ins KZ eingewiesen worden waren und als »Berufsverbrecher« geführt wurden, sind nach der Farbe ihres Winkels »Grüne« genannt worden. Andere Winkelfarben, mit denen Asoziale (schwarz), Bibelforscher oder Homosexuelle gekennzeichnet wurden, haben in der Häftlingshierarchie von Auschwitz keine wesentliche Rolle gespielt, sieht man vom Frauenlager ab, wo Prostituierte mit schwarzem Winkel wichtige Funktionen bekleidet haben. Juden hatten unter ihrem Winkel, von dem das Land abzulesen war, aus dem sie deportiert worden waren, ein mit der Spitze nach oben weisendes Dreieck in gelber Farbe zu tragen. Die beiden Dreiecke ergaben zusammen die Form des sechszackigen Davidsterns.
Mit Bedacht wurden die Unterschiede der Gefangenen nicht nur äußerlich kenntlich gemacht; die Gegensätze zwischen den verschiedenen Gruppen wurden betont und verschärft. Der Kommandant Höß faßte die Gründe dafür so zusammen: »Keiner noch so starken Lagerführung wäre es sonst möglich, Tausende von Häftlingen im Zügel zu halten, zu lenken, wenn diese Gegensätze nicht dazu helfen würden. Je zahlreicher die Gegnerschaften und je heftiger die Machtkämpfe unter ihnen, um so leichter läßt sich das Lager führen.«
Auch der SS-Richter Dr. Morgen, der viele Konzentrationslager kennengelernt hatte, gab in amerikanischer Haft zu Protokoll, daß die Häftlingsselbstverwaltung so ausbalanciert wurde, daß eine ständige Rivalität zwischen Politischen und Kriminellen bestehen blieb.
Maximilian Grabner bescheinigte dem Rapportführer Oswald Kaduk, daß er es als Praktiker verstanden habe, »sich eine Gefolgschaft von kriminellen Häftlingen zu ziehen, die er bei einer jeden Gelegenheit gegen die politischen Häftlinge losließ«.
Je nachdem, ob politische oder kriminelle deutsche Häftlinge in den Schlüsselfunktionen den Ton angaben, spricht man von roten oder grünen Lagern. Von Höß, der über eine jahrelange Lagererfahrung verfügte, als er mit dem Aufbau von Auschwitz betraut wurde, ist der Ausspruch überliefert worden, zehn grüne Häftlingsfunktionäre wären im Sinn der Lagerführung besser als hundert SS-Männer.
Gruppen mit gleichartigem Winkel waren allerdings keineswegs homogen. Als politische Gefangene wurden nicht nur aktive Gegner des Nationalsozialismus in die Lager eingeliefert, sondern zum Beispiel auch Personen, die im Rausch politische Witze erzählt hatten oder bei einer Schwarzschlachtung ertappt worden waren. Ella Lingens berichtet von deutschen Frauen, die mit einem roten Winkel ins Lager eingewiesen worden waren, weil sie ein Verhältnis mit Polen eingegangen waren. Anderseits gab es vereinzelt auch Grüne, deren Delikte politischen Charakter hatten, zum Beispiel Urkundenfälschung, um Mitglieder einer Untergrundorganisation mit falschen Papieren auszustatten.
Ausdrücklich soll betont werden, daß keineswegs alle Grünen willige Werkzeuge der SS waren; ebensowenig, wie alle Roten ihre Funktion im Geist der Kameradschaft ausübten. Trotzdem waren von Grünen regierte Lager mit Recht gefürchtet. In einem roten Lager konnten die politischen Gefangenen eine Art moralische Aufsicht über die Bindenträger ausüben, was sich günstig ausgewirkt hat. In allen Konzentrationslagern wütete infolge des natürlichen Gegensatzes und der Taktik des Gegeneinander-Ausspielens der Lagerführung ein harter unterirdischer Machtkampf zwischen Rot und Grün.
Deutsche wurden bevorzugt zu Lagerfunktionen herangezogen, Juden konnten erst in der letzten Phase gewisse Funktionen erhalten, vor allem in Außenlagern, in denen fast nur Juden interniert waren. Von den »Ariern« (dieser unwissenschaftliche Ausdruck muß im folgenden gebraucht werden, um schwerfällige Umschreibungen abzukürzen) anderer Nationalität hatten die Polen in Auschwitz eine gewisse Vorzugsstellung errungen; nicht weil ihnen diese von der SS eingeräumt worden wäre, sondern weil anfangs Auschwitz fast nur mit Polen belegt war und daher Schlüsselpositionen in der Häftlingsverwaltung, für welche Deutsche wegen ihrer geringen Zahl oder mangelnden Intelligenz nicht herangezogen werden konnten, von Polen besetzt wurden. Diese nützten die Möglichkeiten konsequent aus, um Landsleuten zu besseren Positionen zu verhelfen. Auch sprachlich kam diese Vorzugsstellung zum Ausdruck. Häufig gingen polnische oder polonisierte Worte in die Lagersprache über; so wurde von vielen der Blockälteste »Blokowy« und der Stubenälteste »Stubowy« genannt, die Blockälteste »Blokowa«.
Waren die deutschen Kriminellen wegen ihrer Vorstrafen ins Lager gekommen, die Politischen wegen ihrer – zumindest angenommenen – Gegnerschaft zum Regime, die »Arier« anderer Nationalität wegen meist noch viel vager vermuteter Feindschaft zum Dritten Reich, so sind die Juden aus fast allen Ländern, die damals unter deutscher Herrschaft standen, ausschließlich wegen ihrer Abstammung deportiert worden. Daher gab es unter jüdischen Gefangenen noch größere Unterschiede als unter anderen Häftlingsgruppen. Nur Zigeunern bereitete der Nationalsozialismus das gleiche »totale« Schicksal wie den Juden.
Die Häftlinge sind nicht bloß durch ihren Winkel voneinander unterschieden worden. Jeder Häftling hatte auch eine Nummer an seine Kleidung angenäht zu tragen. Zum Unterschied von manchen anderen Lagern wurde in Auschwitz keine Nummer nach dem Tod oder der Überstellung eines Häftlings nochmals ausgegeben, so daß man von jeder Nummer ablesen kann, wann der Träger nach Auschwitz gekommen ist. In allen Lagern bildete sich eine Art Aristokratie der niedrigen Nummern heraus. Mit einer gewissen Verachtung blickte man in Auschwitz auf die »Millionäre« herab, wie diejenigen mit einer sechsstelligen Nummer genannt wurden. Einen Unterschied gab es jedoch gegenüber anderen Lagern: Ich war 15 Monate in Dachau interniert. Als ich von dort nach Auschwitz überstellt wurde, galt ich auf Grund meiner Nummer noch immer als »Neuer«. In Auschwitz zählte man mich bereits nach wenigen Monaten zu den »Alten«; um so viel stärker war in einem Vernichtungslager die Fluktuation.
Frauen erhielten in Auschwitz Nummern einer eigenen Serie, mit 1 beginnend. Als ein Zigeunerlager eingerichtet wurde, erhielten die Zigeuner ebenfalls eigene Nummernserien, je eine für Männer und Frauen, mit einem »Z« vor der Ziffer. Am 13. Mai 1944 ordnete die Lagerführung an, daß jüdische Neuzugänge Nummern einer neuen Serie erhielten, denen ein »A« vorgesetzt wurde. Später wurde eine weitere Serie mit einem »B« begonnen.
Im Lager kannten die Gefangenen einander mit den Vornamen. Die polnischen Vornamen wurden stets in ihrer Kurzform genannt, also Staszek statt Stanislaw, Tadek statt Tadeusz, Józek wurde ein Józef gerufen, Mietek ein Mieczyslaw. Diese Form wurde auch im folgenden Text beibehalten, übrigens auch bei einigen deutschen Vornamen. Da Rudolf Friemel allgemein als Rudi bekannt war, wird er hier ebenfalls so bezeichnet.
Je größer die Lager wurden – und Auschwitz war bald, nachdem es zum Vernichtungslager ausgebaut worden war, zum größten KZ angewachsen –, desto komplizierter wurde der Verwaltungsapparat. Die Wachmannschaft war weder zahlenmäßig noch ihrer intellektuellen Qualität nach imstande, diesen Apparat reibungslos zu bedienen. Unter den Gefangenen gab es genügend Menschen, welche auch eine komplizierte Verwaltungsarbeit meistern konnten. Aus ihren Reihen wurden die Schreibstuben und andere Verwaltungszentren besetzt. Das Wichtigste für die Lagerführung war der tägliche Appell. Er mußte stimmen, trotz aller Zugänge und Überstellungen, Verlegungen in und Entlassungen aus dem Krankenbau, Todesfälle, Kommandierungen zu Arbeiten außerhalb des Lagerbereichs und dergleichen. Die Häftlinge, die als Rapportschreiber und in ähnlichen Funktionen eingesetzt waren, hatten Interesse daran, den Verwaltungsapparat weiter zu komplizieren, um sich unentbehrlich zu machen. Dabei kam ihnen der bei der SS stark entwickelte Hang zur Überbürokratisierung entgegen.
Jeder einzelne aus diesem Apparat konnte jederzeit willkürlich ausgewechselt werden, wenn er seinen Vorgesetzten mißfiel. Auf den gesamten Apparat der Lager-Selbstverwaltung war die Lagerführung jedoch angewiesen, ihn konnte sie nicht entfernen, wenn der Lagerbetrieb nicht zusammenbrechen sollte. Waren die in dieser Organisation tätigen Gefangenen imstande, trotz aller Bestrebungen der SS zusammenzuhalten, so stellten sie daher eine gewisse Kraft dar.
Die Bindenträger und diejenigen, die Schlüsselpositionen in der Verwaltung und in wichtigen Kommandos bekleideten, wurden zur Lagerprominenz gezählt. Die Lebensbedingungen dieser Prominenz unterschieden sich sehr stark von denen der grauen Masse, in Auschwitz noch weit mehr als in gewöhnlichen Lagern.
Die Masse wurde durch ein System barbarischer Strafen und unsinniger, praktisch undurchführbarer Befehle ständig gehetzt. Mit Vorliebe verhängte die Lagerführung Kollektivstrafen, um Häftlinge gegeneinander auszuspielen. Verlängertes Appellstehen, Strafsport oder Essenentzug sollten die Wut der Masse gegen diejenigen richten, die unliebsam aufgefallen waren. Bereits morgens wurden die Häftlinge zu einem erschöpfenden Wettrennen beim Waschen, Bettenbauen, Aufsuchen der Latrine und Fassen von Kaffee gezwungen, das Bruno Bettelheim vor Kriegsbeginn in anderen Lagern kennengelernt und so beschrieben hat: »Noch vor Sonnenaufgang hat bereits ein Kampf aller gegen alle mit all seinen Spannungen, Erniedrigungen und Depressionen stattgefunden. Er war dem Häftling aufgezwungen, noch bevor ein Angehöriger der Wachmannschaft am Morgen das Lager betreten hatte. Die noch unsichtbare SS hatte die Häftlinge zu einer Masse von Menschen gepreßt, die ihren Zorn nicht abreagieren konnten und an ihrer Ohnmacht verzweifelten.«
Dieser zermürbende Kampf setzte sich abends fort, wenn die SS das Lager schon verlassen hatte. »Man darf sich unseren Aufenthalt in der Baracke nach Beendigung des langen Arbeitstages nicht als ein Ausruhen, man muß sich ihn als neues Martyrium vorstellen«, schreibt Pelagia Lewińska, die das Frauenlager in Birkenau kennenlernen mußte. Daß sich ein prominenter Häftling diesem täglichen, aufreibenden Kampf weitgehend entziehen konnte, war nicht sein geringster Vorteil.
Obwohl die offizielle Abkürzung für Konzentrationslager KL lautete und daher auch in zitierten Dokumenten und Niederschriften von SS-Angehörigen so zu lesen ist, hat sich im Sprachgebrauch die Kurzform KZ durchgesetzt, nicht nur bei den Gefangenen, sondern auch bei ihren Wärtern.
In jedem KZ war eine Art Gefangenenspital eingerichtet, das in Auschwitz Häftlingskrankenbau – abgekürzt HKB – genannt wurde. Der Häftling, der mit der Leitung dieses Krankenbaus betraut war, trug die Binde: »Lagerältester HKB«.
An der Spitze der Wachtruppe stand in jedem Lager ein Kommandant. Das Lager selbst wurde von einem oder mehreren Schutzhaftlagerführern geleitet, denen Rapportführer unterstanden, die ihrerseits Vorgesetzte der Blockführer waren. Blockführer wurden SS-Männer meist niedrigen Dienstgrades genannt, denen ein oder mehrere Blöcke unterstellt waren. Sie sind nicht mit Blockältesten zu verwechseln, die Häftlinge waren. Die Arbeitskommandos – kurz Kommandos genannt – wurden von einem Kommandoführer geleitet.
Der leitende SS-Arzt, dem alles, was mit dem Gesundheitswesen zusammenhängt – und manches, was damit gar nichts zu tun hatte –, unterstand, trug in Auschwitz den Titel SS-Standortarzt. Ihm waren die anderen SS-Ärzte unterstellt, denen wiederum Sanitätsdienstgrade – abgekürzt SDG – zur Verfügung standen. Die Krankenbauten waren der Aufsicht der Lagerführer – und damit auch der Rapport- und Blockführer – entzogen und den SS-Ärzten und SDGs unterstellt, was in Auschwitz besondere Bedeutung erlangt hat.
In jedem Lager bestand eine Politische Abteilung, welche neben administrativen Aufgaben auch die Funktion einer Lagergestapo erfüllte. Der Leiter dieser Abteilung in Auschwitz unterstand der Gestapo in dem benachbarten Kattowitz, während für alle anderen die vorgesetzte Dienststelle das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt in Oranienburg bei Berlin war.
Offiziere wurden bei der SS Führer genannt. Der höchste Dienstgrad, den ein SS-Angehöriger in Auschwitz bekleidete, war SS-Obersturmbannführer, ein Rang, der dem des Oberstleutnants der deutschen Wehrmacht entspricht. Die Kommandanten Höß und Liebehenschel sowie die Leiter der Landwirtschaftlichen Betriebe und der Verwaltung, Caesar und Möckel, waren SS-Obersturmbannführer.
In allen Lagern steigerte sich die Korruption bis ins Groteske. SS-Angehörige ließen in Lagerwerkstätten Häftlinge für sich arbeiten. Je höher der Rang und je größer der Einfluß, um so umfangreicher waren die Bestellungen. Rohstoffe, die als Mangelware nur für die Rüstungsindustrie freigegeben waren, wurden ungeniert dazu verwendet. Auch ein Häftling, der sein Leben bewahren wollte, mußte »organisieren«, wie der allgemein übliche Ausdruck für das Aneignen von Gütern aus Vorratsräumen, Magazinen oder Küchen lautete, denn die offiziell verteilten Rationen waren zu gering. Man unterschied zwischen Diebstahl und Organisation. Vergriff sich jemand am Eigentum eines Mithäftlings, so wurde er von seinen Kameraden als Dieb hart bestraft. Organisieren galt hingegen als ehrenhaft und anerkennenswert. Wer gut organisieren konnte, ohne damit »aufzufallen« und zu »platzen« – wie man sagte –, war allgemein geachtet.
In Auschwitz waren die Möglichkeiten so einer Organisation unvergleichlich größer als in gewöhnlichen Konzentrationslagern; denn den ins Vernichtungslager deportierten Juden wurde gesagt, sie würden umgesiedelt. Man forderte sie auf, alles mitzunehmen, was zum Aufbau einer neuen Existenz im Osten von Nutzen sein könnte. Bei der Ankunft in Auschwitz wurde ihnen alles abgenommen, die Effekten von einem Häftlingskommando sortiert und nach verborgenen Wertgegenständen durchsucht. Alles war da zu finden: nicht nur Lebensmittel, Arzneien, Alkoholika und Kleidungsstücke, sondern auch Schmuck, Diamanten, Gold und Geld in allen möglichen Währungen, vor allem Dollars. Die Baracken, in denen die Effekten durchsucht, sortiert und gelagert wurden, sind von den polnischen Häftlingen «Kanada« genannt worden, für sie wohl ein Synonym für sagenhaften Reichtum. Dieser Ausdruck wurde allgemein übernommen, auch von der SS. Das Kommando, das dort zu arbeiten und daher die günstigste Möglichkeit zu organisieren hatte, wurde Kanada-Kommando genannt.
Nach Auschwitz wurden wie in alle nationalsozialistischen Konzentrationslager Gefangene von verschiedenen Gestapo- und Kripostellen eingeliefert. Seitdem dieses Lager als Vernichtungslager für die Juden – und später auch für die Zigeuner – bestimmt worden war, wurden vom Reichssicherheitshauptamt außerdem Transporte der zu Tötenden dorthin dirigiert. Es war üblich, diese als RSHA-Transporte zu bezeichnen. Die auf diesem Weg Deportierten wurden nicht wie andere Gefangene unmittelbar ins Lager gebracht. Sie wurden an der »Rampe« – wie ein Abstellgeleise allgemein genannt wurde – auswaggoniert und in der Regel einer »Selektion« unterworfen. Selektion bedeutete, daß diejenigen sofort in eine Gaskammer zur Tötung geschickt wurden, die nicht arbeitsfähig zu sein schienen, während die Arbeitsfähigen als Häftlinge ins Lager eingewiesen wurden. Da auf diesem Weg ständig unverbrauchte Arbeitskräfte ins Lager kamen, selektierte die SS periodisch auch unter den Lagerinsassen, um die arbeitsunfähig Gewordenen in den Gaskammern zu töten und an ihrer Stelle Neuzugänge arbeiten zu lassen. Rampe und Selektion sind in Auschwitz ebenso feststehende Begriffe geworden wie Kanada.
Die Geschichte des Vernichtungslagers
»Der SS-Staat erschien im metallischen Glanz seiner Totalität als ein Staat, in dem die Idee sich verwirklichte«, sagt Jean Améry, der in diesen Staat – die Welt der von der SS regierten Konzentrationslager – hineingeworfen worden war.
Hannah Arendt, die ihn aus der Distanz analysieren konnte, schreibt: »Die Konzentrations- und Vernichtungslager dienen dem totalen Herrschaftsapparat als Laboratorien, in denen experimentiert wird, ob der fundamentale Anspruch der totalitären Systeme, daß Menschen total beherrschbar sind, zutreffend ist.«
An anderer Stelle bemerkt diese Autorin: »Terror ist das Wesen totaler Herrschaft. Terror hat in totalitär regierten Ländern so wenig mit der Existenz von Gegnern des Regimes zu tun, wie die Gesetze in konstitutionell regierten Ländern von denjenigen abhängen, die sie brechen.« Hannah Arendt weist auf eine Schwierigkeit hin, mit der sich diejenigen auseinanderzusetzen haben, die nachträglich das System der nationalsozialistischen Lager studieren wollen: »So wie die Stabilität des totalitären Regimes von der Isolierung der fiktiven Welt der Bewegung von der Außenwelt abhängt, so hängt das Experiment der totalen Herrschaft in den Konzentrationslagern daran, daß sie auch innerhalb eines totalitär regierten Landes sicher gegen die Welt aller anderen, die Welt der Lebenden überhaupt, abgedichtet sind. Mit dieser Abdichtung hängt die eigentümliche Unwirklichkeit und Unglaubwürdigkeit zusammen, die allen Berichten aus den Lagern innewohnt und eine der Hauptschwierigkeiten für das wirkliche Verständnis der totalen Herrschaftsformen bildet, deren Existenz mit der Existenz der Konzentrations- und Vernichtungslager steht und fällt; denn diese Lager sind, so unwahrscheinlich dies klingen mag, die eigentliche zentrale Institution des totalen Macht- und Organisationsapparates.«
Darum scheint es am zweckmäßigsten, diese zentrale Institution zu untersuchen, wenn man die Gewalt studieren will, welche ein totalitäres Regime über Menschen erringen kann; und die Folgen, welche diese ungehemmte gewaltsame Einwirkung auf verschiedene Individuen zeitigte.
Die Untersuchung wurde auf Auschwitz beschränkt, das schon Konzentrationslager war, bevor es als Vernichtungsstätte eingerichtet wurde. Insofern unterschied es sich von Treblinka, Belzec, Sobibór und Chelmno, wo ausschließlich Vernichtungsanstalten eingerichtet worden waren. In diesen Lagern wurde nur eine kleine Zahl von Deportierten so lange am Leben gelassen, als sie zur Bedienung des Vernichtungsapparates benötigt wurden. Ihr Schicksal ist mit dem der Sonderkommandos in Auschwitz vergleichbar. Nur Majdanek war ebenso wie Auschwitz gleichzeitig KZ und Vernichtungslager. Es bestand jedoch kürzer, war wesentlich kleiner als Auschwitz, und nur wenige haben dieses Lager überlebt; die meisten von ihnen landeten später in Auschwitz, das zur größten Vernichtungsstätte und zugleich zum Konzentrationslager mit der höchsten Zahl von Internierten angewachsen ist. Man schätzt, daß etwa 60.000 in Auschwitz Internierte im Jahr 1945 die Freiheit erlebt haben. Viele von ihnen haben Zeugnis abgelegt, zahlreiche Dokumente sind erhalten geblieben. Erkenntnisse, die aus diesen Quellen geschöpft werden, können stellvertretend für alle nationalsozialistischen Vernichtungslager gelten.
Wer an diesen Stätten leben mußte, war Bedingungen unterworfen, die bisher unbekannt, ja unvorstellbar waren. Jean Améry wehrt sich gegen einen Vergleich von Auschwitz mit Dachau: »Dachau war eines der ersten nationalsozialistischen Konzentrationslager«, schreibt er, »und hatte darum, wenn man so will, eine Tradition; Auschwitz war erst 1940 geschaffen worden und unterlag bis zum Schluß Improvisationen von Tag zu Tag. In Dachau herrschte unter den Häftlingen das politische Element vor, in Auschwitz aber bestand die weit überwiegende Mehrzahl der Häftlinge aus völlig unpolitischen Juden und politisch recht labilen Polen. In Dachau lag die innere Verwaltung zum größten Teil in den Händen politischer Häftlinge, in Auschwitz gaben deutsche Berufsverbrecher den Ton an.« In Monowitz, wo Améry interniert war, trug bis zuletzt der Lagerälteste einen grünen Winkel.
Ich kam von Dachau nach Auschwitz. Im Frankfurter Auschwitz-Prozeß nach dem Unterschied zwischen diesen beiden Lagern befragt, bezeichnete ich Dachau im Vergleich zu Auschwitz als eine Art Idylle. Der Tscheche Arnost Tauber gebrauchte auf eine gleiche Frage, Buchenwald betreffend, wo er zuerst interniert gewesen war, denselben Ausdruck. Ernst Toch, der von Sachsenhausen nach Auschwitz überstellt worden war, sagte, er hätte in jenem Lager noch geglaubt, eine Chance zu haben, dieses Gefühl jedoch in Auschwitz verloren. Heinz Brandt, der denselben Weg wie Toch gegangen war, schreibt: »Sachsenhausen – das war die Hölle gewesen. Aber eine überschaubare Hölle. Auschwitz ist ein Mord-, Beute- und Sklavendschungel.«
Im ersten nationalsozialistischen Konzentrationslager – Dachau – hat die SS das System entwickelt, das auf alle anderen Lager übertragen wurde. Nach Kriegsbeginn änderte sich der Charakter der KZs grundlegend dadurch, daß in immer größerer Zahl Ausländer in sie eingewiesen wurden und die Lager sich stark vergrößerten. Die deutschen Häftlinge wurden dadurch zur privilegierten Minderheit.
Auschwitz liegt zwischen Krakau und Kattowitz. Dieses Gebiet wurde nach der Besetzung Polens durch die Deutschen zu Oberschlesien geschlagen. Die Geschichte des Lagers begann nicht viel anders als die anderer Konzentrationslager, die während des Krieges eingerichtet wurden. Bereits Anfang 1940 ist der Plan entstanden, bei Auschwitz ein Lager zu errichten, wie einem Bericht des SS-Hauptamtes vom 25. Januar dieses Jahres zu entnehmen ist. Anfang Mai wurde Rudolf Höß, bis dahin Schutzhaftlagerführer in Sachsenhausen, zum Kommandanten ernannt. Er brachte von dort nicht nur den Rapportführer Gerhard Palitzsch, sondern gleich auch dreißig deutsche Häftlinge mit, die die wichtigsten Funktionen innerhalb der Häftlingshierarchie bekleiden sollten. Fast alle waren Kriminelle, die sich nach Ansicht der SS bereits in Funktionen bewährt hatten. Am 14. Juni 1940 wurden die ersten 728 Polen nach Auschwitz eingeliefert; damit beginnt die Geschichte dieses Lagers. Bald folgten weitere Transporte von polnischen Gefangenen.
Nur einmal – am 29. August 1940 – kamen Häftlinge anderer Nationalität nach Auschwitz; wiederum Deutsche aus Sachsenhausen, die in dem inzwischen gewachsenen Lager den Bedarf an Capos und Blockältesten decken sollten. Am 6. Juni 1941 wurde erstmals eine geschlossene Gruppe ins Lager eingeliefert, unter der sich kein Pole befand. Sie kam aus der benachbarten Tschechoslowakei.
In jedem neu errichteten Lager war die erste Zeit des Aufbaus besonders hart für die Häftlinge. Diejenigen Polen, die sie überleben konnten, hatten Lagererfahrung gesammelt und entwickelten leicht ein Gefühl der Überlegenheit denjenigen gegenüber, die später ins Lager kamen, als dieses bereits ausgebaut war. Die drei- und vierstelligen Nummern auf ihrer Häftlingskleidung waren eine Art Legitimation dafür, daß sie das Schwerste überstanden hatten; eine Legitimation, die nicht selten auch von der SS respektiert wurde. Dadurch entstand eine Vorrangstellung der Polen.
Der Kommandant von Auschwitz erhielt im Sommer 1941 von Himmler unter vier Augen den Befehl, sein Lager für die »Endlösung der Judenfrage« auszubauen. Mit diesem Ausdruck umschrieben die Nationalsozialisten den Völkermord an den Juden. An das Datum, wann er diese Weisung erhalten hatte, konnte sich Höß nicht mehr erinnern, es ist auch aus Dokumenten nicht feststellbar.
Im Oktober 1941 wurde etwa 3 Kilometer nordwestlich des Lagers – das später Stammlager genannt wurde – mit dem Bau eines Lagerkomplexes von bisher unbekannten Dimensionen begonnen; in rund 250 Baracken sollten 200.000 Gefangene untergebracht werden. Dieser Komplex, der aus einer Vielzahl von Einzellagern bestand, die voneinander getrennt waren, wurde Birkenau genannt. Der Name der polnischen Ortschaft, die auf diesem Gebiet stand und niedergerissen wurde, war Brzezinka. Birkenau ist eine Verdeutschung dieses Namens. Russische Kriegsgefangene, die im Herbst und Winter nach Auschwitz gebracht worden waren, sind zum Bau eingesetzt worden. Fast alle gingen dabei zugrunde. Von mehr als 13.000 blieben weniger als 200 am Leben. Sie wurden nachher »als eine Art Museumsstück betrachtet« und besser behandelt, wie ein überlebender Russe vor dem Frankfurter Gericht sagte. Im März 1942 wurde mit der Belegung des Birkenauer Lagerkomplexes begonnen. Bis zur Evakuierung konnten nicht alle Ausbaupläne realisiert werden.
»Wenn man über ein Lager spricht, so genügt es nicht, den Namen des Lagers zu nennen … Selbst wenn man dieselbe Periode betrachtet, so lebten die Häftlinge im gleichen Lager auf verschiedenen Planeten, je nach der Art der Arbeit, die sie verrichten mußten.« Diese Feststellung von Benedikt Kautsky ist für Auschwitz noch zutreffender als für andere Lager; sie gilt besonders für den Unterschied zwischen dem Stammlager mit seinen relativ geordneten Verhältnissen und dem Lagerdschungel von Birkenau.
Anfang September 1941 griff man in Ausführung des Himmler-Befehls auf der Suche nach einem Mittel, mit dem viele Menschen gleichzeitig ohne großen Aufwand getötet werden könnten, das erste Mal zum Giftgas. Russische Kriegsgefangene und Arbeitsunfähige aus dem Krankenbau waren die ersten Opfer. Das Giftgas Zyklon-B, das zur Ungeziefervertilgung in Auschwitz gelagert war, bewährte sich dabei in den Augen der Lagerführung. Es bot nicht nur die Möglichkeit, mit Hilfe von wenigen Bewachern und Exekutoren in kurzer Zeit zahlreiche Menschen zu töten; Herbert Jäger weist auf einen anderen Vorteil hin, den diese Tötungsart der SS brachte: »Die hemmenden Wirkungen, die mit den Massenerschießungen (die von den Einsatzgruppen im Osten bis dahin praktiziert wurden) verbunden waren und sogar bei Himmler als Schwächeanfall in Erscheinung traten, dürften der Grund für die späteren Gaswagenmorde und die Tötung in Gaskammern gewesen sein.«
Der Leiter einer Einsatzgruppe, Otto Ohlendorf, sprach in diesem Zusammenhang vor seinen Nürnberger Richtern von einer »Humanisierung« des Massenmordes. Diese Humanisierung bezog sich freilich nicht auf die Opfer, sondern auf die Täter, denen man die mit Erschießungen am laufenden Band verbundene Nervenbelastung ersparen wollte.
Andrzej Wirth weist auf eine weitere bedeutungsvolle Folge dieser Tötungsart hin: »Die Beziehung zwischen dem Mörder und seinem Opfer ist der Anonymität anheimgefallen. Der Mord selbst resultiert aus einer Unzahl von Teilentscheidungen, getroffen von einer Unzahl von Menschen, die weder eine Gefühls-, geschweige denn Gedankenbeziehung zum Gegenstand des Mordes haben.« Damit und mit seiner anschließenden Frage »Wo fängt hier die Ursache an, wo beginnt die Wirkung?« berührt Wirth ein Problem, auf das derjenige stößt, der die Reaktionen der Menschen, welche an den Massenmorden in Auschwitz mitgewirkt haben, studiert.
Schon in der ersten Zeit sind zusammen mit polnischen »Ariern« auch Juden aus diesem Land ins Lager eingewiesen worden. Sie wurden automatisch der Strafkompanie zugeteilt. Willi Brachmann, der mit dem zweiten Sachsenhausen-Transport als Capo nach Auschwitz gekommen war, bezeugte, daß damals alle Juden zur Arbeit in der Kiesgrube eingeteilt worden waren. »Der Capo Roman kriegte gleich Bescheid: Ich will keine Juden sehen!« – so wurde laut Brachmann der Capo des Kiesgrubenkommandos von dem Lagerführer aufgefordert, die ihm zugeteilten Juden fertigzumachen.
Zwei Bauernhäuser, die von dem Dorf Brzezinka stehengelassen worden waren, wurden als Gaskammern umgebaut. Im Januar 1942 sind die ersten rein jüdischen Transporte – sie kamen aus dem benachbarten Oberschlesien – dort ermordet worden. Wie in allen Vernichtungsstätten, zwang auch in Auschwitz die SS Häftlinge, ihr alle Arbeiten, die mit dem Wegräumen und Verbrennen der Leichen zusammenhingen, abzunehmen. Diejenigen, die dafür bestimmt wurden, sind in sogenannten Sonderkommandos zusammengefaßt worden.
Seit dem 26. März 1942 wurden Judentransporte von dem Reichssicherheitshauptamt nach Auschwitz dirigiert; die ersten aus der Slowakei und Frankreich. Anfangs wurden alle ins Lager als Häftlinge eingewiesen. Da im ersten Transport Frauen aus der Slowakei deportiert wurden, ergab sich die Notwendigkeit, ein Frauenlager einzurichten. Einige Blöcke im Stammlager wurden zu diesem Zweck abgetrennt. Am 16. August wurde das Frauenlager nach Birkenau verlegt, das damals dafür in keiner Weise vorbereitet war. Höß schrieb: »Im Frauenlager waren in jeder Hinsicht stets die schlechtesten Verhältnisse.«
Während die anfangs mit RSHA-Transporten Deportierten zur Gänze ins Lager gekommen waren, sind später diese Transporte bei der Ankunft einer Selektion unterworfen worden. Die erste Selektion dieser Art kann am 4. Juli 1942 nachgewiesen werden.
Die Deportationszüge rollten tagaus, tagein. Bald reichten die improvisierten Gaskammern nicht mehr aus. In Birkenau wurden vier große Krematorien errichtet, jedes mit einer eingebauten Gaskammer. Elektrische Aufzüge dienten dazu, die Leichen zu den Öfen zu bringen. Die modernen Gebäude von außergewöhnlichen Dimensionen – in den beiden größeren Krematorien konnten in eine Gaskammer je 2000 Menschen hineingepreßt werden – bildeten den Stolz der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei.
Diese Daten markieren die Periode, in der Auschwitz zu einem Vernichtungslager ausgebaut wurde. Auf die vorangegangene Periode, die eine Art Vorgeschichte genannt werden kann, nehme ich hier nur ausnahmsweise Bezug. Wie schnell das Lager seit dem Beginn der RSHA-Transporte wuchs, illustrieren folgende Zahlen: Von Juni 1940 bis gegen Ende März 1942 sind rund 27.000 Häftlingsnummern ausgegeben worden. In dem folgenden Jahr bis März 1943 erhielten rund 135.000 Menschen eine Auschwitzer Häftlingsnummer.
Die täglichen Massentötungen wurden bald zur Routinearbeit. Die Selektion der in der Regel nichtsahnenden Zugänge erfolgte an der Rampe so schnell wie möglich, die Täuschung wurde bis zuletzt aufrechterhalten. Der Rapportführer Oswald Kaduk bezeugte in Frankfurt, daß die SS Befehl hatte, an der Rampe nicht zu schlagen, damit unter den Opfern keine Panik ausbreche. Rudolf Vrba, der längere Zeit als Häftling an der Rampe arbeiten mußte, bestätigt, daß dieser Befehl in der Regel eingehalten worden ist.
Wer in Auschwitz am Leben gelassen wurde, ist durch die ständige Drohung, als arbeitsunfähig selektiert zu werden, durch den Geruch von verbranntem Menschenfleisch, der über dem Lagerkomplex lastete, durch das Wissen um das tägliche Massenmorden in eine Situation versetzt und mit Problemen konfrontiert worden, die keinen Vergleich zulassen. In Birkenau, wo der Vernichtungsapparat installiert war, sind sie am krassesten spürbar geworden. Seweryna Szmaglewska schreibt: »Wer immer auch nach der täglichen Plackerei in einen bleiernen Schlaf verfällt, wird von dem Schrei der Rampe unabwendbar wachgerüttelt. Ihr Realismus zwängt sich in die Tiefe des Bewußtseins, reizt, weckt.«
Auch diejenigen, die als Bewacher der Opfer und Bediener des Tötungsmechanismus kommandiert worden waren, wurden mit ganz anderen Problemen konfrontiert als zum Beispiel Wachposten in Buchenwald oder Dachau. Die Existenz im Vernichtungslager stellte alle in eine extreme Situation; freilich war sie für diejenigen, die außerhalb des Stacheldrahtes lebten, in einem völlig anderen Sinn extrem als für die Opfer.
Ein zur nüchternen Sachlichkeit verpflichteter und um Distanz bemühter Richter, der Vorsitzende im großen Frankfurter Auschwitz-Prozeß, faßte den Eindruck, den dieses Verfahren vermittelte, bei der Urteilsverkündung in die Worte zusammen: »Hinter dem Tor des Lagers Auschwitz begann eine Hölle, die für das normale menschliche Hirn nicht auszudenken ist und die zu schildern die Worte fehlen.«
Désiré Haffner, dem eine ebenso eindringliche wie um Objektivität bemühte Studie über Birkenau zu verdanken ist, wo er als Häftlingsarzt tätig war, faßt das Geschehen im Vernichtungslager mit folgenden Worten zusammen:
»Der Massenmord in Auschwitz wird durch seine lange Dauer und durch die bedeutende Zahl seiner Opfer charakterisiert. Allein die Anzahl der dort getöteten Kinder und Säuglinge beziffert sich auf mehrere hunderttausend.
Der Massenmord von Auschwitz unterscheidet sich von anderen Massenmorden in der Geschichte durch die Tatsache, daß es bei seiner Durchführung kein Element der Erregung oder der Leidenschaft gab. Es handelte sich um einen logischen, leidenschaftslos geplanten, sorgsam studierten und kühl durchgeführten Massenmord.
Seine Planung war das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Staatsmännern, Chemikern, Ärzten, Psychiatern, Ingenieuren, Soldaten und anderen.
Seine Durchführung erforderte die disziplinierte und methodische Unterstützung einer Organisation von großem Umfang, die über Verzweigungen nach allen Ländern Europas verfügte.«
Diese Organisation erfaßte schließlich auch die Verwertung der Habe der Ermordeten, ja die Leichen selbst: Zahngold wurde ausgebrochen und eingeschmolzen, Frauenhaare wurden für Spezialtextilien verwendet, selbst die »Asche wurde entweder als Düngemittel verwandt oder in die Weichsel verschüttet«, wie Johann Gorges bezeugte, der als SS-Unterscharführer bei den Krematorien tätig gewesen war. Zofia Knapczyk erinnert sich, daß die Felder des Wirtschaftshofes Babitz damit gedüngt worden sind. Mit Asche wurde auch der Boden der Fischteiche in Harmense nivelliert, aus ihr ein Damm zwischen den Dörfern Harmense und Plawy errichtet, Menschenasche wurde zur Isolierung unter Fußböden geschüttet. Häftlinge, die mit dieser Asche zu arbeiten hatten, fanden darin noch Brillengestelle, Kieferstücke mit Zähnen und ähnliches.
Da sich nicht nur Birkenau vom Stammlager unterschied, sondern auch große Unterschiede zwischen den Verhältnissen im Jahr 1942 und denen im Jahr 1944 bestanden, ist die Geschichte des Vernichtungslagers in groben Strichen zu skizzieren, bevor die menschlichen Probleme dargestellt werden können.
Verschiedene Einflüsse führten im Verlauf der zweieinhalb Jahre, die das Vernichtungslager bestand, zu Veränderungen im Lagerklima. Anstoß dafür gab in erster Linie die allgemeine Entwicklung in dieser Zeit. Zu Beginn herrschte auch in Auschwitz noch das System vor, das vor dem Krieg in allen Konzentrationslagern entwickelt worden war: Arbeit sollte Strafe sein. Konsequenterweise wurde häufig sinnlose Arbeit befohlen, die besonders quälend ist. Aus der KZ-Literatur sind zahlreiche Beispiele dafür überliefert worden. Steine mußten im Laufschritt von einem Platz zu einem anderen getragen, dort sorgfältig aufgeschlichtet werden, um dann – wiederum im Laufschritt – auf den alten Platz zurückgetragen zu werden; oder ähnliches.
Völlig hat die SS auf diese Methode der Quälerei nie verzichtet. Doch schon bevor Auschwitz zum Vernichtungslager ausgebaut wurde, kündigte sich eine Wende an. Die Kriegswirtschaft forderte Arbeitskräfte. Wie sehr davon auch die Lager betroffen wurden, zeigt ein Schreiben Himmlers vom 26. Januar 1942, in dem er dem Chef der Inspektion aller Konzentrationslager mitteilte, daß er in den nächsten vier Wochen 150.000 Juden einzuweisen beabsichtige, denn »große wirtschaftliche Aufgaben und Aufträge werden in den nächsten Wochen an die Konzentrationslager herantreten«.
Um die ständig lauter fordernde Rüstungsindustrie mit Arbeitskräften zu versorgen, wurden in der Umgebung aller Lager bei Fabriken, Gruben oder Steinbrüchen Außenlager gebaut und als Arbeitslager eingerichtet. Dadurch fielen die langen Anmarschwege der Gefangenen zu den Arbeitsplätzen weg, welche die Ausnützung der Arbeitskraft eingeschränkt hatten. Im Sommer 1942 entstanden die ersten Arbeitslager auch bei Auschwitz. Im Oktober desselben Jahres ist bei den Buna-Werken der IG-Farben wenige Kilometer östlich von Auschwitz das Arbeitslager aufgebaut worden, welches später nach der benachbarten Ortschaft Monowitz genannt wurde und sich zum größten Außenlager und der Zentrale aller anderen Arbeitslager entwickelt hat. Nach der Niederlage bei Stalingrad verstärkte sich diese Entwicklung. Insgesamt bestanden 39 Außenlager, allerdings nicht gleichzeitig. Während laufend neue errichtet wurden, sind vereinzelt Außenlager auch aufgelöst worden.
In internen Schreiben der Verwaltung der Konzentrationslager aus dieser Zeit fällt ein neuer Ausdruck auf: Vernichtung durch Arbeit. Damit wurde motiviert, warum nicht alle deportierten Juden sofort den Gaskammern zugeführt wurden: Die Arbeitsfähigen sollten noch für die Rüstung arbeiten, bevor sie starben. Das hatte zur Folge, daß Auschwitz als Zentrum der »Endlösung der Judenfrage« schnell zum bevölkertsten KZ anwuchs. Wenn dieser Ausdruck auch eindeutig beweist, daß die Grundeinstellung dieselbe geblieben war, so konnte die Umstellung dennoch von den Gefangenen bis zu einem gewissen Grad genützt werden.
Von dieser Periode an nahmen die Exzesse an Brutalität ab. Der Pole Stanislaw Kamińsky, der von Anfang an in Auschwitz war, meint: »In der allerersten Zeit wurde überall durch SS und Capos wild gemordet. Nach 1942 trat eine gewisse Erleichterung ein, nach 1943 entstand eine ganz andere Einstellung seitens der Funktionshäftlinge.« Sein Landsmann Józef Mikusz bestätigt sachlich: »Im Jahr 1943 wurde in Auschwitz nicht mehr so viel gemordet wie früher.«
Zu diesen Feststellungen mag auch der Umstand beigetragen haben, daß in der Anfangszeit Polen die bevorzugten Opfer der SS waren, während sie später durch die russischen Kriegsgefangenen und dann durch die Juden abgelöst wurden. Gründe für die geänderte Einstellung liegen auf der Hand: Wenn man einen Facharbeiter prügelt, so steigert man damit nicht seine Leistung, sondern vermindert sie. Ein Spezialist ist nicht ohne weiteres zu ersetzen, also entstanden Hemmungen, alle Häftlinge wahllos kaputtzuschlagen oder zu selektieren, wenn sie krank geworden waren. Freilich kam es immer wieder zu Rückfällen. Mancher SS-Mann und Capo konnte sich von dem liebgewordenen System der Prügel und des nackten Terrors nicht trennen. Auch stellten sich derartige Hemmungen nicht bei Arbeitskommandos ein, die unqualifizierte Arbeit zu verrichten hatten.
Trotzdem kann man vereinfachend zusammenfassen: Im Laufe der Geschichte des Vernichtungslagers trat die Tötung mittels Handarbeit immer mehr zugunsten einer industrialisierten Tötung zurück. Die vier großen, modernen Krematorien hatten eine mühselige und anstrengende Handarbeit unrationell gemacht.
In dieser Periode kam die Verwaltung der Konzentrationslager auch zu der Einsicht, daß Sklavenarbeit unproduktiv ist. Brutalster Terror, extrem harte Strafen und ein Netz von Denunzianten können zwar bei leicht überschaubaren Arbeiten im Freien einen vollen Arbeitseinsatz erzwingen; bei qualifizierter Arbeit versagen diese Mittel. In der Rüstungsindustrie wurden die Häftlinge immer mehr zu Arbeiten herangezogen, die nicht ohne weiteres von Fachunkundigen kontrolliert werden konnten. Darum führte die SS ein System ein, das die gleiche Wirkung haben sollte wie der Akkordlohn bei freien Arbeitern. Himmler forderte am 5. März 1943 den Leiter des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, Oswald Pohl, auf, »sich den ganzen Fragen eines Akkordsystems unter unseren Häftlingen intensiv zu widmen«. Die Folge war die Verteilung von Prämienscheinen.
Wie vieles andere wurde auch diese Einrichtung in Auschwitz ins Groteske verzerrt. Nur selten konnte man sich für einen Prämienschein etwas Nützliches kaufen. Zahnpasta und Klosettpapier waren schon begehrenswerte Artikel. Der Besuch des Lagerbordells, das etwa zur gleichen Zeit eingerichtet worden war, konnte ebenfalls mittels Prämienscheinen erkauft werden. Die erwartete Wirkung wurde dadurch geschmälert, daß der Kommandoführer die Prämienscheine häufig nicht denjenigen gab, welche die beste Arbeitsleistung aufwiesen, sondern denen, die für ihn am besten organisierten. Ursprünglich durften Prämienscheine nur an »arische« Häftlinge ausgegeben werden. Als immer mehr Juden in der Rüstungsindustrie eingesetzt wurden, ordnete man am 19. November 1943 an, daß auch sie für gute Arbeit mit Prämienscheinen belohnt werden sollten. Häftlinge, die die schwerste Arbeit zu verrichten hatten – zum Beispiel Erdarbeiten –, blieben von diese einigermaßen problematischen Begünstigung ausgeschlossen. Für sie reichte Terror aus, um die gewünschte Arbeitsleistung zu erzwingen.
Damals wurde auch angeordnet, die Appelle abzukürzen. Früher hatten die Häftlinge morgens und abends oft stundenlang bei jedem Wetter in militärischer Formation auf dem Appellplatz zu stehen, bis der Appell endlich beendet war. Später konnten die Appelle in wesentlich kürzerer Zeit abgewickelt werden.
Um dieselbe Zeit wurde der Empfang von Paketen freigegeben. In einem am 30. Oktober 1942