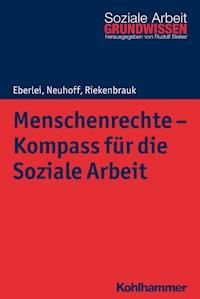
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Human rights are extremely important in the analysis, evaluation and processing of practically every area of social work. On the basis of actual challenges in the central areas of social work, this volume enables students to recognize, acquire and strengthen the skills needed to take action on the basis of human rights. A rigorously interdisciplinary approach clarifies the social-ethics, legal and political aspects of the selected example cases and outlines coherent approaches to action.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin, die Autoren
Dr. Walter Eberlei, Politikwissenschaftler, seit 2005 Professor im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften an der Hochschule Düsseldorf. Lehre u. a. zum Themenfeld Menschenrechte für den Bachelor-Studiengang „Sozialpädagogik/Sozialarbeit“ sowie den Master-Studiengang „Empowerment Studies“. In der Forschung beschäftigt er sich v. a. mit zivilgesellschaftlichem bzw. bürgerschaftlichem Engagement.
Dr. Katja Neuhoff, Sozialpädagogin, Sozialethikerin, 2013 Promotion mit einer Arbeit über Bildung als Menschenrecht, seit 2012 Fachbereichsreferentin und Lehrbeauftragte im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften an der Hochschule Düsseldorf (HSD). Lehrveranstaltungen in den Themenfeldern Diversity, Menschenrechte und Sozialethik. Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Menschenrechte, Inklusion und Bildung.
Dr. Klaus Riekenbrauk, Rechtswissenschaftler, von 1994 bis zum Ruhestand 2015 Professor an der Hochschule Düsseldorf, von 1980 bis 1994 und ab 2009 Rechtsanwalt. Schwerpunkte der wissenschaftlichen Tätigkeit: (Jugend-)Strafrecht, Jugendhilferecht; seit 2006 Lehrveranstaltungen im Bereich der Menschenrechte (Menschenrechte und Strafrecht, Menschenwürde, Menschenrechte in der Weltgesellschaft, Religionsfreiheit).
Walter Eberlei, Katja Neuhoff, Klaus Riekenbrauk
Menschenrechte – Kompass für die Soziale Arbeit
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-030811-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-030812-1
epub: ISBN 978-3-17-030813-8
mobi: ISBN 978-3-17-030814-5
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort zur Reihe
Mit dem so genannten „Bologna-Prozess“ galt es neu auszutarieren, welches Wissen Studierende der Sozialen Arbeit benötigen, um trotz erheblich verkürzter Ausbildungszeiten auch weiterhin „berufliche Handlungsfähigkeit“ zu erlangen. Die Ergebnisse dieses nicht ganz schmerzfreien Abstimmungs- und Anpassungsprozesses lassen sich heute allerorten in volumigen Handbüchern nachlesen, in denen die neu entwickelten Module detailliert nach Lernzielen, Lehrinhalten, Lehrmethoden und Prüfungsformen beschrieben sind. Eine diskursive Selbstvergewisserung dieses Ausmaßes und dieser Präzision hat es vor Bologna allenfalls im Ausnahmefall gegeben.
Für Studierende bedeutet die Beschränkung der akademischen Grundausbildung auf sechs Semester, eine annähernd gleich große Stofffülle in deutlich verringerter Lernzeit bewältigen zu müssen. Die Erwartungen an das selbständige Lernen und Vertiefen des Stoffs in den eigenen vier Wänden sind deshalb deutlich gestiegen. Bologna hat das eigene Arbeitszimmer als Lernort gewissermaßen rekultiviert.
Die Idee zu der Reihe, in der das vorliegende Buch erscheint, ist vor dem Hintergrund dieser bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen entstanden. Die nach und nach erscheinenden Bände sollen in kompakter Form nicht nur unabdingbares Grundwissen für das Studium der Sozialen Arbeit bereitstellen, sondern sich durch ihre Leserfreundlichkeit auch für das Selbststudium Studierender besonders eignen. Die Autor/innen der Reihe verpflichten sich diesem Ziel auf unterschiedliche Weise: durch die lernzielorientierte Begründung der ausgewählten Inhalte, durch die Begrenzung der Stoffmenge auf ein überschaubares Volumen, durch die Verständlichkeit ihrer Sprache, durch Anschaulichkeit und gezielte Theorie-Praxis-Verknüpfungen, nicht zuletzt aber auch durch lese(r)-freundliche Gestaltungselemente wie Schaubilder, Unterlegungen und andere Elemente.
Prof. Dr. Rudolf Bieker, Köln
Zu diesem Buch
Soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession! – Diese These wurde Mitte der 1990er Jahre von Silvia Staub-Bernasconi aus der internationalen Debatte zum Selbstverständnis Sozialer Arbeit in den deutschsprachigen Diskurs eingeführt. In diesem Band geht es darum, die langjährige Fachdebatte um den Menschenrechtsansatz in der Sozialen Arbeit vom Kopf auf die Füße zu stellen: In grundlegender und einführender Weise analysiert das Buch typische Handlungsfelder Sozialer Arbeit aus menschenrechtlicher Sicht, leuchtet ihre ethischen, juristischen und politischen Dimensionen aus, und stellt konkrete Ansätze und Praxisbeispiele für menschenrechtliches Handeln vor.
An dieser Stelle einige „technische“ Hinweise:
• Im Anhang des Buches finden sich ein Glossar, ein Stichwort- und ein Abkürzungsverzeichnis, die die Klärung von Kernbegriffen erleichtern sollen. Glossarbegriffe, die im Text des Buches verwendet werden, sind dort mit einem Pfeil (→) markiert.
• Im Buch folgen wir der in der Rechtswissenschaft üblichen Zitierweise von Rechtsquellen. Rechtsquellen, also Gesetze, Verordnungen, aber auch Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen, werden nicht mit Quellenhinweisen versehen, sondern ausschließlich mit der Kurzzitation. So werden z. B. Strafvorschriften des Strafgesetzbuches nicht unter Angabe des Ortes, wo sie veröffentlicht worden sind, aufgeführt. Die Angabe: § 177 StGB genügt. Im Anhang werden alle verwendeten Abkürzungen von Rechtsquellen aufgelöst.
• Bei im Internet verfügbaren Texten verzichten wir in der Quellenangabe auf die mitunter langen Internetlinks und ersetzen diese nur durch die Einfügung [online]. Die Texte sind i. d. R. durch Eingabe des Titels in eine Suchmaschine auffindbar. Ein Verzeichnis aller Online-Quellen, inklusive der jeweiligen Internetadressen, findet sich überdies auf einer Internetseite, die wir als ergänzendes Angebot zum Buch erstellt haben (www.hs-duesseldorf.de/menschenrechte). In jedem Literaturverzeichnis befindet sich ein QR-Code, der zur entsprechenden Seite führt. Für alle online verfügbaren Dokumente wurde der Zugriff bei Redaktionsschluss am 08.12.2017 nochmals überprüft. Sofern nicht explizit anders angeben, gilt dieses Zugriffsdatum.
• Die Internetseite stellt auch weitere Materialien und Informationen bereit, so z. B. ein Verzeichnis sämtlicher Organisationen, Projekte, Kampagnen usw., die wir im Buch erwähnen, auch hier mit den jeweiligen Internetadressen. Schließlich bietet die Internetseite auch Möglichkeiten des Feedbacks.
Das Autorenteam bedankt sich herzlich bei allen, die durch kritische Lektüre des Manuskripts, wertvolle Hinweise und hilfreiche Kommentare zur Entstehung des Buches beigetragen haben!
Walter Eberlei – Katja Neuhoff – Klaus Riekenbrauk
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
Einleitung: Der Menschenrechtsansatz der Sozialen Arbeit
Teil I Der menschenrechtliche Blick auf Handlungsfelder Sozialer Arbeit
1 Kinder- und Jugendhilfe
1.1 Einleitung
1.2 Kindeswohl versus Elternrecht: Moralische Normen in Konflikt
1.3 Kinder sind Menschenrechtssubjekte
1.4 Kinderrechte: im politischen Alltag umkämpft
1.5 Positivbeispiele aus der Praxis
1.6 Fazit
2 Soziale Arbeit im Bereich der Bildung
2.1 Einleitung
2.2 Unentgeltliche Elementarbildung ist ethisch geboten
2.3 Das Menschenrecht auf Bildung – auch auf frühkindliche?
2.4 Macht und Ohnmacht bestimmen die Bildungschancen
2.5 Positivbeispiele aus der Praxis
2.6 Fazit
3 Schulsozialarbeit
3.1 Einleitung
3.2 Inklusion zielt auf substanzielle Gleichheit in der Rechtswahrnehmung
3.3 Rechtsanspruch auf inklusive Bildung
3.4 Inklusion – der weite Weg vom Papier zur politischen Praxis
3.5 Positivbeispiele aus der Praxis
3.6 Fazit
4 Antirassistische Jugendarbeit
4.1 Einleitung
4.2 Rassismus – Grenzen des Sagbaren
4.3 Volksverhetzung bildet die Grenze der Meinungsfreiheit
4.4 Der Kampf gegen Rassismus muss (auch) politisch geführt werden
4.5 Positivbeispiele aus der Praxis
4.6 Fazit
5 Soziale Arbeit gegen Armut und Soziale Ausgrenzung
5.1 Einleitung
5.2 Armut als Gefährdung selbstbestimmter Lebensführung
5.3 Armut und das Recht auf Achtung menschlicher Würde
5.4 Armut ist (auch) ein Ergebnis politischer Entscheidungen
5.5 Positivbeispiele aus der Praxis
5.6 Fazit
6 Community Organizing/Gemeinwesenarbeit
6.1 Einleitung
6.2 Gerechtigkeit erfordert Mitgestaltung
6.3 Menschenwürde und politische Teilhaberechte
6.4 Politisches Empowerment statt politischer Ausgrenzung
6.5 Positivbeispiele aus der Praxis
6.6 Fazit
7 Soziale Arbeit mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt
7.1 Einleitung
7.2 Einvernehmlichkeit als Testfall für Freiheit und Gleichheit
7.3 Der strafrechtliche Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts
7.4 Der Kampf für sexuelle Selbstbestimmung braucht langen Atem
7.5 Positivbeispiele aus der Praxis
7.6 Fazit
8 Streetwork für und mit Wohnungslosen
8.1 Einleitung
8.2 Menschenrechte als Schutz vor antiliberaler Willkür
8.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung versus Menschenwürde
8.4 Politisches Engagement für und mit Wohnungslosen
8.5 Positivbeispiele aus der Praxis
8.6 Fazit
9 Soziale Arbeit mit geflüchteten Menschen
9.1 Einleitung
9.2 Ethisch zählt die Schwere der Notlage und das Vermögen zu helfen
9.3 Staatliche Schutzgarantien für Geflüchtete
9.4 Der politische Kampf für die Rechte von Geflüchteten
9.5 Positivbeispiele aus der Praxis
9.6 Fazit
10 Soziale Arbeit mit alten Menschen
10.1 Einleitung
10.2 Pflichten gegenüber Alten – Pflichten gegenüber Eltern
10.3 Menschenrechte gelten auch für Ältere
10.4 Menschenwürde im Alter sichern – der Beitrag politischer Institutionen
10.5 Positivbeispiele aus der Praxis
10.6 Fazit
11 Soziale Arbeit im Strafvollzug
11.1 Einleitung
11.2 Menschenrechte haben Vorrang vor Ordnungslogik
11.3 Menschenrechte gelten auch in Gefängnissen
11.4 Menschenrechte hinter Gittern: auch eine politische Herausforderung
11.5 Positivbeispiele aus der Praxis
11.6 Fazit
12 Soziale Arbeit in der Psychiatrie
12.1 Einleitung
12.2 Fürsorgeethos und Achtungspflicht: Lässt sich Zwang ethisch rechtfertigen?
12.3 Rechtliche Zulässigkeit und Grenzen der Zwangsunterbringung
12.4 Empowerment – auch für psychisch kranke Menschen
12.5 Positivbeispiele aus der Praxis
12.6 Fazit
Teil II Systematische Zugänge zu den Menschenrechten
13 Die Menschenrechtsidee
13.1 Einleitung
13.2 Menschenrechte
13.3 Menschenwürde als Grund der Menschenrechte
13.4 Menschenrechte als unabgeschlossene Lerngeschichte
13.5 Menschenrechte zwischen Ethik, Recht und Politik
14 Das System der Menschenrechte und seine institutionellen Schutzvorrichtungen
14.1 Internationale Ebene
14.2 Europäische Ebene
14.3 Nationale Ebene (Deutschland)
15 Menschenrechte als Konfliktfeld
15.1 Einleitung
15.2 Akteure und Institutionen der Menschenrechtspolitik in Deutschland
15.3 Die politischen Prozesse der Menschenrechtspolitik
15.4 Menschenrechtspolitische Kontroversen
Teil III Zusammenfassung methodischer Ansätze
16 Der Menschenrechtsansatz in der Praxis der Sozialen Arbeit
16.1 Menschenrechtsbildung und Empowerment
16.2 Rechtsberatung
16.3 Beiträge zur menschenrechtlichen Organisationsentwicklung
16.4 Politische Menschenrechtsarbeit
16.5 Weiterentwicklung der professionellen Identität
Teil IV Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
Stichwortverzeichnis
EINLEITUNG: DER MENSCHENRECHTSANSATZ DER SOZIALEN ARBEIT
Was Sie in diesem Kapitel lesen können
Menschen, die in der Sozialen Arbeit tätig sind, brauchen ein festes Fundament. In diesem Abschnitt erläutern wir kurz unsere Ausgangsthese: dass Soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession ist. Und wir klären unser Ziel, nämlich diese grundlegende Einsicht in die Praxis zu übersetzen. Hinweise zum Aufbau des Buches runden die Einleitung ab.
Menschen, die professionell in der Sozialen Arbeit tätig sind, stehen im Berufsalltag vor großen Herausforderungen. Sozialpädagog*innen in der Familienhilfe müssen sich regelmäßig mit Fällen von Kindeswohlgefährdung beschäftigen. Kindheitspädagog*innen verzweifeln gelegentlich an den begrenzten Möglichkeiten, allen Kindern angemessene Förderung zukommen zu lassen. Sozialarbeiter*innen in der offenen Jugendarbeit sind mit diskriminierenden und rassistischen Konflikten konfrontiert. In der Arbeit mit Geflüchteten begegnet den Berater*innen Angst und vermeintliche Rechtlosigkeit. Sozialarbeiter*innen in Stadtteilprojekten arbeiten mit Menschen, deren Leben durch → Armutund SozialeAusgrenzung und politische Ohnmacht charakterisiert ist. Die Reihe alltäglicher Herausforderungen für Sozialprofessionelle ließe sich nahezu beliebig fortsetzen.
Gleichzeitig sind es gerade diese Herausforderungen, denen sich viele Sozialprofessionelle ganz bewusst stellen. Viele Studierende der Sozialen Arbeit, viele Berufseinsteiger*innen, aber auch viele, die langjährig in den vielfältigen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit tätig sind, wollen dazu beitragen, allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen – frei von Diskriminierung und Ausgrenzung und fähig, ein selbstbestimmtes, freies und gutes Leben zu führen.
Ein solches Verständnis des eigenen beruflichen Handelns braucht ein festes Fundament, eine klare Orientierung, einen Kompass. Es geht nicht darum, als Dienstleister für die tägliche Bedürfniserfüllung von Klient*innen verantwortlich zu sein. Ebenso wenig gilt es, als Erfüllungsgehilfe staatlich finanzierter Fürsorge zu fungieren und Menschen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen, wieder in die Spur zu bringen oder unter Kontrolle zu halten – mit anderen Worten: der Gesellschaft soziale Probleme vom Hals zu schaffen.
Soziale Arbeit muss mehr sein als ein Beruf, der durch Kundenwünsche oder Arbeitsaufträge bestimmt ist. Soziale Arbeit muss zur Profession werden, verlangt Silvia Staub-Bernasconi, die seit vielen Jahren die Fachdebatte über das Selbstverständnis Sozialer Arbeit mitprägt (vgl. z. B. Staub-Bernasconi 1995, 2003, 2009, 2014; als Würdigung ihres Werks vgl. Prasad 2016).
Die inzwischen über 80-jährige, noch immer höchst engagierte Wissenschaftlerin fordert ein „Tripelmandat“. Das dritte Mandat – neben den Mandaten der Klient*innen und des Arbeitgebers (bzw. der Gesellschaft) – gibt sich ihr zufolge die Soziale Arbeit selber: auf der Basis wissenschaftlich fundierter Handlungskompetenz, orientiert an einem klaren ethischen Kodex, der für sie nur in den Menschenrechten bestehen kann.
Soziale Arbeit ist nach Staub-Bernasconi eine „Menschenrechtsprofession“. Sie lehnt sich mit diesem Begriff an das internationale Verständnis von Sozialer Arbeit an. Schon seit den späten 1960er Jahren und verstärkt in den 1980er Jahren wurde auf Konferenzen und in Publikationen über das Verhältnis von Menschenrechten und Sozialer Arbeit diskutiert. Dies führte u. a. 1988 zur Gründung der Arbeitsgruppe Menschenrechte des maßgeblichen Verbandes der internationalen Sozialen Arbeit, der International Federation of Social Workers (IFSW), und zur Veröffentlichung eines grundlegenden Policy-Papers (IFSW 1988). Weiter schließt die Wissenschaftlerin an Erklärungen der Vereinten Nationen (United Nations – UN) aus den frühen 1990er Jahren an, in denen die Soziale Arbeit zu den Berufsgruppen gezählt wurde, die in besonderer Weise dazu beitragen, ein menschenwürdiges Leben für alle zu ermöglichen (vgl. IFSW/IASSW/UN 1994). Die Definition von Sozialer Arbeit durch die IFSW enthält seit den 1990er Jahren ein klares Bekenntnis zu den Menschenrechten als handlungsleitende Prinzipien. Diese Definition wurde in einer deutschen Übersetzung auch vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) übernommen.
Ein an den Menschenrechten orientiertes professionelles Selbstverständnis ist keineswegs konfliktfrei, sondern führt geradezu in Konflikte: zum einen zwischen den verschiedenen klassischen „Mandaten“, also der Klient*innen einerseits, der Arbeitgeber*innen andererseits (vgl. das klassische Theorem zweier Mandate von Böhnisch/Lösch 1973). Zum anderen führt es aber auch in Konflikte mit anderen gesellschaftlichen Kräften, die wenig Interesse an Veränderungen des sozialen und politischen Status quo haben. Und schließlich und ganz wesentlich begeben sich Sozialprofessionelle, die sich einem menschenrechtlich begründeten dritten Mandat verpflichtet sehen, in die vielfältigen realen Konfliktlagen der Menschen hinein, an deren Seite sie arbeiten. Dabei schafft eine klare Orientierung aber gleichzeitig auch das Fundament für die Bearbeitung solcher Konfliktlagen.
Menschenrechte als Kompass
„Menschen- und Sozialrechte geben der Sozialen Arbeit die Möglichkeit zurück, in größter Radikalität vom Menschen, seinen Bedürfnissen und Nöten, seiner Lern-, Reflexions- und Handlungsfähigkeit und damit der Fähigkeit zur Veränderung seiner selbst wie seiner Umwelt her zu denken.“ (Staub-Bernasconi 2003, 25)
Mit ihrem Plädoyer für „Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession“ hat Staub-Bernasconi Mitte der 1990er Jahre eine Debatte ausgelöst, die bis heute anhält. Ihre Thesen sind vielfach diskutiert worden, in Publikationen, Tagungen und Seminaren. Auch die Jahrestagung 2017 der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) beschäftigte sich mit der Bedeutung der Menschenrechte für die Soziale Arbeit. Schon die Titel eines Keynote-Vortrags („Soziale Arbeit: eine umstrittene Menschenrechtsprofession“) und der Diskussion zum Abschluss („Menschenrechte und Soziale Arbeit – ein Papiertiger?“) verdeutlichen, dass sich das Paradigma einer „Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession“ in der deutschen Community der Sozialen Arbeit noch immer nicht vollständig durchgesetzt hat. Verwiesen sei an dieser Stelle auf einige Auseinandersetzungen mit Staub-Bernasconis Thesen (Kappeler 2008, Spatscheck 2008, Mührel/Röh 2013, Müller-Hermann/Becker-Lenz 2013).
Das vorliegende Buch geht über diese Diskussion hinaus. Das Grundverständnis von „Sozialer Arbeit als einer Menschenrechtsprofession“ ist sein Ausgangspunkt. Aus Sicht der Autorin und der Autoren ergibt sich dies bereits aus dem grundgesetzlichen Auftrag sowie aus einer Vielzahl von menschenrechtlichen Verträgen, die Deutschland ratifiziert hat und die damit unmittelbar geltendes Recht in Deutschland sind, darunter grundlegend die beiden UN-Pakte von 1966 (→ Zivilpakt und → Sozialpakt), eine Reihe von UN-Menschenrechtskonventionen sowie die → Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Die Orientierung an Menschenwürde und Menschenrechten ist damit nicht ins Belieben der in der Sozialen Arbeit tätigen Menschen gestellt, sondern – unwiderruflich und verbindlich – normativ gesetzt.
Menschenrechtsorientierung als grundgesetzlicher Auftrag
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ (Art. 1 Abs. 1 und 2 GG)
Während Silvia Staub-Bernasconi und diejenigen, die sich mit ihren Thesen auseinandersetzen, überwiegend eine Diskussion über das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit führen, soll dieses Buch dazu beitragen, die Debatte vom Kopf auf die Füße zu stellen: Ausgehend von den realen Herausforderungen in zentralen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit vermittelt der Band nicht nur ethisches, juristisches und politikwissenschaftliches Grundwissen zum Verhältnis von Menschenrechten und Sozialer Arbeit, sondern ermöglicht es, menschenrechtlich begründete Handlungskompetenzen in Feldern Sozialer Arbeit zu erkennen, zu erwerben und zu stärken. Dass ein solcher Beitrag dringend notwendig ist, unterstreicht ein Satz aus der Einladung zur genannten DGSA-Jahrestagung 2017: „Bislang besteht in vielen Feldern der Sozialen Arbeit noch wenig systematisches Wissen über die Umsetzung und Gestaltung von Interventionen zur Förderung der Menschenrechte.“ – Die Beiträge während der Tagung verdeutlichten diese Lücke, füllten sie aber nicht. Daran gilt es konkret zu arbeiten.
Menschenrechte stellen kein ethisches oder juristisches Nischenthema dar. Der → Menschenrechtsansatz der Sozialen Arbeit bietet ein Konzept an, das für die Analyse, Bewertung und Bearbeitung praktisch jedes Arbeitsfeldes der Sozialen Arbeit von signifikanter Bedeutung ist. In diesem Sinne ist der Menschenrechtsansatz der Sozialen Arbeit inzwischen nicht nur expliziter Gegenstand ethischer, juristischer oder politikwissenschaftlicher Vorlesungen und Seminare im Studium der Sozialen Arbeit geworden. Darüber hinaus fördert der Ansatz einen neuen analytischen Blick auf die gesamten Inhalte des Studiums und ermöglicht die Entwicklung und Aneignung von Handlungskompetenzen, die den Menschen als Subjekt seiner Lebenswelt und als Rechtsträger begreifen und in diesem Sinne sein menschenrechtliches Empowerment stärken wollen.
Empowerment
Die Debatte über Empowerment, die in den 1970er Jahren durch wichtige Impulse von Paulo Freire zur Pädagogik der Unterdrückten (1971), von Barbara Solomon zum Black Empowerment (1976) oder von Feministinnen zum Women’s Empowerment initiiert und geprägt und dann auch zunehmend in der Sozialen Arbeit in Europa rezipiert wurde, ist auf den ersten Blick durchaus unübersichtlich. Eine Literaturstudie identifizierte 32 verschiedene Definitionen von Empowerment (Ibrahim/Alkire 2007, 7f.). Die Vielschichtigkeit zeigt, dass der Begriff nicht Gegenstand einer Debatte ist, sondern in einer Reihe von Diskurssträngen verhandelt wird. Rivest/Moreau (2014) kritisieren – v. a. in Anlehnung an theoretische Vorarbeiten von Michel Foucault – solche Empowerment-Ansätze, die sich auf das Individuum konzentrieren und ihm die Verantwortung dafür zuschreiben, sich im Wettbewerb mit anderen durchzusetzen und sich so ein gelingendes Leben zu erkämpfen. Dies blende strukturelle Fragen aus und normiere Menschen, statt ihre Emanzipation zu fördern. Ähnlich argumentiert Staub-Bernasconi in ihrer Kritik der individualistischen Interpretation von Empowerment in verschiedenen Konzepten der Sozialen Arbeit. Für sie ist Empowerment, in Anlehnung an internationale Diskurse, untrennbar mit der Definition von Rechten verbunden sowie mit der Handlungsfähigkeit der Rechtsträger*innen, diese auch zu realisieren (Staub-Bernasconi 2014, 367).
Für einen solchermaßen ganzheitlichen Ansatz ist eine interdisziplinäre Perspektive unerlässlich. Ethische, juristische und politikwissenschaftliche Expertisen – die von der Autorin und den Autoren dieses Buches eingebracht werden – müssen sich in der Praxis mit weiteren disziplinären Fachkompetenzen verbinden (z. B. der Psychologie, der Pädagogik, der Soziologie) und sodann wesentlich in die Wissenschaft Soziale Arbeit einfließen. Die Autorin und die Autoren dieses Buches haben in diesem Sinne in den vergangenen Jahren zahlreiche Lehrveranstaltungen zu menschenrechtlichen Themen durchgeführt. Immer wieder wurden sie mit der einfachen Frage konfrontiert: „Was heißt das in der Praxis der Sozialen Arbeit?“ – so ist die Idee zu diesem Buch entstanden, mit dem Ziel, Studierende der Sozialen Arbeit dabei zu unterstützen, menschenrechtlich basierte Handlungskompetenzen für die berufliche Praxis zu erwerben oder zu stärken.
Im Sinne eines induktiven Ansatzes werden im umfangreichen und zentralen Teil I des Buches typische Herausforderungen in wichtigen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit als Ausgangspunkte für die weitere Erschließung des Feldes präsentiert. Die Leser*innen lernen an konkreten Fallbeispielen den Menschenrechtsansatz kennen und werden in die Lage versetzt, typische Problemlagen in diesem Lichte zu analysieren, zu bewerten und Handlungsperspektiven zu entwickeln. In jedem dieser Handlungsfelder werden ethische, juristische und politische Dimensionen der ausgewählten Fälle verdeutlicht und in Beziehung gesetzt. Dabei kann und soll es in diesem grundlegenden Lehrbuch nicht (!) um Vollständigkeit in der Analyse eines Handlungsfeldes gehen (auf entsprechende Fachliteratur wird verwiesen); vielmehr geht es um die jeweils exemplarische Diskussion der Frage, was der Menschenrechtsansatz in den konkreten Kontexten bedeutet. So werden in den ethischen Erörterungen wichtige, für die Fallbearbeitung relevante Begriffe und Konzepte erläutert. Im rechtswissenschaftlichen Abschnitt werden jeweils die menschenrechtlichen Normen auf globaler, europäischer und deutscher Ebene analysiert. Im politikwissenschaftlichen Abschnitt geht es v. a. um die politischen Aushandlungsprozesse der Setzung und Umsetzung menschenrechtlicher Standards. Ein Abschnitt mit Positivbeispielen aus der Praxis (der Sozialen Arbeit und verwandter Praxisfelder) schließt die jeweilige Darstellung eines Handlungsfeldes ab.
In Teil II werden die zuvor in den Handlungsfeldern verdeutlichten ethischen, juristischen und politikwissenschaftlichen Grundlagen und Handlungsansätze systematisiert. Diese Kapitel erfüllen einerseits die Funktion einer Zusammenfassung, eröffnen aber auch die Möglichkeit, ausgehend von den Handlungsfeldern in Teil I in den systematischen Teil „zu springen“, um sich ausführlicher mit einer bestimmten Dimension der Thematik zu befassen. Teil III des Buches führt die Methoden und Instrumente des Menschenrechtsansatzes in der Sozialen Arbeit zusammen.
Die Autorin und die Autoren verstehen das Buch als einen Beitrag zur Weiterentwicklung des → Menschenrechtsansatzes der Sozialen Arbeit. Sie hoffen insofern auch auf vielfältige Rückmeldungen: Kritik und Lob sind gleichermaßen willkommen, ebenso und ganz besonders auch Verbesserungsvorschläge sowie Hinweise auf weitere Positivbeispiele, die den Menschenrechtsansatz in die Praxis der Sozialen Arbeit umsetzen (Feedback ist möglich über die Webseite zum Buch: www.hs-duesseldorf.de/menschenrechte).
Literatur
Böhnisch, Lothar/Lösch, Hans (1973): Das Handlungsverständnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determination. In: Otto, Hans-Uwe/Schneider, Siegfried (Hrsg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit (Bd. 2). Neuwied/Berlin, 21–40.
Freire, Paulo (1971): Pädagogik der Unterdrückten. Stuttgart.
Ibrahim, Solava/Alkire, Sabina (2007): Agency & Empowerment. A Proposal for Internationally Comparable Indiscators. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative (Working Paper/Oxford Poverty & Human Development Initiative, 4).
International Federation of Social Workers (IFSW) (1988): Human Rights. International Policy Paper. Genf.
IFSW / IASSW / UN Centre for Human Rights (1994): Human Rights and Social Work. A Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession. Geneva [online].
Kappeler, Manfred (2008): Den Menschenrechtsdiskurs in der Sozialen Arbeit vom Kopf auf die Füße stellen. In: Widersprüche, 28 (1), Heft 107: Soziale Arbeit und Menschenrechte, 33–45.
Mührel, Eric/Röh, Dieter (2013): Menschenrechte als Bezugsrahmen Sozialer Arbeit. Eine kritische Explikation der ethisch-anthropologischen, fachwissenschaftlichen und sozialphilosophischen Grundlagen. In: Mührel, Eric/Birgmeier, Bernd (Hrsg.): Menschenrechte und Demokratie. Perspektiven für die Entwicklung der sozialen Arbeit als Profession und wissenschaftliche Disziplin. Soziale Arbeit in Theorie und Wissenschaft. Wiesbaden, 89–110.
Müller-Hermann, Silke/Becker-Lenz, Roland (2013): Die Soziale Arbeit als „MenschenrechtsprofessionMenschenrechtsprofession“ – Ein (zu) hoher Anspruch. In: Mührel, Eric/Birgmeier, Bernd (Hrsg.): Menschenrechte und Demokratie. Perspektiven für die Entwicklung der sozialen Arbeit als Profession und wissenschaftliche Disziplin. Soziale Arbeit in Theorie und Wissenschaft. Wiesbaden, 125–141.
Prasad, Nivedita (2016): Das Werk von Silvia Staub-Bernasconi. In: Leideritz, Manuela/Vlecken, Silke (Hrsg.): Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit – Schwerpunkt Menschenrechte: Ein Lese- und Lehrbuch. Opladen u. a., 13–28.
Rivest, Marie-Pier/Moreau, Nicolas (2014): Between Emancipatory Practice and Disciplinary Interventions: Empowerment and Contemporary Social Normativity. In: The British Journal of Social Work, 1–16. doi:10.1093/bjsw/bcu017.
Solomon, Barbara Bryant (1976): Black Empowerment. Social Work in Oppressed Communities. New York.
Spatscheck, Christian (2008): Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession. Begründung und Umsetzung eines professionellen Konzeptes. In: Sozial Extra, Heft 5/6, 6–9.
Staub-Bernasconi, Silvia (1995): Das fachliche Selbstverständnis Sozialer Arbeit – Wege aus der Bescheidenheit. Soziale Arbeit als „Human Rights Profession“. In: Wendt, Wolf Rainer (Hrsg.): Soziale Arbeit im Wandel ihres Selbstverständnisses: Beruf und Identität (= Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit e. V., Bd. 2). Freiburg im Breisgau, 57–104.
Staub-Bernasconi, Silvia (2003): Soziale Arbeit als (eine) „Menschenrechtsprofession“. In: Sorg, Richard (Hrsg.): Soziale Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft: Ein Projekt des Fachbereichs Sozialpädagogik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (= Sozialpädagogik/Sozialarbeit im Sozialstaat, Bd. 18). Münster u. a., 17–54.
Staub-Bernasconi, Silvia (2009): Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. In: Birgmeier, Bernd/Mührel, Eric (Hrsg.): Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Theorie(n). Positionen, Kontroversen, Perspektiven. Wiesbaden, 131–146.
Staub-Bernasconi, Silvia (2014): Macht und (kritische) Soziale Arbeit. In: Kraus, Björn/Krieger, Wolfgang (Hrsg.): Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Lage, 363–391.
Teil I Der menschenrechtliche Blick auf Handlungsfelder Sozialer Arbeit
Was Sie in diesem Teil des Buches lernen können
Der Ansatz von Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession muss sich in der Praxis bewähren. Teil I des Buches stellt zwölf Handlungsfelder vor und führt jeweils mit typischen Problemfällen bzw. Herausforderungen ein (Fallbeispiele). Hier bietet sich die Möglichkeit, ethische Argumente kennenzulernen, sich mit den rechtlichen Grundlagen vertraut zu machen und politische Dimensionen auszuleuchten. Am Ende jedes Unterkapitels werden Positivbeispiele aus der Praxis angeführt. Die zwölf Unterkapitel haben nicht den Anspruch, sämtliche Aspekte des Handlungsfeldes zu diskutieren: Sie bieten vielmehr die Möglichkeit, sich exemplarisch mit der menschenrechtlichen Perspektive und menschenrechtlich begründeten Handlungsoptionen vertraut zu machen. Auf Fallbearbeitungen oder ‚Musterlösungen‘ für jeweils vorangestellten Fallbeispiele wird hier verzichtet. Die Leser*innen sollen stattdessen zur eigenen Analyse motiviert und befähigt werden – im Idealfall unterstützt durch einen Austausch mit Lehrenden und anderen Studierenden (in Seminaren oder Arbeitsgruppen).
1 KINDER- UND JUGENDHILFE
1.1 Einleitung
Kinder gehören in unserer Gesellschaft zu denen, die des besonderen Schutzes für ihre körperliche, seelische und geistige Entwicklung bedürfen. Dennoch werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Eltern oder andere Angehörige ihre Kinder nicht nur nicht ausreichend vor Gefahren schützen, sondern selbst demütigen, schlagen, vernachlässigen oder missbrauchen. Unvorstellbar sind die Schäden, die durch ein solches Verhalten verursacht werden und das ganze Leben dieser Kinder bestimmen. I. d. R. bleiben diese Dramen hinter den Wohnungstüren der Betroffenen verborgen, so dass weder die Gesellschaft noch der Staat helfend eingreifen können. Dabei bleiben Kinderrechte auf der Strecke (vgl. Engelhardt 2016). Bei der Entwicklung und Anwendung von Kinderrechten bildet das Kindeswohl den zentralen Maßstab sowohl für den Gesetzgeber als auch für die Verwaltung und Rechtsprechung. Der Begriff des Kindeswohls ist keineswegs statisch zu begreifen, sondern unterliegt einer fortwährenden Überprüfung auf der Grundlage (sozial-)pädagogischer Erkenntnisse.
Fallbeispiel
Sie sind beim städtischen Jugendamt im Allgemeinen Sozialdienst (ASD) beschäftigt und werden u. a. auch in Fällen von Kindeswohlgefährdung tätig. Dabei ist es Ihre Aufgabe, Hinweisen bspw. aus der Nachbarschaft, Kindertagesstätten oder der Schule nachzugehen und nach Kontaktaufnahme mit den Eltern zu entscheiden, welche Hilfen diesen angeboten werden können oder ob Kinder aus den Familien herausgenommen werden müssen. Eines Tages erhalten Sie einen Anruf aus dem Gesundheitsamt und erfahren, dass Frau S., alleinerziehende Mutter, seit einem halben Jahr nicht mehr mit ihrer einjährigen Tochter Yvonne zu den Vorsorgeuntersuchungen kommt. Daraufhin vereinbaren Sie mit Frau S. einen Besuchstermin in ihrer Wohnung, um festzustellen, was Frau S. davon abhält. Zu dem Termin stehen Sie vor verschlossener Tür. Nach 15 Minuten vergeblichen Klingelns und ergebnislosen Versuchen telefonischer Kontaktaufnahme entschließen Sie sich zu gehen, als Sie eine Nachbarin von Frau S. anspricht und Ihnen berichtet, dass Yvonne häufig von ihrer Mutter allein gelassen würde, „weil sie nachts in einer Kneipe kellnert“. Immer wieder käme es dabei vor, dass Yvonne schreie. Weitere Versuche, Kontakt mit Frau S. aufzunehmen, scheitern. In Ihrem Team beraten Sie das weitere Vorgehen.
1.2 Kindeswohl versus Elternrecht: Moralische Normen in Konflikt
Wenn es um den Verdacht der Vernachlässigung oder Misshandlung von kleinen oder Kleinstkindern geht, sind viele geneigt, für die umgehende Herausnahme des Kindes aus der Familie zu plädieren, um weiteren möglichen Schaden abzuwenden.
Aber lässt sich diese erste Intuition ethisch und menschenrechtlich rechtfertigen? Ethisch (und rechtlich) ist die Herausnahme des Kindes aus der Familie eine sog. → Ultima-Ratio-Maßnahme, denn sie stellt einen gravierenden Eingriff in das natürliche Elternrecht auf Pflege und Erziehung der eigenen Kinder dar (vgl. Art. 6 Abs. 2 GG).
Der vorliegende Fall schildert ein ‚klassisches‘ ethisches Dilemma mit zwei konfligierenden moralischen Werten, mit dem Sozialprofessionelle in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe regelmäßig konfrontiert sind (vgl. Großmaß/Perko 2011): Das Recht des Kindes, in Bezug auf sein Wohlergehen geschützt zu werden – das Kindeswohl –, steht in Konflikt mit dem Recht der Mutter, ihre natürliche Elternverantwortung in der von ihr gewählten Weise auszuüben.
Kindeswohl – der zentrale Begriff des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention – KRK)
Alle Entscheidungen, Maßnahmen etc., die Auswirkungen auf ein Kind als individuelle*n Rechtsträger*in oder auf Kinder als Gruppe haben, müssen so gestaltet werden, dass sie die Interessen des Kindes/von Kindern vorrangig berücksichtigen. Was das im konkreten Fall bedeutet, ist auslegungsfähig. Eine sehr gute Auslegungshilfe bietet die → Allgemeine Bemerkung Nr. 14 des Kinderrechtsausschusses der UN (UN CRC 2013). Wichtig ist: Interessen haben nur Subjekte. Was im Interesse des Kindes liegt, muss „aus Sicht des Kindes und unter Beteiligung des Kindes“ (Krappmann 2013, 7) ermittelt werden. Dabei spielen der Kindeswille (Art. 12 KRK) und die sich entwickelnden Fähigkeiten (engl. → Evolving Capacities) eine entscheidende Rolle. Die → KRK nimmt Abstand von eindeutigen Altersfestlegungen für die Beteiligung von Kindern. Sie verpflichtet Sozialprofessionelle, die Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten von Kindern individuell durch angemessene Informationen und Beteiligungsstrukturen sicherzustellen, zu unterstützen und zu fördern.
Das Elternrecht hat der Staat zu achten. Es ist ein zentrales Freiheits- und Abwehrrecht, welches die Bürger*innen vor willkürlichen Eingriffen des Staats in ihr Privat- und Familienleben schützt, und eine wichtige Schranke gegenüber staatlichen Ambitionen, den Bürger*innen ein Leben nach bestimmten Werten zu verordnen. Ethisch gründet die Achtungspflicht des Staates im Gleichheitsgebot/→ Diskriminierungsverbot angesichts der Pluralität individueller Vorstellungen eines → GutenLebens: Menschen haben unterschiedliche Werte und weltanschauliche Ansichten, die sich auch in der Erziehung ihrer Kinder niederschlagen. Diese diversen – miteinander konfligierenden und ggf. unvereinbaren – Konzeptionen des Guten haben grundsätzlich den gleichen normativen Status und sind insofern gleichermaßen durch den Staat zu respektieren (vgl. Hinsch 2002). Die Nachbarin mag das Verhalten der Mutter für schlecht und/oder unmoralisch halten. Der Staat darf sich diese Auffassung nicht zu eigen machen, weil er damit eine einzelne (partikulare) Vorstellung des Guten Lebens, nämlich die der Nachbarin, zum (universalen) ethischen Prinzip und Beurteilungsmaßstab erheben würde. Die Herausnahme des Kindes allein mit Verweis auf den Lebenswandel der Mutter zu begründen sowie der daraus geschlossenen Unfähigkeit, angemessen Verantwortung zu übernehmen, lässt sich ethisch nicht rechtfertigen. Außerdem formulieren die Menschenrechte keine Ansprüche auf optimale Bedingungen, sondern Mindestgarantien für ein menschenwürdiges Leben: Der Staat hat das Kind vor dem Schlimmsten zu bewahren. Die Schwelle liegt nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) bei einer erheblichen, nachhaltigen und absehbaren Beeinträchtigung des Kindeswohls (vgl. BVerfG 24, 119).
Andererseits hat auch das Kind Rechte gegenüber dem Staat bzw. der Staat Pflichten gegenüber dem Kind. Die Rechtsposition des Kindes als eigenständiges → Rechtssubjekt wurde mit der → KRK erheblich gestärkt. Bezogen auf den konkreten Fall hat der Staat die Pflicht gegenüber Yvonne, „den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu [ihrem] Wohlergehen notwendig sind“ (Art. 3 Abs. 2 KRK). Durch welche Maßnahmen das Wohlergehen und die bestverstandenen Interessen des betroffenen Kindes im Einzelfall am besten gewährleistet und geschützt werden können, ist keine einfache Frage, denn auch widerstreitende Ansichten berufen sich unter Umständen auf das Kindeswohl. Diese Frage lässt sich nur empirisch mithilfe der Erkenntnisse der Kindheitspädagogik, der Psychologie und der Erziehungswissenschaften beantworten. Die Schwierigkeit liegt in der Ermittlung der Bedürfnislage des Kindes: Insbesondere Säuglinge und kleine Kinder sind (i. d. R.) noch nicht in der Lage, ihren körperlichen und seelischen Zustand (eindeutig) zu beschreiben. Zudem müsste zwischen dem objektiven Wohl des Kindes und seinem subjektiven Wohl unterschieden sowie der Stellenwert des letzteren gewichtet werden. Während zur Auslegung des objektiven Kindeswohls die in der KRK verfassten Kinderrechte herangezogen werden können, verweist das subjektive Kindeswohl auf die unterschiedlichen Vorstellungen des Guten zurück. Welche universalen Prinzipien können also angesichts pluraler und diverser Konzeptionen des Guten – das Kindeswohl betreffend – Orientierung bieten?
Ein wichtiges normatives Prinzip, das die Kinderrechtsdebatte prägt, ist die Abkehr vom Adultismus, der Erwachsene als Maßstab und Norm setzt für das, was für Kinder als richtig gilt und Kinder damit als unzulänglich markiert. Gegen diese Vorstellung von Kindern als unfertigen Erwachsenen und Objekten der Fürsorge setzt die KRK das Bild des Kindes als Subjekt und Träger von Menschenrechten, welches aufgrund seiner Verletzlichkeit des besonderen Schutzes bedarf. Im Hinblick auf ihren Status als selbstbestimmte → Rechtssubjekte unterscheiden sich Erwachsene und Kinder nicht kategorisch, sondern nur graduell: Selbstbestimmungsfähigkeit markiert ein Kontinuum, welches abhängig von situativen Bedingungen und individuellen Fähigkeiten ist. In welchem Maße Selbstbestimmungsfähigkeit im Einzelfall gegeben ist, ist nicht allein oder vorrangig altersabhängig (vgl. Kap. 12.2).
Im vorliegenden Fall kann sich die Entscheidung, welche Maßnahmen zum Schutz der bestverstandenen Kindesinteressen getroffen werden sollten, aufgrund des geringen Alters des Kindes nur an der „möglichen Zustimmung“ (Giesinger 2013, 12) des betroffenen Kindes orientieren. Bei älteren Kindern sind Entscheidungsträger*innen ethisch (und völkerrechtlich) verpflichtet, diese – in einer ihrem Alter und Entwicklungsstand angemessenen Weise – an der Entscheidungsfindung zu beteiligen (vgl. Krappmann 2013). Moralphilosophisch haben es Sozialprofessionelle hier mit einer abgestuften Problematik zu tun: Wenn Kinder sich frei eine eigene Meinung bilden und diese äußern können, darf ihr freier Wille nicht übergangen werden. Sofern Kinder dies (noch) nicht können, sollte im bestverstandenen Interesse des betroffenen Kindes entschieden werden. Der Verweis auf das geringe Alter des Kindes ist kein per se legitimer Grund, das Kind nicht zu beteiligen. Gründe, die gegen eine Beteiligung des Kindes sprechen, müssen sich vielmehr selbst durch das Kindeswohl rechtfertigen lassen, z. B. wenn eine Anhörung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens das Kind zu sehr belasten würde. Entscheidungen im Sinne des Kindes müssen insofern notwendig folgenden Bedingungen genügen: (1) das Vertrauen des Kindes zu erhalten und (2) die Selbstachtung des Kindes nicht zu untergraben (vgl. Wiesemann 2015).
1.3 Kinder sind Menschenrechtssubjekte
Wenn es um das Wohl des Kindes und seine Menschenrechte geht, ist auf völkerrechtlicher Ebene die → KRK maßgeblich. Weil die KRK mit Gesetz vom 17.02.1992 (BGBl. II, 121) ratifiziert wurde und am 05.04.1992 für Deutschland in Kraft trat, sind die Regelungen unmittelbar geltendes Recht, das von allen Behörden, insbesondere von den Jugendämtern, und den (Familien-)Gerichten angewendet werden muss (Schmahl 2013, Einleitung, Rn. 26). Mit der KRK ist seither international anerkannt, dass auch Kinder, also Menschen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Art. 1), uneingeschränkt menschenrechtsfähig sind. Neben den klassischen → Freiheitsrechten und Prozessgarantien (z. B. Art. 13–16, 37, 40), dem → Diskriminierungsverbot (Art. 2) gehören zu dem Kreis der Kinderrechte auch die sozialen und kulturellen Rechte (Art. 24–29, 32). Bezogen auf den vorliegenden Fall sind die Vertragsstaaten zu geeigneten Maßnahmen in Gesetzgebung, Verwaltung sowie im Sozial- und Bildungsbereich verpflichtet, „um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenzufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen (…)“ (Art. 19 Abs. 1). Dabei wird in Art. 18 auf das Primat der elterlichen Verantwortlichkeit Bezug genommen und die staatliche Pflicht hervorgehoben, die Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, zu denen auch der Schutz ihrer Kinder gehört, angemessen zu unterstützen.
Auf europäischer Ebene ist mit Art. 8 → EMRK eine sehr allgemein gehaltene Menschenrechtsvorschrift vorhanden, die jeder Person das „Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens (…)“ garantiert. Diese Vorschrift gewährleistet eher das Zusammenleben der Eltern mit ihren Kindern und weniger den Schutz von Kindern vor Vernachlässigung. Dennoch wird in Entscheidungen des → Europäischen Gerichtshofs fürMenschenrechte (EGMR) eine bedeutsame Verfahrensdimension von Art. 8 EMRK erkennbar: Zum Schutz der Familie und seiner Mitglieder gehört es auch, dass staatliche Maßnahmen nicht in bevormundender Weise über die Köpfe der Betroffenen hinweg getroffen werden dürfen, sondern alle Familienmitglieder hinreichend an Entscheidungen, die insbesondere Eingriffe in das Familienleben beinhalten, beteiligt werden (EGMR Urteil vom 26.02.2004, Rn. 52f., Görgülü/Deutschland; NJW 2004, 3397–3401).
Im Grundgesetz (GG) fehlt eine den menschenrechtlichen Anforderungen der → KRK angemessene Vorschrift zum Schutz von Kindern. Der menschenrechtliche Gehalt von Art. 6 Abs. 2 GG bezieht sich allein auf die Eltern und ihre Verantwortung bei Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Eher indirekt kommt der Charakter dieser Verfassungsnorm als eine Schutzbestimmung zugunsten von Kindern zum Ausdruck: einmal durch die den Eltern „zuvörderst obliegende Pflicht“, die mit einem Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung korreliert (Michael/Morlok 2014, Rn. 256), und zum anderen in der Schutzpflicht des Staates, der über die Ausübung der elterlichen Sorge zu wachen hat (sog. Wächteramt). Wir haben es also mit einer verfassungsrechtlichen Dreiecksbeziehung zu tun: auf der einen Seite das Kind mit seinen Rechten aus der KRK und dem uneingeschränkt geltenden Postulat aus Art. 3 KRK, nach dem bei allen staatlichen und privaten Maßnahmen das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist; die Eltern auf der anderen Seite, die nach Art. 6 Abs. 2 GG das Grundrecht der elterlichen Sorge besitzen, das als Abwehrrecht gegenüber staatlichen Eingriffen z. B. eine Einmischung in die elterliche Erziehung verbietet; und schließlich der Staat, der bei Grenzüberschreitungen in der Ausübung der elterlichen Sorge in das Grundrecht der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 GG zur Wahrung des Kindeswohls einzugreifen hat.
Wenn wir uns nun Yvonne mit der Frage nach ihrem Schutz zuwenden, beschreiten wir das Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) – und hier das Recht der elterlichen Sorge – sowie das Kinder- und Jugendhilferecht des SGB VIII. Ausgangspunkt zur Durchsetzung des Schutzes der einjährigen Yvonne ist der – allgemein gehaltene – Schutzauftrag des Jugendamtes nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII. Liegen gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, muss das Jugendamt gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII tätig werden, indem es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen hat. Dies soll i. d. R. mit den Erziehungsberechtigten gemeinsam geschehen. Die bisherigen Versuche der Kontaktaufnahme mit Frau S. waren also richtig; sie weiterhin zu unternehmen, sollte zunächst die Aufgabe des Jugendamtes bleiben. Weil alle weiteren Schritte, die § 8a SGB VIII vorsieht, davon abhängen, wie es Yvonne gesundheitlich geht und wie ihre Mutter ihrer Erziehungsverpflichtung nachkommt, muss das Jugendamt Zugang zu beiden finden. Gelingt dies nicht, weil Frau S. den Kontakt grundsätzlich verweigert, muss das Jugendamt das Familiengericht einschalten (§ 8a Abs. 2 SGB VIII), das nun nach § 1666 BGB über weitere, dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit entsprechende Maßnahmen zu entscheiden hat, die von dem Gebot, Hilfen des Jugendamtes anzunehmen, bis zur Entziehung des elterlichen Sorgerechts reichen (§ 1666 Abs. 3 BGB).
Verhältnismäßigkeit
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips Verfassungsrang und sowohl im internationalen als auch im deutschen Recht eine besondere Bedeutung, weil bei allen staatlichen Eingriffen in die → Freiheitsrechte der Bürger*innen prinzipiell die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt, dass jede Maßnahme auf kommunaler, staatlicher oder transnationaler Ebene geeignet, erforderlich und angemessen ist. Geeignet ist eine Maßnahme dann, wenn sie den vom Gesetz oder einem internationalen Vertrag angestrebten Zweck erreicht. Bei der Frage nach der Erforderlichkeit ist zu prüfen, ob der Zweck nur durch die vorgesehene Maßnahme oder auch durch weniger eingriffsintensive Entscheidungen realisiert werden kann, die den/die Betroffene*n oder die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigen. Stehen mehrere geeignete Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung, so müssen die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen und das am geringsten einschneidende Mittel gewählt werden. Ob eine geeignete und erforderliche Maßnahme auch angemessen ist, muss in einer Abwägung der Interessen bzw. Rechte des/der Betroffenen mit denen des Gemeinwesens ermittelt werden. Dabei darf der Nachteil, der aufgrund der staatlichen Maßnahme entsteht, nicht erkennbar in grobem Missverhältnis zu dem angestrebten Erfolg stehen. Mit der sprichwörtlichen Redensart, wonach man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen darf, kommt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das damit verbundene Übermaßverbot gut zum Ausdruck (vgl. BVerfGE 104, 347; Trenczek u. a. 2014, 100–103; Grabenwarter/Pabel 2016, § 18 Rn. 14–24).
1.4 Kinderrechte: im politischen Alltag umkämpft
In Sonntagsreden, Grundsatzprogrammen und Wahlbroschüren sind sich alle einig: den Kindern gebührt nur das Beste. Kindeswohl, Kinderrechte und Kindesschutz sind weitgehend anerkannt. Bekanntwerdende Fälle von tatsächlicher oder vermeintlicher Vernachlässigung – wie im geschilderten Fall – werden regelmäßig verurteilt. Gleichwohl: Die Umsetzung hehrer Grundsätze in die Realität des politischen Alltags ist immer wieder politisch umstritten.
Dies beginnt mit sehr grundlegenden, normsetzenden Aspekten: Der rechtliche Rahmen, in dem sich Sozialprofessionelle heute bewegen, wenn sie nach dem Kindeswohl fragen, ist das Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse, die sich über Jahrzehnte hingezogen haben. Schon 1913 fand ein erster internationaler Kinderschutz-Kongress statt, bei dem über notwendige Verträge diskutiert wurde. In seiner „Genfer Erklärung“ von 1924 formulierte der Völkerbund erste Grundsätze, die 1959 in einer UN-Resolution über Kinderrechte weiterentwickelt wurden. Es brauchte weitere 40 Jahre politischer Lobbyarbeit und vielfacher Verhandlungen, bis 1989 endlich die völkerrechtlich verbindliche → KRK verabschiedet wurde (der erste Entwurf war bereits 1980 vorgelegt worden); ein politischer Mammutprozess, der auch ganz wesentlich von internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen – einer Kinderrechtsbewegung – forciert worden war (vgl. Fuchs 2007). Die Ratifizierung der Konvention durch die Staatenwelt gelang vergleichsweise gut, aber auch hier mit politisch gewollten Einschränkungen. So ratifizierte Deutschland 1992 z. B. nur unter → Vorbehalt: U. a. wurden die in der Konvention definierte Altersgrenze von 18 Jahren sowie die Anerkennung von Kinderrechten für ausländische Kinder nicht vollständig akzeptiert. Es brauchte nahezu 20 Jahre politischer Lobby- und Kampagnenarbeit deutscher Kinderrechtsorganisationen, bis dieser Vorbehalt 2010 zurückgenommen wurde (vgl. Kasten). Ebenso begannen Kinderrechtslobbyist*innen schon in den 1990er Jahren damit, sich für ein → Fakultativprotokoll zur Einführung eines → Individualbeschwerderechts zur KRK zu engagieren. Was zunächst als aussichtsloses Unterfangen von Idealist*innen galt, wurde nach über 15 Jahren Realität: Das Fakultativprotokoll wurde 2013 auch vom Deutschen Bundestag ratifiziert.
Lobbyarbeit für Kinderrechte
Als der Deutsche Bundestag die → KRK nur unter → Vorbehalt ratifizierte, um ausländischen und deutschen Kindern unterschiedlichen Zugang zu den vollen Rechten zu gewähren, regte sich sofort Protest. Aber nur jahrelange zähe Lobby- und Kampagnenarbeit von Kinderrechtsorganisationen, verbunden auch mit zahlreichen parlamentarischen Initiativen und Beschlüssen (v. a. in den Jahren 1999–2001), zeigten am Ende politischen Erfolg. Einen besonderen Einfluss auf diesen Prozess hatte die NationalCoalitionfür die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, die 1995 nach dem Vorbild anderer Länder von rund 40 Organisationen gegründet wurde. Das Netzwerk umfasst heute 110 bundesweit tätige Organisationen. Weiterhin kämpft das Netzwerk darum, die KRK in vollem Umfang in Deutschland zur Geltung zu bringen. Das Netzwerk spielte auch bei der 2001 von der Kindernothilfe ins Leben gerufenen Kampagne für die Zustimmung der Bundesregierung zur Einführung eines → Individualbeschwerdeverfahrens eine starke Rolle, ebenso die rund 50 Organisationen im Netzwerk Forum Menschenrechte (vgl. Dünnweller 2009).
Mit der Einrichtung einer → Monitoringstelle für Kinderrechte am → Deutschen Institut fürMenschenrechte (DIMR) im September 2015 bekam die Umsetzung der Kinderrechte endlich auch institutionelle Rückendeckung. Diese kurze Skizze zeigt: Völkerrechtlich verbindliche Menschenrechtsnormen sind das Ergebnis eines oft langwierigen politischen Kampfes.
Die Umsetzung solcher Normen ist aber mit der Ratifizierung bei weitem nicht abgeschlossen. Zahlreiche kinder- und familienpolitische Streitpunkte standen in den vergangenen Jahren allein in Deutschland auf der Agenda: die Debatte um wirksame Maßnahmen gegen Kinderarmut; die Forderung nach ausreichenden Kita-Plätzen, auch für Kinder unter drei Jahren (U3); der Streit um das Betreuungsgeld (‚Herdprämie‘); die Behandlung Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge – um nur wenige Beispiele zu nennen. Hinter diesen Streitpunkten stehen unterschiedliche, z. T. konträre ethische und politische Grundverständnisse, z. B. über die Verantwortung des Staates und die Freiheit der Eltern. Doch oft (wie in vielen Politikfeldern) geht es ganz schlicht um knappe Ressourcen: Wie viel Geld wird für die Bekämpfung von Kinderarmut, Familienpolitik, Kindesschutz usw. bereitgestellt? Die jährlichen Haushaltsdebatten im Bundestag (und je nach Zuständigkeit auch in den Länderparlamenten und kommunalen Vertretungen) zeugen von diesen politischen Kämpfen. Solche haushaltspolitischen Entscheidungen haben konkrete Auswirkungen: Wie werden z. B. Jugendämter personell und finanziell ausgestattet? Gibt es genügend Sozialpädagog*innen oder Sozialarbeiter*innen, die sich um das Wohl von Kindern bemühen können, die in prekären Lebenslagen oder fragilen familiären Situationen aufwachsen? Die Beantwortung dieser Fragen hängt ganz wesentlich mit den Haushaltsmitteln zusammen, die von staatlicher Seite für diese Arbeit bereitgestellt werden. Finanzielle Ressourcen sind knapp – der politische Streit um ihre Verteilung ist allgegenwärtig.
Politik für Kinderrechte setzt auf vielen Ebenen an. Eine sehr grundsätzliche Forderung, für die Kinderrechtsorganisationen seit Jahren kämpfen (z. B. die National Coalition, das Netzwerk zur Umsetzung der → KRK), ist es, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Dies spiegelt u. a. die bereits erwähnte Forderung nach einer Abkehr von der Perspektive, die Erwachsene zum Maß aller Dinge macht. Eine Verankerung von Kinderrechten würde unterstreichen, so die Befürworter, dass Kinder eigenständige Persönlichkeiten sind. Darüber hinaus würde die Kernforderung der KRK – Vorrang des Kindeswohls – durch eine grundgesetzliche Verankerung ein starkes Gewicht erhalten, das sicherlich großen Einfluss sowohl auf die weitere Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis als auch auf politische Entscheidungen, z. B. Ressourcen- und Haushaltsentscheidungen, hätte (vgl. Benassi 2012). Inzwischen findet die Forderung auch Unterstützung bei manchen Politiker*innen, auch in den großen Parteien. Doch der Widerstand ist stark. Das sei reine Symbolpolitik, argumentieren die Gegner*innen, denn Kinder seien doch längst – wie die Erwachsenen – Träger der im Grundgesetz verankerten Grundrechte. Von einer notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit ist die Forderung noch weit entfernt. Doch, wie schon eingangs aufgezeigt wurde: Für die politische Weiterentwicklung von Kinderrechten und ihre konkrete Umsetzung muss wohl in Jahrzehnten, nicht in Jahren oder noch kürzeren Perioden gedacht werden.
1.5 Positivbeispiele aus der Praxis
Der einleitend skizzierte Fall einer Kindeswohlgefährdung gehört zu den regelmäßigen Erscheinungen in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Der → Menschenrechtsansatz in der Sozialen Arbeit befähigt in dieser Situation dazu, eine klare anwaltschaftliche Position zugunsten der betroffenen Kinder einzunehmen, ohne dabei die Rechte der Eltern aus den Augen zu verlieren. Im Falle von offensichtlichen Kinderrechtsverletzungen ist staatliches Eingreifen vonnöten. Der Vorrang des Kindeswohls ist in solchen Situationen bei jedem einzelnen Schritt zu ermitteln und umzusetzen. Vielerorts haben Träger oder auch Jugendämter konkrete Empfehlungen für Sozialprofessionelle erarbeitet, wie bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorzugehen ist (z. B. das Jugendamt der Stadt Konstanz). Kinderrechtlich verankerte Organisationen bieten sozialprofessionell tätigen Fachkräften dazu auch Fortbildungen und rechtliche Beratung an, bspw. der Kinderschutzbund (bundesweit) oder auch zahlreiche lokale Organisationen. Ein spannendes Beispiel ist die Einrichtung Till Eulenspiegel der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Düsseldorf, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Interessen und Rechte von Kindern zu vertreten. Dabei berät die Einrichtung auch sozialprofessionell tätige Menschen in konkreten Konfliktsituationen. Sozialpädagog*innen aus anderen Einrichtungen können sich hier in konkreten Konfliktfällen Rat zu kinderrechtlichen Fragen holen. Besonders hervorzuheben ist, dass sich auch Kinder und Jugendliche selbst an Till Eulenspiegel wenden können, um Rat zu suchen. In kleinen Workshops mit Schulkindern werden diese über ihre Rechte informiert und haben in Beratungsstunden in der Schule Gelegenheit, ihre Anliegen und/oder Beschwerden vorzutragen.
Der Schutz von Kinderrechten kann und muss allerdings viel früher einsetzen: Sehr viel besser ist die Prävention. Hier gibt es inzwischen hervorragende Beispiele aus der Praxis. So gibt es in einer Reihe von Städten Kampagnen, die auf eine umfassende Nutzung der Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitlichen Beratungen abzielen, z. B. die Kampagne Enemene-Mu. Hey ich will zur U. des Kinderschutzbundes Hamburg. Bundesweit in über 100 Kitas wurde vor einigen Jahren die Kampagne Ich geh zur U! Und du? der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durchgeführt. In zahlreichen sozial- bzw. kindheitspädagogischen Einrichtungen wurden Elemente dieser Kampagnen aufgenommen und auch dauerhaft verankert.
Auf dauerhafte Verankerung zielen auch einige kommunalpolitische Initiativen. Das „Dormagener Modell“ ist ein solches, in der Fachwelt sehr beachtetes Beispiel für eine präventive kinderrechtsorientierte Arbeit – ein anderes ist das Großprojekt Monheim für Kinder





























