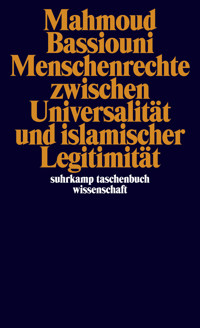
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Menschenrechte befinden sich im zeitgenössischen islamischen Diskurs in einem normativen Spannungsfeld. Einerseits müssen sie islamisch legitimiert, das heißt im islamischen Rechtsdenken verankert werden, andererseits sollen sie aber auch universal konsensfähig sein. Mahmoud Bassiouni entwickelt in seinem bahnbrechenden Buch eine neue Möglichkeit, diese beiden Ansprüche gleichzeitig zu erfüllen, indem er Menschenrechte, angelehnt an die Theorie der islamischen Rechtszwecke (»maqāsid al‐šarīʿa«), als Institutionen zum Schutz grundlegender menschlicher Bedürfnisse konzipiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Menschenrechte befinden sich im zeitgenössischen islamischen Diskurs in einem normativen Spannungsfeld. Einerseits müssen sie islamisch legitimiert, das heißt im islamischen Rechtsdenken verankert werden, andererseits sollen sie aber auch universal konsensfähig sein. Mahmoud Bassiouni entwickelt in seinem bahnbrechenden Buch eine neue Möglichkeit, diese beiden Ansprüche gleichzeitig zu erfüllen, indem er Menschenrechte, angelehnt an die Theorie der islamischen Rechtszwecke (maqāṣid al‐šarīʿa), als Institutionen zum Schutz grundlegender menschlicher Bedürfnisse konzipiert.
Mahmoud Bassiouni ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft sowie am Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Mahmoud Bassiouni
Menschenrechte zwischen Universalität und islamischer Legitimität
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2114.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73876-4
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Danksagung
Einleitung: Menschenrechte als Identitätsfrage
I. Kontexte des muslimischen Menschenrechtsdiskurses
1. Der zeitgenössische Kontext
1.1. Muslime als Teil der internationalen Menschenrechtsdebatte
1.2. Kritik an der westlichen Menschenrechtspolitik
1.3 Reaktion auf westliche Kritik
2. Historischer Kontext
2.1. Trialog der Identitäten
2.2. Religiöses Verständnis in Raum und Zeit
3. Theologischer Kontext
3.1. Scharia und Fiqh
3.2. Differenzierung des islamischen Rechts
3.3. Die Stagnation des islamischen Rechts
3.3.1. Klassische Erklärungsmodelle
3.3.2. Autoritätskonstruktion und taqlīd
3.3.3. Spaltung der geistigen und politischen Autorität
3.4. Islamisches Rechtsverständnis zwischen Text und Kontext
II. Rekonstruktion des muslimischen Menschenrechtsdiskurses
4. Ablehnung und Unvereinbarkeit
4.1. Das Argument der Unvereinbarkeit – eine kritische Analyse
4.1.1. Das islamische Modell für die Realität
4.1.2. Unvereinbarkeit von Islam und Menschenrechten
5.6Aneignung
5.1. Menschenrechte und Urheberrechte
5.2. Sakralisierung der Menschenrechte
5.3. Islamisierung der Menschenrechte
6. Angleichung
6.1. Textueller Ansatz
6.2. Evolutionärer Ansatz
6.3. Intentionaler Ansatz
6.4. Hermeneutischer Ansatz
6.5. Pragmatischer Ansatz
7. Bilanz und Perspektive
III. Islamische Grundlagen einer universalen Menschenrechtskonzeption
8. Der Zweck des islamischen Rechts (maqāṣid al-šarīʿa)
8.1. Vom Grund zum Zweck
8.2. Die Suche nach den Zwecken des islamischen Rechts
8.3. Zwecktheorie bei al-Šāṭibi
8.4. Implikationen der maqāṣid für die islamische Rechtsfindung
9. Ein kritischer Rückblick
10. Neue Konzeptionen der maqāṣid
IV. Menschenrechte und menschliche Bedürfnisse
11. Konzeptionen der Menschenrechte
11.1. Menschenrechte und Konsens
11.2. Menschenrechte und Souveränität
11.3. Menschenrechte und Rechtfertigung
11.4. Menschenrechte und normative Handlungsfähigkeit
11.5. Menschenrechte und Interessen
12.7Menschliche Bedürfnisse
12.1. Was sind Bedürfnisse?
12.2. Welche Bedürfnisse hat der Mensch?
12.2.1. Bedürfnisse aus motivationspsychologischerPerspektive
12.2.2. Bedürfnisse aus soziohistorischer Perspektive
12.2.3. Bedürfnisse aus der Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung
12.3. Zusammenfassung
13. Menschenrechte als Institutionen zum Schutz menschlicher Bedürfnisse
13.1. Rekurs: maqāṣid al-šarīʿa
13.2. Menschenrechte zwischen Bedürfnissen und Gefährdungen
13.3. Menschenrechtliche Prioritäten und Interdependenzen
Schluss
Literaturverzeichnis
9Danksagung
Das vorliegende Buch ist das Ergebnis eines langjährigen Prozesses, der ohne die Mithilfe und das Engagement vieler Personen nicht hätte begonnen, durchlaufen oder vollendet werden können. Zu tiefstem Dank verpflichtet bin ich an erster Stelle Rainer Forst, für sein großes Vertrauen und seine unermessliche Unterstützung, die weit über den Rahmen dieser Arbeit hinausging und hinausgeht. Er hat dieses Projekt von Anfang an begleitet, durch richtungsweisende und konstruktive Kritik geformt und trotz der einen oder anderen inhaltlichen Differenz durchgehend gefördert. Ömer Özsoy hat dieses Projekt stets mit unterstützendem Interesse verfolgt und mir oft dazu verfholfen, mich vom akademischen Selbstzweifel zu befreien. Ihm habe ich zudem die wertvolle Möglichkeit zu verdanken, Teil der sich neu etablierenden Islamischen Theologie in Frankfurt sein zu dürfen, was mir die Gelegenheit gab, meine Gedanken mit Kolleginnen, Kollegen und Studierenden zu diskutieren.
Mohamed Nagy Ibrahim ist es zu verdanken, dass dieses Buch überhaupt entstanden ist. Er hat mir seine Tage und Nächte gewidmet, um mich durch die Tiefen der islamischen Rechtsphilosophie zu führen, und musste sich dabei mit meinen ungeduldigen Fragen auseinandersetzen, die er mit seinem scheinbar unerschöpflichen Wissen stets in aller Ausführlichkeit beantwortet hat. Viele wichtige Gedanken haben sich dabei erst in Gesprächen mit Tasniem Ibrahim entwickelt, die mir stets mit aufopferungsvoller Hilfsbereitschaft zur Seite stand. Ihre Unterstützung trug in erheblichem Maße zur Fertigstellung dieses Buches bei. Eva Buddeberg hat mir in vielen konstruktiven Gesprächen mit ihren scharfsinnigen Fragen dazu verholfen, meine Gedanken zu sortieren und zu konkretisieren; hierfür und für ihre wertvolle Freundschaft sei ihr von Herzen gedankt. Jan-Erik Strasser vom Suhrkamp Verlag danke ich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und für die vielen wertvollen Hinweise bei der Durchsicht des Manuskripts. Meinem Vater Mohamed Bassiouni danke ich für seine Geduld und seine liebevolle Unterstützung, die mir in Form von lachsbelegten Kürbiskernbrötchen und Kaffee lange 10Zeit den Morgen versüßte. Mein Bruder Yosef Bassiouni trug mit seinem Witz und Humor dazu bei, den oft frustrierenden Alltag des Denkens und Schreibens mit Heiterkeit zu füllen.
Ich hielt es immer für eine charmante Geste, wenn sich Wissenschaftler ihren größten Dank aufsparen, um ihn gegen Ende der Danksagung an ihre Lebenspartner zu richten. Mittlerweile ist mir jedoch klargeworden, dass dies nur wenig mit Charme zu tun hat. Denn ohne die unnachgiebige Unterstützung, die ständige Ermunterung und die inhaltlichen Anregungen von Sara Hallouda, meiner Frau, wäre diese Arbeit nur schwer zu bewältigen gewesen. Sie gab mir in langen Gesprächen über so romantische Themen wie die islamische Rechtsmethodik viele Denkanstöße und verhalf mir so zu einem besseren Verständnis meiner Gedanken. Dafür und für all das, was sich nicht in Worte fassen lässt, sei ihr meine tiefste Dankbarkeit ausgesprochen.
Ich widme diese Arbeit dem Gedenken an meine Mutter, Wafaa Assaf, und an meine Großmutter, Hoda Helmy.
Frankfurt am Main, August 2014
11Einleitung: Menschenrechte als Identitätsfrage
Es schadet nichts, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der islamischen Gedankenwelt mit der Feststellung einzuleiten, dass wissenschaftliche Untersuchungen nicht dazu dienen, zu loben oder zu tadeln, sondern primär unternommen werden, um zu fragen, zu hinterfragen, zu verstehen und zu erklären. Dieser basale Befund sei hier deswegen erwähnt, weil er bezüglich der vorliegenden Thematik keinesfalls als selbstverständlich betrachtet werden kann. Nicht selten laufen Forschungsunternehmen darauf hinaus zu zeigen, wie rückständig oder unvernünftig der Islam als Ganzes oder in seinen Teilaspekten ist, während von anderer Seite versucht wird, die Überlegenheit des Islams gegenüber anderen Konzepten zu beweisen. Dass solche Versuche oft von Vorurteilen, Vorwürfen, Belehrungen und schlichter Unwissenheit geprägt sind, lässt sich leicht erschließen. Diese Tendenz mag angesichts der Natur des Diskurses, in dem sich die zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem Islam befindet, auch nicht weiter verwundern. Man kann dabei von einem Identitätsdiskurs sprechen.1 Identität, genauer: kulturelle Identität, erfordert Abgrenzung gegenüber anderen. Sie beinhaltet immer die Frage nach dem, was wir gemeinsam haben und was uns von anderen unterscheidet. Mit dieser Differenzierung geht zumeist ein hierarchisches Denken einher, das zur Konstruktion des Selbst oft eine Abwertung des Anderen mit sich bringt. Der Diskurs um den Islam ist dementsprechend emotional stark besetzt. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit einer Thematik steht dabei oft nicht im Vordergrund, sondern wird – bewusst oder unbewusst – mit der Zielsetzung unternommen, ein Verständnis von Identität zu entwickeln, mit dem man sich vom Anderen abzugrenzen versucht. In diesem Rahmen ergeben sich feste Denk- und Argumentationsstrukturen, die ein partikuläres und stereotypisches Verständnis des Anderen mit sich bringen 12und darauf hinauslaufen, ein bestimmtes Selbstverständnis zu bestätigen oder zu definieren. So wird von einer Seite mit einer gewissen Buchgelehrsamkeit der Frage nachgegangen, inwieweit es »dem Islam« gelungen ist, »westliche Werte« auf dem Wege der Nachahmung zu rezipieren, während auf der anderen Seite versucht wird, eigene »islamische Werte« durch Abgrenzung vom »Westen« zu benennen und zu rechtfertigen. Debatten zu komplexen Themen geraten dadurch oft in ein Spannungsfeld von Hochmut, Apologetik und Polemik und verlieren so an produktiver Substanz.
Wohlgemerkt handelt es sich beim Wertestreit in erster Linie um eine politische Frage. Es sind nämlich nicht metaphysische Streitigkeiten, etwa die Existenz oder Nichtexistenz Gottes, sondern gesellschafspolitische Werte, die das Zentrum der Kontroverse bilden. Nicht zu verkennen ist dabei das Ungleichgewicht der Kräfte, mit denen über soziale und politische Werte debattiert wird. Zu deutlich tritt das Dominanzverhältnis in der Gegenüberstellung von westlicher Fortschrittlichkeit und islamischer Rückständigkeit hervor, zu stark der Dualismus zwischen westlicher Friedfertigkeit und islamischer Gewaltbereitschaft, zu verwurzelt ist die Vorstellung einer spezifisch westlichen Rationalität jenseits islamischer Frömmigkeit und zu selbstverständlich die Auffassung der Freiheit und der Toleranz als Merkmale der westlichen und Defizite der islamischen Kultur. Kulturelle Simplifizierungen wie diese finden ihre Prägung sicherlich darin, dass der scheinbaren »geistigen« Dominanz des Westens eine unleugbare »materielle« Dominanz auf politischer, ökonomischer, militärischer und technologischer Ebene zugrunde liegt. Die Identitätsfrage lässt sich losgelöst von sozialpolitischen Machtstrukturen also nicht erläutern. Diese Feststellung ist wichtig und verdient Beachtung, da sie es uns erlaubt, den Diskurs im Kontext seiner Herrschaftsverhältnisse zu verstehen. Es erweist sich dabei für das genaue Verständnis der zeitgenössischen Auseinandersetzung als unumgänglich, den Diskurs in seiner Aktualität im Lichte seiner kolonialen und postkolonialen Vorgeschichte zu betrachten.2 Denn neben den tiefgreifenden Auswirkungen der 13Kolonialphase auf die Umgestaltung und Verfestigung politischer und wirtschaftlicher Machtstrukturen rief die damit einhergehende »Kolonialisierung des Geistes« ein Grundmuster der (Selbst)Wahrnehmung hervor, dessen Dynamik bis in die heutige Zeit hineinreicht: Europa, in seiner kulturellen Höherwertigkeit bestätigt, wurde zum Inbegriff des »Eigentlichen«; das »Europäisch-Sein« wurde zur Norm. Das muslimische Bewusstsein dagegen verfiel angesichts der europäischen Herausforderung der »Dialektik des kolonisierten Geistes«3 und neigte dazu, seine eigene Identität – in der Abgrenzung zu Europa – zwischen Bewunderung und Abneigung zu suchen.
Anhand dieses Dominanzverhältnisses ist daher für den zeitgenössischen Diskurs eine wichtige Differenzierung vorzunehmen, der zufolge sich zwei unterschiedliche Tendenzen identifizieren lassen, die man jeweils als Identitätsfindung auf muslimischer und als Identitätswahrung auf europäischer Seite bezeichnen kann. Identitätswahrung bezeichnet dabei einen Prozess, in dem bestimmte soziale und politische Werte zu essenziellen Eigenschaften des eigenen Kulturkreises erklärt und als Merkmale der eigenen Identität definiert werden. So liegt es beispielsweise im »Europäisch-Sein«, die Freiheit zu schätzen, für die Demokratie einzutreten und die Menschenrechte zu achten. Normative Werte werden also zu kulturellen Attributen des »Selbst-Seins«. Die eigene Identität wird so zu einem Überbegriff normativer Werte gemacht und folglich selbst zum Maßstab dessen, was als normativ zu gelten hat. Dies wird letztendlich vor allem dadurch erreicht – und hier entsteht der Bezug zur Auseinandersetzung mit dem Islam –, dass dem »Europäisch-« oder »Westlich-Sein« ein Gegenpol des »Anders-Seins« gegenübergestellt wird, dessen Eigenschaften im Widerspruch zu den vermeintlichen Eigenschaften des Westens stehen.4 Es findet 14ein Prozess der subjektiven Wahrnehmung statt, dessen Ziel es nicht ist, ein reales Bild des Anderen zu suchen, sondern, ausgehend vom Selbstbild, ein Bild des Gegenübers zu (er)finden, das den Zwecken der Selbstdefinition gerecht wird. In diesem Sinne schreibt Ernest Renan beispielsweise: »Der Islam ist die komplette Negation Europas; Islam ist Fanatismus, […] die Verachtung der Wissenschaft, die Unterdrückung der Zivilgesellschaft, er ist die entsetzliche Einfachheit des semitischen Geistes, der den menschlichen Verstand einschränkt und ihn für jede feinfühlige Idee, jedes feine Gefühl, jede rationale Forschung verschließt, um ihn vor eine ewige Tautologie zu stellen: Gott ist Gott.«5 Das »Wissen« über den Islam, das aus dieser hegemonialen Perspektive erzeugt wird, dient daher weniger der wissenschaftlichen Erkenntnis als der Spiegelung der eigenen Identität.6 Dem Islam als Verkörperung dieses Anders-Seins werden dementsprechend Eigenschaften zugesprochen, deren Funktionalität im Wesentlichen darin besteht, die Differenz und Unvollkommenheit in Relation zur eigenen Identität hervorzuheben. Muslime befinden sich demnach in einem Spannungsfeld zwischen einem in der Vormoderne steckengebliebenen Islam und der europäischen Moderne, die für Muslime nur dadurch erreichbar zu sein scheint, dass sie 15sich im Zuge einer fälligen Aufklärung dem westlichen Wertekanon anschließen.
Einige Muslime haben dieses Szenario kapitulierend akzeptiert. Die Mehrheit der Muslime jedoch befindet sich demgegenüber in einer Abwehrhaltung, und dies gilt, wie Krämer beobachtet, selbst für jene, die diese Werte grundsätzlich bejahen.7 Der Grund hierfür liegt im Bestreben, der »aufklärerischen Arroganz« entgegenzutreten und sich gegen die oktroyierte Inferiorität und die damit verbundenen Angriffe auf die eigene Identität zu verteidigen. Dies drückt sich oft in einer Tendenz aus, die eigene Identität im Gegensatz zu dem zu definieren, was sie nicht sein soll, nämlich westlich. »Islamische Werte« sollten demnach jenseits von all dem liegen, wofür der Westen steht. Auf diese Weise wird der Islam zu einem wesentlichen, wenn nicht ausschließlichen Bestandteil der kulturellen Identitätskonstruktion, der gegen äußere Angriffe verteidigt werden muss. Muslim zu sein bedeutet infolgedessen nicht mehr nur, islamische Glaubens- und Moralnormen zu befolgen, sondern beinhaltet implizit auch eine politische Oppositionshaltung. Soroush unterscheidet in diesem Zusammenhang passend zwischen zwei Formen des Islams: »Dem Islam der Identität und dem Islam der Wahrheit. Im ersteren ist der Islam ein Deckmantel für kulturelle Identität und eine Antwort auf die wahrgenommene ›Identitätskrise‹. Der letztere versteht den Islam als eine Quelle von Wahrheiten, die auf den Weg der diesseitigen und jenseitigen Erlösung weisen.«8 Die Tendenz, die eigene Identität vornehmlich unter dem Aspekt zu definieren, anders zu sein als der Westen, ist kein spezifisch muslimisches Phänomen, sondern, wie Sen schildert, ein allgemeines Entwicklungsmuster reaktiver Identitäten.9 Diese »reaktive Selbstwahrnehmung« bewirkt dabei unter anderem auch, dass viele Werte und Ideen oft abgelehnt oder zumindest negativ konnotiert werden, weil man sie für westlich hält, und dies, obwohl sie historisch durchaus in der eigenen Kultur verbreitet 16waren. Es wird stattdessen versucht, im Wettstreit mit dem Westen einen »eigenen Souveränitätsbereich«10 auf moralischer und religiöser Ebene zu etablieren. Da im Bereich der Wissenschaft und Technik die Überlegenheit des Westens zwangsläufig anerkannt und dessen Errungenschaften imitiert werden müssen, gilt es nun, auf geistig-moralischer Ebene die eigene Unabhängigkeit zu beweisen und sich gegen die »kulturelle und intellektuelle Invasion der islamischen Welt«11 zu wehren. Im Zuge dessen wird der Westen nur allzu gerne als Ort der moralischen Anarchie, der defekten Familien und des Konsumwahns dargestellt, als Ort, an dem Freiheit bloß sexuelle Zügellosigkeit bedeutet, sowie als homogene Einheit, in der Menschenrechte und Demokratie lediglich Mittel eines andauernden Kulturimperialismus sind. Sosehr der Prozess der Identitätsfindung jedoch in Abgrenzung zum Westen verlaufen mag, losgelöst von ihm wäre er nicht zu verstehen. Die eigene Identität wird nämlich erst dadurch bestimmt, dass der Zirkel der Identitätsfindung auf den Kreismittelpunkt »Westen« fixiert wird, selbst wenn der Kreis dann mit dem größtmöglichen Radius gezogen wird. Auch die Konzipierung »eigener« islamischer Werte und Konzepte entspringt lediglich einem reaktiven Impuls auf die westliche Herausforderung, der es Paroli zu bieten gilt.
Aus dem eben Skizzierten wird ersichtlich, dass der Identitätsdiskurs, in dessen Rahmen die Auseinandersetzung mit dem Islam überwiegend stattfindet, für die wissenschaftliche Erkenntnis von eher geringem Wert ist. Es ist ein politischer, das heißt machtabhängiger Diskurs, in dem Positionen aus einem bestimmten Herrschaftsverhältnis heraus artikuliert werden und der für die dominante Gruppe den Zweck erfüllt, die Stellung der eigenen Identität zu bestätigen (Identitätswahrung), und der dominierten Gruppe einen Rahmen vorgibt, um die eigene Identität zu bestimmen (Identitätsfindung). Die Rollen der Diskursteilnehmer und deren Selbstverständnis sind in diesem Sinne durch die Diskursstruktur schon vorgegeben. Der Zweck des Identitätsdis17kurses ist dementsprechend nicht eine offene, diskursive Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Anliegen, sondern die Demonstration der eigenen Überlegenheit bzw. Unabhängigkeit.
Ein deutliches Beispiel für dieses Phänomen bietet die Diskussion darüber, ob und inwiefern der Islam mit den Menschenrechten zu vereinbaren ist. Gudrun Krämer hat die Situation klar erfasst, wenn sie sagt, dass das »Thema der Menschenrechte […] zum Inbegriff einer Auseinandersetzung, wenn nicht eines Kulturkampfes geworden [ist], in dem jede Seite ihre kulturelle Überlegenheit, ihre Humanität und ihren Humanismus zu beweisen sucht«.12 So fällt es auch nicht schwer, den üblichen Verlauf des muslimisch-westlichen Menschenrechtsdiskurses zu rekonstruieren: Dieser beginnt meist mit dem Vorwurf einer geschichtlich erwiesenen essenziellen Unfähigkeit islamischer Länder, die Menschenrechte zu beachten. Infolgedessen gelangt der »Beobachter zu dem Schluss […], dass dies nicht allein auf besonders ungünstige soziostrukturelle Voraussetzungen zurückzuführen sein könne, sondern ganz wesentlich mit Mentalität und (politischer) Kultur zu tun haben müsse, und in letzter Konsequenz mit dem Islam«.13 Als Einleitung zur Abwehr gegen diese Anschuldigung fragen die Muslime daraufhin ihre westlichen Dialogpartner, ob »es je quantitativ und qualitativ schlimmere Verletzungen der Menschenrechte gegeben [hat] als während der beiden Weltkriege – mit Einsatz chemischer und atomarer Waffen –, während des stalinistischen Terrors, im Holocaust, unter der Apartheid und bei ethnischen Säuberungen in Bosnien und im Kosovo«.14 Darauf folgend wird versucht, die Überlegenheit eines muslimischen Konzepts der Menschenrechte aufzuzeigen. Insgesamt lässt sich leider konstatieren, dass so genannte interkulturelle Menschenrechtsdialoge bisher wenig zu einer Annäherung beigetragen haben.15 Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass solche Dia18loge meist nicht auf interkultureller Basis, sondern lediglich mit innerkulturellem Bezug geführt worden sind und zumeist darum bemüht waren, eigene Standpunkte zu vertreten, um sie gegenüber dem Anderen durchzusetzen und zu verteidigen.
Dies gilt auch und vor allem für den innermuslimischen Diskurs um die Menschenrechte, der in dieser Hinsicht keinen produktiven Beitrag zur Förderung der interkulturellen Menschenrechtsdiskussion geleistet hat; man ist fast geneigt zu behaupten, er beschäftige sich mehr damit, partikularistische Positionen zu beziehen und Rechtfertigungen für diese hervorzubringen. Obwohl der Begriff »Menschenrecht« seit der frühen Phase des Islams unter der Rubrik der »Rechte des Menschen« (ḥaqq ādamī) bzw. »Rechte des Normadressaten« (ḥaqq al-mukallaf) bekannt war, hat man sich kaum mit den theoretischen Grundlagen der Menschenrechte beschäftigt, so dass von muslimischer Seite heutzutage keine ausgearbeitete, theoretisch fundierte Konzeption der Menschenrechte vorliegt. Dies hängt maßgeblich damit zusammen, dass sich muslimische Menschenrechtsverständnisse nicht primär aus einer analytischen Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition herausbilden, sondern vielmehr kolonialen und postkolonialen Rechtfertigungsnarrativen entspringen, die meist eine »ausgeprägte Tendenz zu Abwehr und Gegenangriff, Apologetik und Polemik«16 mit sich bringen.
Ein erstes, defensives Rechtfertigungsnarrativ verwirft die Idee der Menschenrechte dabei als westliches und somit systemfremdes Konzept, das die kulturelle Integrität der Muslime verletzt und als Ausdruck eines ungebrochenen kolonialen Denkens verurteilt werden muss. Zwar wird nicht bestritten, dass Menschen Rechte besitzen. Diese ergeben sich jedoch lediglich in Bezug auf die islamische Scharia und unter der Voraussetzung, dass diese per definitionem bereits eine gerechte Ordnung bereitstellt. Lediglich die Rückbesinnung auf die islamische Tradition, so das Argument, garantiere eine authentische kulturelle Identität. Der Islam fungiert hier nicht als normativer Imperativ der Wertekonstruktion, sondern lediglich als symbolischer Referenzrahmen zur Garantie der kulturellen Unabhängigkeit.
19Auf eine ganz unterschiedliche Weise wird dieses Streben nach kultureller Selbstbehauptung in einem anderen Rechtfertigungsnarrativ verfolgt, in dem Menschenrechte nun nicht mehr als kulturfremdes Element gelten, sondern als fester Bestandteil der islamischen Kultur oder sogar als Erfindung des Islams. Wieder soll die islamische Tradition vor einer kulturellen und intellektuellen Verwestlichung beschützt werden, diesmal jedoch dadurch, dass die Vereinbarkeit und moralische Überlegenheit des Islams gegenüber westlichen Ideen betont wird. Eine allgemeine Strategie besteht darin, zu behaupten, dass jegliche lobenswerte moderne Institution, die sich heute im Westen wiederfindet, zuerst von Muslimen erfunden und realisiert worden ist. Dementsprechend befreite der Islam die Frau, errichtete eine Demokratie, tolerierte den religiösen Pluralismus und schützte die Menschenrechte, lange bevor dies im Westen getan wurde. Um Menschenrechte zu verwirklichen, sei es also lediglich notwendig, den wahren und »eigentlichen« Islam zum Ausdruck zu bringen. Aus dieser Argumentation entstand eine Literaturflut, die den islamischen Menschenrechtsdiskurs bis heute dominiert. Die Folge ist eine künstliche Idealisierung der eigenen Tradition und eine intellektuelle Haltung, welche die Spannungspunkte zwischen der islamischen Tradition und den Menschenrechten ignoriert.
Statt einer anachronistischen Lozierung und essenzialistischen Vereinnahmung von Menschenrechten in das islamische Gedankengebäude unternehmen Vertreter eines dritten Rechtfertigungsansatzes den Versuch, alternative Anknüpfungspunkte für ein modernes Menschenrechtsverständnis aufzuzeigen. Sie untersuchen, ob die Menschenrechte als Rechte aller Menschen garantiert werden können bzw. ob die islamischen Rechtsquellen einer solchen Konzeption zumindest nicht im Weg stehen. Methodologisch geht dieses Rechtfertigungsnarrativ recht heterogen vor, von einer textuellen bis hin zu einer hermeneutischen Kritik eines traditionellen Islamverständnisses. Viele Vorhaben zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie einen Primärwert wie den der Toleranz, der Würde oder der Selbstbestimmung in der islamischen Tradition ausfindig machen, um diesen dann als »Einfallstor« zu verwenden, durch das die Menschenrechte Einzug in den Islam halten können. Diese Tendenz hat vor allem 20unter dem Druck der islamkritischen Atmosphäre nach dem 11. September zugenommen und auch hier zu einer Semantik der »Eigentlichkeit« geführt, die den »wahren Islam« in der einen oder anderen moralischen Vision realisiert sieht.
Wie eine nähere Betrachtung dieser Rechtfertigungsnarrative ersichtlich macht, befindet sich der Herausbildungsprozess muslimischer Menschenrechtsverständnisse in einem Spannungsfeld von zwei unterschiedlichen Normativitätsansprüchen: dem der islamischen Legitimität einerseits und dem der Universalität andererseits. Um die Annahme der Menschenrechte nicht als bloße Übernahme »westlicher« Ideen erscheinen zu lassen, müssen sich Menschenrechte demnach aus der islamischen Tradition ableiten und begründen lassen. Gleichzeitig sieht sich der islamische Menschenrechtsdiskurs mit der Herausforderung konfrontiert, eine Konzeption der Menschenrechte hervorzubringen, die auch aus nichtmuslimischer Perspektive akzeptiert werden kann, da Menschenrechte eine universale Gültigkeit beanspruchen, was impliziert, dass sie jedem Menschen zukommen sowie von jedem Menschen geachtet werden sollen. Menschenrechte stellen in diesem Sinne also normative Ansprüche dar, die dem Menschen einerseits einen bestimmten Handlungsraum gewähren und ihm andererseits auch ein bestimmtes Handeln vorschreiben. Damit dringen sie in ein moralisches Terrain ein, das von verschiedenen religiösen und kulturellen Ordnungen beansprucht wird. Um ihrem universalen Geltungsanspruch gerecht zu werden, müssen Menschenrechte daher so begründet werden, dass ihre Verbindlichkeit von jedem Menschen unabhängig von seiner kulturellen Zugehörigkeit oder religiösen Überzeugung akzeptiert werden kann. Für den islamischen Menschenrechtsdiskurs ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, eine Begründung der Menschenrechte zu formulieren, die auch unabhängig von islamischen Glaubensüberzeugungen akzeptiert und als verbindlich anerkannt werden kann. Dies verdeutlicht das Dilemma, in dem sich der islamische Menschenrechtsdiskurs momentan befindet. Während sich auf begründungstheoretischer Ebene einerseits die Notwendigkeit ergibt, religiös unabhängige Kriterien anzulegen, um die universale Konsensfähigkeit und die damit zusammenhängende Gültigkeit der Menschenrechte zu garantieren, ergibt sich andererseits auf legitimitätstheoretischer Ebene die Notwen21digkeit einer islamischen Rezeption der Menschenrechte, die es erlaubt, ein affirmatives Verhältnis zu ihnen herzustellen und die motivationalen Ressourcen der Religion zur Geltung kommen zu lassen. In ebendiesem Sinn befinden sich Menschenrechte, wie im Titel dieser Arbeit ausgedrückt, zwischen Universalität und islamischer Legitimität.
In diesem Buch wird ein Vorschlag zur Auflösung dieses schwierigen Dilemmas gemacht. Es soll der Versuch unternommen werden, eine Konzeption der Menschenrechte zu erarbeiten, die den normativen Ansprüchen der Universalität und islamischen Legitimität in gleichem Maße Rechnung trägt. Dazu bedarf es vorab jedoch einer näheren Betrachtung der zugrunde liegenden Problematik. Ich halte es daher für sinnvoll, das Buch in vier Teile zu gliedern. Die ersten beiden Teile widmen sich dabei der Systematisierung und Analyse des Menschenrechtsdiskurses unter Muslimen, während die beiden anderen Teile der theoretischen Entfaltung der hier vorgeschlagenen Alternativkonzeption dienen.
Teil I beschäftigt sich mit der Klärung einiger Vorfragen, die für die Rekonstruktion des muslimischen Menschenrechtsdiskurses relevant sind. Dabei soll zunächst der Frage nachgegangen werden, in welchen zeitgenössischen Kontexten die Thematik der Menschenrechte unter Muslimen zur Sprache kommt (1). Um den identitären Charakter dieses Diskurses nachvollziehen zu können, wird in einem weiteren Schritt auf den historischen Kontext eingegangen, in den die Debatte über Islam und Menschenrechte eingebettet ist (2). Eine systematische Differenzierung unterschiedlicher islamischer Rechtsverständnisse soll es daraufhin ermöglichen, den theologischen Kontext des islamischen Menschenrechtsdiskurses zu verdeutlichen (3).
Teil II widmet sich dann der Rekonstruktion des Menschenrechtsdiskurses unter Muslimen. Dabei wird ein Spektrum von Positionen identifiziert, das von absoluter Ablehnung und Unvereinbarkeit (4) über eine kulturelle Vereinnahmung (5) bis hin zu einer vorbehaltlosen Angleichung (6) an den zeitgenössischen Kanon der Menschenrechte reicht. Im Anschluss an diesen Teil wird eine Bilanz gezogen, die es erlaubt, die grundlegenden Problematiken des muslimischen Menschenrechtsdiskurses zu veranschaulichen, um daraus eine alternative Perspektive zu gewinnen (7).
22Die Herleitung und Form dieser Perspektive soll in Teil III näher beleuchtet werden. Durch Rekurs auf die Theorie der »Zwecke des islamischen Rechts« (arabisch: maqāṣid al-šarīʿa) soll dabei gezeigt werden, dass die Rückführung der Menschenrechte auf die menschlichen Bedürfnisse die Möglichkeit schafft, eine sowohl islamisch legitimierte als auch universal konsensfähige Menschenrechtskonzeption hervorzubringen. Hierzu wird zunächst die klassische Theorie der islamischen Rechtszwecke rekonstruiert (8). Der Kerngedanke dieser Theorie lautet, dass das islamische Recht den Zweck verfolgt, die notwendigen, universalen und empirisch feststellbaren Bedürfnisse des Menschen zu schützen. Diese These wird in einem weiteren Schritt kritisch beleuchtet und in einen systematischen Zusammenhang gebracht (9). Im Anschluss daran werden verschiedene zeitgenössische Vorschläge diskutiert, die klassische Theorie der islamischen Rechtszwecke zu erweitern (10).
Teil IV widmet sich schließlich dem Versuch, im doppelten Dialog mit der islamischen Tradition und der zeitgenössischen Menschenrechtsphilosophie eine neue Konzeption der Menschenrechte zu explizieren. Zunächst soll dabei auf verschiedene zeitgenössische Konzeptionen der Menschenrechte eingegangen werden, um sie auf ihre Fähigkeit zu prüfen, zu einem greifbaren Verständnis der Menschenrechte beizutragen (11). Die These, die darauf folgend vertreten wird, lautet, dass Menschenrechte am plausibelsten konzipiert werden können, wenn sie als Institutionen zum Schutz notwendiger, objektiver und universaler menschlicher Bedürfnisse verstanden werden. Durch Rekurs auf die interdisziplinäre Bedürfnisforschung wird dabei der Frage nachgegangen, was Bedürfnisse sind und welche Bedürfnisse der Mensch hat (12). In Anlehnung an die Theorie der islamischen Rechtszwecke wird die Idee der Menschenrechte schließlich in einen kohärenten Zusammenhang mit den menschlichen Bedürfnissen gebracht (13).
23I. Kontexte des muslimischen Menschenrechtsdiskurses
»Zu den Schwierigkeiten, die Menschen daran hindern, Wissen zu verarbeiten […], zählen die große Anzahl geschriebener Bücher, die Differenz in der verwendeten Terminologie […] und die Divergenz der verwendeten Methoden.«17
Ibn Ḫaldūn
Alle drei Hindernisse, die der bekannte arabische Sozialhistoriker Ibn Ḫaldūn im 14. Jahrhundert im Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten und Verstehen aufzählte, erweisen sich auch heute noch als genauso problematisch für jemanden, der sich mit dem Thema »Islam und Menschenrechte« wissenschaftlich auseinandersetzen will. Unmittelbar mit den genannten Problemen hängt nämlich die Schwierigkeit zusammen, einen so differenzierten Menschenrechtsdiskurs, wie er unter Muslimen geführt wird, systematisch darzustellen. Nichtsdestotrotz weist der Diskurs immerhin einen gemeinsamen Nenner auf, nämlich die Ausgangsfrage, ob und wie die Idee der Menschenrechte mit dem Islam zu vereinbaren ist. Die Unübersichtlichkeit ergibt sich erst dann, wenn man sich den verschiedenen Versuchen zuwendet, diese Frage zu beantworten. Um trotz dieser Schwierigkeiten eine einigermaßen überschaubare Struktur herzustellen, ist es in der Literatur üblich geworden, idealtypisch etwa drei bis vier muslimische Positionen zu Menschenrechten herauszuarbeiten, um diese dann wiederum ansteigend nach ihrem Grad der Vereinbarkeit mit den Menschenrechten18 aufzuführen.19 An sich ist 24an solch einer Vorgehensweise nichts auszusetzen, jedoch wird deren Aussagekraft dadurch beeinträchtigt, dass sie die jeweiligen Rahmenbedingungen einer Aussage über die Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten völlig außer Acht lässt. Mit anderen Worten: Es werden erklärende Faktoren übergangen, die ausschlaggebend dafür sind, ob eine Position die Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten bejaht oder verneint bzw. diese positiv oder negativ bewertet. Um also zu aussagekräftigeren Ergebnissen und einem systematischen Verständnis zu kommen, bedarf es der Klärung einiger Vorfragen, die in diesem Teil des Buches in drei verschiedenen Kontexten behandelt werden sollen. Der erste zu betrachtende Kontext ist dabei der zeitgenössische Kontext, in dem beleuchtet werden soll, auf welchen Ebenen die Menschenrechtsthematik unter Muslimen diskutiert wird und in welchen Prozessen sich Muslime dabei befinden (1). In einem weiteren Schritt soll versucht werden, die grundlegende Dynamik des zeitgenössischen muslimischen Menschenrechtsdiskurses in einem historischen Kontext zu verorten (2). Es soll dabei verdeutlicht werden, dass die Debatte über die Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten kein neues Phänomen darstellt, sondern im weiteren Sinne an eine ältere Debatte anschließt, die Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts geführt wurde. Ausgangspunkt dieser Debatte war die Frage, ob der Islam mit der Moderne zu vereinbaren sei oder nicht. Wie man aus der gemeinsamen Frage der »Vereinbarkeit« heraushören kann, handelt es sich sowohl bei der Debatte um die Menschenrechte als auch bei der über das etwas vagere Konzept der Moderne stets um die in Frage gestellte Fähigkeit der Muslime, fremde Ideen – oder differenzierter ausgedrückt, ihnen als fremd entgegentretende Ideen – kulturell zu verarbeiten. Dieser kulturelle Verarbeitungsprozess findet dabei meistens im Rahmen eines theologischen Kontextes statt, auf den in einer etwas längeren Ausführung eingegangen werden soll (3). Die Relevanz des theologischen Kontexts ergibt sich dabei aus der Tatsache, dass sich Unterschiede und Wiedersprüche in der Beurteilung der Menschenrechte sowohl aus einem unter25schiedlichen Verständnis der islamischen Tradition als auch aus einer unterschiedlichen Beurteilung der Rechtsfindung ergeben. Dementsprechend bedarf es einer Darstellung der verschiedenen Auffassungen bzw. Konzeptionen des islamischen Rechts, um bei der Rekonstruktion des Menschenrechtsdiskurses, die im zweiten Teil des Buches erfolgen soll, die diversen muslimischen Positionen anhand ihres Umgangs mit dem islamischen Recht zu systematisieren.
1. Der zeitgenössische Kontext
Bereits in der Einleitung wurde festgestellt, dass die Auseinandersetzung mit dem Islam überwiegend im Rahmen eines politischen Identitätsdiskurses erfolgt. Betrachtet man speziell die Debatte über Islam und Menschenrechte, so lassen sich drei spezifische Prozesse identifizieren, in denen muslimische Menschenrechtsäußerungen vorwiegend artikuliert werden. Muslimische Positionen gliedern sich erstens in die internationale Debatte über Menschenrechte ein. Zweitens äußern Muslime ihre Position als Kritik an der westlichen Menschenrechtspolitik. Schließlich sind muslimische Argumente als Reaktion auf westliche Kritik wahrzunehmen. Wir wollen im Folgenden lediglich auf diese Prozesse aufmerksam machen, um in der Rekonstruktion des muslimischen Menschenrechtsdiskurses die verschiedenen Aussagen kohärent einordnen zu können. Der Leser sollte dabei immer im Auge behalten, dass, wenn von »Muslimen« oder »islamischen Staaten« die Rede ist, damit kein unmittelbarer Bezug zur religiös-philosophischen Ebene des »Islams« hergestellt ist. Denn die Debatte über die Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten findet auf zwei verschiedenen Ebenen statt. Auf theoretischer Ebene beschäftigt sich die Debatte mit der Frage, ob der Islam in seiner religiös-philosophischen Dimension mit den Menschenrechten vereinbar ist. Auf der praktischen Ebene wird die Geltung, Gewährung oder Verletzung von Menschenrechten in so genannten islamischen Staaten thematisiert. Dass letztere Ebene ebenfalls unter dem Titel »Islam« und Menschenrechte behandelt wird, verdankt sich der irrtümlichen Neigung, die Politik der arabischen bzw. islamischen Welt auf das Spiel 26geschichtsübergreifender Kräfte, in diesem Falle also den Islam, zurückzuführen.20
1.1. Muslime als Teil der internationalen Menschenrechtsdebatte
Islamisch geprägte Länder nehmen in der internationalen Debatte über Menschenrechte im Rahmen der Vereinten Nationen einen sowohl generellen als auch spezifischen Standpunkt ein. Auf genereller Ebene werden Ansichten artikuliert, die von anderen nichtwestlichen Ländern geteilt werden. Diese beziehen sich beispielsweise auf Themen wie wirtschaftliche Rechte, Dekolonisation, internationale Gerechtigkeit und kulturelle Souveränität. Andererseits definieren sie Aspekte, die einen spezifisch religiösen, in diesem Fall also islamischen Charakter besitzen. Letztere bilden jedoch, wie Halliday notiert, im Rahmen der internationalen Debatte eine Minderheit: »[A]rgumente, die am häufigsten zu hören sind, haben wenig mit Religion oder Kultur zu tun [, sondern] […] beziehen sich auf solche Argumente, die man in der gesamten dritten Welt hört, über Umverteilung des Reichtums, Gerechtigkeit im internationalen Handel und so weiter«.21 Dementsprechend zeigt eine quantitative Auswertung des Ratifizierungsverhaltens im Rahmen der Vereinten Nationen, dass Mitglieder der Organisation Islamischer Staaten (OIC) kein anderes Ratifizierungsverhalten an den Tag legen als die übrigen UN-Mitgliedsstaaten.
Die Abbildung verdeutlicht, dass islamisch geprägte Staaten keine spezifische Position im Ratifizierungsverhalten einnehmen. Lediglich die Fakultativprotokolle zum Zivilpakt (ICCPR) und zur Frauenrechtskonvention (CEDAW)22 sind im Verhältnis von weni27ger OIC-Mitgliedsstaaten ratifiziert worden. Da wir uns in dieser Arbeit nicht mit der praktischen Geltungsfrage der Menschenrechte in islamisch geprägten Staaten beschäftigen können, sei diesbezüglich lediglich auf weitere Studien verwiesen.23
Abbildung 1: Ratifizierungsverhalten von UN- und OIC-Mitgliederstaaten (in Prozent).24
281.2. Kritik an der westlichen Menschenrechtspolitik
»Warum sollten wir Menschenrechtserklärungen annehmen, die von denjenigen Mächten formuliert sind, die unsere Länder kolonisiert und ausgeplündert haben?«25 »Wieso beseitigte die CIA 1953 eine demokratisch gewählte Regierung in Iran? Wieso griff der Westen erst so spät im Kosovo ein? Wieso diese vollkommen einseitige Parteinahme für Israel? Wieso 1993 der Putsch in Algerien im Anschluss an demokratische Wahlen? Wieso Tschetschenien? Wieso die Unterstützung der Taliban oder Saddam Husseins im Krieg mit Iran? Und was ist jetzt mit dem Irak? […] Hat nicht auch Israel seit 1967 keine einzige UN-Resolution umgesetzt?«26 Die Palette solcher und ähnlicher Vorwürfe könnte Seiten füllen. Es sind Vorwürfe dieser Art, die den schwerwiegendsten Einwand gegen die vorbehaltlose Akzeptanz der Menschenrechte in muslimischen Gesellschaften darstellen. Huntington macht auf diese Tatsache aufmerksam, wenn er sagt: »Nichtwestler zögern nicht, auf die Unterschiede zwischen westlichen Prinzipien und westlicher Praxis zu verweisen. Heuchelei, Doppelmoral und ein allfälliges ›aber nicht‹ sind der Preis universalistischer Anmaßungen. Die Demokratie wird gelobt, aber nicht, wenn sie Fundamentalisten an die Macht bringt; die Nichtweitergabe von Kernwaffen wird für den Iran und den Irak gepredigt, aber nicht für Israel […]. Doppelmoral in der Praxis ist der unvermeidliche Preis für universalistische Prinzipien.«27 Dabei sei zu beobachten, dass sich die Vorbehalte vieler Menschen in islamisch geprägten Ländern damit nicht gegen die Menschenrechte oder deren Beachtung an sich richten, sondern gegen die Regierungen, »die hin und wieder einmal das Wort ›Menschenrechte‹ im Munde führen, aber ansonsten bei Menschenrechtsverletzungen gerne wegsehen oder sogar selber 29gegen die Menschenrechte verstoßen«.28 Dieser Ansicht zufolge werden »westliche Grundsätze« wie Freiheit und Gerechtigkeit zwar im Westen selbst, nicht jedoch im Umgang mit dem Rest der Welt angewandt.29 Die Missachtung der Menschenrechte in der übrigen Welt verrate, so Falaturi, eine faktische Doppeldeutigkeit des Begriffs »Mensch«: »Es scheint sich dabei um zwei Kategorien von Menschen gehandelt zu haben und noch zu handeln: Menschen, die von der Menschenrechtsdeklaration erfasst sind (die Angehörigen der westlichen Zivilisation), und Menschen, die nicht zu dieser Kategorie gehören (die Mehrheit der Bewohner unseres Planeten; also diejenigen, die heute vor allem zur dritten Welt zählen).«30 Hofmann betitelt Menschenrechte sarkastisch als »blond und blauäugig«.31 Ramadan kommentiert: »Wie in der Zeit Athens – ein Modell? – begnügt man sich damit, deren mehr oder weniger gelungene Verwirklichung für eine kleine Zahl – in den Industrieländern – zu gewährleisten und außerhalb dieser Grenzen mit ihnen je nach Bedarf zu verfahren.«32 Die damit angesprochene politische Instrumentalisierung der Menschenrechte trägt nicht dazu bei, das Vertrauen der Menschen in die westlichen Regierungen und ihre Menschenrechtsagenda zu stärken, und verdeutlicht, dass die Politik der Großmächte nicht auf Prinzipien, sondern auf Interessen beruht,33 was Parvez Manzoor in den Worten ausdrückt: »Aus dem machiavellistischen Sack der Staatsräson springt die utopische Katze der Menschenrechte!«34 Ein Blick zurück auf den Ost-West-Konflikt bestätigt, dass Menschenrechte immer schon ein zentraler Bestandteil der politischen Rhetorik beider Groß30mächte waren.35 So diente beispielsweise die erste Hälfte des Artikels 13(2) der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die das Recht festhält, »jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen«, dazu, die ehemalige Sowjetunion für ihre Weigerung zu kritisieren, den russischen Juden das Recht auf Auswanderung zuzusprechen. Die zweite Hälfte desselben Artikels, »und in sein Land zurückzukehren«, wird in Bezug auf das Recht der Palästinenser heute offiziell von Washington abgelehnt.36 Es wäre daher fehlerhaft anzunehmen, dass sich die Instrumentalisierung der Menschenrechte allein gegen islamisch geprägte Staaten richtet oder allein durch westliche Staaten erfolgt. Festzuhalten bleibt lediglich, dass die historische und zeitgenössische Diskrepanz zwischen westlichen Menschenrechtsforderungen gegenüber der islamischen Welt auf der einen und der westlichen Menschenrechtspraxis gegenüber der islamischen Welt auf der anderen Seite einen – wenngleich auch einen für islamische Staaten politisch opportunen – Grund für Vorbehalte gegenüber Menschenrechten darstellt. Diese Tatsache stellt, zumindest auf praktischer Ebene, ein zentrales Hindernis für die Universalisierung der Menschenrechte dar.
1.3 Reaktion auf westliche Kritik
Muslimische Äußerungen zu Menschenrechten sind größtenteils reaktiver Natur und spiegeln sich nicht selten in ihrer apologetischen Position im islamisch-westlichen Menschenrechtsdiskurs wider. Der Prozess der Widerlegung westlicher Kritik schließt unmittelbar an die eben beschriebene Kritik der westlichen Menschenrechtspraxis an, die dazu genutzt wird, äußere Kritik zu »neutralisieren«. Demnach wird meist versucht zu beweisen, dass nicht stimmt, was Muslimen vom Westen vorgeworfen wird. Unter denjenigen, die für eine Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten argumentieren, sind einige bemüht, bestimm31te Rechtsvorschriften, die im vermeintlichen Widerspruch zu den Menschenrechten stehen, so weit wie möglich zu relativieren, während andere versuchen, jene Stellen aus den islamischen Textquellen hervorzuheben, die mit den Menschenrechten in Einklang stehen. Demzufolge haben alle muslimischen Positionen, die in dieser Arbeit behandelt werden, einen gemeinsamen Nenner, und zwar die Bestrebung, nachzuweisen, dass westliche Anschuldigungen und Kritiken in Bezug auf den Islam nicht zutreffen. Dies ist also ein Nachweis, dass Muslime zum Menschenrechtsschutz nicht unfähig sind. Einige Autoren beeilen sich sogar zu betonen, dass der Islam »natürlich« die Menschenrechte garantiere, ja dies sogar schon früher und besser getan habe als der Westen:
Der Islam ging allen internationalen Erklärungen, Chartas und Abkommen voraus. Im Bereich der Menschenrechte hat der Islam diese Rechte seit vierzehnhundert Jahren definiert und verwurzelt. Die AEMR (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte), Abkommen und internationale Chartas wiederholen und bekräftigen lediglich das, was der Islam in diesem Bereich bereits etabliert hat.37
Solche Argumente, die eher den äußeren Druck, sich bekennen zu müssen, als den Versuch einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Menschenrechtsthematik verdeutlichen, dienen der Abwehr internationaler Kritik und sollten, mit den Worten von Fred Halliday, »nicht als abstrakte oder theologische Interpretationen eines heiligen Texts betrachtet werden, sondern als politische Reaktionen in einem Kontext der innerstaatlichen und internationalen Machtförderung«.38 Der in der Einleitung erwähnte Identitätsdiskurs spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Muhammad Sid Ahmed hat die Situation dementsprechend klar erfasst, wenn er sagt: »Menschenrechte sind ein Ausdruck der Identität, des Selbst, und darin liegt die große Krise.«39
322. Historischer Kontext
Historisch betrachtet lassen sich die grundlegende Dynamik des zeitgenössischen muslimischen Menschenrechtsdiskurses und die damit zusammenhängende Frage nach der Identität auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückführen. Muslimische Intellektuelle widmeten sich im Lichte der europäischen Überlegenheit und im Bewusstsein der eigenen Reformbedürftigkeit der Frage, wie die Stagnation der islamischen Gesellschaften zu erklären sei und welche Schritte unternommen werden müssten, um den nötigen Fortschritt in Gang zu setzen. Vielen Muslimen machte dabei nicht nur die materielle Überlegenheit Europas zu schaffen, sondern auch das Minderwertigkeitsgefühl, das sie angesichts der ideologischen Diffamierung der islamischen Gesellschaften durch Europa empfanden. »Jede Person«, so schrieb der französische Philosoph Ernest Renan im Jahre 1883, »die nur einigermaßen an dem Geistesleben unserer Zeit teilnimmt, erkennt deutlich die gegenwärtige Inferiorität der mahomedanischen Länder, den Niedergang der vom Islam beherrschten Staaten, die geistige Nichtigkeit der Rassen, die einzig und allein ihre Kultur und ihre Erziehung jener Religion verdanken.«40 Es lässt sich also festhalten, dass der Reformgedanke seinen Impuls aus einer ideologischen Herausforderung zog, welche die Ursachen der muslimischen Stagnation im Islam sah und diesem eine hemmende, gar blockierende Wirkung für den Fortschritt der islamischen Gesellschaften zuschrieb. Die Krise der muslimischen Identitätssuche entfaltete sich demgemäß anhand der Frage, wie man sich gegenüber Europa definieren und welche Rolle dabei der Religion zukommen sollte. Im weiteren Sinne wurden damit also die Grundfragen der politischen Philosophie neu gestellt: Nach welchen Prinzipien sollen wir leben, und woher nehmen 33wir diese Prinzipien? Ist es möglich, die Prinzipien einer modernen Gesellschaft aus dem Islam abzuleiten? Oder muss man sich dazu auf die Ideen und Institutionen Europas beziehen? Inwiefern kann man sich gegenüber Europa dann noch als islamisch definieren? Drei Denkströmungen lassen sich bei der Beantwortung dieser Fragen identifizieren.
2.1. Trialog der Identitäten
Ein Echo der europäischen Position fand sich in einer säkularistischen Strömung, die der Auffassung war, dass die Muslime aufgrund ihrer Religion intellektuell nicht in der Lage seien, Fortschrittsdenken im europäischen Sinne zu entwickeln.41 Islam und Wissenschaft sowie Islam und moderne Zivilisation seien demnach prinzipiell nicht miteinander zu vereinbaren. Die Muslime sollten deswegen die europäische Moderne als ultimativen Bezugsrahmen akzeptieren und sich so weit wie möglich an Europa anpassen. Auf politischer Ebene wurde diese Assimilationshaltung später vor allem in der Türkei sichtbar. Eine zweite, weitaus breitere Denkströmung, die man als traditionalistisch bezeichnen mag, vertrat dagegen die Meinung, dass die Lage der Muslime mit der Kolonialisierung und Unterdrückung durch den europäischen Westen zu begründen sei. Die Stagnation der islamischen Gesellschaften finde ihre Ursache demnach in der imperialen europäischen Machtausübung, der die Muslime zum Opfer gefallen seien. Die Übernahme europäischer Ideen signalisiere in diesem Zusammenhang lediglich eine intellektuelle Kapitulation. Vielmehr müssten die Muslime ihre Stärke in der eigenen Geschichte suchen und wiederbeleben; nur durch eine solche Renaissance könne man das goldene Zeitalter des Islams wiederherstellen. Allein die Rückkehr zur eigenen Tradition, so das Ar34gument, verleihe der eigenen Identität ihren wahren Charakter. Man kann bereits erkennen, dass die beiden Argumentationen darauf hinauslaufen, das muslimische Zivilisationserbe entweder mit all seinen gesellschaftlichen und institutionellen Eigenheiten blind zu akzeptieren oder es samt seinen Werten undifferenziert als Ganzes zu verwerfen. Allerdings weisen die Positionen trotz aller inhaltlichen Differenzen ein verbindendes Charaktermerkmal auf; beide sehen den Ausweg aus der muslimischen Inferiorität in der Nachahmung eines Vorbildes; einerseits ist das Europa, andererseits die eigene Tradition. Es ist deshalb nicht falsch, das säkularistische Argument als europäisch-imitativ, das traditionalistische als historisch-imitativ zu bezeichnen.42 Es ist genau diese imitative Ausrichtung, welche die Position, die man üblicherweise als modernistisch bezeichnet, zu vermeiden versucht.43 Der islamische Modernismus verstand sich als ein Mittelweg zwischen dem historisch-imitativen Geist, der durch eine Rückkehr in die Vergangenheit versuchte, die eigene Identität wiederzubeleben und das kulturelle »Selbst« gegenüber jeglicher Veränderung zum kulturell »Anderen« mit richtig und falsch gleichsetzte, und dem europäisch-imitativen Geist, der eine absolute Assimilation der Kultur und Lebensweise anstrebte und jegliche Europäisierung unreflektiert akzeptierte. Die funktionale Kategorisierung des islamischen Modernismus als Position der Anerkennung erklärt sich aus der Tatsache, dass er die Akzeptabilität moderner Ideen und Institutionen kaum in Frage stellt – ihm zufolge muss man anerkennen, dass diese ihren festen Platz eingenommen haben. Vielmehr gilt es zu zeigen, dass die Prinzipien einer modernen Gesellschaft und die damit einhergehenden Veränderungen den Prinzipien des Islams nicht widersprechen. Der Schlüssel zu einer solchen Konzeption liege in einem differenzierteren Verständnis des islamischen Gedankensystems und der Unterscheidung zwischen dem, was essenziell, beständig und unveränderlich ist, und dem, was unwesentlich, temporär und ohne weiteres veränderbar ist.
352.2. Religiöses Verständnis in Raum und Zeit
Um die Dimension des Reformbestrebens zu verstehen, sollten die Umstände, aus denen der Reformgedanke entstanden ist, stets im Bewusstsein behalten werden. Denn in der Geschichte des muslimischen Denkens stellt die Forderung nach Reformen kein neues Phänomen dar, sondern wurde beispielsweise schon von Denkern wie al-Ġazāli (gest. 1111/505)44 oder Ibn Taimiyya (gest. 1328/728) vertreten. Das Anliegen dieser und anderer Reformer lag, wie Soroush betont, jedoch eher darin, den Kern der Religion von der Hülle äußerlicher Oberflächlichkeiten zu befreien, um die Essenz der wahren Religiosität zu enthüllen.45 Indessen richteten sich die Reformbestrebungen des islamischen Modernismus dahin, die Bedeutung und Relevanz der Religion in einer sich immer schneller verändernden Welt wiederherzustellen und das religiöse Verständnis im Kontext räumlicher und zeitlicher Veränderungen zu erneuern. Man sah sich mit dem Dilemma konfrontiert, dass keine Religion als relevant bezeichnet werden kann, die auf Kosten der eigenen Beständigkeit jede Neuerung blind akzeptiert und lediglich zur Legitimierung eines fait accompli dient, wohingegen ein starrsinniges Beharren auf Beständigkeit jedoch ein religiöses Leben in der modernen Welt unmöglich macht; beide Wege führen zur Irrelevanz der Religion. Muhammad Iqbal (gest. 1938) hatte dieses Dilemma im Sinn, wenn er schreibt, dass eine Religion
über ewige Prinzipien verfügen [muss], um ihr kollektives Leben zu regeln, denn das Ewige gibt uns Halt in der Welt des steten Wandels. Aber ewige Prinzipien – wenn man sie so versteht, dass sie alle Möglichkeiten des Wandels ausschließen, der laut Koran eines der wichtigsten »Zei36chen« Gottes ist – neigen dazu, das zu lähmen, was in seinem Wesen zutiefst beweglich ist.46
Die Aufgabe des muslimischen Intellektuellen lag dementsprechend darin, Beständigkeit und Wandel zu versöhnen.47 Dazu musste unterschieden werden zwischen den konstanten und den variablen Bestandteilen der Religion, zwischen Profanem und Sakralem, zwischen Form und Substanz, im weiteren Sinne zwischen Religion und religiösem Verständnis.
Der islamische Modernismus ging also von der Grundannahme aus, dass die vermeintliche intellektuelle Rückständigkeit der Muslime ihre Ursachen in einem verkrusteten, inflexiblen Islamverständnis habe, welches vor allem auf einem blinden Gehorsam (taqlīd) gegenüber dem von der islamischen Jurisprudenz ausgearbeiteten und mittlerweile überholten Normensystem beruhe. Er plädierte daher für eine innere Reformierung des islamischen Normensystems im Lichte der Vernunft. Mittels rationaler Überlegung sollte eine freiere, der Zeit angepasste Auslegung der islamischen Grundtexte (Koran und Sunna) möglich werden. Die dominante Figur dieser Strömung war neben dem aus Persien stammenden, jedoch in der ganzen islamischen Welt wirkenden Ǧamal al-Dīn al-Afġāni (gest. 1897) vor allem der ägyptische Theologe Muḥammad ʿAbdūh (gest. 1905) sowie später auch sein Schüler Muḥammad Rašīd Riḍa (gest. 1935).48 Um wieder ein zeitgemäßes Islamverständnis herzustellen, verlangten die islamischen Modernisten die »Wiedereröffnung des Tores zur Neuauslegung« (iǧtihād) und bemühten sich dabei, den Islam von nichtislamischen Elementen zu befreien, die sich im Laufe der Zeit verfestigt hatten. Wie Hofmann kommentiert, sahen die islamischen Modernisten
eine Chance für die Wiederbelebung des Islam allerdings nur, wenn unter Opferung vieler mittelalterlicher Glossen und Kasuistik radikal zwischen den wirklichen Quellen des Islam – Koran und Sunna des Pro37pheten […] – auf der einen und dem zeitbedingten, menschengemachten und daher fehlbaren Gebäude von islamischer Jurisprudenz und Gelehrsamkeit auf der anderen Seite unterschieden wurde.49
Die traditionelle Sichtweise des islamischen Gedankensystems verkenne also im weiteren Sinne den grundlegenden Unterschied zwischen Werten, Prinzipien und Zielen, die unabhängig von Raum und Zeit durch die religiösen Quellen festgesetzt wurden, auf der einen Seite, und Interpretationen, Anwendungen und Methoden, die an das jeweilige räumliche und historische Verständnis der Menschen gebunden sind, auf der anderen. Der Stillstand des religiösen Denkens resultiere aus der Unfähigkeit der Muslime, die kontext- und zeitabhängige Qualität der islamischen Jurisprudenz als solche zu identifizieren. Es sei daher notwendig, anzuerkennen, dass eine Interpretation der religiösen Quellen nicht aus einem existenziellen Vakuum entsteht, sondern stets spezifische historische, kulturelle, soziale und politische Rahmenbedingungen reflektiert. Individuen und Gesellschaften unterscheiden sich zu verschiedenen Zeiten und Orten, je nach ihren Umständen, Bedürfnissen und Herausforderungen. Um die gesellschaftliche Funktionsfähigkeit der Religion zu bewahren, müsse das religiöse Verständnis daher eine kontextbezogene Form annehmen. Islamische Werte und Prinzipien müssten zwar unveränderlich bleiben, jedoch stets neu konkretisiert werden, so dass sie den quantitativen und qualitativen Veränderungen eines jeden Zeitalters gerecht werden können. Soll die Religion in Zeiten des sozialen Wandels ihre gesellschaftssteuernde Rolle nicht verlieren, müsse das religiöse Verständnis notwendigerweise reinterpretiert werden. Sollte dieser Prozess der Reinterpretation zum Stillstand kommen, resultiere dies notwendigerweise in der Entwicklung impotenter, religiös umhüllter gesellschaftlicher Mechanismen, die letztendlich zur Stagnation der Gesellschaft führen. Der Stillstand der muslimischen Gesellschaften könne dementsprechend nicht auf die im Islam verkörperten Werte und Ziele zurückgeführt werden, sondern auf die Art und Weise ihrer Wahrnehmung und Anwendung. Folglich könne von einer Reform des Islams auch keine Rede sein – was reformiert werden müsse, sei das muslimische Denken.
38Die eigentlichen Anliegen betreffen hier das Partikulare und das Allgemeine, die Methodik des islamischen Denkens, die mangelnde Anerkennung von räumlichen und zeitlichen Elementen in der Zusammensetzung der Gesellschaft und das Konzept der Offenbarung als Quelle des Wissens, die sowohl die Vernunft als auch die Natur ergänzt, so dass die Menschheit ihre Aufgabe erfüllen kann, Gutes auf dieser Welt zu tun.50
Allerdings galt es nach ʿAbdūh, in der Identifikation von beständigen und beweglichen Bestandteilen der Religion eine wichtige systematische Unterscheidung zu treffen, und zwar zwischen Normen der rituellen Handlung (ʿibadāt) und Normen der zwischenmenschlichen Beziehungen (muʿāmalāt). Während die islamischen Quellen für Erstere spezifische Normen festlegten, setzten sie für Letztere lediglich allgemeine Prinzipien fest, die der menschlichen Konkretisierung im Umfeld ihrer jeweiligen Lebensumstände überlassen sind.51 Tatsächlich kenne der Islam im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung keine andere Autorität als die der Vernunft, und was als religiöse Autorität gilt, wie etwa das Kalifat und die verschiedenen geistlichen Ämter, sind in ʿAbdūhs Augen rein weltliche Einrichtungen ohne dogmatische Befugnis.52 »Dies war«, wie Hofmann kommentiert,
revolutionär, sollten sich doch die Muslime an die Vorstellung zurückgewöhnen, dass der Koran nicht alles und jedes geregelt hat, sondern nur dasjenige, was Gott zu regeln für notwendig hielt; dass es einen Freiheitsraum gibt, der bewusst menschlicher Regelung überlassen ist, und auch einen Freiheitsraum, der durch keine menschliche Regelung eingeengt werden darf.53
Um diese Gedanken zu verstehen und zu verdeutlichen, ist es notwendig, sich etwas näher mit dem dahinterliegenden theologischen Kontext auseinanderzusetzen, dessen Zentrum das Konzept der islamischen Scharia darstellt.
393. Theologischer Kontext
»[Die] erste Pflicht [islamischer Gelehrter] besteht nach Ansicht dieses Autors nicht darin, die Überlegenheit ihres Rechtssystems zu zeigen, sondern die exakte Natur ihres Rechtssystems zu entdecken.«54
Der Begriff »Scharia« ist in aller Munde. Für manche symbolisiert er Ordnung und Gerechtigkeit, für andere Barbarei und Unterdrückung. Die einen verbinden mit ihm ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit, während andere eine Rückkehr ins Mittelalter befürchten. Der Begriff wird sowohl von muslimischer als auch von nichtmuslimischer Seite zum Politisieren und Polemisieren genutzt. Dabei lässt sich mit Krämer relativ leicht beobachten, dass »viele derer, die nach der ›Anwendung der Scharia‹ rufen oder ihre Hoffnungen in sie setzen, keine juristischen Vorkenntnisse aufweisen und keine präzisen Vorstellungen darüber haben, was mit ›Scharia‹ im einzelnen gemeint sein könnte«.55 Diese Beobachtung mag nicht weiter verwundern, geht es im öffentlichen Diskurs doch meist nicht darum zu verstehen, was genau mit dem Begriff Scharia gemeint ist, als vielmehr darum, die Überlegenheit der eigenen Identität zu behaupten.56 Problematisch ist dabei, dass sich diese Tendenz nicht nur auf den öffentlichen Diskurs beschränkt, sondern in großen Teilen auch im islamwissenschaftlichen Diskurs zu beobachten ist, der, geleitet von den Paradigmen des Orientalismus, nur allzu oft dazu dient, den kulturalistischen und identitätspolitischen Diskurs zu verfestigen.57 Ohne an dieser Stelle näher auf die Probleme einzugehen, die sich in der islamwissenschaftlichen Literatur in Bezug auf den Begriff und Charakter der islamischen Scharia wiederfinden,5840soll im Folgenden versucht werden, eine systematische Darstellung der islamischen Scharia vorzunehmen, um ein differenziertes Verständnis zu ermöglichen. Man sollte sich dabei bewusst sein, dass das Verständnis der islamischen Scharia eine Schlüsselrolle für das Verständnis des gesamten islamischen Gedanken- und Glaubenssystems spielt. Schacht ist in diesem Sinne recht zu geben, wenn er betont: »Das islamische Recht ist der Inbegriff des islamischen Denkens, die typischste Erscheinungsform der islamischen Lebensweise, der Wesenskern des Islam selbst. […] [E]s ist unmöglich, den Islam zu begreifen, ohne das islamische Recht zu verstehen.«59
3.1. Scharia und Fiqh
Ursprünglich steht der Begriff »Scharia« für den »Weg, der zur Quelle führt«.60 Man kann diesen Weg im abstrakteren Sinne so verstehen, dass er dem Menschen durch grundlegende religiöse und ethische Prinzipien dazu verhelfen soll, zur Glückseligkeit zu finden.61 Diese Konzipierung der Scharia trägt allerdings wenig zu ihrem strukturellen Verständnis bei. Wenn der Weg zur Quelle, die Scharia, den Bezugsrahmen für islamische Lebensprinzipien darstellen soll, so ist es zunächst notwendig zu verstehen, wie sie gegliedert ist, um klären zu können, wie das Absolute und das Relative in ihr zum Ausdruck kommen, das heißt, welches Verhältnis die Scharia zu zeitlicher und räumlicher Veränderung einnimmt und welche Rolle daraus resultierend der Vernunft im Rahmen der Offenbarung zukommt. Es ist daher fruchtbarer, 41den Begriff »Scharia« analytisch als eine Bezeichnung für ein System von Normen (aḥkām)zu betrachten.62 Wenn wir von der »islamischen Scharia« sprechen, so bezeichnen wir damit also ein islamisches Normensystem. Kennzeichnend für das islamische Normensystem ist dabei, dass es in drei unterschiedliche Normkategorien gegliedert ist: (a) Glaubensnormen, die für einen Muslim zu verinnerlichende Glaubensinhalte formulieren; (b) Ethiknormen, die aussagen, welche moralischen Eigenschaften bzw. Tugenden (Dankbarkeit, Geduld, Barmherzigkeit etc.) der Mensch besitzen soll; und (c) Handlungsnormen, die wiederum in Normen der rituellen Handlung (ʿibādāt) und Normen der zwischenmenschlichen Beziehungen (muʿāmalāt) unterteilt werden.63
Abbildung 2: Die Scharia als ein System von Normen.
Glaubensnormen (aḥkām iʿtiqādiyya) beinhalten in erster Linie den reinen Monotheismus, das heißt den Glauben an den einen Gott (tawḥīd), seine Offenbarungen, Propheten und Gesandten, die Engel, den Jüngsten Tag und die Vorherbestimmung. Die Wissenschaft, die sich aus der Auseinandersetzung mit den Grundlagen des islamischen Glaubens entwickelt hat, bezeichnet 42man als ʿilm al-kalām(islamische Religionsphilosophie). Ethiknormen (aḥkām ḫulqiyya)befassen sich mit den moralischen Eigenschaften, Motiven und Folgen des menschlichen Handelns. Sie konzentrieren sich vor allem auf die innere Dimension des Menschen und widmen sich der Entwicklung und Erlangung einer höheren Ebene der Sittlichkeit und eines tieferen spirituellen Bewusstseins. Sowohl die Disziplin des ʿilm al-aḫlāq(Tugendethik) als auch die des taṣawwuf (Sufismus) beschäftigen sich mit diesem Gebiet. Die Handlungsnormen (aḥkām ʿamaliyya)werden in der islamischen Rechtswissenschaft dagegen im Rahmen der Disziplin des fiqh behandelt, was so viel wie »Verständnis« bedeutet.
Grundsätzlich geht es beim fiqh darum, die fundamentalen Fragen »Was sollen wir tun?« und »Wie sollen wir leben?« zu beantworten. Normen der rituellen Handlung (ʿibādāt) legen dabei fest, wie ein Muslim oder eine Muslima die rituellen Handlungen durchzuführen hat, das heißt, wie und wie oft man beispielsweise beten oder fasten soll. Normen der zwischenmenschlichen Beziehungen (muʿāmalāt) beziehen sich dagegen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und regeln sowohl die Beziehungen der Individuen untereinander als auch die Beziehung von Individuum zum Staat sowie die zwischenstaatlichen Beziehungen.64 Während es beim fiqh darum geht, Antworten auf die praktischen Fragen »Was sollen wir tun?« und »Wie sollen wir leben?« zu geben, beschäftigt sich die Wissenschaftsdisziplin des uṣūl al-fiqh mit der Frage, wo und wie Antworten auf diese Fragen gefunden werden können; sie kann dementsprechend als »Quellen- und Methodenlehre der Normfindung« bezeichnet werden. Sie gibt an, aus welchen Quellen und durch welche Methoden Normen aufgestellt, hergeleitet oder modifiziert werden.65
Fiqh bildet also einen Teil der islamischen Scharia, jedoch nur den, der unmittelbaren Bezug zum praktischen Leben der Menschen hat. Wenn wir nun vom »islamischen Recht« sprechen, dann ist damit lediglich der Teil der islamischen Scharia gemeint, dessen Gegenstand derjenige Teil der Handlungsnor43men ist, der wiederum die zwischenmenschlichen Beziehungen (muʿāmalāt) regelt.66 Da das islamische Normensystem neben den rechtlichen Normen auch spirituelle, ethische und rituelle Normen enthält, wäre es fehlerhaft, die islamische Scharia mit dem islamischen Recht gleichzusetzen.67 Das Recht ist vielmehr Teil eines übergreifenden Konzepts, das diverse Bereiche des menschlichen Lebens in sich vereint und normiert. Die oft gehörte Aussage, der Islam sei eine alle Lebensbereiche umfassende Religion, ist in dieser Hinsicht also richtig, sie muss jedoch differenziert betrachtet werden. Wird der umfassende Charakter der islamischen Scharia nämlich dahingehend interpretiert, dass sie zwischen den verschiedenen Lebensbereichen nicht unterscheidet, so muss dies dezidiert in Frage gestellt werden. Viele Muslime gehen unreflektiert davon aus, dass es keinen Unterschied gebe zwischen Privatem und Öffentlichem, zwischen Religion und Politik, zwischen Glauben und Denken; der Islam, so heißt es, sei allumfassend. Diese – von Orientalisten nur allzu gerne bestätigte – Vorstellung vermittelt den Eindruck, als handele es sich hierbei um eine sakrale Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche. Um solchen Fehlschlüssen im Zusammenhang mit dem islamischen Recht vorzubeugen, gilt es aufzuzeigen, wie sich das Recht als selbstständige Entität von anderen Normkategorien der Scharia unterscheidet.
3.2. Differenzierung des islamischen Rechts
Rechtsnormen bilden einen von zwei Teilen der Handlungsnormen, und zwar genau den Teil, der die zwischenmenschlichen Handlungen regelt. Diese Feststellung ist wichtig, da die Zusammenfassung der rituellen und zwischenmenschlichen Normen zu einer Normgruppe einen fundamentalen Unterschied im Bezugsrahmen und Charakter der beiden Normenzweige verbirgt. Normen der rituellen oder gottesdienstlichen Handlungen beziehen sich auf eine konstante und unabänderbare Beziehung zwischen 44Gott und Mensch und beschreiben die formalen und quantitativen Aspekte der rituellen Hingabe. Diese Aspekte sind größtenteils unbegreiflich, denn es ist beispielsweise rational nicht nachzuvollziehen, warum Muslime fünf Mal am Tag beten sollen und nicht etwa vier Mal. Es lässt sich auch nicht vernünftig begründen, wieso das Morgengebet aus zwei, das Mittagsgebet aus vier und das Abendgebet aus drei Gebetsabschnitten (rakʿa) besteht oder wieso die Höhe der Sozialabgabe (zakāh) 2,5% und nicht etwa 3% oder 5% beträgt.68 Diese in diesem Sinn unbegreiflichen Normen (aḥkām ġayru maʿqūlat al-maʿna) müssen unabhängig von der Einsicht in ihren Grund von jedem gläubigen Muslim akzeptiert und befolgt werden. Da in diesem Zusammenhang lediglich Muslime als Normadressaten gelten, kann man Ritualnormen abstrahiert als Gemeinschaftsnormen bezeichnen. Normen der zwischenmenschlichen Beziehung richten sich dagegen auf die sich stets entwickelnden und verändernden Beziehungen der Menschen untereinander und können dementsprechend als Gesellschaftsnormen bezeichnet werden. Im Unterschied zu den Ritualnormen besitzen sie zudem die Eigenschaft, begründbar bzw. rational einsehbar zu sein.69 Rationale Einsehbarkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jede Norm einen Grund besitzt, der mit der Vernunft nachzuvollziehen ist, so dass eine Norm aus vernünftiger Einsicht befolgt werden kann.70 In der 45Auseinandersetzung mit dieser Normgruppe spielt es somit laut Ibrahim
keine Rolle, ob man gläubiger Muslim oder gar kein Muslim ist. Es spielt auch keine Rolle, ob man davon ausgeht, dass der Quran Gotteswort sei, von Mohammad erfunden worden sei oder dass er von den Juden und Christen abgeschrieben worden sei. Die einzige Eigenschaft, die der Leser mitbringen soll, ist, dass er vernunftbegabt und in der Lage ist, diese Normen rational zu betrachten.71
Die Auseinandersetzung mit der Begründbarkeit von Normen, die uns im Laufe dieses Buches noch öfters begegnen wird, ist insofern wichtig, als sie unmittelbar mit der Abänderbarkeit bzw. Unabänderbarkeit von Normen und somit eng mit der Entwicklungsfähigkeit des islamischen Rechts zusammenhängt. Mir-Hosseini kommentiert in diesem Zusammenhang:
Anders als die Vorschriften im Bereich der ʿibadāt – die die Beziehung zwischen Gott und den Menschen regeln und somit wenig Raum für Rationalisierungen und Erklärungen lassen – sind die Vorschriften im Bereich der muʿāmalāt – die die Beziehungen der Menschen untereinander regeln – im allgemeinen für rationale Überlegungen fast uneingeschränkt offen. Da menschliche Angelegenheiten sich in einem Zustand der ständigen Veränderung und Entwicklung befinden, ist es erforderlich, diese Vorschriften in Übereinstimmung mit den Lebenswirklichkeiten der jeweiligen Zeit neu zu interpretieren.72
Prinzipiell wird im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen davon ausgegangen, dass alles erlaubt ist, es sei denn, es ist ausdrücklich oder eindeutig verboten (al-ibāḥa aṣlun fi’l-ašyāʾ).73 Im Kontrast zu den Ritualnormen erhält die menschliche Vernunft somit einen breiten Handlungsspielraum, der 46lediglich durch explizite Verbote eingeschränkt wird. Normen der zwischenmenschlichen Handlungen können folglich in eine flexible (mutaġayyir) und eine feste (ṯābit) Dimension eingeteilt werden.74
Abbildung 3: Normen der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Unabänderbare Normen sind im Wesentlichen Ge- und Verbote, die im Koran und in der Sunna ausdrücklich geregelt sind. Als Teil der muʿāmalāt müssen auch sie rational begründet sein und eine »notwendige Verknüpfung zwischen der Norm und ihrem Grund« aufweisen (al-ḥukm yadūr maʿ al-ʿilla ʿadaman wa wuʿǧūdan).75 Ein Beispiel dafür ist das Verbot, alkoholische Getränke zu konsumieren, basierend auf dem koranischen Vers 5:90. Der Grund dieses Verbots ist eine empirisch nachweisbare Eigenschaft alkoholischer Getränke, nämlich die, berauschend zu wirken. Berauscht ein alkoholisches Getränk, beispielsweise Wein, nicht mehr, weil es in Weinessig umgewandelt wurde, wird das Verbot automatisch aufgehoben. Eine Norm bleibt folglich so lange unabänderbar, bis sie nicht mehr an den rationalen Kontext ihrer Bestimmung gebunden ist.
Abänderbare Normen sind Normen, die weder vom Koran noch der Sunna explizit geregelt worden sind und sich auf historisch 47gewachsene Rechtsbedürfnisse beziehen, so dass sie keine überzeitliche Gültigkeit oder Verbindlichkeit beanspruchen können. So entstand beispielsweise die völkerrechtliche Konzeption des dār al-islām (Gebiet des Islams) und dār al-ḥarb (Gebiet des Krieges) aus einem historischen Kontext, in dem sich Muslime mit dem persischen und dem byzantinischen Reich im Kriegszustand befanden und man von der (im Mittelalter gängigen) geopolitischen Annahme ausging, dass Frieden lediglich die Abwesenheit von Krieg bedeute.76 Solche aus historischen Umständen entstandenen rechtlichen Institutionen sind an die Bedingungen und die Erfordernisse einer jeweiligen Gesellschaftsstruktur gebunden und müssen bei gesellschaftlichem Wandel modifiziert werden, um neuen gesellschaftlichen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden zu können.77 Historische Modelle müssen dementsprechend von überzeitlichen Prinzipien differenziert werden. Prinzipien sind Richtlinien eines ethisch bestimmten Handelns und definieren grundlegende Maximen und Werte, die es in jedem Fall zu erfüllen gilt. Wie und in welcher Form dies geschieht, bleibt dabei allerdings offen. Es sind also nicht die Prinzipien an sich, die sich im Laufe der Zeit relativieren, sondern die jeweiligen Ausdrucksformen, die an die gegebene Realität angepasst werden müssen. In diesem Sinne kommentiert Ramadan:
Die Treue gegenüber Prinzipien kann nicht die Treue gegenüber historischen Modellen beinhalten, da sich Zeiten ändern, Gesellschaften sowie politische und wirtschaftliche Systeme komplexer werden und es in jedem Zeitalter tatsächlich notwendig ist, ein Modell zu entwickeln, das der jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Realität entspricht.78
48Es muss also methodologisch sowie auch inhaltlich zwischen Prinzipien und deren bestimmten historischen und kulturellen Ausdrucksformen differenziert werden, um der Gefahr zu entgehen, die eigene Realität mit fremden Augen zu betrachten. Da sich die zwischenmenschlichen Beziehungen zudem zunehmend entwickeln und daher immer komplexer und vielschichtiger werden, oder anders gesagt, da das Bedürfnis der Menschen nach Verhaltensreglungen ständig steigt, bietet letztlich ein freier Raum (mantiqat al-ʿafw)die Möglichkeit, Normen zu entwickeln, um neu entstandene Rechtsbedürfnisse zu befriedigen.79 Denn »[w]eder Koran noch Sunna äußern sich unmittelbar zur Ressourcennutzung im Weltraum, zu Urheberrecht im Internet, zu Verkehrsregeln auf der Skipiste, zu Leihmutterschaft, zu Gentechnologie, zu In-vitro-Befruchtung und Ähnlichem.«80





























