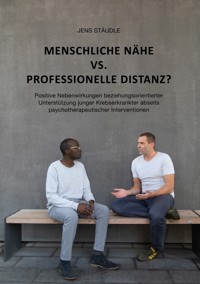
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Junge Menschen stehen mit der Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung vor endlosen Fragen, Herausforderungen und Ängsten. Freundeskreis, Familie und medizinisches System versuchen in dieser Situation den Bedürfnissen und Nöten der Betroffenen adäquat zu begegnen. Doch das Netz dieser Unterstützung ist nicht für alle Erkrankten tragfähig und gut gemeinte Angebote werden nicht von allen Betroffenen angenommen. Dabei scheint der Umgang mit Nähe und Distanz sowohl in der Konzeption von Unterstützungssystemen als auch im zwischenmenschlichen Kontakt von Helfenden und Hilfeempfangenden eine maßgebliche Rolle zu spielen, ob ein Angebot von Menschen genutzt wird, oder nicht. Die vorliegende Arbeit greift Argumente und Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen im Umgang mit Nähe und Distanz in der Versorgung bedürftiger Menschen auf und wendet diese auf die Versorgungsstruktur junger Menschen mit Krebs an. Am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart wurde ein Modellprojekt "Diagnose Krebs - Mitten im Leben" entwickelt, das psychosoziale Unterstützung vor diesem Hintergrund neu konzipiert. Die Auswertung der aktuellen Nutzerdaten und externe Evaluationen zeigen auf, welche Möglichkeiten und Grenzen in einem veränderten Umgang mit Nähe und Distanz im medizinischen Versorgungssystem liegen. Inzwischen wurde diese Arbeitsweise unter dem Namen LINA (Lebensweltorientiert - Integrativ - Nah - Aufsuchend) im Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart auch auf Menschen mit anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen ausgeweitet. Darüber hinaus hat der Krebsverband Baden-Württemberg e.V. die Arbeitsweise LINA in sein Unterstützungsangebot aufgenommen. Weitere Informationen zu LINA werden unter lina-support.de publiziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Dank:
Die vorgelegte Arbeit gründet in der persönlichen Auseinandersetzung mit jungen Krebserkrankten und deren Angehörigen. Maßgebliche Impulse für den wissenschaftlichen Disput und zentrale Gedanken verdanke ich den Betroffenen selbst. Dank derer Bereitschaft, mich an ihrem Leben teilhaben zu lassen, individuelle Sorgen, Nöte, Probleme und Herausforderungen zu diskutieren, konnte der alternative Unterstützungsansatz entwickelt werden.
Darüber hinaus gilt mein persönlicher Dank meinem hochgeschätzten ehemaligen Chef, Herrn Prof. Aulitzky und Frau Idler, unserer stellvertretenden Pflegedirektorin und Pflegedienstleitung sowie allen Unterstützern des Vereines „Freunde und Förderer des Robert-Bosch-Krankenhaus e.V.“, die mir seit 2011 die Möglichkeit gegeben haben, das beschriebene Projekt überhaupt zu entwickeln und hernach auch zu implementieren.
Auf dem Weg des Dissertationsprojektes bin ich überaus dankbar für die wissenschaftliche Begleitung von Frau Prof. Doris Nauer. Die gemeinsamen Gespräche und Diskussionen haben die Dissertation ermöglicht und die Auseinandersetzung mit der Thematik wesentlich bereichert.
Durch das Stipendium der Strube Stiftung konnte ich Zeitressourcen nutzen, um mich dieser Arbeit zu widmen, aber auch hier stellten die gemeinsamen Diskussionen und Gespräche eine wertvolle Bereicherung zum Thema dar.
Danken möchte ich auch meiner Familie, Freunden, Kolleginnen und Kollegen aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, die mir in der Zeit zur Seite standen und mich auf vielfältigste Weise unterstützten.
Für meine Wegbegleiter:
Timo, Armen, Steffi, Ehis, Mehmet, Jenny, Asit, Patrick, Daria, Alex, Elli, André, Christoph, Alper, Claudia, Tobias, Ahmed, Lucas, Heike, Benedikt, Celot, Sandra, Yves, Isabell, Brian und die anderen jungen Erkrankten.
Für alle, die mir während ihrer schweren Erkrankung gestattet haben, einen Einblick in ihr Leben zu nehmen und wir uns zu Wegbegleitern geworden sind.
Die Zeit mit Euch hat mein Leben bereichert.
Jens Stäudle
Menschliche Nähe versus professionelle Distanz?
Positive Nebenwirkungen beziehungsorientierter Unterstützung junger Krebserkrankter abseits psychotherapeutischer Interventionen
Jens Stäudle, Doctor of Philosophy (Ph.D.), hat an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar promoviert.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel I
Junge Erwachsene mit Krebs in ihrer Lebenswelt
Kapitel II
Nähe und Distanz im Umgang mit Betroffenen
Kapitel III
Transfer in die Medizin: Streetwork in der Klinik
Schluss
Vorwort des Verfassers:
Eine Krebserkrankung im jungen Erwachsenenalter bzw. in der Mitte des Lebens ist sowohl für die Erkrankten, als auch für deren Umfeld eine Extremsituation, die fast alle Lebensbereiche erschüttert. Neben den Betroffenen und Angehörigen sind teils auch professionell Helfende mit den Einzelschicksalen überfordert.
Bedingt durch die Differenzierung der Zuständigkeiten im Gesundheitssystem, sowohl in Bezug auf die Themenfelder psychische sowie soziale Hilfen, als auch in Bezug auf stationäre und ambulante Behandlung, stehen den Betroffenen meist keine konstanten Ansprechpartner bei den umfänglichen Herausforderungen zur Seite.
Aufgrund dieser Problematik wurde 2011 am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart (RBK) ein alternatives Modellprojekt zur psychosozialen Unterstützung der jungen Krebserkrankten entwickelt, welches in Kooperation mit dem Krebsverband Baden-Württemberg e.V. 2022 in Stuttgart weiter ausgebaut wurde und inzwischen auch innerhalb des RBK auf Menschen mit anderen lebensverändernden Erkrankungen erweitert ist (seit 2022 „LINA“). Der Ansatz hat zum Ziel, individuelle und passende Unterstützung Betroffener durch eine feste Bezugsperson zu ermöglichen und beschreitet dabei völlig neue Wege in der medizinischen Versorgungsstruktur.
Im vorliegenden Buch werden die Hintergründe dieses Unterstützungsansatzes diskutiert, die neuartige Arbeitsweise dargelegt und aus wissenschaftlicher Perspektive bewertet. Das erste Kapitel möchte die Augen für die Herausforderungen der jungen Erkrankten öffnen und das in Deutschland vorherrschende Unterstützungssystem beleuchten. Im zweiten Kapitel folgt eine kritische Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz in helfenden Berufen. Diese kann die Leserschaft zum Nachdenken anregen, das eigene Verhalten, beruflichen Habitus und Begegnungen mit Betroffenen zu reflektieren. Daran anschließend zeigt das dritte Kapitel den alternativen Ansatz professioneller Hilfe auf, der sich inzwischen seit über zehn Jahren am RBK in Stuttgart bewährt hat und im Rahmen der vorliegenden Dissertationsschrift wissenschaftlich beleuchtet wurde.
Somit liefert das vorliegende Buch bedeutende Grundlagen, um Menschen in herausfordernden Lebenslagen zu unterstützen und zu begleiten.
Mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, dass Sie als Fachpersonen, Interessierte, Angehörige oder Betroffene Anregungen bekommen, die Ihr Leben und Ihre Beziehungen bereichern.
Jens Stäudle im Januar 2023
Vorwort von Prof. Aulitzky:
Die Probleme und Beeinträchtigungen, die durch eine Krebserkrankung bei jungen Erwachsenenveru rsacht werden, unterscheiden sich in vielfältiger Weise von jenen, die bei Erkrankten im mittleren und fortgeschrittenen Lebensalter im Vordergrund stehen. Natürlich dominiert auch bei jungen Erwachsenen die Frage, wie viel Zukunft trotz Erkrankung möglich ist. Zusätzlich stellt die Erkrankung junge Menschen aber vor weitere massive praktische Probleme, die häufig die existentiellen Fragen in vielen Phasen überlagern.
Die Erkrankung trifft Menschen häufig in einer Lebensphase, die in vieler Hinsicht vulnerabel ist. Ein Teil der jungen Erwachsenen ist dabei, wirtschaftlich von den Eltern unabhängig zu werden und sie haben gerade die ersten Schritte in die berufliche Tätigkeit getätigt. Bei diesen Patienten führt die Erkrankung häufig sehr rasch wieder zu einer neuerlichen Abhängigkeit von den Eltern. Dies stellt sowohl für den jungen Menschen als auch für die Eltern eine mitunter schwierige Herausforderung dar.
Andere haben gerade Familien gegründet und Kinder sind häufig noch in einem Alter, in dem sie vollständig auf beide Elternteile angewiesen sind. In dieser Phase sind Familien meist schon ohne eine Erkrankung eines Elternteils erheblich belastet, da Versorgung der Kinder und Partnerschaft in einem häufig schwer vereinbaren Konkurrenzverhältnis stehen. Die gängigen Krebstherapien führen zu erheblichen zusätzlichen Belastungen. Dabei spielen sowohl Veränderungen des Körperbildes eine wesentliche Rolle wie z.B. Brustentfernung oder künstlicher Darmausgang. Der Umgang mit diesen Veränderungen fordert in einer Partnerschaft alle Beteiligten und es ist nur schwer möglich, Intimität und Nähe zu bewahren. Die fast immer auftretenden Funktionsstörungen im Bereich der Sexualität tragen zu weiterer Verunsicherung bei. Die medikamentösen Therapien beeinträchtigen auch die kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen. Dadurch kann es für Patienten schwierig sein z.B. auf Kinder einzugehen oder auch nur die quirlige Präsenz von Kindern zu ertragen. Gleichzeitig ist in dieser Zeit häufig die Beschaffung von Wohnraum ein Thema. Die jungen Familien haben sich hier bei der Planung darauf verlassen, mit voller Kraft diese Aufgaben bewältigen zu können. Zusätzlich trifft es in dieser Zeit auch viele junge Menschen, die durch Mehrleistung im Beruf sich für diese Aufgaben die finanziellen Grundlagen schaffen wollten und daher oft auch wesentliche Einkommensanteile aus Minijob oder anderem Nebenerwerb in die Planung mit einbezogen hatten. Sich durch Versicherungen abzusichern, wird dabei häufig vertagt. Diese Voraussetzungen führen häufig dazu, dass der langdauernde Ausfall mit Krankenstand sogar im Falle einer Heilung zu erheblichen finanziellen Verwerfungen führen kann und der Wohlstand auch mittelfristig nicht gesichert werden kann. Schließlich ist die Wiedererlangung der vollständigen beruflichen Leistungsfähigkeit und damit der alten Rolle im beruflichen Umfeld häufig verzögert und manchmal nur schwer oder oft auch gar nicht zu erreichen. Somit besteht bei diesen Patienten der Bedarf nach Psychoonkologie, Sozialarbeit, Familientherapie, Sexualtherapie, Schuldenberatung usw. Zusätzlich erschwert wird diese komplexe Situation durch die Tatsache, dass wesentliche Gruppen wie z.B. junge Männer oder Patienten mit geringen Deutschkenntnissen der Betroffenen von sich aus entsprechende Stellen nicht aufsuchen. Dies führt dazu, dass vor diese Gruppe von unseren konventionellen Beratungsangeboten nicht erreicht werden.
Herr Stäudle hat aus seinen persönlichen Berufserlebnissen und den Erfahrungen sozialer Arbeit mit anderen, schwer erreichbaren Gruppen ein innovatives Konzept entwickelt, das die Barrieren der gegenwärtigen psychosozialen Unterstützungssysteme für junge onkologische Patienten überwinden hilft. Kern dieses Konzeptes ist, dass alle Patienten nach Diagnose aufgesucht werden. Dabei wird durch den Betreuer ein persönlicher Kontakt aufgebaut, der nicht auf spezifische Probleme fokussiert ist. Das dabei aufkeimende Vertrauen hilft, gemeinsam Problemfelder zu identifizieren und diese bearbeiten zu können. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass durch dieses Vorgehen alle Patienten erreicht werden können und damit eine gute Basis geschaffen werden kann, Katastrophen von Familien möglichst abzumildern und eine weitgehende berufliche Wiederherstellung zu erreichen. Diese Erfahrungen zeigen auch, dass der Aufbau einer Vertrauensbasis zum Betreuer für den Zugang zu diesen Patienten häufig wichtiger ist, als ein erschöpfendes Spezialwissen des jeweiligen Betreuers. Mein persönlicher Eindruck von diesem Angebot ist, dass es eine effiziente und sachgerechte Innovation in der Betreuung junger Erwachsener mit Krebs darstellt.
Prof. Dr. med. Walter-Erich Aulitzky
Einleitung
1 Problemhorizont und persönlicher Hintergrund
Jährlich erhalten in Deutschland ungefähr 16.500 Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren die Diagnose Krebs (Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut 2020). Damit geht fast immer ein dramatischer Schock für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld einher. Als problematisch erweisen sich in der Regel nicht nur die körperlichen Auswirkungen der Erkrankung, die Angst an der Krankheit zu sterben, oftmals unvermeidbare Therapienebenwirkungen, sondern ganz spezifische Herausforderungen in fast allen Lebensbereichen.
Die wissenschaftliche Entwicklung in der Bekämpfung der Krebserkrankungen schreitet rasant voran. So haben beispielsweise die Antikörperforschung oder die personalisierte Medizin in den letzten Jahren medizinische Möglichkeiten geschaffen, die vor einigen Jahren noch völlig unvorstellbar waren. So konnte dadurch zum Beispiel beim Hodgkin-Lymphom und den chronisch myeloischen Leukämien zwischen 1975 und 2015 die Sterblichkeit um über 60 % gesenkt werden (Welch, H. Gilbert; Kramer, Barnett S.; Black, William C. 2019, 1380).
Dennoch muss leider festgestellt werden, dass die Anzahl der Krebserkrankungen in Deutschland in Summe zunimmt. Dabei sind jedoch vor allem drei Faktoren zu berücksichtigen: (1) Da mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit bösartiger Zellmutationen steigt, führt der demographische Wandel zu einer statistischen Zunahme der Krebserkrankungen. (2) Aufgrund der gestiegenen Nachfrage, selbst im hohen Alter bei gesundheitlichen Problemen auch umfassende Diagnostik in Anspruch zu nehmen, werden mehr Krebserkrankungen diagnostiziert. (3) Durch moderne Untersuchungsmöglichkeiten werden Erkrankungen heute oft schon in einem Frühstadium festgestellt und statistisch erfasst. In der Vergangenheit war das so nicht möglich und Betroffene sind u.U. vor der Diagnose einer Krebserkrankung an einem anderen Leiden verstorben.
Berücksichtigt man diese drei Veränderungen bei der statistischen Auswertung der Krebsregister, zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Krebserkrankung zu überleben, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist (Malvezzi, Matteo; Carioli, G.; Bertuccio, P.; Boffetta, P.; Levi, F.; La Vecchia, C.; Negri, E. 2018).
Viele Menschen mit schweren, bis dato relativ schnell tödlich verlaufenden Erkrankungen bekommen heutzutage eine Chance auf Heilung oder zumindest deutlich längere Überlebenszeit. Krebserkrankungen sind heute weniger primär lebensbedrohlich, sondern entwickeln immer häufiger einen chronischen Verlauf und müssen dadurch wiederkehrend therapiert werden. Hinzu kommt, dass auch belastende Therapienebenwirkungen wirksamer bekämpft werden können.
Die diversen medizinischen Weiterentwicklungen haben somit dazu geführt, dass zwischen 2012 und 2018 die Sterblichkeit an Krebs deutlich gesunken ist. Während sie bei Männern um etwa 10 % auf ca. 129 Sterbefälle je 100.000 Einwohner im Jahr gesunken ist, beträgt der Rückgang bei Frauen lediglich ca. 5 %, was ca. 84 Sterbefälle je 100.000 Einwohner im Jahr bedeutet (Malvezzi, Matteo; Carioli, G.; Bertuccio, P.; Boffetta, P.; Levi, F.; La Vecchia, C.; Negri, E. 2018). Der geringere Rückgang der Sterblichkeit bei Frauen ist wohl darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele Frauen begonnen haben zu rauchen und nun oft viele Jahre später an Lungenkrebs erkranken (Kieseritzky von, Katrin 2018). Es ist sogar damit zu rechnen, dass in Zukunft die Lungenkrebserkrankungen bei Frauen zur häufigsten Todesursache werden und Brustkrebserkrankungen hier ablösen (Christmann, Daniela 2018).
Signifikant verbessert hat sich diese Situation dagegen bei jungen Menschen mit einer Krebserkrankung. Hier können inzwischen bei den 15- bis 39-Jährigen ca. 80 % der Betroffenen geheilt werden (Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 2020a).
Neben den Weiterentwicklungen in der medizinischen Forschung sind auch die psychosozialen Themen der Menschen, die an Krebs erkrankt sind, zunehmend in den Fokus der Forschung und Therapie gerückt. Viele Kliniken erheben inzwischen mit Fragebögen die emotionalen Belastungen der Erkrankten, um ihnen bei Bedarf speziell ausgebildetes psychoonkologisches Personal zur Seite zu stellen.
Auch die Pflege in der Onkologie, dem Fachbereich für Krebserkrankungen, hat sich deutlich weiterentwickelt. Pflegekräfte haben die Möglichkeit, eine spezielle Fachweiterbildung für die Pflege von Menschen mit einer Krebserkrankung zu absolvieren, um auf die komplexen Herausforderungen in der Onkologie mit hoher Expertise zu reagieren.
Obwohl die Überlebenschancen sich offensichtlich verbessert haben, sterben aber leider immer noch Menschen an Krebs oder den damit einhergehenden Folgeerkrankungen. Um die medizinische, pflegerische, spirituelle und auch psychosoziale Versorgung der Menschen, die nicht geheilt werden können, zu verbessern, wurden in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Städten Palliativstationen und Hospize gegründet.
Parallel zu dieser hochkomplexen Weiterentwicklung in der Krebsforschung und der Spezialisierung in den stationären Einrichtungen wurde ein ganzes Netzwerk an ambulanten Angeboten aufgebaut. In den Ballungsräumen entstanden Krebsberatungsstellen sowie unterschiedliche Angebote zur Unterstützung. Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ trat Ende 2015 eine wichtige Grundlage in Kraft, um ambulante Versorgungsstrukturen zu gestalten und diese zu finanzieren.
Darüber hinaus werden seit einigen Jahren auch zunehmend die speziellen Belange gerade junger Menschen mit Krebs beachtet. Arbeitskreise in den ärztlichen Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) oder der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) beschäftigen sich mit den altersspezifischen Themenfeldern der adoleszenten und jungen Erwachsenen („AYA“, d.h. adolescents and young adults, Menschen in der Altersgruppe von 18 bis 39 Jahren). Die ärztliche, pflegerische, psychologische, seelsorgerliche und sozialrechtliche Unterstützung von jungen erkrankten Menschen und deren Umfeld wird in großen Kliniken zunehmend professionalisiert und optimiert. Stiftungen wie die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs vertreten bundesweit die Interessen der Betroffenen. Sie unterstützen sowohl die Forschung als auch in ganz konkreten Herausforderungen. Das Engagement dieser Stiftung reicht beispielsweise von der deutschlandweiten Gründung und Unterstützung regionaler Betroffenengruppen bis hin zu konkreter sozialrechtlicher Beratung. Außerdem engagiert sich die Stiftung auch sozialpolitisch, um beispielsweise die Finanzierung fruchtbarkeitserhaltender Maßnahmen über die Krankenkassen zu sichern.
Dennoch kommt das hochprofessionelle psychosoziale bzw. psychoonkologische Angebot der Kliniken, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und anderer Organisationen bedauernswerterweise nicht bei allen Erkrankten an. Vor allem viele junge Menschen und deren soziales Umfeld sehen sich mit multiplen Problemen konfrontiert und bleiben dabei oft ohne adäquate Unterstützung.
Eine Befragung von Überlebenden nach Brustkrebs, Darmkrebs und Prostatakrebs zeigt, dass lediglich 9 % der Befragten angaben, während eines Klinikaufenthaltes psychoonkologisch betreut worden zu sein. Nur 3 % gaben an, eine Krebsberatungsstelle besucht zu haben. Diese wurden vorwiegend von Frauen mittleren Alters mit höherem Bildungsgrad genutzt (Zeissig, Sylke Ruth; Singer, Susanne; Koch, Lena; Blettner, Maria; Arndt, Volker 2015). Deutlich unterrepräsentiert sind in den Beratungsstellen dagegen Männer, Menschen mit Migrationshintergrund, mit geringerer Schulbildung und niederem Einkommen (Giesler, Jürgen M.; Weis, Joachim; Schreib, Melanie; Eichhorn, Svenja; Kuhnt, Susanne; Faust, Tanja; Mehnert, Anja; Ernst, Jochen 2015, 456). Ein weiteres Problem in der Unterstützung der Betroffenen entsteht durch die vorgegebene Aufgliederung in eine ambulante und eine stationäre Versorgungsstruktur. So sind Fachkräfte der Psychoonkologie und der Sozialen Arbeit aus den Kliniken meist nur während des Krankenhausaufenthaltes zuständig und Betroffene müssen sich danach fast immer neue Ansprechpartner suchen, um ambulante Unterstützung zu erhalten. Termine in ambulanten psychoonkologischen Praxen sind darüber hinaus nur schwer zu bekommen (Schreiber, Sabine; Goss, Susannah 2019, 185). Zudem wird häufig auch das Angebot der Selbsthilfegruppen von vielen jungen Betroffenen nicht genutzt (Pons, Ruth 2016, 11–15). Eine Studie der Epidemiologin und Versorgungsforscherin Susanne Singer hat gezeigt, dass die deutliche Mehrheit der befragten Krebserkrankten vor einer Behandlung nicht in erster Linie von Fachkräften der Psychologie, Sozialen Arbeit oder Seelsorge emotionale Unterstützung erwarten, sondern vielmehr von ärztlichem und pflegerischem Personal. Nach einem Krankenhausaufenthalt wurden dieselben Personen erneut befragt, wie eine möglicherweise erhaltene Unterstützung bewertet wird. Diese zweite Befragung zeigt, dass emotionale Unterstützung durch Pflegende oder ärztliches Personal von den Befragten deutlich hilfreicher empfunden wurde, als die Unterstützung durch Fachkräfte der anderen Berufsgruppen (Singer, Susanne; Götze, Heidi; Möbius, C.; Witzigmann, H.; Kortmann, R-D; Lehmann, A.; Höckel, M.; Schwarz, R.; Hauss, J. 2009). Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt eine aktuellere Studie des Stuttgarter Sozialarbeiters Thomas Stork, der Singers Fragestellungen aufgegriffen und erweitert hat. In seiner Untersuchung wurden ausschließlich junge Krebserkrankte nach erhaltener emotionaler Unterstützung während des Klinkaufenthaltes befragt (Stork, Thomas 2019). Dabei wird deutlich, dass Betroffene diese vorwiegend von Angehörigen und dem Freundeskreis erhalten haben und auch als sehr hilfreich empfanden. Auch hier wurde bestätigt, dass emotionale Unterstützung durch ärztliches und pflegerisches Personal von den Betroffenen sehr häufig erlebt und positiv bewertet wurde. Deutlich weniger Unterstützung haben die Befragten durch Fachkräfte der Psychologie, Sozialen Arbeit und Seelsorge erhalten bzw. falls sie diese erhalten haben, als weniger hilfreich eingestuft.
Die genannten Untersuchungen belegen, dass sowohl die hochprofessionellen ambulanten als auch stationären Angebote zur psychosozialen Unterstützung von vielen (auch jungen) Betroffenen leider nicht genutzt, teilweise sogar als nicht hilfreich wahrgenommen werden. Fakt aber ist, dass junge Erwachsene mit Krebs mit erheblichen psychosozialen Belastungen kämpfen, was eine Leipziger Forschungsgruppe anhand fortlaufender Datenerhebungen immer wieder aufzeigt (Breuer, Nora; Sender, Annekathrin; Daneck, Lisa; Mentschke, Lisa; Leuteritz, Katja; Friedrich, Michael; Nowe, Erik; Stöbel-Richter, Yve; Geue, Kristina 2017).
Was also ist die Ursache für die mangelnde Inanspruchnahme der Angebote durch Erkrankte und ihr soziales Umfeld, wenn diese doch in vielen Lebensbereichen unter den Auswirkungen der Erkrankung offensichtlich leiden?
Diese Frage stellte sich für mich ganz persönlich. Lag es an der Struktur der Angebote und/oder der professionellen Distanz der Hilfeleistenden? Seit 2003 durfte ich viele Erkrankte und deren Angehörige sowohl als Krankenpfleger als auch als Psychoonkologe im interdisziplinären Team der Palliativstation des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) in Stuttgart in der letzten Lebensphase begleiten.
Ein veränderter Umgang mit Nähe und Distanz und der Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Helfenden und Betroffenen hat es in der Klinik oft ermöglicht, umfassende psychosoziale Unterstützung zu leisten, die meist auch angenommen wurde. Evident war aber auch, dass derartige Unterstützung direkt nach Diagnosestellung und im Behandlungsverlauf für die Betroffenen deutlich hilfreicher gewesen wäre. Gerade im Palliativkontext zeigt sich immer wieder, wie Menschen am Lebensende mit Problemen kämpfen, die nie aufgefangen wurden.
Diese Problematik, dass dringend nötige Hilfe u.U. bei den Betroffenen nicht rechtzeitig ankommt, bezieht sich aber nicht nur auf Erkrankte im Palliativbereich und deren Angehörige. Diese Einsicht verdanke ich Herrn Prof. Aulitzky, Chefarzt der Abteilung Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am RBK. Er hat immer wieder in Erinnerung gerufen, dass nicht nur Sterbende, sondern selbst junge Menschen, die geheilt werden, regelmäßig keinen Zugang zu wichtigen Unterstützungsangeboten finden. Vermutlich haben Betroffene aufgrund übermäßiger Distanz in Hilfeberufen und fehlender vertrauter Beziehung zu den professionell Unterstützenden oft keinen Zugang.
Interessanterweise konnte ich bereits vor meiner professionellen Tätigkeit an der Klinik innerhalb unterschiedlicher Bereiche beziehungsorientierter Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen, die Erfahrung machen, dass eine Vertrauensbeziehung den Schlüssel darstellt, um Zugang zu vorhandenen Hilfsangeboten zu ermöglichen. Sehr prägend waren dabei für mich Arbeitsbereiche in Amsterdam und Frankfurt am Main, die sich auf die Unterstützung von Menschen mit multiplem Substanzgebrauch konzentrierten. Betroffene in dieser Lebenslage haben meist mit sehr komplexen Herausforderungen wie beispielsweise Diskriminierung, sozialer Isolation, Ausgrenzung, traumatischen Lebensgeschichten, psychischen Störungen, Beschaffungskriminalität, Obdach- und/oder Arbeitslosigkeit zu kämpfen. In den beziehungsorientierten Unterstützungsangeboten wurde außerordentlich auf niederschwellige Zugangswege wie Streetwork und ganzheitliche Hilfeansätze geachtet. Denn längst ist bekannt, wie schwierig es für viele Menschen ist, selbst aktiv zu werden und sich um Beratung oder Unterstützung zu bemühen.
Ist beispielsweise ein junger Mensch in Drogenmissbrauch, Prostitution oder Obdachlosigkeit geraten, bestehen die ersten Schritte der Hilfe meist im informellen Kontaktaufbau und der Unterstützung in lebenspraktischen Themen wie beispielsweise der Versorgung mit Hygieneartikeln, mit einer Übernachtungsmöglichkeit oder mit Nahrungsmitteln. Erst wenn eine Vertrauensbasis zu den Betroffenen entstanden ist, kann möglicherweise in einem zweiten Schritt konkrete Unterstützung in Blick auf tiefer liegende komplexe Lebensthemen gegeben werden. Die Problembewältigung der Themen, welche zum Drogenmissbrauch geführt haben, können dann ggf. in den Blick genommen werden. So kann es gelingen, die Menschen zu stabilisieren bzw. zu fördern und möglicherweise durch aktive Unterstützung bei der Arbeitssuche auch die gesellschaftliche Integration zu ermöglichen.
Die Forschung in der Sozialen Arbeit hat sich schon seit Jahren mit der Situation von Menschen beschäftigt, die mit herkömmlichen Angeboten wie Beratungsstellen oder Anlaufstellen nur schwer erreicht werden. Die betroffene Personengruppe wird in diesem Bereich auch mit dem Begriff Hard to Reach umschrieben (Doel, Mark 2012, 84). Aufgrund vorliegender Forschungsergebnisse wurden bereits viele soziale Unterstützungsangebote umgestaltet.
Diese zeichnen sich durch die folgenden Merkmale aus:
1. Niederschwellige Zugangswege zu den Betroffenen beispielsweise durch Streetwork
2. Vertrauensaufbau durch konkrete lebenspraktische und an die Lebenswelt der Betroffenen angepasste Unterstützung
3. Vertrauensbeziehung zwischen Helfenden und Hilfebedürftigen als Basis für Unterstützung in komplexen, oft auch stigmatisierenden Lebensthemen
Auf diese Weise erhalten Menschen Hilfe, die aus unterschiedlichen Gründen kaum Beratungsstellen aufsuchen und auch aus eigener Initiative beispielsweise keine Unterstützung bei einer Drogenberatung oder einer Arbeitsvermittlung suchen würden (Baruch, Geoff; Fonagy, Peter; Robins, David 2007).
Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, eine Ursache für mangelnde Inanspruchnahme vorhandener psychosozialen Angebote durch junge Krebserkrankte könnte auch in der Gestaltung dieser Angebote liegen.
Für viele Menschen, auch ohne lebensbedrohliche Erkrankung oder Suchterfahrung, bedarf es einer positiven persönlichen Beziehung zum Gegenüber, um schwierige persönliche Lebensthemen zu besprechen. Sehr deutlich zeigt sich dies an Themen, wie dem Umgang mit Übergewichtigkeit, Beziehungsproblemen, ungewollter Schwangerschaft, ernsthaften Problemen mit den Kindern oder Ängsten vor Verlust des Arbeitsplatzes. Die Bereitschaft für Gespräche zu schwierigen Themen kann im kollegialen oder freundschaftlichen Rahmen entstehen, wenn eine positive Vertrauensbeziehung zum Gegenüber vorhanden ist.
Dem steht unser sehr distanzschaffendes Versorgungssystem entgegen. So sind weite Bereiche des gesellschaftlich organisierten Lebens durch eine Expertenkultur geprägt. Beispielhaft kann hier die Organisation von Angestellten und Beamten in Ämtern oder Behörden angeführt werden. Neben den Vorteilen klarer Zuordnungen von Zuständigkeiten, Sprechzeiten und Kompetenzen kann ein Nachteil dieser Kultur ein meist sehr distanzierter Umgang mit Menschen sein. Aber auch Unterstützungssysteme in weiten Bereichen des medizinischen Kontextes zeigen eine starke Prägung dieser Expertenkultur. Hilfe oder Unterstützung ist an Termine mit den entsprechenden Fachpersonen gekoppelt. Ständig wechselnde Zuständigkeiten, Überweisungen in weitere Spezialgebiete und die Aufgliederung in ambulante und stationäre Therapien bauen deutliche Distanzen zwischen Helfenden und Erkrankten auf. Auch psychosoziale Unterstützungsangebote sind von dieser Expertenkultur durchdrungen. Erkrankte haben während oder nach einer Therapie viele unterschiedliche medizinische bzw. therapeutische Fachpersonen und können so kaum eine Vertrauensbeziehung zu diesen aufbauen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Aufgliederung in multiple Zuständigkeiten und Professionen zu einer Distanz führt, welche ein Grund dafür sein könnte, warum Hilfsangebote bei den Betroffenen nicht ankommen.
Die mangelnde Inanspruchnahme der Unterstützungsangebote könnte somit drei Ursachen haben:
1. Zugangsbarrieren beispielsweise durch Terminvereinbarungen mit unbekannten Personen oder Beratungsstellen außerhalb der Kliniken könnten bereits den Erstkontakt zum psychosozialen Angebot verhindern.
2. Persönliche Distanz im professionalisierten Beratungskontext könnte für Betroffene hinderlich sein, um Vertrauen zu Helfenden aufzubauen.
3. Strukturelle Aufgliederungen in ambulante bzw. stationäre Angebote und wechselnde Ansprechpartner in den Settings erschweren den Aufbau einer Vertrauensbeziehung.
In Bereichen der sozialpädagogischen oder karitativen Arbeit mit Menschen in prekären Lebenssituationen wurden längst positive Erfahrungen mit beziehungsorientierten Ansätzen, konkreter praktischer Unterstützung der Betroffenen und menschlicher Nähe im Hilfesystem gesammelt und veröffentlicht. So hat beispielsweise Hans Thiersch, Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der Universität Tübingen, bereits Ende der 1970er-Jahre das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit entwickelt, veröffentlicht und gelehrt (Thiersch, Hans 2012).
Aber auch im medizinisch-pflegerischen Setting werden zunehmend die professionalisierten, häufig distanzierten Ansätze kritisiert und alternative, beziehungsorientierte Ansätze vorgeschlagen: Fachleute der Pflegewissenschaft wie beispielsweise Helen Kohlen (Kohlen, Helen 2016), der praktischen Theologie wie der Niederländer Andries Baart (Baart, Andries 2018), aber auch der Pflegepraxis wie die erfahrene Palliativfachkraft Susanne Kränzle (Kränzle, Susanne 2017) oder dem ärztlichen Fachbereich, wie der Stuttgarter Spezialist für HIV- und suchtkranke Menschen, Albrecht Ulmer (Ulmer, Albrecht 2018), und der ärztliche Direktor einer psychiatrischen Einrichtung, Heinrich Kunze (Kunze, Heinrich 2015), stellen die professionelle Distanz in pflegerisch-medizinischen Expertensystem in Frage und plädieren für einen alternativen Umgang mit Nähe und Distanz.
In Deutschland spielen diese Ansätze in der Betreuung von Krebserkrankten bislang jedoch kaum eine Rolle. Betrachtet man die Inhalte der Krebs- oder Psychoonkologiekongresse, wird die Weiterentwicklung psychosozialer Unterstützung nahezu ausschließlich im Rahmen der bestehenden Expertenkultur diskutiert. In den Niederlanden dagegen haben diese Ansätze in den vergangenen Jahren nicht nur in der Sozialen Arbeit, sondern auch in der Onkologie zunehmend an Bedeutung gewonnen. So hat die Versorgungsforscherin Klaartje Klaver zusammen mit Andries Baart bereits 2011 die ersten Artikel zu beziehungsorientierten Ansätzen wie Care Ethik und Präsenztheorie im Kontext Krankenhaus veröffentlicht (Klaver, Klaartje; Baart, Andries 2011).
Eine solche Umorientierung würde in Deutschland neben einer weitgehenden Umstrukturierung der psychosozialen Versorgungsstruktur auch einen kulturellen Wandel derselben bedeuten.
Ausgehend von meiner beruflichen Erfahrung stellen sich für mich die folgenden Fragen:
An welchen Stellen ist professionelle Distanz wichtig?
Wie viel Nähe ist gut, wichtig und hilfreich für Betroffene und Begleiter?
Können Erfahrungen aus anderen Fachbereichen zu Nähe und Distanz auf die psychosozialen Unterstützungskonzepte der jungen KrebspatientInnen übertragen werden?
Sind positive Erfahrungen mit alternativen Ansätzen, beispielsweise aus der Sozial- oder karitativen Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen, in das medizinische System integrierbar?
Wie kann eine auf menschlicher Nähe basierende Versorgungsstruktur für junge Erwachsene mit Krebs realisiert werden?
Worin zeigen sich Stärken und Limitationen einer solchen Veränderung?
2 Forschungsinteresse und Zielsetzung
Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht, inwiefern ein beziehungs- und lebensweltorientierter Ansatz ein gelingender Zugang sein kann, um junge Menschen mit einer Krebserkrankung und ihr soziales Umfeld umfassend zu unterstützen. Dabei werden herkömmliche Prämissen in Bezug auf Nähe und Distanz im medizinisch-pflegerischen Kontext hinterfragt und Alternativen dargestellt.
In der psychosozialen Unterstützung von jungen Erwachsenen mit Krebs spielen bislang Ansätze, welche auf menschlicher Nähe der Fachkräfte zu den Betroffenen basieren, kaum eine Rolle und wissenschaftliche Untersuchungen stehen bislang weitgehend aus. Daher besteht an dieser Stelle eine Forschungslücke. Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag leisten, diese zu schließen.
Durch die Unterstützung von Prof. Aulitzky und der Pflegedienstleitung Frau Idler war es mir möglich, seit 2011 das psychosoziale Angebot für junge Krebserkrankte und ihr soziales Umfeld am RBK umzustrukturieren und neu zu gestalten. Dabei wurden die Erfahrungen aus sozial-karitativer Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen verwoben mit Konzepten aus anderen Disziplinen wie beispielsweise dem genannten Konzept der Lebensweltorientierung aus der Sozialen Arbeit. Erkenntnisse der beziehungs- und lebensweltorientierten Arbeit wurden in der Konzeption und Ausführung des Projektes „Diagnose Krebs – Mitten im Leben“, dem Unterstützungsangebot für junge Krebserkrankte am RBK, berücksichtigt (seit 2022 „LINA“).
Somit dient das Projekt als exemplarischer Forschungsgegenstand, um zu untersuchen, inwieweit junge Menschen mit einer Krebserkrankung und deren soziales Umfeld durch menschliche Nähe in einem beziehungs- und lebensweltorientierten Angebot konkrete und umfassende Unterstützung erhalten können.
Um diese Forschungsfrage im Detail zu erörtern und einen möglichen Mehrwert des alternativen Ansatzes zu prüfen, müssen die folgenden Fragen klar beantwortet werden:
Kann konkretes, beziehungsorientiertes und lebensweltorientiertes Handeln Zugangsbarrieren abbauen?
Erhalten somit mehr Menschen Zugang zu psychosozialer Unterstützung als in bestehenden Strukturen?
Inwiefern können Menschen, die in herkömmlichen psychosozialen Beratungssettings unterrepräsentiert sind, wie beispielsweise Männer oder Menschen mit Migrationshintergrund, durch den hier dargestellten Ansatz konkrete Unterstützung erhalten?
Erhalten Betroffene und ihr soziales Umfeld durch den beziehungsorientierten Ansatz die Möglichkeit, auch über schambehaftete und/oder stigmatisierende Themenfelder zu sprechen?
Anhand dieser Fragen soll geklärt werden, inwiefern für die Betroffenen durch den beziehungs- und lebensweltorientierten Ansatz ein deutlicher Mehrwert im Vergleich zur herkömmlichen psychosozialen Versorgungsstruktur geschaffen wird.
3 Aufbau und Methodik
Die komplexen Herausforderungen junger Erwachsener mit Krebs und ihres sozialen Umfeldes stehen im Fokus des ersten Kapitels. Dabei ist die von der WHO vorgenommene Aufgliederung in die einzelnen Dimensionen menschlicher Existenz in physisch, psychisch, sozial und spirituell hilfreich (World Health Organization 2002, 9). Im Anschluss an diesen Überblick werden sowohl das professionelle Versorgungssystem als auch Beispiele zivilgesellschaftlich organisierter Unterstützung für junge Menschen mit Krebs in Deutschland aufgezeigt.
Das zweite Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern menschliche Nähe und Distanz zwischen Personen, die Unterstützung erhalten und den Menschen, die Unterstützung leisten, hilfreich und wichtig ist. Dabei wird der Fokus auf weitere Fachbereiche geweitet und Argumente sowohl aus medizinischen, psychologischen und pflegewissenschaftlichen Blickwinkeln als auch aus sozialwissenschaftlicher, theologischer und kulturgeschichtlicher Perspektive betrachtet. Erkenntnisse zu einem positiven Umgang mit Nähe und Distanz aus diesen Themenfeldern werden daran anschließend zusammengefasst.
Im dritten Kapitel wird das Modellprojekt „Diagnose Krebs – Mitten im Leben“ von seiner Entstehungsgeschichte her über die zugrundeliegenden Prinzipien, die theoretische Konzeption bis hin zur praktischen Umsetzung beschreibend dargestellt. Dabei zeigt sich, dass Erkenntnisse, die im zweiten Kapitel aufgezeigt werden, konkret im Projekt angewandt wurden, um die psychosoziale Unterstützung der Betroffenen umzugestalten. Eine kritische Betrachtung und Bewertung des exemplarischen Projektes macht daraufhin deutlich, inwiefern ein beziehungs- und lebensweltorientierter Ansatz ein gelungener Zugang sein kann, um junge Menschen mit einer Krebserkrankung und ihr soziales Umfeld umfassend zu unterstützen. Benefit und Limitationen für Betroffene und das Versorgungssystem werden herausgearbeitet.
Der Schluss dieser Arbeit widmet sich mit einem Fazit der Zusammenfassung der markantesten Erkenntnisse und wagt einen Ausblick über die Unterstützung der jungen Krebserkrankten hinaus, in welcher Hinsicht die Ergebnisse auch für Menschen mit anderen Erkrankungen hilfreich sein könnten.
Die methodische Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit ist in den ersten beiden Kapiteln rein deskriptiv. Anhand interdisziplinärer Literaturrecherchen werden zunächst Lebensthemen, Herausforderungen und Probleme der Betroffenen herausgearbeitet. Die daran anschließende Darstellung der Versorgungsstruktur im medizinischen Kontext basiert auf Fachliteratur, die vorwiegend der Versorgungsforschung zuzuordnen ist.
Um alternative Ansätze angrenzender Disziplinen im Umgang mit Nähe und Distanz im zweiten Kapitel zu untersuchen, wird weitere Literatur aus unterschiedlichen Fachbereichen recherchiert. Dabei wird medizinische, psychologische, pflegewissenschaftliche, sozialwissenschaftlicher, theologische und kulturgeschichtliche Literatur zu Nähe und Distanz in den entsprechenden Fachbereichen beachtet. Die Literaturauswahl konzentriert sich auf Untersuchungen zu einzelnen Konzepten, Forschungsbereichen oder Vorgehensweisen, um Ansätze im Umgang mit Nähe und Distanz in der Unterstützung von Menschen darzustellen. Prämissen, Ideen, Konzepte oder Umsetzungsmöglichkeiten, die sich in diesen Disziplinen als fruchtbar erwiesen haben, werden zusammenfassend präsentiert. Daran schließt sich das dritte Kapitel mit einer deskriptiven Präsentation des Feldexperimentes an. Da bisher nur wenig Literatur zu dem Projekt existiert, sich dieses aber als exemplarischer Forschungsgegenstand eignet, muss beschreibend vorgegangen werden. Da der Verfasser das Projekt, welches als Feldexperiment dient, seit 2011 verantwortet und gestaltet, erscheint die Vorgehensweise angebracht.
Empirische Erkenntnisse externer Evaluationen des Modellprojektes werden im Anschluss mit einer eigenen empirischen Datenerhebung zur Inanspruchnahme präsentiert und ausgewertet. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem exemplarischen Forschungsprojekt werden zusammengefasst. Abschließend soll das Fazit einen Transfer der Erkenntnisse aus dem Feldexperiment auf andere Unterstützungssysteme ermöglichen.
Wegen der Komplexität der zu erörternden Themenfelder genügt es nicht, die Fragestellungen nur aus einem einzigen fachlichen Blickwinkel, wie beispielsweise Psychologie, Theologie oder Medizin, zu betrachten. Folglich ist die vorgelegte Dissertation eine interdisziplinäre Forschungsarbeit unter Beachtung unterschiedlicher Blickwinkel.
4 Möglichkeiten und Grenzen
Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz zwischen Helfenden und zu Unterstützenden im medizinischen Versorgungssystem leisten. Diese Auseinandersetzung findet bislang hierzulande kaum statt. Im europäischen Ausland dagegen, wie beispielsweise den Niederlanden, werden diese Themen diskutiert. Auch angrenzende Bereiche wie die Soziale Arbeit haben hierzu wissenschaftliche Grundlagen und alternative Ansätze erarbeitet und implementiert. Somit könnte die Arbeit diese entscheidende Diskussion auch hier in Deutschland befruchten.
Anhand des exemplarischen Modellprojektes wird ein konkreter Ansatz dargestellt, um die psychosoziale Versorgung junger Erwachsener mit Krebs zu verbessern. Dieser könnte über die Versorgung der Betroffenen am RBK hinaus ausgebaut und möglicherweise in mehreren Kliniken übernommen und angepasst werden.
Darüber hinaus könnten Anregungen gegeben werden, um Versorgungsstrukturen in angrenzenden Bereichen zu überdenken und weiter zu beziehungs- und lebensweltorientierten Ansätzen auch außerhalb der Sozialen Arbeit zu forschen. Menschen mit anderen lebenslimitierenden und/oder chronischen Erkrankungen könnten davon profitieren.
Über diese strukturelle Ebene der Versorgungsforschung hinaus kann und will die Arbeit auch Anregung für Pflegende, therapeutisches- und ärztliches Personal, Fachkräfte der Sozialen Arbeit und andere Helfende sein, menschliche Begegnung im eigenen beruflichen Kontext zu reflektieren und ggf. umzugestalten.
Neben den Möglichkeiten muss aber auch auf die Grenzen der vorliegenden Arbeit hingewiesen werden. Ein Feldversuch kann einerseits sehr konkret und praktisch einen Sachverhalt nachweisen, andererseits ist diese Methodik aber auch limitierend. Jeglicher Feldversuch, und damit auch in der empirischen Sozialforschung wie der Versorgungsforschung, kann nur nachweisen, wie ein Sachverhalt sich unter ganz bestimmten Umständen verhält. Wird der Versuch unter veränderten Bedingungen durchgeführt, muss mit veränderten Ergebnissen gerechnet werden.
Die Grenze, der hier im dritten Kapitel dargelegten Erkenntnis, liegen in multiplen Variablen. Allen voran ist die bedeutendste Variable stets der Faktor Mensch oder im konkreten Forschungsprojekt: Die Beziehung der Fachkraft zu den Betroffenen und umgekehrt. Fachkräfte in beziehungsorientierten Unterstützungssystemen benötigen unbedingt die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in komplexe Lebenswelten der Betroffenen zu involvieren. Auf der anderen Seite ist es unabdinglich, dass Betroffene sich im Kontakt öffnen, herausfordernde Lebensthemen benennen und sich auf das Beziehungsangebot einlassen wollen und auch können. Darüber hinaus ist jedoch eine Beziehungsgestaltung für den Menschen nicht vollumfänglich steuerbar, zu berechnen oder zu produzieren. Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt diese Ungewissheit mit dem Begriff „Unverfügbarkeit“ (Rosa, Hartmut 2019, 295–298).
Eine zweite Variable besteht zweifelsfrei in der Besonderheit oder gar Exklusivität jedes Modellprojektes. Intrinsische Motivationsfaktoren der Fachkräfte, wie zum Beispiel der Wunsch nach Veränderung, Selbstwirksamkeit, Gestaltungsfreiraum o.ä., können sich mit extrinsischen Faktoren, wie zum Beispiel der aktiven Unterstützung durch Vorgesetzte, positiv zu einem motivierenden Arbeitsumfeld ergänzen (Becker, Florian 2019, 141–152). Ob in einer Regelversorgung die Motivation der Mitarbeitenden in diesem Maße gefördert werden kann, bleibt unklar. Es ist davon auszugehen, dass auch die Veränderung weiterer Variablen die Ergebnisse des Feldversuches verändern werden.
Die vorliegende Arbeit liefert Erkenntnisse zu einem veränderten Umgang von Nähe und Distanz zwischen Unterstützenden und Betroffenen in einem beziehungs- und lebensweltorientierten psychosozialen Angebot innerhalb des medizinischen Kontextes. Dies wiederum bietet eine Chance auf effektive Unterstützung für Betroffene und Angehörige.
Weitere Daten stehen aus und könnten in einem größeren multizentrischen Feldversuch gesammelt werden, welcher aktuell konzeptioniert wird.
Kapitel I Junge Erwachsene mit Krebs in ihrer Lebenswelt
Lebensbedrohliche Diagnosen stellen einen massiven Einschnitt im Leben dar, der von Betroffenen als Schock, surreales Erlebnis oder auch nicht enden wollender Albtraum beschrieben wird. Das Leben verändert sich für die Menschen unumkehrbar.
Krebserkrankungen sind die häufigste Todesursache unter dem 65. Lebensjahr in Deutschland (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2019). Obwohl die meisten Diagnosen in deutlich fortgeschrittenem Alter gestellt werden, erkranken auch junge Menschen an Krebs. Was aber ist Krebs? Und wer sind die jungen Erwachsenen?
Der eher umgangssprachlich verwendete Begriff Krebs ist ein Überbegriff für sehr viele Erkrankungen, deren Gemeinsamkeit in bösartiger Neubildung körpereigener Zellen besteht. In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD 10) sind die Erkrankungen unter der Ziffer C zusammengefasst und als „bösartige Neubildungen“ (allgemeinverständlich: Krebs) bezeichnet (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 2020).
Die Informationen zum Thema Krebs sind nahezu unerschöpflich. In den Medien finden sich Nachrichtenmeldungen zu Krebserkrankungen prominenter Persönlichkeiten, über semiprofessionelle Therapieansätze bis hin zu wissenschaftlich basierten Informationen der Krebsgesellschaften, einzelner Stiftungen oder Ärztegesellschaften. Kaum ein anderes Thema ist so stark mit der Angst zu sterben verknüpft. Da Krebs jede oder jeden treffen kann, meist akut auftritt und manchmal auch sehr schnell zum Tod führt, ist diese Angst sehr subtil und weit verbreitet. Zusätzlich dazu ist Krebs eine häufig auftretende Erkrankung, und daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, im sozialen Umfeld damit konfrontiert zu werden.
Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums publiziert auf seiner Webseite allgemeinverständlich, fundiert und ausführlich zu den Krebserkrankungen (www.krebsinformationsdienst.de). Die folgenden Erläuterungen basieren auf dessen Informationen. Innerhalb der Arbeit werden immer wieder aktuelle Zahlen und Daten unterschiedlicher Quellen zu Krebserkrankungen präsentiert, welche für die jeweilige Argumentation hilfreich erscheinen.
Für den Zweck eines allgemeinen Überblicks bietet sich hier die folgende Aufgliederung in drei Übergruppen der Krebserkrankungen an:
Zunächst ist die Gruppe der soliden Tumorerkrankungen zu nennen, welche ihren Ursprung in einem körpereigenen Organ haben und sich durch Wachstum von Geschwülsten zeigen. Bei jungen Menschen sind das Krankheiten wie z.B. Hodentumore, Brustkrebserkrankungen oder auch Hautkrebserkrankungen.
In der zweiten Gruppe der Erkrankungen sind die Leukämien zu nennen. Diese werden in Fachkreisen nur im weiteren Sinne als Krebserkrankungen betrachtet, da sie ihren Ursprung nicht in einem Organ, sondern im blutbildenden System des Knochenmarkes haben. Abhängig davon, welche Blutzellen betroffen sind und wie diese sich verändert haben, handelt es ich um unterschiedliche Diagnosen mit komplexen Auswirkungen und Verläufen. Hier sind unter anderem die Akute Myeloische Leukämie (AML) oder die Akute Lymphoblastische Leukämie (ALL) als Erkrankungen junger Menschen zu nennen.
Die dritte Gruppe der malignen (bösartigeren) Lymphome kann sowohl als Untergruppe der Leukämien oder aber eigenständig betrachtet werden, was für diesen Überblick letztlich unbedeutend ist. Diese haben ihren Ursprung im lymphatischen Gewebe des Körpers und zeigen sich durch übermäßiges Wachstum von fehlerhaften weißen Blutkörperchen, den Lymphozyten. Erste Anzeichen für Lymphome sind häufig geschwollene Lymphknoten. Zu dieser Gruppe gehören beispielsweise das Hodgkin Lymphom und die Non-Hodgkin-Lymphome.
Auch wenn in der Fachwelt die Leukämien und Lymphom-Erkrankungen nur im weiteren Sinne zu den Krebserkrankungen gezählt werden, hat sich der Begriff Krebs als Überbegriff für alle drei beschriebenen Krankheitsgruppen weitgehend durchgesetzt und wird auch von Experten genutzt (Aulitzky, Walter-Erich; Waldmann, Werner 2007), und dementsprechend in der vorliegenden Arbeit so verwendet.
Da die einzelnen Diagnosen auch innerhalb der vorgenommenen Gruppierungen sehr unterschiedliche Ursachen, Auswirkungen, Therapieansätze und Prognosen haben, wird das Bild der Krebserkrankungen immer unscharf bleiben. Darüber hinaus sind auch die betroffenen jungen Erwachsenen eine inhomogene Gruppe. Neben der Varianz krankheitsbedingter Beeinträchtigungen, Prognosen, Therapien und Langzeitfolgen sind auch Lebensphasen, persönliche Ressourcen, Möglichkeiten und Grenzen der Betroffenen und ihres Umfeldes sehr unterschiedlich und stets individuell zu betrachten.
Sowohl in der deutschsprachigen als auch in internationalen Fachliteratur wird die Gruppe der jungen Erwachsenen als „AYA“ (adolescents and young adults with cancer) bezeichnet. Im angloamerikanischen Bereich bezieht sich die Formulierung in der Regel auf die 15- bis 39-Jährigen. Die Expertengruppe um Gery Guy forscht beispielsweise zu den finanziellen Folgen der AYA, im US. amerikanischen Kontext und untersucht dabei diese Altersgruppe (Guy, Gery P.; Yabroff, K. Robin; Ekwueme, Donatus U.; Smith, Ashley Wilder; Dowling, Emily C.; Rechis, Ruth; Nutt, Stephanie; Richardson, Lisa C. 2014). In Deutschland herrscht dagegen in den Versorgungsstrukturen eine Trennung zwischen der Pädiatrie (Kinder- und Jugendheilkunde) und Erwachsenenmedizin. Zuständigkeiten für Erkrankte bis zu dem 18. Lebensjahr liegen in der Pädiatrie, die hervorragende Versorgungsstrukturen für Kinder und Jugendliche gestaltet hat. Da strukturübergreifende Arbeiten sich sehr kompliziert gestalten, konzentrieren sich hierzulande Forschung und Unterstützung für junge Erwachsener mit Krebs auf 18- bis 39-Jährige. Ein Beispiel wäre in diesem Zusammenhang die Leipziger AYA-Forschungsgruppe zu psychosozialen Themen und Langzeitfolgen (Geue, Kristina; Leuteritz, Kathja; Nowe, Erik; Sender, Annekathrin; Stobel-Richter, Yve; Friedrich, Michael 2017) oder auf Unterstützerseite die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs (Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 2020a). Da sowohl Versorgungsangebote als auch psychosoziale Folgen in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich sind, wird in der vorliegenden Arbeit bei den Themenfeldern der Versorgungsforschung vorwiegend auf deutsche Fachliteratur zurückgegriffen, die sich, sofern nicht anders vermerkt, auf junge Erwachsene mit Krebs im Alter von 18 bis 39 Jahren bezieht.
Um die Herausforderungen der Betroffenen zu erfassen, ist es unumgänglich, sich mit der Lebenswelt gesunder Gleichaltriger zu beschäftigen. Hierzu hat Mathias Freund, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO), Mitgründer und Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, die psychosozialen Bereiche in der folgenden Grafik sehr anschaulich dargestellt.
Abbildung 1: Mögliche Lebensthemen in der Entwicklung junger Erwachsener (eigene Darstellung nach Mathias Freund; Volker König et al. 2019, S. 13)
Eine Krebsdiagnose in diesen Lebensphasen stellt das Leben der Betroff enen meist förmlich „auf den Kopf“. Neben den üblichen altersentsprechenden Lebensthemen (wie in Abbildung 1 dargestellt) kommen für die jungen Erwachsenen durch die Krebserkrankung neue Herausforderungen hinzu, die sie deutlich von ihren Altersgenossen unterscheiden. Einer unserer jungen Patienten hat diese Veränderung einmal als „Leben auf einem anderen Stern“ beschrieben – ein Leben mit anderen Problemen, Ängsten und gefühlter Distanz zu gesunden Gleichaltrigen.
Der Versuch, als Nichtbetroff ene die Lebenswelt junger, an Krebs erkrankter Menschen zu verstehen, wird wohl nur begrenzt möglich sein. Dennoch soll dieses Kapitel einen Einblick in die Herausforderungen der Betroff enen geben und aufzeigen, mit welchen Problemen und Folgen sie durch die Erkrankung zu kämpfen haben.
Vielfältige Unterstützungsangebote vonseiten der professionellen Versorgungsstruktur und des zivilgesellschaftlichen Engagements stehen zur Verfügung. Im zweiten Teil des ersten Kapitels werden diese präsentiert und aufgezeigt, inwiefern die jungen Erwachsenen die Angebote in Anspruch nehmen.
1 Lebensverändernde Herausforderungen durch Krebs
Wie einleitend erwähnt sind Probleme, Nöte, Symptome und Folgen einer Krebserkrankung vielfältig. Von den jeweils individuell zu betrachtenden psychischen, emotionalen, spirituellen oder auch sozialen Herausforderungen der Erkrankten sind vor allem drei Faktoren zu benennen, welche das Leben mit einer Krebserkrankung maßgeblich beeinflussen: Krankheitsspezifische Auswirkungen, die jeweilige Lebensphase und die Prognose der Erkrankung.
Die Symptome und weiteren direkten körperlichen Auswirkungen einer Erkrankung können sehr belastend sein. Darüber hinaus sind die erforderlichen, auf einzelne Diagnose genau abgestimmte Therapien unter Umständen in diversen Facetten sehr strapaziös. Der temporäre Verlust des Haarkleides ist z.B. für eine junge Frau während einer Chemotherapie sehr belastend, ein deutlich massiverer und nachhaltigerer Einschnitt ist jedoch, wenn zur Tumorentfernung beispielsweise ein Bein amputiert werden muss.
Wie anhand der oben gezeigten Grafik deutlich wird, sind die jungen Erwachsenen in den Lebensphasen, in denen sie sich befinden, bereits mit multiplen Unsicherheiten, Aufgaben und Problemstellungen konfrontiert. Diese spezifischen Themenfelder sind ein zweiter Faktor für Auswirkungen und Bewältigung einer Erkrankung. Ein junger Mensch, der sich beispielsweise schon weitgehend emotional und auch räumlich von Elternhaus gelöst hat, aber noch nicht in stabilen Beziehungen lebt, ist dadurch zusätzlich zu den krankheitsspezifischen Problemen mit weiteren Belastungen konfrontiert. Wirtschaftliche Fragen, mangelnde emotionale oder auch praktische Unterstützung, in und nach der Behandlungsphase können die Situation zusätzlich erschweren.
Der dritte Faktor, einer der bedeutendsten, ist die Prognose. Mit Prognose ist hier der auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende anzunehmende Verlauf der Erkrankung und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser auf den oder die Erkrankten zutrifft gemeint. Für viele Betroffene sind diese Informationen unvorstellbar wichtig, auch wenn Prognosen manchmal nur sehr unscharf sind und somit auch nicht klar kommuniziert werden können. Von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang sind Wahrscheinlichkeiten bezüglich Überleben, verbleibender Lebenszeit, möglicher Neuerkrankung und/oder Spätfolgen.
Mit der Diagnose einer Krebserkrankung ist für die Mehrzahl der Betroffenen und ihr Umfeld der Gedanke, dass eine Krebserkrankung tödlich sein kann, plötzlich präsent. Durch die „Verkündung der Prognose“ wird diese Angst vor dem Tod meist entweder deutlich relativiert oder dramatisiert. Hat sich beispielsweise eine Brustkrebserkrankung an unterschiedlichen Stellen des Körpers durch Metastasen (Tochtergeschwülste) ausgebreitet und stellt sich in der Gewebeprobe heraus, dass diese nicht nur aggressiv wachsen, sondern auch schlecht behandelt werden können, ist die Prognose negativ und damit garantiert belastend. Auf der anderen Seite kann eine günstige Prognose, wie beispielsweise im Frühstadium eines Hauttumors, die Betroffenen entlasten und Gedanken an und Angst vor Tod verdrängen.
Anhand der genannten Faktoren wird deutlich, wie vielschichtig die Auswirkungen einer Erkrankung sind. Für die Betroffenen und ihr Umfeld sind diese komplex und schmerzhaft. Auch wenn viele Erkrankte genesen, Nebenwirkungen und Folgen der Erkrankungen gut kontrolliert werden können, gibt es immer noch junge Menschen die extremes Leid erleben oder an der Krebserkrankung sterben.
Der russische Schriftsteller Tolstoj zeigt 1886 in seiner Erzählung „Der Tod des Iwan Iljitsch“ sehr anschaulich die Not und Verzweiflung eines Juristen auf, der von seiner Familie ausgegrenzt und völlig verzweifelt auf dem Sterbebett sein Leid klagt. Dabei wird deutlich, dass körperliche Schmerzen nur ein Aspekt des Leides des Iwan Iljitsch sind, die Gesamtsituation sich aber deutlich komplexer darstellt. Verzweiflung, Einsamkeit, Neid auf die Gesunden, Trauer über das nicht gelebte Leben, Hilflosigkeit, Grausamkeit der Menschen, Grausamkeit und Abwesenheit Gottes, all das bringt er zum Ausdruck. Ihn quält die Frage nach dem Warum und die Verzweiflung über das Leben, das er nicht gelebt hatte (Tolstoj, Leo 1886).
Der ärztliche Leiter des Garden House Hospice (UK), Viv Lucas, bringt Tolstojs Geschichte in Verbindung mit dem Konzept von „total pain“, welches die englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Cicely Saunders beschrieben hat (Lucas, Viv 2012). Was in Tolstojs Novelle auf grausame Art anschaulich wird, versucht Cicely Saunders wissenschaftlich zu beschreiben und definiert dabei Schmerz weitaus umfassender, als das in rein biophysischen oder biochemischen Zusammenhängen gefasst werden kann. Die Begründerin der heutigen Hospiz- und Palliativbewegung spricht von „total pain“ als umfassendes Schmerzerleben, welches auf körperlicher, psychischer, sozialer und auch spiritueller Ebene betrachtet werden muss (Saunders, Cicely 1967).
Diese vier Dimensionen menschlichen Lebens hat 2002 auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgegriffen, um die Beeinträchtigungen durch eine Krebserkrankung und deren Behandlung zu thematisieren (World Health Organization 2002, 9, 105).
Anhand dieser von der WHO verwendeten Gliederung, werden in den folgenden Abschnitten lebensverändernden Herausforderungen junger Menschen aufgrund der Krebserkrankung thematisiert.
1.1 Herausforderungen auf körperlicher Ebene
Wie bereits deutlich wurde, sind Krebserkrankungen sehr unterschiedlich und differenzieren sich nicht nur in den Zellen, aus denen die bösartigen Neubildungen mutiert sind, sondern auch in der Aggressivität des Zellwachstums, der Ausbreitung im Körper und auch in den Möglichkeiten, die Erkrankung mit aktuellen Methoden zu behandeln. Daraus resultierend ergeben sich auch komplexe körperliche Auswirkungen für die Betroffenen, welche sich auch im Krankheitsverlauf verschiedenartig darstellen.
Diese Komplexität ermöglicht weder eine umfassende, noch eine detaillierte Darstellung der körperlichen Auswirkungen der Erkrankungen. Die aufgezeigte Zusammenfassung soll keine medizinische akkurate Beschreibung aller möglicher körperlicher Veränderungen sein, sondern auch Menschen ohne medizinisches Expertenwissen, einen Einblick ermöglichen, mit welchen körperlichen Veränderungen sich junge Menschen mit einer Krebserkrankung konfrontiert sehen.
Für diese Zielsetzung erscheint eine chronologische Darstellung dienlich. Mit den ersten Symptomen der Krebserkrankungen beginnend, werden anschließend Folgen der Erkrankungen und deren Therapien in der Behandlungsphase und abschließend mögliche Spätfolgen der Erkrankung dargestellt. Durch den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums (www.krebsinformationsdienst.de) und die DGHO (www.onkopedia.com) sind online detailliertere Informationen zu den Krebserkrankungen zugänglich. Die folgenden Abschnitte basieren, wenn nicht anders vermerkt, auf deren Informationen.
1.1.1 Unerklärliche Symptome ohne eindeutige Diagnose
Die durch die jeweilige Krebserkrankung hervorgerufenen und somit bei den Erkrankten gehäuft auftretenden Veränderungen und Einschränkungen werden als krankheitsspezifische Symptome bezeichnet. Diese Symptome können jedoch außer einer Krebserkrankung auch andere Ursachen haben und sind daher meist nur ein erster vager Hinweis, der einer weiteren Diagnostik bedarf.
Die Symptome und Funktionseinschränkungen eines Organes, eines Körperteiles oder des gesamten Körpers, die durch eine Krebserkrankung hervorgerufen werden, lassen sich in spezifische und unspezifische Symptome unterteilen.
Spezifische Symptome entstehen meist durch Veränderungen, welche durch die bösartigen Neubildungen in den betroffenen Körperbereichen entstehen, und somit deren Funktion und häufig auch die Funktion umliegender Organe oder weiterer davon anhängiger Funktionen beeinträchtigen. Bei soliden Tumorerkrankungen führt das Wachstum der Krebszellen nicht nur zur Zerstörung des betroffenen Gewebes, sondern auch zu Entzündungen und Schwellungen im umliegenden Gewebe. Dadurch bedingt, können als direkte Auswirkung dieser Veränderung lokale Schmerzen, Hautveränderungen, Blutverlust und/oder körperliche Schwäche auftreten. Beispielhaft kann hierfür eine Brustkrebserkrankung genannt werden, welche sich zunächst nur in einem verhärteten Knoten, einer Hautveränderung oder einer Entzündung der Brust zeigt. Wächst ein Tumor jedoch in einem inneren Organ, wie beispielsweise der Leber, kann sich dies durch Schmerzen im Bauchraum, vor allem aber durch Funktionseinschränkungen zeigen. Bei der Leber können beispielsweise eine Gelbfärbung der Augen und der Haut oder starke Müdigkeit die Folge eingeschränkter Organfunktion sein.
Spezifisches Symptom der Lymphom-Erkrankungen können beispielsweise geschwollene Lymphknoten sein. Bei der Gruppe der Leukämien kann die Ausbreitung unfertiger und nicht funktionierende Leukozyten (also Leukämiezellen) im Blut zu erhöhter Infektanfälligkeit führen, da nicht mehr genügend gesunde Leukozyten zur Abwehr bereitstehen. Häufig verdrängen diese kranken Zellen auch andere Blutzellen. Durch den folgenden Mangel an Erythrozyten, welche für den Sauerstofftransport zuständig sind, kommt es bereits bei geringer körperlicher Belastung zu Schwäche oder Müdigkeit.
Neben den spezifischen Krankheitszeichen, die bei einer Krebserkrankung auftreten können, kommt es häufig auch zu sehr unspezifischen Auswirkungen wie Fieber, Nachtschweiß oder Gewichtsabnahme. Diese unspezifischen Begleiterscheinungen einer möglichen Tumorerkrankung werden auch als B-Symptomatik bezeichnet (Krebsinformationsdienst; Deutsches Krebsforschungszentrum 2021), müssen aber nicht automatisch durch eine Krebserkrankung bedingt sein, sondern können ebenso sehr unterschiedliche Ursachen haben.
Da die durch eine Krebserkrankung verursachten körperlichen Veränderungen oder Beeinträchtigungen häufig auch bei anderen, nicht so folgenschweren Erkrankungen auftreten können, suchen Erkrankte nicht immer zeitnah ärztliche Hilfe, was eine klare Diagnosestellung und somit auch einen möglichen Behandlungsbeginn verzögert. Immer wieder kommt es aber auch vor, dass Menschen bereits lange Zeit an schwersten, teils recht eindeutigen Symptomen leiden, diese weitgehend verdrängen, mit anderen Ursachen in Verbindung bringen oder bagatellisieren, da sie sich nicht mit der Tatsache einer schweren Erkrankung auseinandersetzen wollen oder können. So kommt es immer wieder vor, dass Frauen die Diagnose einer Brustkrebserkrankung verschleppen, da sie eine Geschwulst in der Brust lange Zeit mit alternativ- bzw. paramedizinischen Methoden zu behandeln versuchen oder komplett ignorieren (Banerjee, Saptarshi 2019, 22). Der Tumor kann in dieser Zeit ungehindert wachsen, Metastasen bilden und die Betroffenen suchen unter Umständen erst ärztliche Hilfe auf, wenn der Tumor durch die Haut wächst und dadurch eine offene Wunde entsteht. Aber auch bei jungen Männern mit Hodenkrebserkrankungen kommt es manchmal zu den beschriebenen Verdrängungsreaktionen bei recht eindeutigen Erkrankungszeichen (Saab, Mohamad M.; Hegarty, Josephine; Landers, Margaret 2019). Die Geschwulst am Hoden wird von den Betroffenen teilweise so lange ignoriert, bis durch das Ausmaß des Tumors Einschränkungen beim Gehen entstehen oder Alltagsaktivitäten nur noch begrenzt möglich sind. Ärztliche Hilfe wird teils erst in Anspruch genommen, wenn das Umfeld der Betroffenen die Veränderungen bemerkt und den Betroffenen dazu nötigt. Es kommt aber auch vor, dass Erkrankte erst aufgrund von Rückenschmerzen, welche durch Knochenmetastasen eines großen Hodentumors verursacht sind, ärztliche Unterstützung suchen und in diesem Zusammenhang dann die Erkrankung diagnostiziert wird.
Eine Verdrängung von Krankheitssymptomen, wie sie in den beiden Beispielen beschrieben wurde, ist sicher nur bei einer kleinen Minderheit der Betroffenen zu beobachten, zeigt aber exemplarisch, dass, selbst wenn Symptome für Betroffene kaum zu ignorieren sind, die aktive Auseinandersetzung dennoch ausbleiben kann und Erkrankungen erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert bzw. behandelt werden.
Neben den beschriebenen, tendenziell durch die Betroffenen verursachten Verzögerungen einer eindeutigen Diagnose, kommt es auch immer wieder auf ärztlicher Seite zu Fehleinschätzungen. Die Gründe hierfür können sehr unterschiedlich sein. Die folgende Ausführung dreier Themenfelder lassen erahnen, wie schwierig es in der hausärztlichen Praxis sein kann, auf eine potentielle Krebserkrankung aufmerksam zu werden. Die erste Schwierigkeit besteht in der „Alltäglichkeit“ einer Symptomatik, darüber hinaus ist die Zeit, die für einzelne Erkrankte in der Sprechstunde zur Verfügung steht, sehr begrenzt und ein bedeutender Anteil der Erkrankten klagt über belastende Symptome, obwohl keine körperliche Erkrankung vorliegt, sondern andere Motive im Vordergrund stehen (s.u.).
Einige Beispiele hierzu: Klagt ein Patient bei der Hausärztin über Rückenschmerzen, so gehört er zu den 70 % der Erwachsenen in Deutschland, die angeben, mindestens einmal im Jahr unter einer Rückenschmerzepisode zu leiden. Rückenschmerzen können sehr vielfältige Ursachen haben, sind aber sehr selten Anzeichen für potenziell gefährliche Erkrankungen. So leiden 4 % an einem Bandscheibenvorfall, weiter 4 % an osteoporotischen Kompressionsfrakturen und lediglich 0,7 % leiden unter einer Krebserkrankung (Bleckwenn, Markus; Märker-Hermann, Elisabeth 2019).
Die bundesweite Umfrage Ärztemonitor 2018 zeigt, dass durch eine ärztliche Fachkraft in der hausärztlichen Versorgung täglich durchschnittlich 52,5 Patient-Innen und in der fachärztlichen Versorgung 37,2 PatientInnen je Fachkraft behandelt werden (Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e.V. 2018, 36). Der daraus resultierende Zeitmangel erschwert eine umfängliche Diagnostik, welche auch bei vielen Beschwerden oder Erkrankungen u.U. nicht angemessen erscheint.
Darüber hinaus leidet nur ein sehr kleiner Anteil der Menschen, die sich in der hausärztlichen Praxis vorstellen, an einer potentiell gefährlichen Erkrankung. Sehr deutlich zeigt sich diese Problematik in den Behandlungsleitlinien zu den „funktionellen Körperbeschwerden“, einer Umschreibung für unterschiedliche Symptome wie Kraftlosigkeit, Schwindel, Schmerzen, Verspannungen oder Verdauungsbeschwerden, bei denen keine körperliche Erkrankung ursächlich ist, die Betroffenen jedoch sehr häufig Kontakt zum Gesundheitssystem suchen. In der hausärztlichen Versorgung muss davon ausgegangen werden, dass ca. 2050 % der Erkrankten unter „funktionellen Körperbeschwerden“ leiden und keine körperliche Ursache für beschriebe Beschwerden gefunden werden kann (Roenneberg, Casper; Hausteiner-Wiehle, Constanze; Henningsen, Peter 2020, 38).
Demzufolge ist die Diagnostik einer schweren körperlichen Erkrankung, wie beispielsweise Krebs, im bestehenden Gesundheitssystem eine ungemein schwierige und diffizile Aufgabe.
Neben den beschriebenen Verzögerungen einer Diagnose seitens der Betroffenen und der hausärztlichen Versorgung, entstehen häufig weiter Verzögerungen durch Wartezeiten bei wichtigen Untersuchungen in der fachärztlichen Versorgungsstruktur. Die Wartezeiten für Termine betrugen 2019 häufig mehr als drei Wochen (Ärzteblatt 2020). Ob sich diese Situation deutlich durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), welches bereits am 11.05.2019 in Kraft getreten ist, deutlich verbessert, wird die Zeit zeigen.
Dieser Hintergrund erklärt, warum immer wieder Erkrankte mit deutlichen Krankheitssymptomen zwei oder drei hausärztliche Termine wahrnehmen und teilweise erst nach vielen Wochen weitere Diagnostik im fachärztlichen System erhalten. Steht eine Verdachtsdiagnose im Raum, beanspruchen weitere fachärztliche Untersuchungen zur exakten Diagnosesicherung zusätzlich Zeit.
Für die Betroffenen ist die Zeitspanne vom Auftreten erster Krankheitssymptome bis zur eindeutigen Diagnose einer Tumorerkrankung häufig sehr belastend und verunsichernd. Nicht selten berichten sie über Fehleinschätzungen von ärztlicher Seite, wie beispielsweise die Zuschreibung der Symptome als ursächlich psychosomatischer Natur. Diese spezielle Zuschreibung wird häufig als kränkend empfunden und geht nicht selten mit einem generellen Vertrauensverlust in die ärztliche Versorgung einher.
Steht nach dieser Phase der Unklarheit eine Krebsdiagnose fest, leiden PatientInnen immer noch an körperlichen Symptomen. Außerdem wird „spürbar deutlich“, wie umfassend sich das Leben durch die Erkrankung verändern wird und ggf. akut bedroht ist.
1.1.2 Quälende Symptome durch die Erkrankung und Therapien
Stehen Diagnose und Ausmaß der Erkrankung fest, wird den Betroffenen ein Therapievorschlag unterbreitet. Diese Therapien sind individuell abhängig von der Erkrankung, deren Ausbreitung und der körperlichen Verfassung der Patient-Innen. Therapien, die aktuell in der Krebsbekämpfung angewendet werden, sind zum Beispiel diverse Operationen zur Entfernung von Tumoren, Chemotherapie, Bestrahlung, Hormontherapie, Stammzelltransplantationen, Antikörpertherapie, Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder auch neuartige Ansätze wie z.B. die CAR-T-Zelltherapie.
Der zeitliche Verlauf nötiger Behandlungsphasen ist ebenfalls unterschiedlich. Wird beispielsweise eine auffällige Hautveränderung durch eine kleine Operation entfernt und in der nachfolgenden Gewebsuntersuchung als Hautkrebs diagnostiziert, der auch vollständig entfernt wurde, muss unter Umständen keine weitere Behandlung folgen. Dagegen erstreckt sich ein Behandlungsschema bei Erwachsenen mit Akut Lymphoblastischer Leukämieerkrankung über knapp drei Jahre. Therapien unterschiedlicher metastasierter Krankheiten können hingegen lebenslänglich erforderlich sein.
Die Nebenwirkungen und belastenden Folgen der einzelnen Therapien sind mannigfaltig und trotz bedeutender medizinischer Fortschritte in der Eindämmung von Nebenwirkungen und Langzeitfolgen nicht immer zuverlässig beherrschbar bzw. prognostizierbar. So stehen u.a. inzwischen gut wirksame Medikamente zur Linderung von Übelkeit/Erbrechen bei Chemotherapie zur Verfügung. Bei anderen Nebenwirkungen, wie Schwäche, Abgeschlagenheit und Infektanfälligkeit stehen aktuell noch kaum lindernde Methoden zur Verfügung.
Bei vielen Krebsarten müssen PatientInnen zudem damit rechnen, durch die Erkrankung, meist aber infolge der lebenswichtigen Therapien, unfruchtbar zu werden (Appiah, Leslie Coker; Green, Daniel M. 2019). Manche junge Erwachsene haben sich vor einer Krebsdiagnose nur sehr begrenzt mit Zukunftsplänen wie Familienplanung auseinandergesetzt. Bedingt durch die aktuelle Bedrohung der Erkrankung kann sowohl auf ärztlicher Seite als auch seitens der Betroffenen ein möglicher zukünftiger Kinderwunsch sekundär erscheinen. Jahre später empfindet aber ein Großteil der Betroffenen die Unfruchtbarkeit infolge der Krebstherapie als sehr belastend (Armuand, Gabriela M.; Wettergren, Lena; Rodriguez-Wallberg, Kenny A.; Lampic, Claudia 2014). Lange Zeit wurde das Problem der Fruchtbarkeitsschädigung ungenügend beachtet und junge Erkrankte teils nicht oder schlecht beraten (Balcerek, Magdalena; Schilling, Ralph; Byrne, Julianne; Dirksen, Uta; Cario, Holger; Fernandez-Gonzalez, Marta Julia; Kepak, Tomas; Korte, Elisabeth; Kruseova, Jarmila; Kunstreich, Marina; Lackner, Herwig; Langer, Thorsten; Sawicka-Zukowska, Malgorzata; Stefanowicz, Joanna; Strauß, Gabriele; Borgmann-Staudt, Anja 2020). In den letzten Jahren rückt das Thema zunehmend in den Fokus der medizinischen Diskussion.
Unterschiedliche Möglichkeiten stehen für Frauen und Männern zur Verfügung, um vor Gabe von überlebenswichtigen, aber fruchtbarkeitschädigenden Therapien Keimzellen zu gewinnen. Diese können nach der Therapie für eine künstliche Befruchtung genutzt werden. Eine Vernetzung unterschiedlicher Forschungsinstitute und Kliniken durch Fertiprotekt e.V. ermöglicht im deutschsprachigen Raum die Bündelung aller wichtigen Informationen.
Viel mehr im Fokus der Behandler, Betroffenen und Angehörigen stehen zu diesem Zeitpunkt jedoch körperliche Beschwerden, mögliche Nebenwirkungen der vorgeschlagenen Therapien und auch Angst, an der Erkrankung zu versterben.
Zusätzlich zu den bestehenden krankheitsbedingten Beschwerden führen die unterschiedlichen Krebstherapien zu Nebenwirkungen und weiteren Einschränkungen: Beispielsweise eine Leukämiepatientin, die vor der Therapie schon sehr geschwächt und zusätzlich durch einen Infekt in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt war, wird durch Chemotherapie und Stammzelltransplantation noch maßgeblich weiter belastet. Oder aber der junge Mann, der durch eine Knochenkrebserkrankung bereits vor der Diagnose unter Schmerzen, Müdigkeit und Bewegungseinschränkungen gelitten hat, erlebt bedingt durch Chemotherapie, die Amputation des betroffenen Beines und eine Strahlentherapie herausfordernde Belastungen und eine nachhaltige Einschränkung.
Auch wenn die Komplexität möglicher behandlungsbedingter körperlicher Auswirkungen deren allumfassende Beschreibung kaum ermöglicht, müssen die Betroffenen vor Therapiebeginn über mögliche Folgen, Komplikationen und Nebenwirkungen aufgeklärt werden, bevor diese durchgeführt werden können. Da viele Krebserkrankungen unbehandelt oft schnell tödlich verlaufen, sind Erkrankte meist bereit, auch sehr weitreichende Einschränkungen durch die Therapien hinzunehmen. Selbst wenn die Chance auf Heilung gering ist, mit starken Nebenwirkungen gerechnet werden muss und die Gefahr besteht, an der vorgeschlagenen Therapie zu sterben, entscheiden sich die allermeisten jungen Erwachsenen dennoch dafür. Da auch für Fachkräfte nicht immer gesichert sein kann, ob die Therapie im Einzelfall auch bei weit fortgeschrittener Erkrankung zielführend sein wird, versterben Erkrankte teils auch während der Therapiezyklen. Zusätzlich dazu stellt u.U. auch die mangelnde Auseinandersetzung mit dem Tod seitens des Behandlungsteams und der Betroffenen ein Problem dar. Im Vorfeld findet unter Umständen keine objektive Abwägung zwischen den durch die Therapie verursachten zusätzlichen letalen Gefahren gegenüber der Möglichkeit einer lebenszeitverlängernden Palliativtherapie statt.
Aber auch bei Erkrankungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit geheilt werden können und die Therapien vergleichsweise weniger einschneidend sind, leiden viele Erkrankten an deutlichen Beeinträchtigungen, die infolge der Behandlung auftreten können: Haarausfall, Amputation von Körperteilen wie Brust oder Hoden, ständigen Durchfällen, einem künstlichen Darmausgang, sexueller Dysfunktion, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen, Gangunsicherheit, Schmerzen oder auch ausgeprägter körperlicher Schwäche.
Einige der Symptome sind vor allem in der Akutphase der Erkrankung sehr präsent, andere Auswirkungen bleiben ein Leben lang bestehen. Auf www. krebsinformationsdienst.de sind die spezifischen Nebenwirkungen einzelner Therapien allgemeinverständlich erklärt.
1.1.3 Bleibende körperliche Einschränkungen trotz Heilung
Die Spätfolgen einer Krebserkrankung und der daraus folgenden Therapie bedeuten für viele Menschen über Jahre hinweg eine verminderte Lebensqualität, die mit einer einschneidenden Lebensveränderung einhergeht.





























