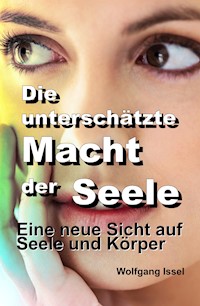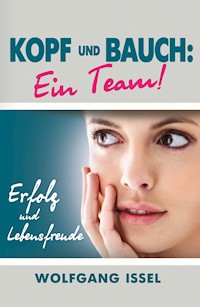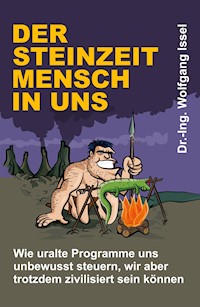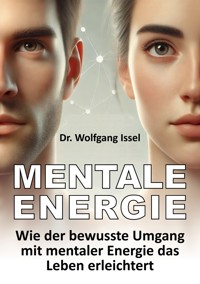
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
„Mentale Energie“ schöpfen wir aus positiven Erlebnissen, beruflichen und privaten Erfolgen, stabilen sozialen Beziehungen und Genussmomenten. Wir verlieren sie durch Misserfolge, kritische Beziehungen und falsche Entscheidungen. Ohne ausreichenden Zufluss aus diesen Energiequellen gerät das Gehirn unter Stress und schaltet auf »Notmodus«, was die geistige Leistungsfähigkeit einschränkt und das Lebensgefühl mindert. Vernunft und Rationalität weichen Schwarz-Weiß-Denken, ideologischen Mustern oder dem Glauben an »höhere Mächte«. In diesem Zustand verzerrt das Gehirn die Realität und greift zu seinem Schutz notfalls auf Aggression und Machtausübung zurück. Dieses Buch zeigt, wie das Gehirn aus Sicht eines neuen Modells arbeitet und bietet alltagsnahe Strategien, um die Zuflüsse mentaler Energie zu steigern, den Verstand zu schärfen und Stress langfristig zu reduzieren. In Zeiten der Unsicherheit eröffnet es neue Perspektiven und gibt Mut, hoffnungsvoll und zielgerichtet durchs Leben zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dr. Wolfgang Issel
Mentale Energie
Wie der bewusste Umgang mit mentaler Energie das Leben erleichtert
© 2024 Dr. Wolfgang Issel
Lektoratsservice: Martina Leiber, Karlsruhe
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Softcover978-3-384-38816-2copy
Hardcover978-3-384-38817-9copy
E-Book978-3-384-38818-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Das Gedankenmodell der „mentalen Energie“
2. Einführung in das Konzept der „mentalen Energie“
3. Der Pegel an „mentaler Energie“: ein Modell des Energiekontos
4. Mittlerer Energiepegel: Ausgeglichenheit
5. Moderat gesunkener mentaler Energiepegel: Eustress
6. Weiter sinkender Pegel: Die Auswirkungen von Energieverlust
7. Eigenschaften neuronaler Netze
8. Zusammenarbeit neuronaler Netze
9. Ideologie
10. Der Algorithmus
11. Bedenklicher Tiefstand an mentaler Energie
12. Selbstüberschätzung
13. Der Glaube als „Urprogramm“ zur Stabilisierung
14. Homöopathie
15. Soziale Beziehungen
16. Das Prinzip „Sündenbock“
17. Aggression und Macht
18. Belohnung und Sozialisation
19. Gewohnheit
20. Steigerung
21. Empfindung einer Belohnung
22. Energiepegel und Wahrnehmung der Realität
23. Wofür belohnt der Algorithmus?
24. Anlagen und Sozialisation
25. Drogen und ihre Auswirkungen auf den Energiepegel
26. Motivation
27. Steigerung? Geht es auch ohne Crash?
28. Der Drang zu Steigerung und Wachstum
29. Effiziente Pionierzeit und kritische Sättigung: der „Sägezahn“
30. Das Leistungsprinzip und die Kultur des Wohlfühlens
31. Die Menschheit stößt an ihre Grenzen
32. Herausforderungen und Lösungen
33. Führung: Die Begrenzung der individuellen Freiheit
34. Merkmale effektiver Führung in einer Organisation
35. Freiräume
36. Strategisches Denken und mentale Energie
37. Die Geführten
38. Gute fachliche und soziale Einschätzung
39. Soziale Kompetenz entwickeln
40. Der „Fähige“ hat es nicht leicht
41. Arbeit und Privates
42. Unternehmenskultur
43. Kooperation
44. Künstliche Intelligenz (KI)
45. Kommunikation
46. Simulation einer Übertragung
47. Mentale Energie und Lebensführung
48. Risiken
49. Die Frage nach dem Sinn
50. Burn-out
51. Der „freie Wille“
52. Extrem niedriger Energiepegel: Panik im Cockpit
53. Soziale Kompetenz
54. Kriminalität und „freier Wille“
55. Gewalt und Terror
56. Dr. Jekyll und Mr. Hyde
57. Mentale Energie und Ernährung
58. Schlussbetrachtung und Ausblick
Mentale Energie
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1.Das Gedankenmodell der „mentalen Energie“
58.Schlussbetrachtung und Ausblick
Mentale Energie
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
1. Das Gedankenmodell der „mentalen Energie“
Überforderung und Stress wird zunehmend als eine der Hauptursachen für verminderte Leistungsfähigkeit und negative Stimmungen bis hin zu ernsthaften körperlichen und psychischen Erkrankungen wie „Burn-out“ betrachtet. Um die Entwicklung von Stress und dessen Verminderung besser zu verstehen, wird hier ein neues Gedankenmodell vorgestellt, das eine eigenständige Denkweise etabliert.
Eine andere Sicht
Während die klassische Psychologie menschliches Verhalten vorwiegend durch empirische Beobachtungen beschreibt, verfolgt dieses neue Modell einen logisch nachvollziehbaren Ansatz. Dieser ermöglicht tiefere, unkonventionelle Einblicke in das menschliche Empfinden und Verhalten, sowie in die Leistungsfähigkeit und das allgemeine Lebensgefühl. Das Modell zielt darauf ab, die Dynamik der „mentalen Energie“ auf leicht vorstellbare Weise darzustellen und daraus neue Erkenntnisse für die Lesenden zu schaffen.
Der menschliche Körper als Energieproduzent
In diesem Modell wird der menschliche Körper als Energieproduzent betrachtet, der zugleich ein sensibles wie auch ausführendes Organ darstellt, das seinen Zustand ans Gehirn kontinuierlich rückmeldet. Dieses fungiert dabei als eine Art biologischer Computer, der durch die Verarbeitung von Sinnesdaten –visuellen Eindrücken, Geräuschen, Gerüchen, Geschmack und Berührungen – die jeweilige Situation je nach der Verfügbarkeit „mentaler Energie“ wahrnimmt. Anhand dieser Informationen berechnet das Gehirn das bestmögliche Verhalten zur Sicherung des Überlebens und setzt es um.
Eine neue Perspektive auf den Menschen und sein Verhalten
Es lohnt sich, den Menschen und sein Verhalten aus dieser neuen Perspektive zu betrachten – mit Offenheit und einer gewissen Abenteuerlust und Mut. Diese Herangehensweise bietet nicht nur ein erweitertes Verständnis von Stress und dessen Auswirkungen, sondern eröffnet auch innovative Wege zur Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden, Bewusstheit und Resilienz. Da der Mensch hier als eine Einheit aus einem biologischen und einem energetischen System verstanden wird, kann dieses Modell einen neuen Schlüssel zu mehr Gesundheit und Lebensfreude liefern.
2. Einführung in das Konzept der „mentalen Energie“
Eine Grundaussage des Modells ist, dass das Gehirn nicht nur chemische, sondern auch mentale Energie braucht, um arbeiten zu können.
Bereits Sigmund Freud und C. G. Jung nutzten den Begriff der „psychischen Energie“, um seelische Prozesse zu erklären. Während dieser Begriff heute noch in verschiedenen religiösen und esoterischen Denkansätzen verwendet wird, setzt das neue Gedankenmodell eine klare Abgrenzung zu den unscharfen Konzepten „Seele“ und „Psyche“: Es stellt die „mentale Energie“ in den Mittelpunkt der menschlichen Existenz. Diese Energie beeinflusst nicht nur Wahrnehmung und kognitive Prozesse, sondern moduliert auch Emotionen, Empathie und körperliche Funktionen.
Die Rolle der „mentalen Energie“ in Erfolgen und Misserfolgen
Nach diesem neuen Modell ist mentale Energie eng mit der Erfahrung von Erfolg und Misserfolg verknüpft. Positive Erlebnisse wie ein erfolgreiches Projekt oder ein erzieltes Tor können den Körper regelrecht „aufleben“ lassen. Diese Erfolgsempfindung wird im Gehirn durch die Ausschüttung von Belohnungssubstanzen wie Dopamin ausgelöst, was zu euphorischen und mental stärkenden Gefühlen führt. Serotonin, ein weiterer wichtiger Neurotransmitter, wirkt mittelfristig und wird oft zur Behandlung und Prävention von Depressionen eingesetzt. Oxytocin, das sogenannte „Kuschelhormon“, fördert soziale Bindungen und kann die Wahrnehmung wie durch eine „rosarote Brille“ verändern.
Künstliche Steigerung der mentalen Energie
Manche Drogen imitieren die Wirkung von Belohnungssubstanzen, indem sie die gleichen „Glücksrezeptoren“ im Gehirn ansprechen und somit künstlich Erfolge vorgaukeln. Diese nicht selbst erarbeitete Zufuhr „mentaler Energie“ von außen kann zwar kurzfristig stabilisieren, birgt jedoch die Gefahr, dass sie langfristig die natürliche Balance der mentalen Energie stört. So kann beispielsweise der Griff zur Zigarette nach einem Misserfolg eine schnelle, jedoch künstliche Erhöhung der mentalen Energie bewirken.
Mentale Energie als universelle Währung
In diesem Gedankenmodell übernimmt die „mentale Energie“ die Rolle einer universellen Währung im Organismus. Sie ermöglicht es, ihren Zu- und Abfluss aus Empfindungen und Aktivitäten in verschiedenen Lebensbereichen miteinander zu verknüpfen und zu verrechnen. Ob bei der Abwägung eines Kaufes oder der Entscheidung, einen Apfel zu pflücken – stets wird der erwartete Nutzen gegen den Aufwand und mögliche moralische Implikationen abgewogen.
Fazit
„Mentale Energie“ fungiert in diesem neuen Modell wie eine Art universelle Währung, die es erlaubt, mentale Zu- und Abflüsse sowie Erfolge und Misserfolge in verschiedensten Lebensbereichen gegeneinander abzuwägen. Dieses Konzept bietet eine neue Perspektive auf die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und unsere mentale und körperliche Energie einsetzen.
3. Der Pegel an „mentaler Energie“: ein Modell des Energiekontos
Das Konzept eines „Energiekontos“ lässt sich mit einer Unternehmensbilanz vergleichen: Einzahlungen durch Erfolge und Abflüsse durch Misserfolge und Unkosten. Dieser Vergleich erinnert zwar an kapitalistische Prinzipien, doch er stellt die Dynamik der „mentalen Energie“ im menschlichen Organismus prägnant dar.
Einzahlungen auf das Energiekonto
Die Einzahlungen auf das Energiekonto erfolgen durch positive Erlebnisse und Erfolge in verschiedenen Lebensbereichen:
• Berufliche Erfolge: Anerkennung und Lob für geleistete Arbeit, das Erreichen von Zielen und Karrierestufen füllen das Energiekonto auf. Diese Erlebnisse stärken das Selbstwertgefühl und die Motivation.
• Soziale Erfolge: Positive Interaktionen und Beziehungen, Unterstützung durch Freunde und Familie sind weitere Quellen der mentalen Energie. Diese Einzahlungen fördern das Zugehörigkeitsgefühl und die emotionale Stabilität.
• Persönliche Erfolge: Das Erreichen selbstgesetzter Ziele, das Erlernen neuer Fähigkeiten oder die Ausübung aufbauender Hobbys tragen zur mentalen Energie bei. Solche Erfolge stärken das Selbstvertrauen und die innere Zufriedenheit.
Abflüsse vom Energiekonto
Im Gegensatz dazu führen negative Erfahrungen und Misserfolge zu Abflüssen der mentalen Energie:
• Berufliche Misserfolge: Fehler, Kritik, unerreichte Ziele oder Arbeitsplatzunsicherheit belasten das Energiekonto. Solche Abflüsse können zu Frustration und vermindertem Selbstbewusstsein führen.
• Soziale Abflüsse: Streitigkeiten, schwelende Konflikte, Isolation oder mangelnde Unterstützung entziehen dem Energiekonto wertvolle Ressourcen. Diese negativen Erlebnisse beeinträchtigen das Wohlbefinden und das Gefühl der sozialen Zugehörigkeit.
• Persönliche Rückschläge: Das Scheitern bei der Verfolgung persönlicher Ziele, gesundheitliche Probleme oder fehlende Spielräume zur Erholung wirken sich negativ auf den mentalen Energiepegel aus.
Die „Unkosten“: dauerhafte Belastungen
Neben den temporären Abflüssen gibt es auch „Unkosten“, die als laufende Belastungen verstanden werden können und zu anhaltenden Abflüssen der mentalen Energie führen:
• Überlastung und Stress: Anhaltender Druck im Beruf oder Privatleben kann zu einem kontinuierlichen Energieverlust führen.
• Negative Einstellung: Gestörte Selbstwahrnehmung, Selbstzweifel, mangelndes Selbstvertrauen und physische Erschöpfung entziehen dem Körper dauerhaft mentale Energie.
• Fehlende Erholung: Mangelnde Regeneration und gesundheitliche Belastungen tragen ebenfalls zu dauernden Abflüssen bei.
• Anstehende, nicht gelöste Probleme: Diese entziehen dem Energiekonto ständig mentale Energie.
Das Energiekonto als „Gewinn-und-Verlustrechnung“
Das Energiekonto eines Menschen kann wie eine „Gewinn-und-Verlustrechnung“ betrachtet werden. Wenn die Einzahlungen die Abflüsse überwiegen, entsteht ein Gewinn, und der mentale Energiepegel steigt. Sind die Verluste jedoch größer, sinkt der Kontostand, und der Pegel der „mentalen Energie“ nimmt ab.
Anpassung und Maximierung der mentalen Energie
Der Mensch lebt in ständiger Konkurrenz mit anderen Lebewesen und muss sich kontinuierlich an seine Umwelt anpassen. Dieser Anpassungsprozess kann als Streben nach Maximierung der Einzahlungen und Minimierung der Abflüsse gesehen werden:
• Maximierung der Einzahlungen: Durch die Entwicklung und Nutzung von Fähigkeiten und Ressourcen sollen Erfolge und Gewinn erzielt werden.
• Minimierung der Abflüsse: Stressbewältigungsstrategien, Konfliktlösungen und Selbstfürsorge helfen, den Abfluss der mentalen Energie zu reduzieren.
Fazit: Das Gleichgewicht der „mentalen Energie“
Das Modell des Energiekontos verdeutlicht, dass ein angenehmes und erfolgreiches Leben ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Einflüssen erfordert. Wie bei einer finanziellen Bilanzierung ist ein bewusstes Management notwendig, um sicherzustellen, dass die „Einnahmen“ die „Ausgaben“ letztlich übersteigen. Dieses Modell zeigt, dass der Mensch bestrebt ist, seine Ressourcen optimal zu nutzen, um in seiner Umwelt erfolgreich zu sein und eine positive Energiebilanz aufrechtzuerhalten.
4. Mittlerer Energiepegel: Ausgeglichenheit
Wer würde nicht auch gern zufrieden in einem Liegestuhl auf einer grünen Wiese liegen und chillen: kein Hunger, kein Durst, kein Problem, nichts Beunruhigendes, auch nicht von außen. Als i-Tüpfelchen ein laues Lüftchen, das sanft über das Gras streicht. Kein störender Lärm, nur Bienensummen und Vogelgezwitscher.
Entspannung und Regeneration
Der Organismus ist ganz entspannt und voller Freude darüber, sich regenerieren zu können, und auch das Immunsystem nutzt diese Phase, um voller Energie alles abzuwehren, was von Schaden sein könnte.
Wertvolle Zeit, um zu sich selbst zu kommen, vor sich hin zu träumen, Pläne zu machen, sich schöne, mentale Energie bringende Erlebnisse vorzustellen oder Luftschlösser zu bauen.
Der Zustand der Ausgeglichenheit
Der mentale Zustand „ausgeglichen“ ist ein manchmal erreichter Referenzpegel ganz ohne Spannung, Stress oder innere Konflikte und Hemmungen, ein Gleichgewicht, in dem der Mensch in Harmonie mit sich selbst und seiner Umgebung steht und der zur Sammlung und Regeneration des Organismus dient, aber mangels eigener Bedürfnisse oder fehlender Anforderungen von außen keine besondere Motivation aufkommen lässt, tätig zu werden. Diesen Zustand regelmäßig zu erreichen und zu pflegen, kann langfristig zu einem gesünderen und erfüllteren Leben beitragen.
5. Moderat gesunkener mentaler Energiepegel: Eustress
Man kann jedoch nicht immer nur chillen, irgendwann treten Bedürfnisse auf wie Hunger oder äußere Anforderungen, z. B. durch die Arbeit. Welche Befriedigung und Lebensfreude, im „Eustress“, einer eher angenehmen Anspannung, über alle seine Fähigkeiten zu verfügen, sein Verhalten im Griff zu haben und sich den Herausforderungen des Tages gewachsen zu fühlen: Mentale Energie sprudelt dabei auf das Energiekonto.
Produktivität im Eustress
Ein leichtes Defizit an mentaler Energie ist mit Abstand der produktivste mentale Bereich mit einer effizienten Selbststeuerung. Eigene Bedürfnisse, die mentale Energie abwerfen können, bewusst erkennen und erfüllen: in den Urlaub fahren, Freunde und Bekannte treffen, sich etwas Schönes gönnen, was auch immer.
Souveränes Handeln im Alltag
In der Firma fachlich souverän und sozial kompetent agierend, mit genug mentaler Energie, um eine Situation realistisch zu erfassen und darauf professionell zu reagieren. Verstand und Vernunft sind voll und ganz dabei: Nichts wird aufgeschoben, sondern angepackt, der Blick ist strategisch weit in die Zukunft gerichtet.
Mut und Resilienz
Genug mentale Energie auf dem Konto, um neugierig, mit frischen Gedanken und Ideen mutig ins kalkulierte Risiko zu gehen und mit großer Resilienz auch mal einen Fehlschlag wegzustecken. Ein hohes Selbstwertgefühl speist sich aus diesen Erfolgen. Es gleicht einem Computerspiel: Durch geschicktes Spielen kann man Punkte sammeln und einen hohen „Score“ erreichen.
Die Kraft des Eustress
Ein Kontostand leicht unter der Ausgeglichenheit, der „Eustress“, bietet alle Ressourcen und beste Möglichkeiten zum Erarbeiten mentaler Energie. Eine gewisse Anspannung mit einem Quäntchen Herausforderung um die Leistungsgrenzen herum weckt die Lebensgeister. Man fühlt sich dem Geschehen gewachsen: ganz bewusst fachliche und soziale Kompetenzen einsetzen mit besten Chancen, eine Menge mentaler Energie zu gewinnen und das mentale Konto weiter auf Stand zu halten. Hoher Score – hohe Leistung und ein gutes Lebensgefühl.
6. Weiter sinkender Pegel: Die Auswirkungen von Energieverlust
Jedoch nicht alles kann gelingen, und so wird der Pegel mentaler Energie sinken und den Stress im Organismus wachsen lassen – als Ansporn, um das Konto durch Erfolge schnell wieder aufzufüllen. Außerdem zwingt ein sich leerendes Konto zum Sparen.
Unbewusste Reduktion der Denkqualität
Meist wird zunächst gar nicht bewusst wahrgenommen, wie sehr sich durch das Einsparen mentaler Energie das Denken vereinfacht und die Denk- und Verhaltensqualität sinkt. Unter Stress neigen wir dazu, weniger durchdachte, vorschnelle Entscheidungen zu treffen.
Beispiele für Fehlentscheidungen unter Stress
Der gestresste Kommissar legt sich zu früh auf einen Täter fest. In der Politik führen lange Diskussionen bis in die frühen Morgenstunden durch Müdigkeit und mentale Überlastung zu Schwarz-Weiß-Denken, bei dem wichtige Grautöne wegfallen. Mehrheitsentscheidungen sind oft Einfach-Entscheidungen, die komplexe Zusammenhänge vernachlässigen.
Schubladendenken als Energieeinsparung
Denken in Schwarz-Weiß oder in Schubladen spart viel Energie: Jugendliche werden vorschnell und pauschal als faul, Polizisten als gewalttätig, Politiker als borniert und Zuwanderer als kriminell kategorisiert. Diese pauschalen Urteile haben ihren Ursprung in stark vereinfachenden Denkprozessen.
Evolutionäre Wurzeln des Schubladendenkens
„Schubladendenken“ war evolutionär vorteilhaft: Traf der Frühmensch auf einen anderen bewaffneten Jäger, musste er blitzschnell entscheiden, ob dieser eine Bedrohung oder eine Chance darstellte. Die schnelle Einordnung in die Schublade „gefährlich“ oder „ko-operativ“ war überlebenswichtig. Viele existenzielle Entscheidungen für Kampf, Flucht oder Kooperation konnten nur auf bereits bekannten Entscheidungsgrundlagen getroffen werden. Ein schneller Griff in eine Schublade, basierend auf früheren Erfahrungen, erlaubte eine rasche, oft lebensrettende Entscheidung.
Mentale Einschränkung bei niedrigem Energiepegel
Bei einem niedrigen Energiepegel kann das Gehirn, nun im Sparmodus, anspruchsvolle und komplexe Zusammenhänge nicht mehr ausreichend erfassen und verarbeiten. Es muss die Wahrnehmung der Realität und die Verarbeitung der Informationen so lange einschränken und herunterbrechen, bis es sie auf einem niedrigeren Niveau wieder bewältigen kann. Ein Teil der Realität geht verloren und der Betroffene nimmt diese mentale Einschränkung häufig selbst gar nicht wahr.
Konsequenzen des sinkenden Energiepegels
Ein sinkender mentaler Energiepegel führt zu einem Anstieg des Stressniveaus und zwingt das Gehirn dazu, Energie einzusparen und Denk- sowie Verhaltensprozesse zu vereinfachen. Dies kann in vorschnellen und potenziell fehlerhaften Entscheidungen münden. Insbesondere Schwarz-Weiß-Denken nimmt bei einem niedrigen Energiepegel zu, was Vorurteile und Missverständnisse begünstigt. Es ist ratsam, sich selbst regelmäßig zu reflektieren und wichtige Entscheidungen nur bei einem hohen mentalen Energiepegel zu treffen, da nur dann tiefgründiges, umfassendes und zukunftsorientiertes Denken möglich ist. Bei einem niedrigen Energiepegel sollten hingegen Routineaufgaben priorisiert werden, die dem reduzierten Leistungsniveau entsprechen. Die mentale Energie lässt sich am effizientesten einsetzen, wenn man das aktuelle Leistungsniveau erkennt und seine Aktivitäten diesem entsprechend anpasst."
7. Eigenschaften neuronaler Netze
Hoher Energiebedarf des Gehirns
Um zu verstehen, warum Menschen in ein und derselben Situation ganz unterschiedlich reagieren, hilft ein Blick auf die Gehirnfunktionen. Das menschliche Gehirn macht zwar nur etwa 2 % des gesamten Körpergewichts aus, beansprucht jedoch etwa 20 % der umgesetzten chemischen Energie. Diese hohe Energieanforderung resultiert aus seiner Rolle als zentrale Steuerzentrale des Körpers.
Komplexität neuronaler Netzwerke
Mit etwa 100 Milliarden Nervenzellen und unzähligen Synapsen als Schaltelementen hat das Gehirn den höchsten Stellenwert im Körper. Es arbeitet jedoch nicht wie ein statischer Computer-Chip, sondern operiert meist an seinen Leistungsgrenzen und benötigt daher zwingend Zeiten geringerer Auslastung, Pausen und Schlaf. Diese sind wichtig, um die neuronalen Netzwerke zu regenerieren und ihre optimale Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Neuronen und Synapsen: Bausteine des Gehirns
Die Zeichnung einer multipolaren Nervenzelle des menschlichen Kleinhirns nach Ramón y Cajal symbolisiert die Komplexität neuronaler Strukturen.
Eine einzelne Nervenzelle (Neuron) mit ihren fast unendlich vielen Inputs ist ein geeignetes Modell, um das neuronale Netz zu verstehen. Es besteht aus unzähligen Neuronen, die miteinander interagieren und durch ihre Verbindungen die Komplexität und Flexibilität der Gehirnleistungen ermöglichen.
Hoher Energieverbrauch durch neuronale Aktivität
Jeder kleinste Input in den verzweigten Dendriten eines Neurons, ob aktivierend oder hemmend, trägt zur Gesamtinformation der Zelle oder des Netzes bei. Gleichzeitig führt dieser Prozess zu einem hohen Energieverbrauch, den das Gehirn nicht dauerhaft aufrechterhalten kann. Die dynamischen Veränderungen im täglichen Leben erfordern vom Gehirn eine kontinuierliche Neubewertung und Abwägung von Verhaltensmöglichkeiten.
Herausforderung für das Gehirn
Dieses „Dauerfeuer“ ist eine immense Herausforderung für Neuronen und Synapsen. Sie müssen Membranpotenziale entladen, Neurotransmitter synthetisieren, Traubenzucker und Sauerstoff zuführen und Abfallprodukte abführen. Diese Spitzenleistung wird von Milliarden von Neuronen und Synapsen in kürzester Zeit erbracht.
Überlastung im Gehirn
Bei maximaler Auslastung könnte es im Inneren des Gehirns sogar zu einer „Überhitzung“ kommen, ähnlich wie in einem überlasteten Rechenzentrum. Daher versucht das Gehirn trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit ständig, Energie zu sparen und „cool“ zu bleiben.
Auswirkungen eines sinkenden Energiepegels
Wenn der Energiepegel sinkt, könnte das Gehirn beginnen, die feinen Inputs der neuronalen Netze schrittweise zu reduzieren und schließlich nur noch die gröbsten Informationen zu verarbeiten. Dies würde bedeuten, dass energieintensive Grautöne eliminiert werden und am Ende nur noch eine grobe Rasterung und ein
„Schwarz-Weiß-Denken“ übrigbleiben.
Einfluss des mentalen Energiepegels
Das Gedankenmodell geht davon aus, dass der Pegel an mentaler Energie entscheidend dafür ist, wie fein oder grob das Gehirn Eindrücke wahrnimmt, Signale verarbeitet und die körperliche Ausführung steuert. Der mentale Pegel beeinflusst die Qualität aller Prozesse im Organismus.
Dazu ein Beispiel aus der Psycho-Mathematik:
Model „Romana“ in geschichteter Darstellung
Mathematische Transformation des Bildes „Romana“
Das Bild des Models „Romana“ wurde durch eine mathematische Transformation in 64 Schichten aufgesplittet. Die unteren Schichten liefern die groben Anteile des Bilds. Je mehr Informationen aus den folgenden Schichten hinzukommen, desto feinere Details werden sichtbar.
Grob-Informationen für die schnelle Einschätzung
Schon die Grob-Informationen der ersten beiden Schichten lassen eine Gestalt erkennen – ein wichtiges Merkmal für die schnelle Einschätzung einer Situation. Bereits mit den ersten fünf Schichten wird schemenhaft eine Frau sichtbar und aus zehn Schichten zusammengesetzt ergibt sich schon ein erstaunlich klares Bild von
„Romana“. Mit allen 64 Schichten zeigt sich schließlich das hoch aufgelöste Original.
Bestätigung des Paredo-Prinzips
Dies bestätigt das „Paredo-Prinzip“, auch „80/20-Regel“ genannt, nach Vilfredo Paredo, die besagt, dass man eine Aufgabe zu 80 % mit gerade einmal 20 % des Aufwandes erledigen könne, der für 100 % zu erbringen wäre. Die Qualität in Richtung 100 % zu steigern, würde unverhältnismäßig viel Energie kosten. Perfektionismus hat einen (zu) hohen Preis.
Die Natur und die Unvollkommenheit
Daher läuft in der Natur vieles mehr oder weniger „ungefähr“ ab, nichts und niemand ist wirklich perfekt, wie schon 1959 in dem Film „Manche mögen’s heiß“ mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon festgestellt wird.
Untere und obere Schichten der neuronalen Netze
Die unteren Schichten der neuronalen Netze, ließe sich daraus folgern, machen die Grobarbeit, sind evolutionär alt, fest verschaltet und dadurch schnell und energiesparend. Die oberen hingegen, in denen z. B. Verstand und soziale Kompetenzen beheimatet sind, sind fluide, langsam und sehr energieintensiv. Besonders der präfrontale Kortex, verantwortlich für hochwertige Gehirnfunktionen wie Planung, Vernunft und soziale Kompetenz, verbraucht unverhältnismäßig viel Zeit und Energie.
Sparsame Energiewirtschaft bei niedrigem mentalem Pegel
Daraus ergibt sich eine weitreichende Schlussfolgerung: Das Gehirn ist bei einem sinkenden mentalen Pegel gezwungen, mit seiner Energie sparsamer zu wirtschaften und seine Aufgaben bei minderer Qualität stärker auf die energiesparenden unteren Schichten zu verlagern.
Verschwendung von Energie bei hohem mentalem Pegel
Während einer Überflutung mit mentaler Energie, etwa bei einem überwältigenden Zufluss durch Ausnahme-Erlebnisse oder bei starkem Verliebtsein, kann das Gehirn verschwenderisch mit seiner „mentalen Energie“ umgehen und buchstäblich „die ganze Welt umarmen“.
Unterschiedliches Verhalten bei hohem und niedrigem Energiepegel
Daher wird das Verhalten eines Menschen in ein und derselben Situation bei einem hohen oder niedrigen mentalen Pegel im Gehirn unterschiedlich berechnet.
Ziel: effizientes Arbeiten auf jedem Energielevel
Das Beispiel des schichtenweisen Bildaufbaus von „Romana“ zeigt, dass das Gehirn ähnliche Strategien anwenden könnte, um