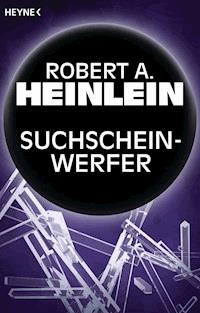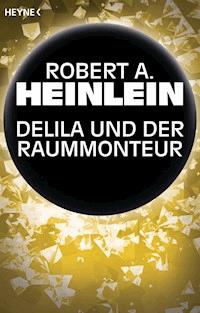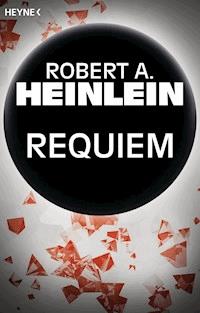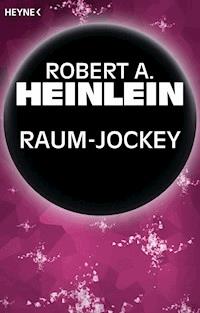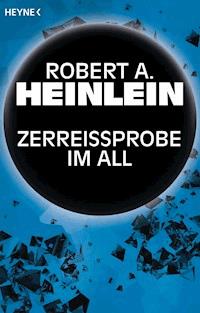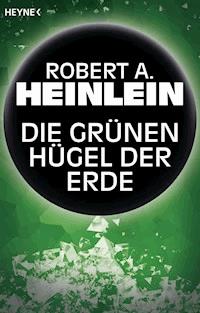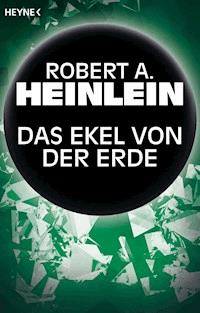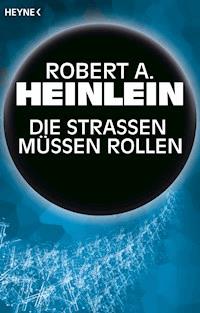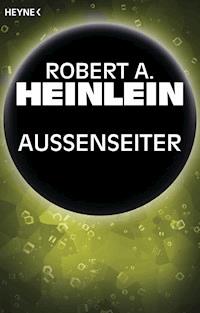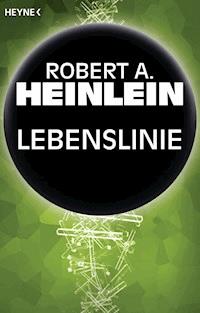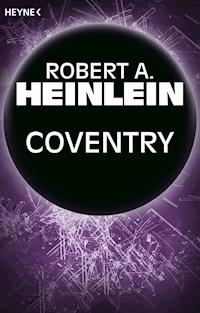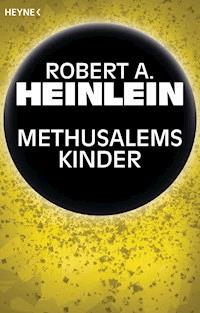
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein langes, erfülltes Leben
Lazarus Long ist 213 Jahre alt – und Weltraumpionier. Als eine Stiftung Ende des 19. Jahrhunderts anfängt, Menschen zusammenzubringen, die alle Voraussetzungen für ein langes Leben zeigen, entwickelt sich eine Reihe von Familien, deren Langlebigkeit nach der Enthüllung ihrer Existenz Neider auf den Plan ruft. Die Menschen glauben, die sogenannten Howard-Familien hätten das Rezept für das ewige Leben gefunden, und schrecken vor nichts zurück, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Lazarus wandert zusammen mit den Familien aus, um Morde oder gar Kriege zu verhindern: Sie verlassen die Erde, um als erste Menschen Planeten zu kolonisieren, die außerhalb des Sonnensystems liegen …
Der Roman „Methusalems Kinder“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem Sammelband „Die Geschichte der Zukunft“ enthalten. Er umfasst ca. 235 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ROBERT A. HEINLEIN
METHUSALEMS KINDER
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
DAS BUCH
Lazarus Long ist 213 Jahre alt – und Weltraumpionier. Als eine Stiftung Ende des 19. Jahrhunderts anfängt, Menschen zusammenzubringen, die alle Voraussetzungen für ein langes Leben zeigen, entwickelt sich eine Reihe von Familien, deren Langlebigkeit nach der Enthüllung ihrer Existenz Neider auf den Plan ruft. Die Menschen glauben, die sogenannten Howard-Familien hätten das Rezept für das ewige Leben gefunden, und schrecken vor nichts zurück, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Lazarus wandert zusammen mit den Familien aus, um Morde oder gar Kriege zu verhindern: Sie verlassen die Erde, um als erste Menschen Planeten zu kolonisieren, die außerhalb des Sonnensystems liegen …
Der Roman »Methusalems Kinder« erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem Sammelband »Die Geschichte der Zukunft« enthalten.
DER AUTOR
Robert A. Heinlein wurde 1907 in Missouri geboren. Er studierte Mathematik und Physik und verlegte sich schon bald auf das Schreiben von Science-Fiction-Romanen. Neben Isaac Asimov und Arthur C. Clarke gilt Heinlein als einer der drei Gründerväter des Genres im 20. Jahrhundert. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefunden. Die Romane »Fremder in einer fremden Welt« und »Mondspuren« gelten als seine absoluten Meisterwerke. Heinlein starb 1988.
www.diezukunft.de
Diese Erzählung ist dem Band Robert A. Heinlein: »Die Geschichte der Zukunft« entnommen.
Titel der Originalausgabe: Methuselah’s Children
Aus dem Amerikanischen von Rosemarie Hundertmarck
Copyright © 1958 by Robert A. Heinlein
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Stardust, München
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-16987-9
ERSTER TEIL
1
»Mary Sperling, du bist verrückt, wenn du ihn nicht heiratest!«
Mary Sperling addierte erst ihre Verluste und schrieb einen Scheck aus. Dann antwortete sie: »Der Altersunterschied ist zu groß.« Sie schob den Scheck über den Tisch. »Ich sollte nicht mit dir spielen – manchmal glaube ich, du bist Telepathin.«
»Unsinn! Du versuchst nur, das Thema zu wechseln. Du bist sicher bald dreißig … und du wirst nicht immer hübsch bleiben.«
Mary lächelte schief. »Als ob ich das nicht wüsste!«
»Bork Vanning kann nicht viel über Vierzig sein, und er ist ein prominenter Bürger. Du müsstest mit beiden Händen zugreifen.«
»Greif du zu! Ich muss laufen. Zu Diensten, Ven.«
»Zu Diensten«, antwortete Ven. Stirnrunzelnd betrachtete sie die Tür, die sich hinter Mary Sperling zusammenzog. Die Neugier plagte sie, warum Mary sich einen solchen Fang wie den Ehrenwerten Bork Vanning entgehen ließ, und beinahe ebenso gern hätte sie gewusst, warum und wohin Mary ging. Aber die Gewohnheit, das Privatleben anderer zu respektieren, war stärker.
Mary hatte nicht die Absicht, irgendwen wissen zu lassen, wohin sie ging. Vor der Wohnungstür ihrer Freundin sprang sie in den Fallschacht zum Keller, holte ihren Wagen aus der Robotgarage, lenkte ihn die Rampe hinauf und stellte die Kontrollen auf das Nordufer ein. Der Wagen wartete eine Verkehrslücke ab, stürzte sich in den Hochgeschwindigkeitsstrom und raste nordwärts. Mary lehnte sich zurück und schlief ein.
Gegen Ende seines Programms verlangte der Wagen mit einem Pfeifton Anweisungen. Mary wachte auf und sah hinaus. Der Michigan-See hob sich von der Dunkelheit zu ihrer Rechten als noch dunkleres Band ab. Sie signalisierte der Verkehrskontrolle, dass sie auf den Weg für den Ortsverkehr einbiegen wollte. Die Verkehrskontrolle sortierte ihren Wagen aus, lenkte ihn hin und überließ ihn der manuellen Steuerung. Mary steckte die Hand ins Handschuhfach.
Das Nummernschild, das die Verkehrskontrolle automatisch fotografierte, als sie die Fernlenkstraße verließ, war nicht das Nummernschild, das der Wagen vorher getragen hatte.
Sie folgte mehrere Meilen einem dem Fernlenksystem nicht angeschlossenen Seitenweg, bog in einen schmalen Fußpfad ein, der zum Ufer hinunterführte, und hielt an. Dann wartete sie mit abgeschalteten Scheinwerfern und lauschte. Südlich von ihr schimmerten die Lichter Chicagos, ein paar Hundert Yards landeinwärts brauste der Verkehr der Fernlenkstraße, aber hier war nichts zu hören als die leisen Geräusche scheuer Nachttiere. Mary fasste ins Handschuhfach und legte einen Schalter um. Das Armaturenbrett glühte auf und ließ andere Anzeigen hinter dem Paneel erkennen. Sie überprüfte sie und nahm ein paar Einstellungen vor. Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass sie von keinem Radargerät erfasst wurde und sich nichts in ihre Richtung bewegte, schaltete sie die Instrumente ab, schloss das Fenster auf ihrer Seite und startete von Neuem.
Was ein normaler Camden-Flitzer zu sein schien, stieg geräuschlos in die Höhe, schwebte auf den See hinaus, ließ sich auf das Wasser nieder und sank. Mary wartete, bis sie eine Viertelmeile vom Ufer entfernt in fünfzig Fuß tiefem Wasser war. Dann rief sie eine Station.
»Antworte«, sagte eine Stimme.
»›Das Leben ist kurz …‹«
»›… aber die Jahre sind lang.‹«
»›Nicht‹«, respondierte Mary, »›solange die schlechten Tage fern sind.‹«
»Das frage ich mich manchmal«, bemerkte die Stimme im Plauderton. »Okay, Mary. Ich weiß jetzt, dass du es bist.«
»Tommy?«
»Nein – Cecil Hedrick. Hast du die manuellen Kontrollen abgeschaltet?«
»Ja. Du kannst übernehmen.«
Siebzehn Minuten später tauchte der Wagen in einem Teich auf, der den Großteil einer künstlichen Höhle einnahm. Als der Wagen auf trockenem Boden stand, stieg Mary aus, grüßte den Wachtposten und ging durch einen Tunnel in einen großen, unterirdischen Raum, in dem fünfzig oder sechzig Männer und Frauen saßen. Sie unterhielt sich, bis eine Uhr Mitternacht anzeigte. Dann stieg sie auf ein Podest und wandte sich an die Versammelten.
»Ich bin«, verkündete sie, »einhundertunddreiundachtzig Jahre alt. Ist jemand anwesend, der älter ist?«
Niemand meldete sich. Nach einer Anstandspause fuhr Mary fort: »Dann erkläre ich dieses Treffen in Übereinstimmung mit unserem Brauch für eröffnet. Wollt ihr einen Vorsitzenden wählen?«
Jemand rief: »Mach du das, Mary!« Als sonst niemand etwas sagte, meinte sie: »Na gut.« Sie nahm die Ehre gleichmütig an, und die anderen Anwesenden benahmen sich ebenso lässig. Es herrschte eine Atmosphäre, als gebe es hier keine Hetze und nichts von den Spannungen des modernen Lebens.
»Wir sind wie üblich zusammengekommen«, sagte Mary, »um über unser Wohlergehen und das unserer Schwestern und Brüder zu diskutieren. Hat ein Familiensprecher eine Nachricht von seiner Familie erhalten? Oder möchte jemand für sich selbst sprechen?«
Ein Mann fing ihren Blick ein und ergriff das Wort. »Ira Weatheral, Sprecher der Johnson-Familie. Wir treffen uns fast zwei Monate zu früh. Die Treuhänder müssen einen Grund dafür haben. Lass ihn uns hören!«
Mary nickte und forderte einen steifen kleinen Mann in der ersten Reihe auf: »Justin – willst du so freundlich sein?«
Der steife kleine Mann erhob sich und machte eine förmliche Verbeugung. Dünne Beine sahen unter einem schlecht geschnittenen Kilt hervor. Er sah aus und benahm sich wie ein ältlicher, verstaubter Büroangestellter, aber sein schwarzes Haar und die straffe, gesunde Haut verrieten, dass er ein Mann in der Blüte seiner Jahre war. »Justin Foote, Sprecher für die Treuhänder.« Er hatte eine präzise Aussprache. »Vor elf Jahren entschieden sich die Familien für das Experiment, die Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass es unter der normalen Bevölkerung Menschen gibt, deren Lebenserwartung die des Durchschnitts weit übertrifft, und andere, die den wissenschaftlichen Beweis für diese Erwartung repräsentieren, indem sie bereits mehr als das doppelte Alter eines normalen menschlichen Wesens erreicht haben.«
Obwohl er ohne Notizen sprach, hörte es sich an, als lese er einen vorbereiteten Bericht ab. Was er sagte, war allen bekannt, aber niemand drängte ihn. Seine Zuhörer hatten nichts von der fieberhaften Ungeduld, die anderswo allgemein üblich war. »Zu dem Entschluss«, dozierte er weiter, »die bisherige langjährige Politik des Schweigens und Verheimlichens eines bestimmten Aspektes aufzugeben, in dem wir uns von der übrigen menschlichen Rasse unterscheiden, kamen die Familien durch verschiedene Erwägungen. Der Grund, warum man es ursprünglich für angebracht hielt, diese Besonderheit geheim zu halten, sollte beachtet werden:
Die ersten Abkömmlinge von Verbindungen, die durch die Howard-Stiftung zusammengekommen waren, wurden 1875 geboren. Sie erweckten keine Aufmerksamkeit, da sie auf keine Weise bemerkenswert waren. Die Stiftung war eine ordnungsgemäß eingetragene, nicht nach Gewinn strebende Gesellschaft …«
Am 17. März 1874 saß Ira Johnson, Medizinstudent, in der Kanzlei der Rechtsanwälte Deems, Wingate, Alden & Deems und hörte sich einen ungewöhnlichen Vorschlag an. Schließlich unterbrach er den Senior-Partner. »Einen Augenblick! Habe ich richtig verstanden, dass Sie mich dafür bezahlen wollen, eine dieser Frauen zu heiraten?«
Der Rechtsanwalt war schockiert. »Bitte, Mr. Johnson. Ganz und gar nicht.«
»Es hörte sich aber so an.«
»Nein, nein, ein solcher Vertrag wäre nichtig und gegen die guten Sitten. Als Verwalter einer Stiftung teilen wir Ihnen lediglich mit: Sollte der Fall eintreten, dass Sie eine der jungen Damen auf dieser Liste heiraten, würde es unsere angenehme Pflicht sein, jedem dieser Vereinigung entspringenden Kind entsprechend der hier festgelegten Staffelung einen Geldbetrag auszuzahlen. Aber es würde zwischen uns weder einen Vertrag geben, noch machen wir Ihnen ein ›Angebot‹ – und ganz gewiss drängen wir Sie nicht, irgendeinen bestimmten Kurs einzuschlagen. Wir informieren Sie lediglich über gewisse Tatsachen.«
Ira Johnson machte ein finsteres Gesicht und scharrte mit den Füßen. »Was soll das alles? Warum?«
»Das ist Sache der Stiftung. Man könnte es so ausdrücken, dass Ihre Großeltern unsere Billigung finden.«
»Haben Sie mit ihnen über mich gesprochen?«, fragte Johnson scharf. Er empfand keine Zuneigung für seine Großeltern. Ein puritanisches Vierergespann – wenn einer von ihnen den Anstand gehabt hätte, in einem vernünftigen Alter zu sterben, hätte er jetzt keine Sorgen, woher er das Geld nehmen sollte, um sein Medizinstudium zu beenden.
»Wir haben mit ihnen gesprochen, ja. Aber nicht über Sie.«
Der Rechtsanwalt ließ sich nicht auf eine weitere Diskussion ein, und der junge Johnson nahm mürrisch eine Liste junger Frauen in Empfang. Sie waren ihm alle fremd, und er hatte die Absicht, das Blatt zu zerreißen, sobald er das Büro verlassen hatte. Stattdessen schrieb er an diesem Abend sieben Entwürfe zu einem Brief, bis er die richtigen Worte fand, um die Beziehung zwischen ihm und seinem Mädchen zu Hause langsam abkühlen zu lassen. Er war froh, dass er ihr niemals einen richtigen Heiratsantrag gemacht hatte – das wäre jetzt verflixt peinlich gewesen.
Als er tatsächlich heiratete (eine Dame von der Liste), sah er einen lustigen, aber nicht weiter bemerkenswerten Zufall in der Tatsache, dass seine Frau ebenso wie er vier lebende, gesunde, aktive Großeltern hatte.
»… eine ordnungsgemäß eingetragene, nicht nach Gewinn strebende Gesellschaft«, fuhr Foote fort, »und ihr erklärtes Ziel, Heiraten zwischen Personen von gesunder amerikanischer Rasse zu fördern, stand in Einklang mit den Sitten jenes Jahrhunderts. Durch das einfache Mittel, über den wahren Zweck der Stiftung zu schweigen, erübrigten sich besondere Maßnahmen zur Verheimlichung. Doch dann begann die Periode zwischen den Weltkriegen, die manchmal ungenau ›Die verrückten Jahre‹ genannt wird …«
Ausgewählte Schlagzeilen von April bis Juni 1969:
BABY BILL SPRENGT DIE BANK
Zweijähriger jüngster Gewinner von Ein-Million-Dollar-Jackpot Telefonische Glückwünsche vom Weißen Haus
GERICHT BEFIEHLT VERKAUF DES KAPITOLS
Oberster Gerichtshof in Colorado ordnet Altersrente an Besitzt Pfandrecht an allem Staatseigentum
JUGEND VON N. Y. VERLANGT OBERE ALTERSGRENZE FÜR DAS WAHLRECHT
GEBURTENRATE DER USA »STRENG GEHEIM«
Verschlusssache des Verteidigungsministeriums
KONGRESSABGEORDNETE VON CAROLINA WIRD SCHÖNHEITSKÖNIGIN
»Stehe als Präsidentschaftskandidatin zur Verfügung«, verkündet sie.
Auf einer Tournee will sie ihre Qualifikation beweisen
IOWA ERHÖHT ALTER FÜR DAS WAHLRECHT AUF EINUNDVIERZIG
Aufstand auf dem Campus von Des Moines
ERDFRESS-WELLE BREITETE SICH NACH WESTEN AUS:
CHICAGOER PFARRER ISST AUF DER KANZEL LEHM-SANDWICH
»Zurück zu den einfachen Dingen«, rät er seiner Gemeinde
SCHÜLER-MOB VON LOS ANGELES WIDERSETZT SICH SCHULLEITUNG
»Höhere Bezahlung, weniger Schulstunden, keine Hausaufgaben – Wir verlangen das Recht, unsere Lehrer zu wählen.«
SELBSTMORDRATE DAS NEUNTE JAHR IN FOLGE GESTIEGEN
Atom-Energie-Kommission macht radioaktiven Niederschlag verantwortlich
»… ›Die verrückten Jahre‹, genannt wird. Die damaligen Treuhänder waren der – wie wir heute wissen, richtigen – Meinung, in einer Zeit der semantischen Desorientierung und der Massenhysterie sei jede Minderheit das wahrscheinliche Ziel von Verfolgung, diskriminierender Gesetzgebung und sogar Gewalttätigkeit des Mobs. Außerdem wurde die Solvenz der Stiftung durch die gestörte Finanzstruktur des Landes und im Besonderen durch den erzwungenen Eintausch von mündelsicheren Papieren gegen Zahlungsanweisungen der Regierung bedroht.
Die Treuhänder beschlossen zwei Maßnahmen: Erstens wurden die Aktivposten der Stiftung in Sachwerte umgewandelt und unter den Mitgliedern der Familie, die offiziell als Eigentümer auftraten, breit gestreut. Zweitens führten sie die sogenannte Maskerade ein. Man fand Wege, den Tod eines Mitglieds der Familien vorzutäuschen, wenn sein Alter Anlass zu Gerede gab, und es in einem anderen Teil des Landes mit einer neuen Identität auszustatten.
Wie weise dieser letzte Entschluss war, auch wenn er für den einen oder anderen Unannehmlichkeiten mit sich brachte, zeigte sich während des Interregnums der Propheten. Zu Beginn der Herrschaft des ersten Propheten hatten siebenundneunzig Prozent unserer Mitglieder ein öffentlich zugegebenes Alter von weniger als fünfzig Jahren. Die strenge Registrierung aller Bürger, wie sie die Geheimpolizei der Propheten erzwang, machte einen Wechsel der öffentlichen Identität schwierig, obwohl es ein paarmal mithilfe der revolutionären Bruderschaft gelang.
So hat eine Kombination von Glück und Voraussicht unser Geheimnis vor einer Entdeckung bewahrt. Das war gut – in jener Zeit wäre jede Gruppe im Besitz eines Schatzes, den zu konfiszieren nicht in der Macht des Propheten lag, hart bedrängt worden.
Die Familien als solche beteiligten sich nicht an den Unternehmungen, die zu der Zweiten amerikanischen Revolution führten, aber viele Mitglieder bewährten sich ruhmreich in der Bruderschaft und bei den Kämpfen, die dem Fall von New Jerusalem vorausgingen. Wir machten uns die darauffolgende Unordnung zunutze, um Verwandten, die verdächtig alt geworden waren, ein neues Geburtsdatum zu geben. Dabei halfen uns Mitglieder der Familien, die als Logenbrüder Schlüsselposten beim Wiederaufbau innehatten.
Beim Familientreffen von 2075, dem Jahr des Vertrages, vertraten viele die Meinung, wir sollten uns entdecken, da die bürgerliche Freiheit wieder fest etabliert sei. Damals stimmte die Mehrheit nicht zu – vielleicht der eingewurzelten Gewohnheit wegen, das Geheimnis zu wahren und vorsichtig zu sein. Aber das Wiederaufblühen der Kultur in den nun folgenden fünfzig Jahren, das stetige Erstarken von Toleranz und guten Manieren, die semantisch gesunde Orientierung des Unterrichts, die wachsende Achtung vor dem Privatleben des anderen und der Würde des Individuums – all das machte uns glauben, endlich sei die Zeit gekommen, da wir uns ohne Gefahr entdecken und unsern rechtmäßigen Platz als eine merkwürdige, aber nichtsdestoweniger respektierte Minderheit in der Gesellschaft einnehmen könnten.
Es gab zwingende Gründe dafür. Immer mehr von uns fanden die Maskerade in einer neuen und besseren Gesellschaft unerträglich. Es war nicht nur schmerzlich, alle paar Jahre entwurzelt zu werden und sich eine neue Umgebung suchen zu müssen, sondern auch, in einer Gesellschaft, deren meiste Mitglieder sich gewohnheitsgemäß ehrlich und anständig benahmen, mit einer Lüge leben zu müssen. Außerdem hatten die Familien als Gruppe durch unsere Forschungsarbeit in den Bio-Wissenschaften vieles gelernt, was für unsere armen kurzlebigen Brüder von großem Nutzen hätte sein können. Wir brauchten Freiheit, um ihnen zu helfen.
Über diese und ähnliche Argumente ließ sich diskutieren. Doch die Wiederaufnahme des Brauchs einer eindeutigen physischen Identifizierung machte es beinahe unmöglich, die Maskerade aufrechtzuerhalten. Unter den neuen Verhältnissen begrüßt ein geistig gesunder und friedlicher Bürger diese Regelung, auch wenn er sonst eifersüchtig über sein Recht auf Privatleben wacht. Deshalb wagten wir nicht, dagegen zu protestieren. Das hätte Neugier erweckt, uns als exzentrische Gruppe abgestempelt, uns ausgesondert, und die ganze Maskerade wäre dadurch sinnlos geworden.
Der Not gehorchend, beugten wir uns der persönlichen Identifizierung. Zur Zeit des Treffens von 2125, also vor elf Jahren, war es schon außerordentlich schwierig geworden, neue Identitäten für die wachsende Zahl unserer Verwandten zu fälschen, deren Alter nicht mehr mit ihrem Aussehen übereinstimmte. Wir entschlossen uns zu einem Experiment: Freiwillige aus dieser Gruppe, aber höchstens zehn Prozent aller Mitglieder der Familien, sollten sich als das, was sie waren, entdecken. Wir wollten die Folgen abwarten und währenddessen alle anderen Geheimnisse der Familien-Organisation weiterhin bewahren.
Die Ergebnisse unterschieden sich in bedauerlicher Weise von unsern Erwartungen.«
Justin Foote sprach nicht weiter. Eine Weile herrschte Schweigen, dann ergriff ein kräftig gebauter Mann von mittlerer Größe das Wort. Sein Haar war leicht ergraut – ungewöhnlich in dieser Gruppe –, und sein Gesicht war raumgebräunt. Mary Sperling hatte ihn bemerkt, und sie hätte gern gewusst, wer er war – sein lebendiges Gesicht und sein herzhaftes Lachen hatten ihr Interesse geweckt. Aber es stand jedem Mitglied frei, an den Sitzungen des Familienrates teilzunehmen. Sie hatte dann nicht weiter darüber nachgedacht.
Der Mann sagte: »Nun mach schon! Wie lautet der Bericht?«
Foote richtete seine Antwort an die Vorsitzende. »Eine Zusammenfassung des Berichts sollte unser Chef-Psychometriker vortragen. Meine Bemerkungen stellen nur eine Einleitung dar.«
»Da soll doch gleich …«, rief der angegraute Fremde aus. »Kumpel, willst du dich wirklich hinstellen und zugeben, dass du nichts zu sagen hattest als Dinge, die wir bereits wussten?«
»Meine Ausführungen sollten die Grundlage schaffen. Und mein Name ist Justin Foote, nicht ›Kumpel‹.«
Entschlossen trennte Mary Sperling die beiden. »Bruder«, sagte sie zu dem Fremden, »da du die Familien ansprichst, willst du bitte deinen Namen nennen? Leider muss ich sagen, dass ich dich nicht erkenne.«
»Verzeihung, Schwester. Ich heiße Lazarus Long, und ich spreche für mich selbst.«
Mary schüttelte den Kopf. »Ich weiß immer noch nicht, wo ich dich hintun soll.«
»Noch einmal Verzeihung – das ist ein Maskerade-Name, den ich zur Zeit des ersten Propheten annahm … Er machte mir Spaß. Mein Familienname ist Smith … Woodrow Wilson Smith.«
»›Woodrow Wilson Sm…‹ Wie alt bist du?«
»Nun, das habe ich längere Zeit nicht mehr nachgerechnet. Einhundert… nein, zweihundertund… dreizehn Jahre. Ja, das ist richtig, zweihundertunddreizehn.«
Plötzlich herrschte vollkommene Stille. Dann fragte Mary ruhig: »Hast du nicht gehört, dass ich fragte, ob jemand älter als ich sei?«
»Ja. Aber, Schwester, du machtest es doch sehr gut. Ich habe seit über einem Jahrhundert an keinem Familientreffen mehr teilgenommen. Seitdem hat sich manches verändert.«
»Ich bitte dich, von hier an zu übernehmen.« Sie verließ die Plattform.
»O nein!«, protestierte er. Aber sie achtete nicht darauf und suchte sich einen Platz. Lazarus sah hierhin und dahin, zuckte die Achseln und ergab sich. Ein Bein über die Ecke des Sprecher-Tisches hängend, meinte er: »Na gut, fahren wir fort. Wer ist der Nächste?«
Ralph Schultz von der Schultz-Familie sah eher wie ein Bankier als wie ein Psychometriker aus. Er war weder schüchtern noch zerstreut, und er sprach auf eine nüchterne, sachliche Art, die ihm Autorität verlieh. »Ich gehöre zu der Gruppe, die vorschlug, die Maskerade zu beenden. Ich hatte unrecht. Ich glaubte, die große Mehrheit unserer Mitbürger, die alle nach modernen Unterrichtsmethoden erzogen sind, sei fähig, Daten aller Art ohne emotionalen Aufruhr auszuwerten. Natürlich rechnete ich damit, dass ein paar abartige Menschen Abscheu, vielleicht sogar Hass für uns empfinden würden; ich sagte sogar voraus, wir würden bei den meisten Neid erwecken – jeder, der das Leben genießt, möchte gern lange leben. Aber ich rechnete nicht mit ernsthaften Schwierigkeiten. Die moderne Einstellung hat mit den Reibungen zwischen den Rassen Schluss gemacht. Wer heute immer noch Rassenvorurteile hat, schämt sich, sie auszusprechen. Ich glaubte, unsere Gesellschaft sei so tolerant, dass wir friedlich und ohne Geheimniskrämerei unter den Kurzlebigen leben könnten.
Ich hatte unrecht.
Der Neger hasste und beneidete den weißen Mann so lange, wie der weiße Mann Privilegien genoss, die dem Neger aufgrund seiner Farbe vorenthalten wurden. Das war eine gesunde, normale Reaktion. Als es keine Diskriminierung mehr gab, erledigte sich das Problem von selbst, und es fand eine kulturelle Assimilation statt. Eine ähnliche Tendenz liegt bei den Kurzlebigen vor, wenn sie die Langlebigen beneiden. Wir gingen davon aus, diese zu erwartende Reaktion werde in den meisten Fällen ohne soziale Bedeutung sein, sobald wir klargemacht hatten, dass wir unsere Besonderheit unsern Genen verdanken – dass es kein Fehler und keine Tugend unsererseits ist, sondern nichts als Glück in der Zusammensetzung unserer Vorfahren.
Das war reines Wunschdenken. Im Rückblick ist leicht zu erkennen, dass wir, wären die Daten richtig analysiert worden, eine andere Antwort erhalten hätten. Dann hätten wir entdeckt, dass die Analogie mit dem Neger falsch ist. Ich verteidige die Fehleinschätzung nicht, denn das ist nicht möglich. Wir wurden von unsern Hoffnungen in die Irre geführt.
Tatsächlich geschah Folgendes: Wir zeigten unsern kurzlebigen Vettern den größten Schatz, den ein Mensch sich vorstellen kann – und sagten ihnen dann, er werde ihnen nie gehören. Das stellte sie vor ein unlösbares Dilemma. Sie haben die unerträglichen Tatsachen zurückgewiesen, sie weigern sich, uns zu glauben. Ihr Neid verwandelt sich jetzt in Hass. Sie sind gefühlsmäßig überzeugt, dass wir sie ihrer Rechte berauben … absichtlich, aus Bosheit.
Dieser steigende Hass ist nun zu einer Flut angeschwollen, die das Wohlergehen und sogar das Leben aller unserer der Öffentlichkeit bekannten Brüder bedroht – und eine Gefahr für uns alle darstellt. Die Gefahr ist sehr groß und uns sehr nahe.« Er setzte sich abrupt hin.
Aus jahrelanger Gewohnheit nahmen sie es ruhig auf. Dann erhob sich eine Delegierte. »Eve Barstow für die Cooper-Familie. Ralph Schultz, ich bin hundertundneunzehn Jahre alt, und damit, wie ich glaube, älter als du. Ich weiß nicht so viel wie du über Mathematik und menschliche Verhaltensweisen, aber ich habe eine Menge Menschen kennengelernt. Menschliche Wesen sind von Natur aus gut und sanft und freundlich. Oh, sie haben ihre Schwächen, aber die meisten von ihnen sind anständig, wenn man ihnen nur eine halbe Chance gibt. Ich kann nicht glauben, dass sie mich hassen und mich töten würden, nur weil ich lange Zeit gelebt habe. Welche Beweise hast du? Du hast eingestanden, einen Fehler gemacht zu haben – warum können es nicht zwei sein?«
Schultz sah sie ernst an und strich seinen Kilt glatt. »Du hast recht, Eve. Ich könnte mich leicht wieder irren. Das ist das Problem bei der Psychologie: Sie ist ein so schrecklich komplexes Thema, es gibt so viele Unbekannte, es sind so viele Beziehungen zu beachten, dass unsere größten Anstrengungen manchmal im nüchternen Licht späterer Tatsachen töricht wirken.« Er stand wieder auf, drehte sich zu den Versammelten um und sprach mit der Sachlichkeit des Fachmanns. »Aber diesmal mache ich keine langfristige Vorhersage. Ich spreche von Tatsachen. Und auf diese Tatsachen baue ich eine Prognose auf, die so kurzfristig ist, als sage man, ein Ei werde zerbrechen, wenn man es schon unterwegs zum Fußboden sieht. Trotzdem hat Eve in gewissem Umfang recht. Individuen sind freundlich und anständig – als Individuen und zu anderen Individuen. Eve droht keine Gefahr von ihren Nachbarn und Freunden, und mir droht keine Gefahr von meinen. Aber ihr droht Gefahr von meinen Nachbarn und Freunden – und mir von ihren. Wer das Verhalten einer Masse untersuchen will, darf nicht einfach psychologische Erkenntnisse über Individuen summieren. Das sage nicht ich, das ist ein Grundtheorem der sozialen Psychodynamik, und bisher ist noch nie eine Ausnahme von der Regel festgestellt worden. Es ist die Regel der Massenaktion, das Gesetz der Mob-Hysterie, bekannt und angewendet von militärischen, politischen und religiösen Führern, von Werbeleuten und Propheten und Propagandisten, von Unruhestiftern und Schauspielern und Gangsterbossen, Generationen bevor es in mathematischen Symbolen formuliert wurde. Es funktioniert. Und es funktioniert jetzt.
Meinen Kollegen und mir kam vor mehreren Jahren der Verdacht, es baue sich ein Mob-Hysterie-Trend gegen uns auf. Wir baten den Rat nicht, etwas dagegen zu unternehmen, weil wir nichts beweisen konnten. Was wir damals beobachteten, hätte auch das Murren einer Minderheit von Spinnern sein können, die es in der gesündesten Gesellschaft gibt. Der Trend war anfangs so undeutlich, dass wir nicht sicher sein konnten, ob es ihn überhaupt gab, denn alle sozialen Trends sind mit anderen sozialen Trends verflochten wie ein Teller voller Spaghetti – und schlimmer, denn man braucht einen abstrakten vieldimensionalen Raum (zehn oder zwölf Dimensionen sind nicht ungewöhnlich und reichen kaum aus), um das Zusammenspiel sozialer Kräfte mathematisch zu beschreiben. Ich kann die Vielschichtigkeit des Problems gar nicht genug betonen.
Also warteten wir voller Sorge und machten Stichproben, nachdem wir unser statistisches Universum mit größter Sorgfalt aufgestellt hatten.
Als wir uns sicher waren, war es beinahe zu spät. Die Entwicklung soziopsychologischer Trends folgt dem komplizierten »Hefewachstum-Gesetz«. Wir hofften, andere, uns günstige Faktoren würden den Trend umkehren – Nelsons Arbeit mit Symbiotika, unsere eigenen Beiträge zur Geriatrie, das große Interesse an der Erschließung der Jupiter-Satelliten für die Einwanderung. Jeder Durchbruch, der den Kurzlebigen längeres Leben und größere Hoffnung gab, konnte den schwelenden Groll gegen uns auslöschen.
Stattdessen ist das Schwelen in Flammen aufgelodert und zu einem unkontrollierten Waldbrand geworden. Nach unsern Messungen hat sich die Rate in den letzten siebenunddreißig Tagen verdoppelt, und die Rate selbst beschleunigt sich. Ich kann nicht abschätzen, wie weit oder wie schnell sie sich entwickeln wird – und darum haben wir um diese außerordentliche Sitzung gebeten. Denn wir müssen jeden Augenblick mit Schwierigkeiten rechnen.« Er ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Sein Gesicht wirkte müde.
Eve widersprach ihm nicht länger, und auch sonst brachte niemand einen Einwand vor. Ralph Schultz galt nicht nur als Experte auf seinem Wissensgebiet, es hatte auch jeder Einzelne der Anwesenden von seinem eigenen Gesichtspunkt aus die deutlicheren Anzeichen bemerkt. Doch während man einstimmig akzeptierte, dass die Stimmung gegen ihre der Öffentlichkeit bekannten Vettern war, gab es ebenso viele Meinungen wie Anwesende, was zu unternehmen sei. Lazarus hörte sich die sinnlose Diskussion zwei Stunden lang an. Dann hob er die Hand. »Das führt zu nichts«, erklärte er, »und es sieht ganz so aus, als ob es auch die ganze Nacht zu nichts führen wird. Lasst uns einmal die wesentlichen Punkte zusammenfassen!
Wir können …« – er zählte an den Fingern ab – »nichts tun, stillhalten und abwarten, was geschieht.
Wir können die Maskerade vollständig aufgeben, unsere Gesamtzahl enthüllen und auf politischem Weg unsere Rechte verlangen.
Wir können unsere Organisation und unser Geld unter Wahrung der Geheimhaltung dazu benutzen, unsere exponierten Brüder zu schützen, sie vielleicht in die Maskerade zurückzuholen.
Wir können an die Öffentlichkeit treten und um ein Reservat bitten, wo wir uns ansiedeln und unter uns leben werden.
Oder wir können irgendetwas anderes tun. Ich schlage vor, dass ihr euch nach diesen vier hauptsächlichen Gesichtspunkten in vier Gruppen aufteilt und euch in die vier Ecken dieses Raums begebt, von der hinteren rechten Ecke angefangen im Uhrzeigersinn weiter. Jede Gruppe arbeitet einen Plan aus, den sie den Familien vorlegen kann. Und diejenigen von euch, die für keinen der vier Punkte sind, versammeln sich in der Mitte und legen ihren Standpunkt klar. Wenn ich nun keinen Einwand höre, werde ich die Sitzung bis morgen um Mitternacht vertagen. Wie ist es?«
Keiner sagte ein Wort. Lazarus Longs stromlinienförmige Version eines parlamentarischen Prozedere hatte sie einigermaßen überrollt. Sie waren an lange, gemächliche Diskussionen gewöhnt, bis sich alle einer bestimmten Meinung angeschlossen hatten. Etwas hastig tun zu sollen, erschreckte sie ein bisschen.
Aber der Mann hatte eine machtvolle Persönlichkeit, seine Jahre gaben ihm Prestige, und seine etwas archaische Sprache trug zu einer patriarchalischen Autorität bei. Nicht ein Protest wurde laut.
»Okay.« Lazarus klatschte einmal in die Hände. »Die Kirche ist aus bis morgen Abend.« Er stieg von der Plattform.
Mary Sperling trat zu ihm. »Ich würde dich gern besser kennenlernen«, sagte sie und sah ihm in die Augen.
»Klar doch, Schwester. Warum nicht?«
»Bleibst du zur Diskussion hier?«
»Nein.«
»Könntest du mit zu mir nach Hause kommen?«
»Gern. Ich habe keine dringenden Geschäfte anderswo.«
»Dann komm!« Sie führte ihn durch den Tunnel zu dem unterirdischen Teich, der mit dem Michigan-See in Verbindung stand. Er machte große Augen, als er den Pseudo-Camden sah, sagte aber nichts, bis sie getaucht waren.
»Einen hübschen kleinen Wagen hast du da.«
»Ja.«
»Er hat ein paar ungewöhnliche Eigenschaften.«
Sie lächelte. »Ja. Unter anderem explodiert er – sehr gründlich –, wenn irgendjemand versucht, ihn zu untersuchen.«
»Gut.« Er erkundigte sich: »Bist du Konstrukteurin, Mary?«
»Ich? Himmel, nein! Wenigstens nicht mehr in diesem Jahrhundert, und ich versuche nicht länger, darin auf dem Laufenden zu bleiben. Aber du kannst dir einen so umgebauten Wagen über die Familien bestellen, wenn du einen möchtest. Sprich mit …«
»Lass nur, ich brauche keinen. Ich liebe einfache Maschinen, die tun, wozu sie gebaut worden sind, und es ruhig und kompetent tun. In dem da steckt einiges Gehirnschmalz.«
»Ja.« Sie war jetzt beschäftigt, musste auftauchen, eine Radarkontrolle durchführen und sie ans Ufer zurückbringen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
In ihrer Wohnung stellte sie ihm Tabak und etwas zu trinken hin, ging in ihr Schlafzimmer, zog ihre Straßenkleidung aus und hüllte sich in ein weiches, lockeres Gewand, in dem sie noch kleiner und jünger als vorher aussah. Als sie zu Lazarus zurückkehrte, stand er auf, zündete eine Zigarette für sie an und pfiff ebenso galant wie unfein.
Mary lächelte kurz, nahm die Zigarette, setzte sich in einen großen Sessel und zog die Füße unter sich. »Lazarus, du gibst mir neuen Mut.«
»Hast du keinen Spiegel, Mädchen?«
»Nicht das«, wehrte sie ungeduldig ab. »Deine Person. Du weißt, dass ich über das Alter hinaus bin, das wir vernünftigerweise erwarten können, und in den letzten zehn Jahren bin ich ständig darauf gefasst gewesen zu sterben. Aber da sitzt du – Jahre und Jahre älter als ich. Das lässt mich hoffen.«
Er setzte sich gerade hin. »Du sprichst vom Sterben? Himmel, Mädchen, du siehst aus, als hättest du noch ein Jahrhundert vor dir.«
Sie machte eine müde Geste. »Zieh mich nicht auf! Du weißt genau, dass das Aussehen nichts damit zu tun hat. Lazarus, ich will nicht sterben!«
Lazarus antwortete ernst: »Ich wollte dich nicht aufziehen, Schwester. Du wirkst einfach nicht wie eine Todeskandidatin.«
Sie zuckte anmutig die Achseln. »Das verdanke ich der Biotechnik. Ich halte meine äußere Erscheinung bei Anfang Dreißig.«
»Oder weniger, würde ich sagen. Ich kenne die neuesten Tricks nicht. Du hast gehört, wie ich sagte, dass ich seit über einem Jahrhundert nicht mehr an Zusammenkünften teilgenommen habe. Tatsächlich bin ich die ganze Zeit ohne jede Berührung mit den Familien gewesen.«
»Wirklich? Darf ich fragen, warum?«
»Das ist eine lange und langweilige Geschichte. Im Grunde läuft sie darauf hinaus, dass mir die Familien langweilig wurden. Ich kam regelmäßig als Delegierter zu den Jahrestreffen. Allmählich verknöcherten die Leute, oder zumindest kam es mir so vor. Deshalb wanderte ich aus. Das Interregnum habe ich hauptsächlich auf der Venus verbracht. Nachdem der Vertrag unterzeichnet war, kam ich für eine Weile zurück, aber ich habe alles in allem seitdem wohl keine zwei Jahre auf der Erde verbracht. Ich reise gern herum.«
Ihre Augen leuchteten auf. »Oh, erzähle mir davon! Ich bin noch nie im tiefen Raum gewesen. Nur einmal in Luna City.«
»Gern«, stimmte er zu, »irgendwann. Jetzt möchte ich Genaueres über diese Sache mit deinem Aussehen wissen. Mädchen, man sieht dir dein Alter gewiss nicht an.«
»Das will ich hoffen! Aber darüber, wie man es macht, kann ich dir nicht viel sagen. Hormone und Symbiotika und Drüsentherapie und ein bisschen Psychotherapie – lauter solche Sachen. Alles zusammen wirkt darauf hin, dass die Senilität für Mitglieder der Familien hinausgeschoben und das Altern zumindest kosmetisch verhindert wird.« Sie grübelte eine Weile. »Einmal glaubten sie, dem Geheimnis der Unsterblichkeit auf der Spur zu sein, den echten Jungbrunnen gefunden zu haben. Aber es war ein Irrtum. Die Senilität wird nur hinausgeschoben – und verkürzt. Etwa neunzig Tage nach der ersten deutlichen Warnung stirbt man an Altersschwäche.« Sie erschauerte. »Natürlich warten die meisten unserer Vettern das nicht ab – zwei Wochen, um sicher zu sein, dass die Diagnose stimmt, dann Euthanasie.«
»Was du nicht sagst! Also, ich würde diesen Weg nicht wählen. Wenn der Sensenmann kommt, mich zu holen, muss er mich wegzerren – und ich werde jeden Schritt des Weges heftig mit den Füßen um mich treten und meine Finger in Augen stechen!«
Mary lächelte schief. »Es tut mir gut, dich so reden zu hören. Lazarus, zu niemandem, der jünger ist als ich, würde ich so offen sein. Aber dein Beispiel macht mir Mut.«
»Wir werden sie alle überleben, Mary, hab keine Bange! Was jedoch die heutige Sitzung angeht: Ich habe kein Interesse an Nachrichtensendungen gehabt, und ich bin erst vor Kurzem auf die Erde zurückgekehrt – weiß dieser Ralph Schultz, wovon er spricht?«
»Davon bin ich überzeugt. Sein Großvater war ein brillanter Mann, und sein Vater ist auch einer.«
»Dann kennst du Ralph.«
»Flüchtig. Er ist eins meiner Enkelkinder.«
»Das ist lustig. Er sieht älter aus als du.«
»Ralph passte es, sein Aussehen bei etwa Vierzig festzuhalten, das ist alles. Sein Vater war mein siebenundzwanzigstes Kind. Ralph muss – lass mich nachdenken – oh, mindestens achtzig oder neunzig Jahre jünger sein als ich. Aber er ist älter als einige meiner Kinder.«
»Du hast viel für die Familie getan, Mary.«
»Das finde ich auch. Andererseits haben sie auch viel für mich getan. Ich habe gern Kinder bekommen, und die Zulagen der Stiftung für meine mehr als dreißig ergaben ein ganz hübsches Sümmchen. Ich habe jeden Luxus, den man sich wünschen kann.« Wieder erschauerte sie. »Sicher bin ich darum so deprimiert – ich genieße das Leben.«
»Hör auf! Ich dachte, mein edles Beispiel und mein jungenhaftes Grinsen hätten dich von diesem Unsinn geheilt.«
»Nun – du hast mir geholfen.«
»Hmm … hör mal, Mary, warum heiratest du nicht wieder und bekommst noch ein paar wilde Rangen? Dann hättest du zu viel zu tun, um dich trüben Gedanken hinzugeben.«
»Was? In meinem Alter? Nein, wirklich, Lazarus!«
»Mit deinem Alter ist alles in bester Ordnung. Du bist jünger als ich.«
Sie musterte ihn. »Lazarus, machst du mir einen Antrag? Wenn ja, wünschte ich, du würdest dich deutlicher ausdrücken.«
Er öffnete den Mund und schluckte. »He, einen Augenblick! Immer mit der Ruhe! Ich habe ganz allgemein gesprochen … ich bin kein häuslicher Typ. Jedes Mal, das ich geheiratet habe, hat meine Frau innerhalb weniger Jahre meinen Anblick satt bekommen. Nicht etwa, dass ich … nun, ich meine, du bist ein sehr hübsches Mädchen, und ein Mann sollte …«
Sie beugte sich vor und legte ihm die Hand auf den Mund, wobei sie koboldhaft grinste. »Ich wollte dich nicht in Panik versetzen, Vetter. Oder vielleicht doch – Männer sind so komisch, wenn sie glauben, man will sie einfangen.«
»Also …«, sagte er düster.
»Vergiss es, Lieber! Sag mir, auf welchen Plan werden sie sich deiner Meinung nach einigen?«
»Der Haufen, der heute Abend da war?«
»Ja.«
»Natürlich auf keinen. Sie werden zu keinem Schluss kommen. Mary, ein Komitee ist die einzige bekannte Lebensform, die hundert Bäuche und kein Gehirn hat. Aber schließlich wird jemand mit einer eigenen Meinung sie zwingen, seinen Plan zu akzeptieren. Ich weiß nicht, was für einer das sein wird.«
»Nun … für welchen Weg bist denn du?«
»Ich? Für keinen. Mary, wenn ich in den letzten zwei Jahrhunderten irgendetwas gelernt habe, dann dieses: So etwas geht vorüber. Kriege und Depressionen und Propheten und Verträge – sie gehen vorüber. Der Trick ist, dass man währenddessen am Leben bleibt.«
Sie nickte nachdenklich. »Ich glaube, du hast recht.«
»Sicher habe ich recht. Man braucht so etwa hundert Jahre, um zu begreifen, wie schön das Leben ist.« Er stand auf und reckte sich. »Aber gerade jetzt könnte dieser heranwachsende Junge etwas Schlaf gebrauchen.«
»Ich auch.«
Marys Wohnung lag im obersten Stockwerk und hatte Aussicht auf den Himmel. Als sie vorher aus dem Schlafzimmer gekommen war, hatte sie die Innenbeleuchtung ausgeschaltet und die Decken-Rollläden zurückgezogen. Sie hatten, von einer unsichtbaren Plastikfolie abgesehen, unter den Sternen gesessen. Lazarus reckte sich und hob dabei den Kopf, und sein Blick fiel auf sein Lieblingssternbild. »Seltsam«, bemerkte er. »Der Orion scheint seinem Gürtel einen vierten Stern hinzugefügt zu haben.«
Mary sah nach oben. »Das muss das große Schiff für die zweite Centauri-Expedition sein. Pass einmal auf, ob du erkennen kannst, dass es sich bewegt.«
»Ohne Instrumente kann ich das nicht sagen.«
»Nein, das geht wohl nicht«, stimmte sie zu. »Klug von den Leuten, dass sie es draußen im Raum bauen, nicht wahr?«
»Es gibt keine andere Möglichkeit. Das Schiff ist zu groß, als dass es auf der Erde zusammengesetzt werden könnte. Ich kann gleich hier schlafen, Mary. Oder hast du ein Gästezimmer?«
»Dein Zimmer liegt hinter der zweiten Tür rechts. Rufe, wenn du etwas, das du brauchst, nicht finden kannst.« Sie hob den Kopf und gab ihm einen schnellen Gute-Nacht-Kuss.
Lazarus folgte ihr hinaus und ging in sein Zimmer.
Am nächsten Tag erwachte Mary Sperling zur gewohnten Stunde. Sie stand leise auf, um Lazarus nicht zu wecken, nahm in ihrem Erfrischer eine Dusche und eine Massage, schluckte ein Körnchen Schlaf-Surrogat, um die kurze Nacht auszugleichen, und ließ ihm beinahe ebenso schnell alles an Frühstück folgen, was sie ihrer Taille erlaubte. Dann spielte sie die Anrufe ab, um die sie sich am Abend zuvor nicht mehr gekümmert hatte. Einige vergaß sie gleich wieder. Dann erkannte sie die Stimme Bork Vannings. »Hallo«, sagte das Gerät, »Mary, hier ist Bork. Es ist einundzwanzig Uhr. Morgen um zehn komme ich Sie abholen. Wir können kurz in den See springen und irgendwo essen. Falls ich nichts von Ihnen höre, ist es abgemacht. Bis dann, meine Liebe. Zu Diensten.«
»Zu Diensten«, wiederholte Mary automatisch. Zum Teufel mit dem Mann! Akzeptierte er ein Nein als Antwort nicht? Mary Sperling, du lässt nach! Er ist ein Viertel so alt wie du, und doch wirst du anscheinend nicht mit ihm fertig.
Ruf ihn an und sage ihm – nein, zu spät. Er muss jede Minute hier sein. Ach du meine Güte!
2
Als Lazarus zu Bett ging, stieg er aus seinem Kilt und warf ihn in Richtung des Schrankes – der ihn auffing, ausschüttelte und ordentlich aufhängte. »Gut gefangen«, kommentierte Lazarus. Dann blickte er auf seine haarigen Oberschenkel nieder und lächelte schief. Der Kilt hatte einen Laser verborgen, der an das eine Bein geschnallt war, und ein Messer am anderen. Er wusste, dass man in diesen gesitteten Zeiten nicht mit Waffen herumlief, aber er fühlte sich ohne sie nackt. Und dann war es sowieso ein Altweiberblödsinn, es gebe gefährliche Waffen. Nein, es gab nur gefährliche Menschen.
Er ging in den Erfrischer, und bevor er sich zum Schlafen zusammenrollte, legte er seine Waffen so hin, dass er sie erreichen konnte.
Voll wach, beide Waffen in den Händen fuhr er in die Höhe … Er erinnerte sich, wo er war, entspannte sich und sah sich um, was ihn geweckt haben mochte.
Es war das Gemurmel von Stimmen, das durch den Luftschacht kam. Schlecht isoliert, dachte er. Mary musste Besuch haben. Da wollte er keine Schlafmütze sein. Er stand auf, erfrischte sich, schnallte sich seine besten Freunde wieder an die Beine und ging, um nach seiner Gastgeberin Ausschau zu halten.
Die Tür zum Wohnzimmer öffnete sich geräuschlos vor ihm, und die Stimmen wurden laut und sehr interessant. Das Wohnzimmer war L-förmig, und er war außer Sicht. Er blieb stehen und lauschte schamlos. Das Lauschen hatte ihm schon bei verschiedenen Gelegenheiten das Leben gerettet. Es war ihm gar nicht peinlich – er hatte Spaß daran.
Ein Mann sagte: »Mary, Sie sind unvernünftig! Sie haben mich gern, Sie räumen ein, dass eine Heirat mit mir zu Ihrem Vorteil wäre. Also warum wollen Sie nicht?«
»Das habe ich Ihnen doch gesagt, Bork. Der Altersunterschied.«
»Das ist töricht. Was erwarten Sie? Jugendliche Romantik? Oh, ich gebe zu, dass ich nicht so jung bin wie Sie … Aber eine Frau braucht einen älteren Mann, zu dem sie aufblicken kann und der ihr Halt gibt. Ich bin nicht zu alt für Sie; ich bin in den besten Jahren.«
Lazarus meinte, diesen Kerl bereits gut genug zu kennen, um ihn nicht leiden zu mögen. Dieser eingeschnappte Ton …
Mary antwortete nicht. Der Mann fuhr fort: »Wie dem auch sei, zu diesem Punkt habe ich eine Überraschung für Sie. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen gleich sagen, aber … nun, es ist ein Staatsgeheimnis.«
»Dann sagen Sie es mir nicht. Meine Meinung würde es sowieso nicht ändern, Bork.«
»O doch! Hmm … ich werde es Ihnen verraten – ich weiß ja, dass ich Ihnen vertrauen kann.«
»Nein, Bork, Sie sollten nicht davon ausgehen, dass …«
»Es spielt keine Rolle; in wenigen Tagen wird es doch allgemein bekannt sein. Mary … Ich werde niemals mehr älter werden!«
»Wie meinen Sie das?« Lazarus nahm das Misstrauen in Marys Stimme wahr.
»Genauso, wie ich es gesagt habe. Mary, man hat das Geheimnis der ewigen Jugend gefunden!«
»Was? Wer? Wie? Wann?«
»Das interessiert Sie also doch, he? Nun, ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Sie wissen von diesen alten Knackern, die sich die Howard-Familien nennen?«
»Ja … ich habe von ihnen gehört«, antwortete sie langsam. »Aber was ist mit ihnen? Das sind doch Schwindler.«
»Durchaus nicht. Ich weiß es. Die Regierung hat ihre Behauptungen in aller Stille überprüft. Einige von ihnen sind zweifellos über hundert Jahre alt – und immer noch jung!«
»Das ist kaum zu glauben.«
»Und trotzdem wahr.«
»Wie machen sie das denn?«
»Ah! Das ist es ja. Sie behaupten, es liege nur an der Vererbung, dass sie lange leben, weil sie von langlebigen Vorfahren abstammen. Aber das ist unsinnig und wissenschaftlich nicht mit den festgestellten Tatsachen zu vereinen. Die Regierung hat sehr sorgfältig nachgeforscht, und die Antwort ist eindeutig: Sie besitzen das Geheimnis, jung zu bleiben.«
»Dessen können Sie doch gar nicht sicher sein.«