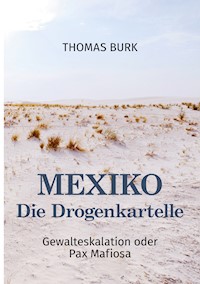
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Organisierte Kriminalität steht immer in einem komplexen Spannungsverhältnis zu Regierungen, Behörden der Strafverfolgung und staatlichen Institutionen. Die Kollaboration zwischen Regierungen, Teilen der Polizeibehörden und den Drogenkartellen ist eine erwiesene Tatsache. Interessanter ist die Kollaboration von US-Regierungsstellen, und der CIA mit Drogenkartellen. Auch sie ist durch einen von John Kerry geleiteten Untersuchungsausschuss offiziell erwiesen. Die US Drogenfahndung, Drug Enforcement Administration (DEA) stand oft in Konkurrenz zu verdeckten Operationen der CIA weltweit. Laut Kerry-Report und weiteren Quellen wurden Drogenhändler für Waffenlieferungen an die Contra Rebellen in Nicaragua aus staatlichen Fonds bezahlt. Für die Kartelle war in diesem Fall der ungehinderte Drogenhandel wichtiger als die Bezahlung der Hilfsflüge. Sie lag knapp unter einer Million Dollar. Das sind gemessen an den Einkünften aus dem Drogenhandel Peanuts. Aus diesen Zusammenhängen wird auch die Gewalteskalation in Mexiko verständlich. Sie ist keineswegs typisch für das Agierung von Verbrecherkartellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Autor:
Thomas J. Burk, Jahrgang 1953. Studium der Geschichte, Literatur- und Sprachwissenschaften an der Universität Trier. Studienaufenthalt am Centro Intercultural de Documentación, Cuernavaca, Mor. Mexiko.
Inhalt
A. Vorbemerkungen
B. Der Graubereich: Zwischen Legalität und Kriminalität
C. Die mexikanischen Verbrecherkartelle
D. Das Golfkartell und die Zetas
E. Die Familia Michoacána / Caballeros Templarios
Ideologie, Kulte und charismatische Führer
F. Die Eskalation der Gewalt
I. Der mexikanische Drogenhandel bis zum Jahr 1985
II. Das Ende des „Systems Gallardo“
G. Die Folgen
I. Internationale Verbreitung und Kooperation mit der ‚Ntrangheta
II. Die Bilanz: Mexiko 2016
III. Das Jahr 2017 und die Zeit von September 2017 bis zu den Wahlen am 1. Juli 2018
IV. Cártel Jalisco Nueva Generación – ein neuer Global Player
H. Der weltweite Drogenkrieg und die Folgen
I. Realistische Ziele?
II. Der Antidrogenkrieg im Schatten des Kalten Krieges
III. Lateinamerika – imperiale Hegemonie und nationale Souveränität
IV. Narcokult, Narcokultur, Kultur der Gewalt
Abkürzungen
Gedruckte Bücher und Aufsätze
Wenn im Text von Dollars die Rede ist, sind, wenn nicht anders vermerkt, US-amerikanische Dollars gemeint. Das $ Zeichen wird auch für mexikanische Pesos verwendet und kann missverständlich sein.
A. Vorbemerkungen
Organisierte Kriminalität ist ein weltweites Phänomen, und es ist nicht neu. Organisierte Kriminalität ist schwer zu fassen, weil sie per definitionem im Verborgenen wirkt. Sie ist in legale wirtschaftliche Aktivitäten verstrickt und korrumpiert Politiker, Banken und Großkonzerne. Es ist nicht immer leicht, sie von Terrorgruppen und Privatarmeen abzugrenzen. Vermeintlich legale Rohstoffausbeutung internationaler Großkonzerne in Afrika und Südamerika trägt Züge organisierter Kriminalität, weil Politiker bestochen werden, Menschen in Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen arbeiten und Umweltverwüstungen in Kauf genommen werden, die unmittelbar Menschenleben fordern.1 Organisierte Verbrecherkartelle sind illegale Großunternehmen. Ihr Ziel ist das gleiche wie das legaler Großunternehmen: Profitmaximierung. Extreme Gewaltanwendung kann diesem Ziel teilweise entgegenwirken. Es ist deshalb erklärungsbedürftig, wie es zu exzessiven Gewaltorgien kommen kann, die den Geschäften durchaus schaden können. Sie können staatliche Gegenmaßnahmen provozieren oder einfach den normalen Geschäftsablauf stören. Bekannt sind die Kämpfe rivalisierender Mafiagruppen, die aber in der Vergangenheit immer wieder zur teilweisen Pazifizierung oder zumindest zu einer kontrollierten, unterschwelligen Gewaltanwendung führten.
Die Gewaltexzesse in Mexiko verlaufen dagegen teilweise unkontrolliert und nehmen bizarre Formen an. Es mag sein, dass es in Mexiko wie in den USA aus geschichtlichen Gründen eine Tradition gibt, seinen Schutz und die Verteidigung seiner Interessen schneller in die eigene Hand zu nehmen, als dies in Europa der Fall ist. Solche Dispositionen der Mentalität spielen allerdings bei der hier verhandelten Gewalteskalation, wenn überhaupt, dann eine sehr geringe Rolle.
Einem möglichen Missverständnis soll vorgebeugt werden: In Mexiko lebt und reist man sicherer als in manchem europäischen Land. Es ist von der Vielfalt seiner Landschaften und Lebensformen her ein großartiges Land. Es hat ein faszinierendes kulturelles Erbe, dessen Erforschung noch immer Überraschungen an den Tag bringt. Ein Leben reicht nicht aus, um es in all seinen Facetten zu erfahren. Niemand sollte sich abschrecken lassen, das Land zu bereisen. Auch für Individualreisende genügen einfache Regeln des gesunden Menschenverstands, die auch in Europa eingehalten werden müssen, um sicher zu leben und zu reisen.
Como México no hay dos!
1 Da im öffentlichen Diskurs in der Bundesrepublik einige Maßstäbe verrückt sind, sei darauf hingewiesen, dass es hier nicht um Feinstaubbelastungen in Innenstädten geht, sondern um Massenvertreibungen, völlige Zerstörung der Lebensgrundlagen und Massenvergiftungen. Wer gute Nerven hat, findet reihenweise Beispiele in dem hervorragenden Buch von Louise Shelley. Shelley, Louise I.: Dark Commerce. How a new illicit Economy is Threatening Our Future. Princeton University Press 2018, S. 58 et passim.
B. Der Graubereich: Zwischen Legalität und Kriminalität
„Mehr als drei sind eine Gruppe,“ sagte der Soziologe Alfred Schütz (1899-1959), wenn ich mich recht erinnere. Damit hatte er recht. Aber zwei Paare, wie immer sie zusammengesetzt sind, haben in der Regel die Welt noch nicht aus den Angeln gehoben. Pathologien der Kommunikation und der Interaktion gibt es schon bei Paaren; das war schon vor Watzlawick bekannt. Die „folie à deux“ ist ein schönes Beispiel. Spätestens ab fünf Personen treten asymmetrische Kommunikation, Macht und Hierarchie in einer anderen Qualität auf als bei Paaren. Anderenfalls würde es schwierig und zeitaufwendig, zu einheitlichen Beschlüssen zu kommen, die alle betreffen. Das ist ein Vorteil, verfestigt aber auch Macht und Dominanz in allen gruppenrelevanten Interaktionen. Auch in den egalitärsten Organisationen gibt es Obergenossen. Der Gruppendruck kann hier schlimmer und unberechenbarer sein als in einer Organisation, die sich zu klaren Hierarchien bekennt, wie etwa die katholische Kirche. Wenn es um organisierte Kriminalität, Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe von Autoritätspersonen geht, sind moralische Urteile nicht unberechtigt, erklären aber nichts. Verbände, Parteien und organisierte Interessensgruppen sind notwendig und berechtigt. Auch informelle Gruppen innerhalb und außerhalb von Verbänden sind unvermeidbar und stellen eine soziale Tatsache im Sinne Durkheims dar. Sie neigen dazu, einen intellektuellen und emotionalen Arkanbereich zu bilden, eben den Graubereich. Er entsteht fast zwangsläufig aus der gruppeninternen Kommunikation heraus. Diese wird von Außenstehenden kaum oder gar nicht wahrgenommen. So bleibt ein Kern des arkanen Wissens inhaltlich und in Bezug auf die Intentionen der Gruppe geschützt, wenn sie an die Öffentlichkeit tritt. Der Graubereich ist eine Folge menschlicher Interaktion. Er ist nicht mit der Grauzone zwischen Legalität und Illegalität deckungsgleich, obwohl Schnittmengen bestehen. In der Grauzone spielen sich verdeckte Ermittlungen und Beeinflussungen ab, die sich am Rande der Legalität bewegen.2
Abgrenzung nach außen stärkt die Solidarität innerhalb der Gruppe. Nicht nur Insiderwissen wird geteilt, auch emotionale Bindungen gehören zu einer echten Seilschaft. Letztere werden im Falle von Verbrecherorganisationen durch abgestufte Initiationsriten und Treueide verstärkt. Besonders bei vormodern sozialisierten Menschen werden die Gruppensolidarität und Loyalität gegenüber Führern zum obersten moralischen Imperativ. Das führt zur emotionalen Entlastung bei der Durchführung von Verbrechen aller Art, im günstigsten Fall zu dem Bewusstsein, ein gutes Werk getan zu haben. Gleichzeitig ist klar, dass es für den Initiierten keinen Weg aus der Organisation gibt, wenn er sozial und physisch überleben will. Ein Beispiel: Im Zusammenhang mit der Anklageerhebung gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher aus den Reihen der kosovarischen Befreiungsbewegung (UCK) forderte das Tribunal ein Expertengutachten an. Man wollte das merkwürdige Verhalten einiger Zeugen verstehen, deren Aussagen durch eine starke Loyalität zur UCK geprägt war. Hier heißt es:
„(Der) Ehrbegriff der Albaner beherrscht alle Beziehungen über die Blutsverwandtschaft hinaus. … Die Solidarität mit Personen des gleichen ‚Bluts‘ gilt als selbstverständlich, Treue zu einer Gruppe oder Sache außerhalb der Familie muss rituell beschworen werden. ... Das Treueversprechen oder (besa) gebietet absolute Loyalität und verlangt, dass der Einzelne die Werte der Familie oder der Gruppe im Allgemeinen achtet. Gleichzeitig rechtfertigt es das Töten jener innerhalb der Gruppe, die gegen diesen Kodex verstoßen …“3
Das Gutachten darf nicht typologisch, essentialistisch, missverstanden werden. Selbstverständlich gibt es unter den Mitgliedern der albanisch sprechenden Volksgruppen Hunderte von Menschen mit einer modernen, zivilgesellschaftlichen Haltung. Ihre relative Schwäche und ihr geringer Einfluss sind aber gerade auf die Dominanz vormoderner, archaischer Vorstellungen von Ehre und Treue zurückzuführen. Diese Verhältnisse begünstigen eine systemische Kriminalität, der sich der Einzelne nur schwer entziehen kann. Bei der kalabrischen ´Ndrangheta finden wir beides nebeneinander: modernste Logistik im weltweiten Drogenhandel, professionelle Finanztransaktionen auf der einen Seite und archaisch-vormoderne Initiationsrituale auf der anderen. Sie konnten teilweise abgehört werden.
„Was suchst Du?“ „Blut und Ehre.“ Mit diesen Formeln wird das Ritual eingeleitet. In Hufeisenform sitzen die Clanmitglieder um den Ort der Handlung. Der Novize schwört, zum Schutz der ´Ndrangheta selbst seine Familie zu ermorden, wenn es sein muss. Dabei hält er eine brennende Kerze und eine Figur des Erzengels Michael, dem Schutzpatron der Organisation, in jeweils einer Hand. Dann schneidet er sich in einen Finger und lässt etwas Blut über die Heiligenfigur tropfen. Anschließend wird die Heiligenfigur verbrannt, und so wird auch der Novize verbrennen, wenn er seine neue Familie, die ´Ndrangheta, verraten wird.4
Auch in nicht kriminellen Organisationen wird Missbrauch aller Art begünstigt, ohne dass Organisation und Aufbau von Anfang an darauf ausgerichtet waren. Das sind die faktischen Gegebenheiten des kommunikativen und interaktiven Weltinnenraums, in dem wir alle leben und denken. Da führt kein Weg hinaus und muss auch kein Weg hinausführen, um es hegelianisch zu formulieren. Nur größtmögliche Öffentlichkeit, wechselseitige Kontrolle und strenge Legalität können diesen unvermeidbaren Tendenzen zur Verselbstständigung sozialer Strukturen mildernd entgegenwirken. Ohne öffentliche Kontrolle und Legalität begünstigt Gruppenloyalität Formen systemischer Kriminalität, denen sich einzelnen Personen nur schwer entziehen können. Zudem mildert die Solidarität der Gruppe mögliche Skrupel und ermöglicht das Erreichen von Machtpositionen und die Anhäufung von erheblichem Reichtum.
Wir wollen einen exemplarischen Fall ohne Häme analysieren, um die hier angesprochenen Fallstricke zu verstehen. Es ist die haarstäubende Geschichte des mexikanischen Geistlichen Marcial Maciel Degollado (1920-2008). Blanca Estela Lara Gutiérez lebte in Cuernavaca, Mexiko. Ihr Ehemann, so glaubte sie, arbeite für den US-Geheimdienst CIA. Das erklärte seine häufige Abwesenheit von zu Hause und seine eher kurzen Besuche bei seiner Familie. Das Ehepaar lebte seit 21 Jahren zusammen. 1997 sah die Frau das Bild ihres Ehemannes auf der Titelseite des Magazins „Contenido“, Aus dem Artikel erfuhr sie, dass ihr Ehemann ein katholischer Priester war, Leiter des katholischen Ordens „Regnum Christi“, etwa „Legion oder Reich Christi“ in Anlehnung an den englischen Namen der merkwürdigen Organisation. Ehemalige Seminaristen bezichtigten Marcial Maciel, so der richtige Name, des sexuellen Missbrauchs, als sie im jugendlichen Alter unter seiner Aufsicht standen. Der Orden „Regnum Christi“ war von Maciel in jungen Jahren gegründet worden. Heute umfasst er 800 Priester und 70 000 Laien, Männer und Frauen in aller Welt.5 Der Orden unterhält 15 Universitäten mit
140 000 Studenten und mehrere Schulen auch in den USA. Maciel war ein Finanzgenie. Angehörige der reichen Witwe Flora Barrangán de Garza klagten, Maciel habe von der Dame 50 Millionen Dollar erhalten. Die konservative mexikanische Elite, Carlos Slim, Marta Sahagún, die Frau des ehemaligen Präsidenten Vicente Fox, u. a. trugen große Summen Geldes zusammen. Maciel war ein enger Vertrauter von Johannes Paul II., auf dessen Wunsch hin er die polnische Gewerkschaft „Solidarität“ unterstützte. Wohlhabenden Mitmenschen vermittelte er gegen Zahlung von 50.000 Dollar Privataudienzen beim Papst. Er erreichte die Heiligsprechung seines Onkels, Bischof Guízar, jetzt der heilige Guízar. Die Heiligsprechung seiner Mutter, die er ebenfalls betrieben hatte, war 2010 noch nicht abgeschlossen. Falls man im Vatikan noch nicht von allen guten Geistern verlassen ist, wird das Verfahren wohl nicht weitergeführt.
Wegen Drogenmissbrauch und Sexaffären mit Abhängigen wurde Maciel schon 1956 die Leitung des Ordens für zwei Jahre entzogen. Danach war er wieder in Amt und Würden. Lara Guitiérez war nicht die einzige Frau in Maciels Leben. Zumindest in Acapulco glaubte eine Kellnerin, mit einem Mann liiert zu sein, der im Ölgeschäft arbeitete. Das Paar hatte eine Tochter. Die drei Söhne der Lara Gutiérez gaben an, sie seien ab dem siebenten Lebensjahr von ihrem Vater sexuell missbraucht worden.
Die Journalistin Eugenia Jiménez hat recherchiert, dass weibliche Mitglieder des Ordens als Consagradas in Abgeschiedenheit gehalten werden, ohne geweihte Nonnen zu sein. Einmal pro Jahr dürfen sie für zwei Wochen mit den Eltern zusammen sein. Andere Verwandte dürfen sie nur alle sieben Jahre sehen. Gegen kanonisches Recht müssen die Consagradas zweimal im Monat eine Art Beichte bei der Oberin ablegen, die dann den Leitern des Ordens Bericht erstattet.6 Elena Sada, eine ehemalige Sagrada mit tiefen Einblicken in das Management des Vereins, legte 2019 ihre Erlebnisse in Form einer Novelle vor: Blackbird: la tentación de creer. Am 15. November 2019 gab sie ein Interview.7 Wir beenden die Aufzählung der haarsträubenden Fakten. Worum geht es?
Das Beispiel der „Legion Christi“ und ihres Gründers wurde gewählt, weil die Sachverhalte gut recherchiert sind.8 Schwere Straftaten im reformpädagogischen Milieu in Deutschland wurden nur allmählich aufgedeckt. Der Leiter der Odenwaldschule in Ober-Hambach, Gerald Becker (1936-2010), starb, ohne für seine sexuellen Übergriffe strafrechtlich belangt worden zu sein. Über Machtkämpfe und Intrigen in dieser Einrichtung berichtete der Deutschlandfunk (DLF) am 21. 7. 2014. Becker wurde ohne Lehramtsausbildung und Examen Lehrer und Schulleiter.9 So wirken Protektion und Seilschaften.10
Die „Legion Christi“ wie auch das bizarre Leben des Marcial Maciel zeigen uns einen Schattenbereich zwischen Legalität und Kriminalität. Der Orden ist keine kriminelle Vereinigung im strafrechtlichen Sinn, hat aber mafiaähnliche Züge. Geschadet haben die Skandale der Legion Christi nicht. Die Mitgliederzahl soll um 3 % gestiegen sein. Der Orden unterhält weiterhin zahlreiche Bildungseinrichtungen und verfügt über eine Jugendorganisation mit 11.584 Mitgliedern im Januar 2019.11 Vertuschungen, verhaltene Drohungen und undurchsichtige Machtstrukturen schaffen ein clair obscur, in dem dunkle Seilschaften und einzelne Kriminelle ihr Biotop finden. Dunkle Finanzgeschäfte, Erpressung, sexueller Missbrauch, Freiheitsberaubung, das sind die typischen Straftaten in solchen Institutionen. Seilschaften durchsetzen staatliche Institutionen, Parteien und Sportverbände. Sie versuchen, die Justiz zu beeinflussen. Sie arbeiten mit Korruption, Erpressung, und wenn alles nichts hilft, auch mit brutaler Gewalt. Wir vergessen es zu leicht:
„Über das Elend des Menschenlebens kann der schön schreiben, dessen Leben nicht elend ist. Er kann stilisieren, wo andere laborieren. Das macht sein Zeugnis nicht falsch, aber einseitig.“12
Wer in einem Staat mit halbwegs funktionierender Gewaltenteilung, unabhängiger Justiz, einem großen Maß an Rechtssicherheit und Informationsfreiheit lebt, unterschätzt leicht die Gefahren. Der nur schwache Fortschritt von Aufklärung und Vernunft in den politischen und sozialen Institutionen kann jederzeit von Barbarei und Gewalt überrollt werden. Sogar dort, wo die Grenzen der Vernunft selbst nicht erkannt werden, ist säkularreligiöser Terror möglich. Trotz institutionell gesicherter persönlicher Freiheitsrechte überlebt die Vernunft nach wie vor nur in den Intermundien einer Welt der Gewalt, der maßlosen Habgier, des Wahnsinns und des Fanatismus.
2 Zur Grauzone s. das hervorragende Buch von Feldman, Gregory: The Gray Zone. Sovereignty, Human Smuggling, and Under Cover Police Investigation in Europe. Stanford University Press 2019.
3 Zit. nach Del Ponte, Carla: Im Namen der Anklage. Meine Jagd auf Kriegsverbrecher und die Suche nach Gerechtigkeit. Frankfurt/M. 2010, hier 2016, 375.
Das Original: dies.: La Cacca. Io e i Criminale di Guerra. (Feltrinelli) Mailand 2008.
4 Verdú, Daniel: Territorio ´Ndrangheta: La multinacional del crimen. in: El País Semanal (2.189) 9. September 2018, S. 32-43, hier S. 34.
5 Die Angaben stammen aus dem Jahre 2010.
6 Jimémez, Eugenia: Maciel despojó a 900 mujeres. In: Milenio 3. Mai 2010.
7 Martínez, José Luis: Elena Sade: mi vida en el reino de Marcial Marciel. In: Milenio 15. Nov. 2019 https://www.milenio.com/cultura/laberinto/elena-sada-vida-reino-marcial-maciel
8 Die Angaben stammen von Guillermoprieto, Alma: The Mission of Father Maciel. in: The New York Review of Books, Nr. 11 Juni-Juli 2010, S. 28-29. Neben ihren eigenen Recherchen gibt Guillermoprieto folgende Literatur an: Gonzáles, Fernando M.: La iglesia del silencio. Mexico D. F. o. J., Berry, Jason; Renner, Gerald: Vows of Silence: The Abuse of Power in the Papacy of John Paul II. Free Press. Jiménez (2010).
9 Wikipedia, 2.8. 2016 eingesehen.
10 Zur Reformbewegung s. auch: Schmoll, Heike: Die Herren vom Zauberberg. in: FAZ 14.3.2010.
11 Bedoya, Juan G.: El Vaticano ocultó durante 63 años los abusos del fundador de los Legionarios. In: El País 2. Januar 2019, S. 22.
12 Borst, Arno: Lebensformen im Mittelalter. Berlin, Frankfurt, Wien 1979, S. 33.
C. Die mexikanischen Verbrecherkartelle
I.
Privatarmeen, Drogenkartelle, Terror- und Guerillaorganisationen sowie Mafiaorganisationen weisen interessante strukturelle Gemeinsamkeiten auf. Da sie illegal sind, müssen sie interne Konflikte außerhalb von Justiz und Rechtsprechung regeln. Da sie komplex und arbeitsteilig aufgebaut sind, können interne Konflikte nicht vermieden werden. Gelegentlich dringt es an die Öffentlichkeit, wenn solche Konflikte mit brutalen Gewalteskalationen verbunden sind. Dies ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel. Ansonsten wären sie weniger erfolgreich. Es gibt durchaus die Möglichkeit, interne Konfliktpotenziale zu minimieren. Dazu gehören feste Hierarchien, die von den einzelnen Mitgliedern und Untergruppen nie vollständig durchschaut werden können. Persönliche Abhängigkeiten und Loyalitätsverhältnisse bis hin zur Verehrung und Heroisierung von Führungspersonen sind für einfache Mitglieder, die z. T. in archaischen, vormodernen Lebensverhältnissen sozialisiert wurden, von zentraler Bedeutung. Gleiches gilt für eine Sozialisation in deprivierten Unterschichtmilieus. In Mexiko findet man das interessante Phänomen der Romantisierung von Verbrecheridolen in populären Volksliedern, den sog. Narcocorridos, die für die Drogenbosse in Anlehnung an traditionelle Gesänge komponiert und geschrieben werden.13 Das ist in etwa analog zur „Gangsta“-Romantik in der Rapkultur.
Ein Beispiel: Am 8. August 2019 wurde Sergio Alberto del Villar Suárez (alias el Napoleón) in Hermosillo (Sonora) anlässlich eines Restaurantbesuchs erschossen. Er war der Capo der „Salazar,“ einer sehr aktiven Zelle des Kartells von Sinaloa. Obgleich er am 5. Oktober 2018 verhaftet worden war, befand er sich in Freiheit. Das ist umso merkwürdiger, als ihm vorgeworfen wurde, für die Ermordung mehrerer städtischer Sicherheitsbeamten verantwortlich zu sein. Die Salazar-Bande schickte nach der Ermordung des Capo eine Drohung an die Gouverneurin des Bundesstaates Sinaloa, Claudia Pavlovic, und deren Familie. Der Vorfall werde mit Blut bezahlt. Dabei steht die Tat entweder im Kontext eines Bandenkonflikts, oder es handelte sich um einen Akt von Selbstjustiz. Es versteht sich von selbst, dass die Beerdigung ein pompöses Ereignis und eine Demonstration von Macht und Einfluss war. Heldenballaden zur Glorifizierung von Drogenbanditen durften bei dem Ereignis nicht fehlen. Die Journalistin Maria Alejandra Navarrete Forero berichtete am 20. August 2019 im Portal „Insight Crime“:
„His funeral became a controversial affair as it was celebrated with „narcocorridos“, ballads glorifying the actions of drug traffickers. A police motorcycle escort (sic T. B.) also accompanied his funeral procession along with luxury vehicles, as can be observed in a video published by Milenio.“14
Manche Narcocorridos vermitteln auch sehr realitätsnahe Zusammenhänge. Ein Beispiel: Die norteño Band „Los Brancos de Reynosa“ verbreitete schon kurz nach der Ermordung des DEA-Agenten (Drug Enforcement Administration) Enrique Camarena (1985) die Behauptung, die CIA stehe hinter dem Verbrechen. Das stellte sich 2013 als Tatsache heraus. Ende der 1980er Jahre musste das jeder vernünftige Mensch für eine Schnapsidee halten, oder „another legend made up over shots of tequila“, wie es in der englischsprachigen Version der spanischen Zeitung El País heißt.15 Ganz ungefährlich leben auch die Sänger und Sängerinnen der Narcocorridas nicht. Ergreifen sie mit einem Song faktisch oder vermeintlich für einen Capo oder eine Bande Partei, können sie auch schon einmal von einem gegnerischen Kartell ermordet werden.16
Verklärende Chansons gab es schon zu Ehren des Schmugglerkönigs Louis Mandrin im absolutistischen Frankreich. Auch die neapolitanische Camorra wird in populären Liedern verherrlicht. Der ehemalige Mafiafahnder Franco Roberti betont, es sei strafbar, Verbrechen der Mafia zu rechtfertigen. Die Gesetze seien streng. Im Fall von Liedern sei der Nachweis einer Straftat allerdings schwierig, weil durch das Gesetz nur die klare Rechtfertigung eines Verbrechens bestraft werden kann. Das Problem sei, dass die populäre Musik auch Nicht-Mafiosi anspreche und so eine Art Subkultur fördere.17 Von Telenovelas bei Netflix zu diesem Thema will ich hier nichts sagen, weil ich sie mir nicht ansehe.
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden in Mafiaorganisationen viele interne Konflikte durch Mord, vorgängige Folter und Verstümmelung gelöst, ohne dass etwas an die Öffentlichkeit dringt. Leichen mit eindeutiger Zurichtung, auf deren Formen ich aus Geschmacksgründen hier nicht näher eingehen will, werden auch bewusst öffentlich gemacht, um eine klare Botschaft zu übermitteln. Ein Teil der zahlreichen Leichen z. B. in Mexiko dürfte eher auf interne und nicht auf externe Konflikte zurückzuführen sein. Eine empirische Erfassung ist aus verständlichen Gründen nicht möglich. Die Mehrzahl der Leichenfunde zeigt eindeutige Hinweise auf gewaltsame Auseinandersetzungen unter konkurrierenden Gruppen. Das ist aber nicht immer der Fall. Zudem verschwinden auch Personen, ohne dass es auffällt oder dem organisierten Verbrechen zugeordnet wird. Terrorgruppen und Verbrecherorganisationen zeigen zwei zunächst widersprüchliche Tendenzen: 1. Sie streben territoriale Kontrolle, Unterwanderung der legalen Wirtschaft und der Politik an. 2. Sie operieren durch Terror, Drogen- und Menschenhandel international, im Falle des IS global. Das ist grundsätzlich auch ohne territoriale Kontrolle möglich. Jones spricht im Zusammenhang mit den mexikanischen Kartellen von territorialen und transaktionalen Strategien, wohl wissend, dass es sich um eine idealtypische Unterscheidung handelt.18





























