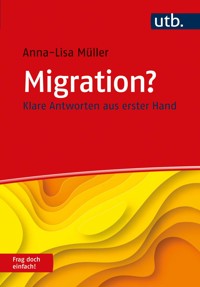
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist Migration in aller Munde. Doch Migration ist nicht neu. Was heißt es, eine Migrant*in zu sein? Wer kann leicht, wer schwer Grenzen überschreiten? Welche Rolle spielen Krieg und Klimawandel? Diesen und weiteren Fragen geht Anna-Lisa Müller nach. Sie zeigt, wo sich Migration heute von Migration damals unterscheidet, welche Formen es gibt und welche Akteure wichtig sind. Frag doch einfach! Die utb-Reihe geht zahlreichen spannenden Themen im Frage-Antwort-Stil auf den Grund. Ein Must-have für alle, die mehr wissen und verstehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anna-Lisa Müller
Migration? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Hand
UVK Verlag · München
Dr. habil. Anna-Lisa Müller ist Geographin und Soziologin. Sie forscht derzeit am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld. Schwerpunkte ihrer Forschung sind Migrationsforschung, Stadtforschung, Qualitative Methoden der Sozialforschung sowie Raum- und Kulturtheorien. Zudem untersucht sie die Lebensrealitäten internationaler Migrant:innen sowie Merkmale postmigrantischer Gesellschaften.
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue – iStock
Abbildungen im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur
Autorinnenfoto: © Gesine Born
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838556949
© UVK Verlag 2024— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5694
ISBN 978-3-8252-5694-4 (Print)
ISBN 978-3-8463-5694-4 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Spätestens seit dem sogenannten „Sommer der Migration“ im Jahr 2015 ist Migration in Deutschland in aller Munde. Dieser Begriff wurde in den MedienMedien verwendet, um die Situation im Sommer 2015 zu beschreiben: die Situation, als eine große Zahl an Asylsuchenden, viele davon auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien, in die EU und nach Deutschland migrierte. Doch Migration ist nicht neu, sie ist bekannt und für viele Menschen alltäglicher Bestandteil ihres Lebens. Aber ist sie das wirklich? Denn weltweit migriert nur ein Bruchteil der Menschen: Im Jahr 2020 waren es gerade einmal 3,6 % (McAuliffe und Triandafyllidou 2021, 10). Dennoch ist Migration ein Thema, über das in Deutschland und weltweit viel gesprochen und geschrieben wird, das politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ebenso beschäftigt wie Wirtschaftsunternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Es ist Thema in Tages- und Wochenzeitungen, in sozialen Medien, wir sprechen darüber im Alltag, im Fernsehen und im Radio. Sehr unterschiedliche Akteure beschäftigen sich also mit dem Thema, sowohl beruflich als auch privat. Darum dieses Buch. Es soll Informationen geben, was Migration ist und wie jede Einzelne und jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganze und die weltweiten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen damit zu tun haben. Das Buch soll Fragen beantworten. Fragen wie diese: Was heißt es, eine Migrantin oder ein Migrant zu sein? Wie unterscheidet sich die Migration innerhalb eines Landes von der Migration zwischen Ländern? Wo bin ich zuhause, wenn ich das Land meiner Geburt verlassen habe, aber noch Kontakte dorthin habe? Welche Rolle spielen Politik und Wirtschaft in der Steuerung und Ermöglichung von Migration? Wer kann leicht, wer schwer Grenzen überschreiten? Und welche Rolle spielen Krieg und Klimawandel für Migration? Diesen und weiteren Fragen gehe ich in diesem Buch nach. Ich zeige, auf welche Weise sich heutige Formen der Migration von Migration in anderen Zeiten unterscheidet und wo sie sich ähneln, welche Formen es überhaupt gibt und welche Akteure wichtig sind. Zentrales Anliegen ist, Migration als etwas Alltägliches vorzustellen, das uns alle betrifft, selbst wenn statistisch nur wenige von uns migrieren.
Dazu nehme ich in diesem Buch auch explizit bestimmte Bilder und Stereotype auf, die mit Migration verbunden sind, und setze sie in einen Kontext (vgl. dazu auch Haas 2023). Es geht darum, manches gegen den Strich zu bürsten und das, was uns im öffentlichen Diskurs als Behauptung begegnet, ernst zu nehmen und auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu befragen. Das gilt etwa für die Frage, ob Migration zur Ghettobildung beiträgt oder mehr Migration zu mehr Kriminalität führt.
Ein Buch über Migration zu schreiben ist eine Herausforderung, da es so viel zu sagen gibt. Und es ist ein so vielschichtiges Thema, das einfache Antworten schwierig macht.
Das beginnt bei den Formulierungen und Begriffen. So spreche ich davon, dass Menschen migrieren und sich aus ihren Herkunftsländern in andere Länder bewegen. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Herkunftsländer auch immer die Länder sind, in denen die Menschen geboren und aufgewachsen sind. Denn es gibt auch Menschen, die aus dem Land, in dem sie geboren sind, erst in ein Land migrieren und nach einigen Jahren oder Jahrzehnten in ein weiteres. So können sich im Laufe eines Lebens mehrere Länder als zeitweilige Lebensmittelpunkte ergeben, die dann jeweils Herkunftsländer der nächsten Station sind.
Auf den Begriff des Heimatlandes verzichte ich in diesem Buch außerdem komplett. Dieses Buch betrachtet Migration und damit die Bewegung von Menschen durch Räume und über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Es geht um Gründe und Motive für Migration, um die Bedeutung von Orten, Netzwerken und Medien und die Wirkung von Migration auf das Leben in einer Gesellschaft und im Alltag. Dabei geht es auch um Fragen der Zugehörigkeit und der Bindung. Diese aber sind, so die Grundannahme des Buches, nicht ursächlich an Nationalstaaten geknüpft, was der Begriff „Heimatland“ nahelegen würde, und sie sind auch nicht mit dem Begriff „Heimat“ fassbar.
Außerdem heißt ein Buch über Migration zu schreiben, über vieles nicht zu schreiben. Zum Beispiel über Integration. In einigen Fragen wird das Thema Integration angesprochen werden, da es in bestimmten Bereichen mit Migration und damit, wie wir Migration verstehen, verbunden ist. Dieses Buch ist aber kein Buch, dass Formen der Integration vorstellt, ihre Bedeutung für eine Gesellschaft diskutiert oder Gelingensbedingungen präsentiert. Mit dem Thema Integration beschäftigen sich andere, auf die ich dort, wo es sinnvoll ist, verweise.
Dass es eine Herausforderung ist, ein Buch über Migration zu schreiben, liegt schließlich auch daran, dass ich mich als Autorin im Spannungsfeld zwischen der Darstellung und Unterscheidung von Phänomenen auf der einen Seite und der Reproduktion bestimmter, damit verbundener Stereotype und der Fixierung von Unterschieden auf der anderen Seite bewege. Wenn ich zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten spreche, die in eine ihnen neue Gesellschaft einwandern, stelle ich sowohl die Migrant:innen als einheitliche Gruppe dar als auch die Gesellschaft, in die eingewandert wird. Dass aber weder die Migrant:innen noch die Gesellschaften so einheitlich sind, erleben wir alle im Alltag. Letztlich sind es Lebensweisen und Wertvorstellungen, manchmal soziodemographische Merkmale (Geschlechtsidentität, Bildungshintergrund, Alter etc.), die einander als gemeinsame Gruppe erleben lassen. Dennoch ist es für den Zweck dieses Buches unerlässlich, derartige Unterscheidungen zu verwenden und mit ihnen zu arbeiten. Denn ich richte den Blick in jeder der Fragen auf das, für das Migration einen Unterschied macht. Und hier sind Menschen und Situationen, die von Migration geprägt sind, letztlich dann doch anders als Menschen und Situationen, die dies nicht sind.
Ich bitte daher die Leser:innen dieses Buches, dies zu bedenken, insbesondere dann, wenn ich immer mal wieder recht künstliche Unterscheidungen treffe. Hilfreich kann es daher sein, als Erstes meine Antwort auf die Frage zu lesen, ob wir in einer Migrationsgesellschaft leben. Denn in der Antwort wird deutlich, auf welche Weise Migration unser Leben betrifft, auch wenn nur 3,6 % der Weltbevölkerung selbst migrieren.
Anna-Lisa Müller
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni verrät spannende Literaturtipps, Videos und Blogs im World Wide Web.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an, deren Antwort unbedingt lesenswert ist.
Die Lupe weist auf eine Expert:innenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
→
Wichtige Begriffe sind mit einem Pfeil gekennzeichnet und werden im Glossar erklärt.
↠
Der Pfeil mit der doppelten Spitze verweist auf weiterführende Fragen zu diesem Thema.
Aktuelles Beispiel – KriegKrieg, Corona und die Auswirkungen auf Migration
Für Menschen, die im Jahr 2024 in Deutschland leben, trifft das Thema dieses Buches auf unerwartete Weise mitten in das Herz zweier aktueller Krisenerfahrungen. Zum einen ist da der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, der mit dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 einsetzte. An diesem Tag wurde ein militärischer Angriff auf ein fremdes → Territorium begonnen. Grenzen wurden von Soldat:innen und Ausrüstung überschritten, Grenzen wurden mit Soldat:innen und Ausrüstung verteidigt. Und Menschen begannen zu fliehen: zunächst innerhalb der Ukraine Richtung Westen, dann zunehmend über Staatsgrenzen hinweg in andere Staaten, in denen sie sich sicher fühlten. Auch aus Russland flohen Menschen in andere Staaten, und alle diese Menschen wurden zu Migrant:innen. Sie hielten mit Menschen in ihrem Herkunftsland mithilfe von sozialen MedienMedien Kontakt, sie erhielten im Aufenthaltsland befristete Aufenthaltsgenehmigungen, arbeiteten zum Teil aus der Ferne weiter in ihren Jobs. In den Aufnahmeländern organisierten sich Menschen zu Unterstützungsgruppen, halfen als Übersetzer:innen, stellten ihre Wohnungen als Unterkünfte zur Verfügung. Es kam aber auch zu Anfeindungen, Diskriminierungen und Konflikten zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Migrant:innen. Damit verweist diese Fluchtmigration, wie wir sie ab Februar 2022 beobachteten und zum Teil selbst erlebten, auf viele Bereiche des Themenfeldes Migration, das Gegenstand dieses Buches ist. Denn Migration ist mit vielen anderen Themen verbunden: mit nationalstaatlichen Grenzen und ihren Sicherungssystemen, mit Fragen von Aufenthaltsrecht und Geopolitik, mit dem Arbeitsmarkt und Bildungseinrichtungen, aber auch mit der Bedeutung von Sprache und Medien für Migration und Migrationsentscheidungen.
Die Corona-PandemieCorona-Pandemie wiederum, die das Alltagsleben aller Menschen seit 2020 verändert hat, führte uns vor Augen, wie angreifbar ein vermeintlich grenzenloses Leben in der heutigen Zeit ist. Sie hat nicht nur das Miteinander vor Ort geprägt, sondern sie hat uns allen verdeutlicht, dass wir in einer weltweit vernetzten Welt leben, in der grenzüberschreitende Beziehungen Normalität sind. Lockdowns in Agrar- und Industriebetrieben in Asien führten dazu, dass es in Europa zu Lieferengpässen von Lebensmitteln und Produktionsstopps von Gütern kam. Maßnahmen zur Reduktion von Infektionen erzeugten neue Interaktionsformen, die physische Präsenz am selben Ort nicht nötig machten und uns lehrten, einigermaßen souverän mit digitalen Technologien umzugehen. Einreise- und daran gekoppelte Quarantänebestimmungen führten zu einem veränderten Reiseverhalten. Saisonarbeitskräfte konnten nicht mehr nach Deutschland einreisen, migrantische Arbeitskräfte auf Frachtschiffen konnten nicht mehr in ihre Wohnorte zurückkehren, da die Schiffe nicht anlegen durften. Der Umgang mit dem Sars-CoV-2-Virus machte weltweit sehr deutlich, welche Bedeutung territoriale, d. h.: nationalstaatliche, Grenzen im sozialen, politischen, ökonomischen Leben heute aufweisen. Migration war hier ein Thema, das auf andere Weise als sonst in den Blick geriet: Grenzschließungen etwa innerhalb der Europäischen Union sowie intensivierte Grenzkontrollen weltweit und zum Teil vollständige Schließungen von Regionen und Orten für MobilitätMobilität in allen Bereichen (Freizeit, Arbeit, Handel) zeigten uns, wie sehr Gesellschaften von räumlicher Mobilität geprägt sind.
Räumliche MobilitätMobilität ist der Oberbegriff für das Phänomen, zu dem Migration gehört und das verschiedene Formen der Bewegung von Menschen im geographischen Raum umfasst. Und Migration und migrierende Personen waren von der Pandemie und den zu ihrer Eindämmung eingesetzten Maßnahmen in besonderer Weise betroffen: Nicht nur waren Urlaubs- oder Dienstreisen in ein anderes Land nicht oder nur mit Umständen und zusätzlichen Genehmigungen möglich. Menschen, die in einem anderen Staat eine Arbeitsstelle aufnehmen wollten, mussten in ungekannter Weise den Grenzübertritt organisieren, wenn er überhaupt möglich war. Besuche bei Verwandten im Ausland, selbst zu besonderen Ereignissen wie Todesfällen und Hochzeiten, waren schwierig. Und Menschen, die die Lebensverhältnisse in ihrem Heimat- oder aktuellen Aufenthaltsland nicht mehr ertrugen und migrieren oder fliehen wollten, waren an ihre aktuellen Lebensorte gebunden oder mussten (meist illegale) Wege finden, diese zu verlassen. Und Menschen auf der Flucht fanden sich an Orten wieder, die als Durchgangsstationen gedacht waren und sich während der Pandemie als ungeplant dauerhafte Aufenthaltsorte herausstellten.
Der Krieg in der Ukraine und die Pandemie zeigen, so unterschiedlich sie als Beispiele sind, wie sehr Migration im Besonderen und räumliche Mobilität im Allgemeinen unsere heutige Zeit prägen und Teil unserer alltäglichen, als normal empfundenen Lebensrealität sind. Sie zeigen außerdem, wie stark ihr prägendes Merkmal, der Grenzübertritt, sie be- oder verhindern kann. Und beide Beispiele machen deutlich, mit wie vielen anderen Phänomenen Migration verbunden ist: mit dem Arbeitsleben, dem weltweiten Handel und der Ökonomie, mit politischen Beziehungen, mit gesellschaftlichen Lebensverhältnissen und individuellen Lebenswünschen, mit Grenzen, Infrastrukturen und letztlich auch der Natur, die, wie im Fall des Sars-CoV-2-Virus, das menschliche Leben beeinflusst.
Linktipp | Die Migrationsforscherin Melissa Siegel stellt in ihrem Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/c/MelissaSiegelMigration/featured) verschiedene Aspekte von Migration vor und diskutiert sie in Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Themen wie Politik, Wirtschaft, Sport oder Bildung. Unter anderem behandelt sie dort auch die Wirkungen der Covid-19-Pandemie auf Migration.
Migration: das Phänomen
Migrationsbewegungen gibt es in viele Richtungen, innerhalb eines Landes und über Grenzen hinweg. Was der Begriff Migration genau umfasst, erklärt dieses Kapitel. Dabei werden auch verschiedene Merkmale von Migration besprochen sowie die Bezeichnung „Migrationshintergrund“ erklärt.
Was ist Migration?
Als Migration bezeichnet man eine besondere Form der Bewegung durch den Raum. Menschen bewegen sich zwischen Orten und überwinden Distanzen. In der Wissenschaft wird Migration als eine besondere Form von räumlicher MobilitätMobilität bezeichnet: diejenige, bei der ein Mensch den Wohnsitz dauerhaft in ein anderes Land verlagert. Im Alltagssprachgebrauch wird Migration allerdings als Sammelbegriff für sehr viele Formen der räumlichen Mobilität verwendet.
Versteht man Migration als räumliche Mobilität, d. h. als räumliche Bewegung zwischen Orten, so ist die internationale oder Außenmigration von der internen oder Binnenmigration zu unterscheiden. Das Kriterium für die Unterscheidung ist das Überschreiten nationalstaatlicher → Grenzen. Im Fall der internationalen Migration werden Grenzen zwischen Nationalstaaten überquert. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen: mit Verkehrsmitteln wie Eisenbahnen, Flugzeugen, Schiffen oder Autos, zu Fuß, auf legalem Weg oder illegal. Bei der Binnenmigration wird der Wohnsitz innerhalb ein und desselben Bezugsrahmens, in der Regel eines Nationalstaates, verlegt. Damit bleibt der politisch-administrative Kontext, in dem sich eine Person bewegt, gleich. Dies ist etwa für aufenthaltsrechtliche Fragen von Belang: Als Binnenmigrantin mit deutscher Staatsbürgerschaft muss ich mich innerhalb Deutschlands nicht um eine Aufenthaltserlaubnis, ein Visum oder ähnliches kümmern. Anders ist es, wenn ich z. B. in die USA und damit international migriere. Um dort leben zu können, muss ich mich an das dort geltende → Aufenthaltsrecht halten und z. B. über meinen Arbeitgeber ein Arbeitsvisum vorweisen können.
Zudem hat sich international eine zeitliche Unterscheidung etabliert, um Migration von anderen Phänomenen der räumlichen Mobilität zu unterscheiden, zählbar und vergleichbar zu machen: Als Migrantin oder Migrant werden Menschen klassifiziert, die ihren Wohnsitz für ein Jahr oder mehr an einen anderen Ort verlagern.
Wie lässt sich Migration klassifizierenEx-post-Klassifizierung?
Klassifizierungen von Migration können immer erst im Nachhinein (ex post) vorgenommen werden. Das liegt daran, dass es neben den räumlichen auch zeitliche Kriterien gibt, anhand derer entschieden wird, ob Menschen lediglich international mobil sind oder tatsächlich migrieren und auf Dauer ihren Wohnsitz verlagern. Eine räumliche Bewegung, die weniger als drei Monate dauert, wird als räumliche MobilitätMobilität, aber nicht als Migration bezeichnet. Zwischen drei und zwölf Monaten spricht man von temporärer internationaler Migration, ab zwölf Monaten von internationaler Migration. Diese Unterscheidung kann allerdings erst im Nachhinein als Kriterium angelegt werden, da zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person aufbricht, um in ein anderes Land zu gehen, noch nicht klar ist, ob die Person tatsächlich länger als zwölf Monate an einem anderen Ort leben wird, und wenn ja, an welchem. Sie kann sich nach einigen Monaten entscheiden, wieder in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Oder sie entscheidet sich, nach einigen Wochen im Zielland noch einmal umzuziehen und in ein weiteres Land zu migrieren. Derartige zeitliche Muster lassen sich daher erst nachträglich verlässlich identifizieren und zur Beschreibung von Migrationsbewegungen nutzen. Dies hat dann auch Konsequenzen für die statistischen Daten über die Anzahl der Migranten und Migrantinnen an einem Ort oder in einem Land. Diese Daten sind also mit diesem Wissen zu lesen.
Linktipp | Zwei wichtige Organisationen, die sich mit Migration beschäftigen und Material und Berichte zu diesem Thema zur Verfügung stellen, sind die Vereinten Nationen (UN) und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO). Beide Einrichtungen dienen international auch als wichtige Referenz, wenn es darum geht, zu bestimmen, wie Migration definiert wird. Bei der UN findet sich ein sehr breites Verständnis von Migration, das darunter alle Phänomene von Binnen- zu internationaler Migration und kurzzeitiger zu dauerhafter Migration fasst (https://www.iom.int/about-migration). Die ILO dagegen verwendet eine engere Definition und versteht unter Migration ausschließlich die internationale Migration über Staatsgrenzen hinweg (https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-international-labour-migration-statistics/). Beiden Definitionen ist aber zueigen, dass die Gründe der Migration keine Rolle spielen; es geht lediglich um die räumliche Mobilität der Menschen.
Welche Typen von Migration gibt es?
Menschen migrieren aus unterschiedlichen Gründen, und so liegen unterschiedliche Typen von MigrationMigrationfreiwillige vor. Es lassen sich die freiwillige von der unfreiwilligen MigrationMigrationunfreiwillige unterscheiden. In ersterem Fall entscheiden sich Menschen aus freien Stück, für eine bestimmte Zeit oder für immer in ein anderes Land zu ziehen. Dies ist der Fall, wenn von Berufs wegen migriert wird oder um mit Familienangehörigen am selben Ort zu leben. In zweiterem Fall, der unfreiwilligen Migration, liegen äußere Umstände vor, die eine Person zur Migration nötigen, etwa politische Unruhen, Verfolgung oder (Bürger-)Krieg.
Dann gibt es die Unterscheidung nach räumlichen und zeitlichen Mustern. Hier lassen sich die → transnationale von der internationalen und der PendelmigrationPendelmigration unterscheiden. In diesem Fall unterscheiden sich die Typen der Migration danach, ob die Menschen einmalig in ein anderes Land umziehen (internationale Migration), sich wiederholt zwischen Orten in unterschiedlichen Ländern bewegen (Pendelmigration) oder ob sie dezidiert Beziehungen zu Menschen in ihrem Herkunfts- und ihrem aktuellen Aufenthaltsland aufrechterhalten (transnationale MigrationMigrationtransnationale).
Darüberhinaus lassen sich aus der Perspektive eines Nationalstaates drei Typen von Migration unterscheiden: die → Emigration, die → Immigration und die → Remigration. Im Fall der EmigrationEmigration (Auswanderung) wird aus Sicht des Staates, aus dem ausgewandert wird, gesprochen. Im Fall der ImmigrationImmigration (Einwanderung) wird die Perspektive des Staates eingenommen, in die eingewandert wird. Und im Fall der → RemigrationRemigration (Rückkehr) richtet sich der Blick auf die Beziehung zwischen zwei Staaten und auf die Tatsache, dass ein Mensch in das Herkunftsland zurück migriert.
Wenn man von Typen von Migration spricht, kann man demnach danach unterscheiden, aus welchen Gründen oder mit welchen räumlichen und zeitlichen Mustern oder aus welcher Perspektive aus gesehen jemand migriert.




























