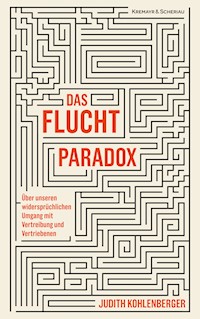17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Picus Konturen
- Sprache: Deutsch
Krieg, Vertreibung, Klimakrise, Pandemie, Künstliche Intelligenz und internationale Aufrüstung – die großen geopolitischen Verwerfungen unserer Zeit machen Angst, verunsichern und lassen uns vereinsamen. In dieser zunehmend unübersichtlichen, unkontrollierbaren Welt steigt der Wunsch nach einer »starken Hand« und hartem Durchgreifen, an den Grenzen und im Inneren. Judith Kohlenbergers Analyse zeichnet die beginnende und in Teilen bereits vollzogene autoritäre Wende, die mittlerweile auch das gutbürgerliche Milieu ergriffen hat, anhand der grassierenden Migrationspanik nach. Und zeigt, dass es aus dieser Welt der Angst nur einen einzigen, glasklaren Ausweg gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Picus Konturen
Herausgegeben von Georg Hauptfeld
Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.
Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
ISBN 978-3-7117-3504-1
eISBN 978-3-7117-5541-4
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
JUDITH KOHLENBERGER
MIGRATIONSPANIK
WIE ABSCHOTTUNGSPOLITIK
DIE AUTORITÄRE WENDE BEFÖRDERT
PICUS VERLAG WIEN
INHALT
VORWORT
1. EINLEITUNG ODER: WAS ZULETZT GESCHAH
2. INTEGRATION GESCHEITERT?
3. EINE KOLLABIERTE DEBATTE
4. ANWERBEN ODER ABSCHRECKEN
5. MIGRATION ALS PRISMA
6. GRENZSPEKTAKEL
7. WENDEPUNKTE
8. WAS TUN? SIEBEN VORSCHLÄGE UND EINE UTOPIE
9. POLITIK DER EMPATHIE
ANMERKUNGEN
DANKSAGUNG
DIE AUTORIN
VORWORT
Hochsommer 2024. Ich sitze mit meinem Freund Simon in einer Cocktailbar in der Wiener Innenstadt. Wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt, aber rasch gemerkt, dass das nicht klappen wird mit uns. Jetzt sind wir befreundet. Oder versuchen es zumindest zu sein. Das ist nicht ganz so einfach, denn ich bin Migrationsforscherin, setze mich für Menschenrechte von Schutzsuchenden und legale Fluchtwege ein, bin im Vorstand von SOS Mitmensch und Mitglied des Integrationsrats der Stadt Wien. Und Simon ist FPÖ-Wähler.
Das äußert sich in unserer Freundschaft oft tagelang gar nicht, und dann wieder fast durchfallartig, wie jetzt gerade beim zweiten Negroni. Dann wettert er bevorzugt gegen Flüchtlinge und Ausländer, gegen messerstechende Jugendbanden, gegen Frauen, die sich zu viel herausnehmen, gegen die schleichende Islamisierung, gegen Systemmedien und Meinungshegemonie. Nicht selten wird er, sonst ein Verfechter der gepflegten Konversation, urplötzlich vulgär, benutzt Gewaltsprache, wirkt regelrecht paranoid – ganz so, wie es dem Typus des »rechtsextremen Agitators« in Caroline Amlingers und Oliver Nachtweys Buch Gekränkte Freiheit entspricht.1 Manchmal passiert das mitten in einem belanglosen Gespräch, wie ein verbaler Tick, ein fast zwanghaftes Verhalten. Dass er FPÖ wählt, das wurde mir rasch klar, geschieht nicht aus Mangel an Alternativen oder aus reinem Protest; oder gar weil ihm diese Gefühle »von einer Politik, die Gewinne privatisiert und Leid vergesellschaftet, aufoktroyiert wurden«.2 Es geschieht aus Überzeugung.
Und es hat weder mit sozialer Deprivation noch mit fehlenden Aufstiegschancen oder steigenden Abstiegsängsten zu tun. Es hat auch wenig mit falscher, zu wenig »linksgerichteter« Oppositionspolitik, der Untergrabung des Sozialstaates oder der Aushöhlung von Arbeitnehmer:innenrechten zu tun. Und es ist ganz sicher nicht »the economy, stupid«, um den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton zu zitieren. Rechtspopulistische Ideologie ist und war nie das Privileg der unteren 25 Prozent, der Globalisierungsverlierer und Zwangsenteigneten. Besonders in den letzten Jahren hat sie erfolgreich in die Mitte der Gesellschaft Einzug gehalten, ist in der oberen Mittelschicht und den vermögenden Klassen angekommen.
Dafür steht Simon paradigmatisch, denn er ist das Gegenteil von abgehängt. Er ist erfolgreicher Manager bei einem internationalen Unternehmen, wohnt in einer europäischen Hauptstadt, jettet regelmäßig in zahlreiche andere. Er hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ein intaktes Elternhaus auf dem Land, einen großen, diversen Freundeskreis, viele Jahre an Auslandserfahrung in Asien und im Nahen Osten. Er ist groß, blond, muskulös, kommt gut bei Frauen an und nimmt sich zahlreiche Freiheiten, die damit einhergehen. Er liest Dostojewski, spielt Tennis, trinkt Matcha Latte mit Hafermilch, sitzt in hippen Brunchlokalen und tanzt in Schwulenbars. Er ist weder ein deplorable noch ein Incel,3 und schon gar nicht ist er ökonomisch prekär. Er ist ein Anywhere, ein Kosmopolit, ganz sicher kein Hinterwäldler. Ein Globalisierungsgewinner auf der Butterseite des Lebens.
Wenn da nicht einige Episoden in seiner Vergangenheit gewesen wären, die in ihm das Gefühl, on top of the world zu sein, alles im Griff zu haben, erschüttert hätten. Zuerst der Wunsch, Gedenkdienst4 zu leisten, was ihm ob seiner nicht lupenreinen links-kommunistischen Gesinnung verwehrt wurde – zumindest seinem Eindruck nach. Dann eine Gesundheitskrise in jungen Jahren. Kaum war diese überwunden, eine falsche Anschuldigung, die in einem Gerichtsprozess und hohen Anwaltskosten (und einem Freispruch) endete. Selbst im engsten Freundes- und Familienkreis wandten sich Menschen von ihm ab, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das hat ihn zur Überzeugung gebracht: Wenn es darauf ankommt, bist du immer allein. Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. Niemand hilft dir, wenn du dir nicht selbst hilfst.
All das hat Spuren hinterlassen. Hinter seinem selbstironischen Humor steckt eine gehörige Portion Zynismus und Einsamkeit. Das Gefühl, nicht dazuzugehören. Irgendwie falsch zu sein. Das ist fruchtbarer Boden für die verführerischen Parolen der Rechtspopulisten. Ihr bestes Verkaufsargument sind nämlich weder eine radikale Grenzpolitik noch rigide Abschiebepläne. Sondern es ist das Gefühl, das sie ihren Wähler:innen geben: Du bist genau richtig so, wie du bist. Andere mögen dich rassistisch, misogyn, menschenverachtend, abnormal finden. Wir dagegen schätzen dich so, wie du bist. Ja mehr noch: Du bist normal, die anderen sind die Aberration. Mit ihren Dragqueen-Lesungen, Gendersternchen, Menschenrechten, Cancel Culture und Klimapanik sind sie falsch abgebogen. Du dagegen bist richtig. Goldrichtig.
Schon Hannah Arendt wusste, dass das Gefühl der Einsamkeit, das sie als politischen, nicht rein privaten Zustand verstand, zu den radikalsten Erfahrungen des Menschen zählt und ihn anfällig werden lässt für die Blender, Hetzer, Extremisten und Despoten dieser Welt. Die versprechen ihren Anhänger:innen Gemeinschaft und Zugehörigkeit, getreu dem Motto: Wir schätzen dich für all die Eigenschaften, die andere an dir ablehnen. Und sie vermitteln ein verführerisches Gefühl der Selbstwirksamkeit: Wir halten die Ausländer raus, aus dem einfachen Grund, weil wir es wollen – und können. Das umfassende Gefühl des Kontrollverlusts kontern sie mit Handlungsmacht und Korpsgeist. Das sei, laut Arendt, eines der »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« (im englischen Original The Origins of Totalitarianism); ein Einfallstor für Autoritarismus und Totalitarismus.
Trotz alledem treffe ich Simon immer wieder, in wechselnden Wiener Innenstadtlokalen. Ich will ihn weder bekehren noch umstimmen, ihn nicht belehren oder beschämen. Dass solche Versuche fruchten könnten – so naiv bin ich nach Jahren des Austauschs mit FPÖ-Wähler:innen im engsten Familienkreis nicht. Aber ich will unsere Begegnungen zum Anlass nehmen, um ihm ein Gegenmodell der bedingungslosen Zugewandtheit ohne Hintergedanken anzubieten, das ihn womöglich seine eigenen Vorurteile über »linkslinke Gutmenschen« überdenken lässt. Noch viel mehr aber richtet dieses soziale Experiment (auch wenn er mit dieser Bezeichnung unserer mittlerweile echten Freundschaft höchst unglücklich wäre) den Scheinwerfer auf mich und meine eigene Rolle in der radikalen gesellschaftlichen Transformation, die viele liberale Demokratien gerade durchlaufen. Denn Simon verdeutlicht exemplarisch, wie weit sich die autoritäre Wende bereits vollzogen hat, wie sehr die Verführungen der Rechtspopulisten weit in die Mitte der Gesellschaft hineinragen. Und wie untauglich die dominanten Erklärungs- und Entzauberungsversuche der linksliberalen Intelligenzija sind, wie einfach sie es sich durch ihre moralische Überhöhung machen.5 Wie untauglich umgekehrt die Anstrengungen der Mitte-Parteien sind, die Rechtspopulisten durch noch härtere Migrationsrhetorik und -politik rechts zu überholen, ihren vermeintlichen »Protest« einzuhegen, den sie durch ihren Urnengang zum Ausdruck brächten. Denn wenn etwas durch die rechte Welle, die in den vergangenen Jahren durch Europa und die Welt fegte, klar geworden sein sollte, dann die Tatsache, dass Menschen rechtspopulistische Parteien nicht aus reinem »Dagegensein«, sondern aus Überzeugung wählen, weil sie die Inhalte und Positionen eines Kickl, einer Weidel, einer Meloni und eines Trump sinnvoll und gut finden. In diesem Punkt ist Simon zumindest ehrlich.
Ehrlich ist er aber auch darin, dass er, seit er mich kennt, einige Annahmen über alleinstehende, kinderlose, akademisch gebildete weiße Mittelschichtfrauen, die noch dazu an einer öffentlichen Hochschule beschäftigt und damit Teil der »Elite« sind, revidieren musste. Zähneknirschend zwar und nur, indem er mich als absolute Ausnahme, quasi als Pick me Girl der Rechten, charakterisiert – das ich aber nicht bin. Dennoch, in unserer gegenseitigen Zugewandtheit liegt eine verborgene Kraft, davon bin ich nach einem Jahr dieser herausfordernden Freundschaft überzeugt. In der gegenseitigen Wertschätzung, die sich eben nicht in Parteifarben oder Ideologien erschöpft, sondern alle (noch so widersprüchlichen) Facetten des konkreten anderen miteinbezieht, steht die gegenseitige Überzeugung, dass noch mehr Ausgrenzung und Spaltung unser ohnehin schon gespaltenes Land nicht weiterbringen werden.
Es mag den einen oder die andere Leser:in befremden, wie man mit einem selbst proklamierten Rechtspopulisten, der regelmäßig rassistische und sexistische Sprüche vom Stapel lässt, befreundet sein, ja freiwillig Zeit verbringen kann. So einfach die Abgrenzung von rechtspopulistischem Gedankengut und jenen Menschen, die ihm anheimgefallen sind, in der Theorie ist, so komplex ist sie in der Praxis. Zum einen, weil mittlerweile fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung die FPÖ wählt, ebenso wie ein Drittel der Franzosen Le Pen, ein Fünftel der Deutschen AfD und die Hälfte der Amerikaner Trump. Sich von einem Drittel der Mitmenschen, die unsere Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter, Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen sind, abzugrenzen, ist nicht nur unmöglich, sondern in Zeiten zunehmender Polarisierung und Blasenbildung als Ziel zu hinterfragen. Was, so die ernsthafte Frage, die wir, die wir uns auf der »richtigen« Seite wähnen, uns stellen sollten, ist dadurch gewonnen, außer das kuhwarme Gefühl der eigenen moralischen Überlegenheit?
Zum anderen greift der routinemäßige Ruf nach »Abgrenzung nach rechts« zu kurz, weil kursierende schablonenhafte Beschreibungen des/der typischen Rechtswähler:in deren Vielschichtigkeit nicht gerecht werden. Genauso wie ich mehr bin als eine Migrationsforscherin, ist Simon mehr als ein FPÖ-Wähler. Er ist auch humorvoll und manchmal absurd komisch, er ist respektvoll und höflich in jeder Alltagsbegegnung, ob mit dem afghanischen Pizzalieferanten oder der transsexuellen Kellnerin, er ist ein verkappter Philosoph, der belesener ist als die meisten meiner Uni-Kolleg:innen, und ein leidenschaftlicher Salsatänzer. Das sehen und noch vielmehr auch wertschätzen zu können, ist Herausforderung und Provokation zugleich.
Wenn wir aber das Motto des Schriftstellers George Tabori, dass »jeder jemand ist«, auf die Verfolgten, Schutzsuchenden und Marginalisierten dieser Welt anwenden, müssen wir das folgerichtig und mit allen damit verbundenen Konsequenzen auch auf Wähler:innen rechter und rechtspopulistischer Parteien tun. Die Menschenwürde ist unteilbar und die universalen Menschenrechte gelten auch für jene, die sie mit Füßen treten oder abschaffen wollen. Maya Angelous Losspruch, dass entweder alle gleiche Rechte und Gerechtigkeit erfahren können, oder aber niemand es tun würde, ist absolut zu verstehen: Jeder Flüchtling ist jemand, aber auch jede:r MAGA-Anhänger:in ist jemand. Diese Maxime als Richtschnur für das eigene Denken und Handeln unter allen Umständen zu wahren, ist schmerzhaft, unbequem, führt zu Gewissenskonflikten und mitunter zu ethisch uneindeutigen Entscheidungen. Aber bedingungslos die Menschlichkeit jedes und jeder Einzelnen immer und unter allen Umständen im Fokus zu haben, geht eben nur so: bedingungslos.
»Only connect« stellte E. M. Forster seinem Jahrhundertroman Howards End (1910)6 als Motto voran. Während er damit vor allem die Überwindung der Klassenunterschiede der britischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts meinte, liegt die große Aufgabe der gegenseitigen Verbindung heute darin, sie über Echokammern, ideologische Blasen und auseinanderdriftende Medienökosysteme hinweg zuzulassen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, auch oder gerade weil ich immer wieder grandios daran scheitere.
Aus dieser Überzeugung heraus ist der vorliegende Essay entstanden. Er ist ein Versuch, die beginnende (und in Teilen bereits vollzogene) autoritäre Wende, die mittlerweile auch jene Teile der Bevölkerung ergriffen hat, die Simon repräsentiert, durch und mittels der Migrationskrisenerzählung nachzuzeichnen. Wie kam es dazu, und noch wichtiger: Wie kommen wir da wieder raus?
Der Vorwurf, keine »Lösungen« zu haben, ist ein von Migrationsforscher:innen oft gehörter, der schon allein deshalb ins Leere führt, weil Migration kein »Problem« ist, das es zu lösen gilt. Dennoch wage ich mich am Ende dieses Essays an die Skizzierung von sieben konkreten Vorschlägen und einer großen Vision für eine Migrationspolitik Europas, die ressourcenorientiert, menschenrechtsbasiert und zukunftsweisend ist. Aber die Leser:innen seien bereits an dieser Stelle gewarnt: Nichts davon ist eine radikale Idee, die das »Migrationsproblem« – das eben keines ist – ein für alle Mal »lösen« wird; nichts davon kommt der Neuerfindung des Rades gleich. Es sind vielmehr lauter kleine Stellschrauben, an denen einzeln und im Kollektiv mühsam und stetig gedreht werden muss, um kleine Verbesserungen zu erzielen. Einiges davon ist, in Teilen und auf manchen politischen Ebenen, umgesetzt; diese Aspekte harren der vollständigen Implementierung, denn nur so können sie ihren vollen Effekt entfalten. Anderes ist noch im Design- und Ausarbeitungsstadium oder im Rahmen der GEAS-Reform auf europäischer Ebene angedacht (GEAS – Gemeinsames Europäisches Asylsystem). Das in die Umsetzung und Entfaltung zu bringen und dabei die Einhaltung menschenrechtlicher Verpflichtungen zu kontrollieren bzw. Verstöße zu sanktionieren, wird eine der großen Aufgaben der EU-Kommission sein, aber auch nationale Staats- und Regierungschef:innen vor Herausforderungen stellen.
Zum Schluss bleibt die über allem schwebende Aufgabe, der sich die offene Gesellschaft zunehmend und verstärkt stellen wird müssen: Wie lassen sich Menschen wie Simon für die liberale Demokratie zurückgewinnen? Auch auf diese Gretchenfrage wagt der Essay eine Antwort. Ob sie befriedigend ist und in der Praxis verfangen kann, mag der/die Leser:in selbst entscheiden.
1. EINLEITUNG ODER: WAS ZULETZT GESCHAH
Die europäische Migrationspolitik ist seit Jahren in der Krise. Ein so oft gehörter wie nüchterner Befund, der aber doch nicht der Realität gerecht wird. Denn es sind durch Migration betroffene Politikfelder, von der Wirtschaftspolitik bis zur Bildungspolitik, die sich durch den höheren Diversitätsgrad in Einwanderungsländern, zu denen die meisten west- und mitteleuropäischen Länder seit spätestens den Achtzigern zu zählen sind, massiv verändert haben. Diese werden aber weder entsprechend begleitet noch finanziert und eingehegt. Somit sind unsere Schulen überlastet, unsere Kindergärten in Personalnot, unser Wohnungsmarkt unter Druck, unsere sozialen Absicherungssysteme auf Anschlag. Und die Migrationspolitik soll plötzlich Probleme lösen, die eigentlich in der Bildungspolitik, der Wohnungspolitik oder der Sozialpolitik liegen, ganz zu schweigen von der (EU-)Handels- und Klimapolitik, die weltweit zu Flucht und Vertreibung beiträgt.
All das verursacht nicht nur unmittelbare Probleme des Alltags für alle Betroffenen, von überforderten Pädagog:innen an städtischen Mittelschulen und KiTas bis zur Verkehrsplanung und dem Gesundheitssystem, das unter immer größeren Schwierigkeiten funktionieren muss, sondern bietet auch den idealen Nährboden für die große Wende, die sich derzeit auf europäischer wie globaler Ebene vollzieht: der Aufstieg rechtspopulistischer, illiberaler und autoritärer Kräfte, von den Niederlanden bis Frankreich, von Deutschland bis Rumänien, von Österreich bis in die USA.
Vorangestellt eine kleine Notiz zur Verwendung des Begriffs »Wende«: Sind wir mittendrin, steht sie unmittelbar bevor, ist sie womöglich gar schon vollzogen? Wie der australische Historiker Christopher Clark anmerkt, markiert in der Bundesrepublik die politische »Wende« fast immer eine Wende weg von liberalen oder linken Positionen hin zu rechten oder autoritären.7 Das trifft auf die als »Wende« bezeichnete Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 genauso zu wie auf die »geistig-moralische Wende« der frühen achtziger Jahre unter Helmut Kohl und die gesellschaftlichen Umwälzungen nach dem Mauerfall – und zuletzt auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene »Zeitenwende« nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Sie bedeutete eine neue geopolitische Ordnung und damit (in Scholz' Diktum) die notwendig gewordene Abwendung vom deklarierten und gelebten Pazifismus der linken und Mitte-Parteien Deutschlands hin zur Aufrüstung Europas. Der umfassende gesamtgesellschaftliche Wandel zum Autoritarismus vollzieht sich aber nicht allein auf dem europäischen Kontinent, sondern ist ein globales Phänomen, wie die USA verdeutlichen.
Der Aufstieg rechter Parteien ist aber nur ein Kennzeichen dieser autoritären Wende. Sie ist auch charakterisiert durch eine Fusionierung und gegenseitige Potenzierung von Krisen, darunter die Klimakrise, die Coronavirus-Pandemie und eine davon ausgelöste Wirtschaftskrise, die sich durch hohe Inflationsraten und Stagnation oder beginnende Rezession in Industrieländern zeigt, ein umfassender Vertrauensverlust in die Politik, technologischer Gigantismus, damit einhergehender Anstieg von Fake News und die Etablierung alternativer Medienökosysteme, wachsende geopolitische Spannungen und soziale Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften – und die stetig und ständig ausgerufene »Migrationskrise«. Letztere ist an dieser Stelle in Anführungszeichen gesetzt, weil sie nämlich, wie die folgenden Ausführungen veranschaulichen werden, weniger einen Istzustand beschreibt als eine Erzählung einer chronischen, unliebsamen und zu »lösenden« Ausnahmesituation, die es alsbald zu überwinden gelte. Dabei wird aber gerade die »Migrationskrise« von den meisten (inter-)nationalen Kommentator:innen und Analyst:innen in einem Atemzug mit allen anderen Elementen der Polykrise genannt, ja häufig sogar als einer ihrer Eckpfeiler charakterisiert, getreu der politischen Losung: »2015 darf sich nicht wiederholen.«
Im Rückspiegel der letzten zehn Jahre betrachtet, mag das anmaßend klingen, weil so ziemlich jedes folgende Jahr nationalstaatlich wie auch wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernder war als 2015, aber die intendierten Ableitungen daraus sind unmissverständlich: Erstens, Migration ist ein Problem, ja eine »Krise« – also ein Ausnahmezustand. Zweitens gilt es, folgerichtig, in den »Normalzustand« (die Nicht-Krise) zurückzukehren, also in einen Status mit weniger/keiner (irregulären) Migration. Denn, drittens, die »Migrationskrise« bereitet westlichen Aufnahmeländern vielfältige Probleme, vom Druck auf die Sozialsysteme über die Problemlagen der steigenden gesellschaftlichen Diversität und innerstaatlichen »Kulturkämpfe« bis hin zum Aufstieg rechter und rechtsextremer politischer Kräfte. Daran, so eine häufig geäußerte Einschätzung liberaler wie auch konservativer Pundits, seien »die Flüchtlinge« auch schuld: Die Menschen hätten eben einfach genug von (zu) viel Zuwanderung und würden deshalb Kickl, Weidel, Le Pen, Fico, Meloni und Trump wählen.
Dieser unterkomplexen Argumentation (»die Ausländer sind schuld am Ausländerhass«) will der vorliegende Essay die gegenteilige Lesart entgegenstellen: Erst die restriktive, in Zügen autoritäre, »harte« Asyl- und Migrationspolitik, und noch mehr der Diskurs darüber, sowie die gesamtgesellschaftliche Gewöhnung an solcherart Abschottungsfantasien ermöglichten den Aufstieg rechtsextremer, autoritärer und illiberaler Kräfte in Österreich, Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Sie sind somit nicht Auslöser, sondern Ergebnis einer brutalisierten Grenzpolitik, die immer mehr zur Norm wird, trotz umfassender, jedoch immer seltener geahndeter Völkerrechtsbrüche, auf denen sie basiert. Denn eine Politik, die »Migration« als die größte Gefahr für den Nationalstaat und das ureigene, eng gefasste »Wir« identifiziert und deren oberstes Ziel es ist, Sicherheit vor dieser Gefahr zu bieten, ist »am besten mit anti-demokratischen und autoritären Regimen zu haben«, wie die Migrationsforscherin Sabine Hess schlussfolgert.8 Autoritäre Kräfte ernten also längst, was sie (und mittlerweile auch viele Kräfte in der Mitte des politischen Spektrums) gesät haben: Migrationspanik, die zu mehr Abschottung und damit wieder zu mehr Panik führt – denn warum bräuchte es eine physische wie metaphorische Mauer um uns herum, wenn das, was hinter der Mauer liegt, nicht brandgefährlich wäre?
Diese Lesart führt zur vierten und wirkmächtigsten Ableitung, die in das Narrativ der »Migrationskrise« eingeschrieben ist: Eine »Krise« sei sie nämlich nur für jene, die diesseits der Grenze stünden, also die Aufnahmegesellschaft. Das blendet strategisch aus, was das Grenzregime des Globalen Nordens für jene bedeutet, die Zuflucht suchen. Gewalt, Dehumanisierung und Tod sind an Europas Grenzen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Pushbacks, wie sie an der griechischen und der kroatischen Grenze sowie entlang der Balkanroute regelmäßig dokumentiert werden, sind mittlerweile zu einem integralen Bestandteil des europäischen Außengrenzschutzes geworden. Nahezu alle Geflüchteten, die über die zentrale Mittelmeerroute, laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die tödlichste Migrationsroute der Welt,9 ankommen, berichten von schwerer physischer und psychischer Gewalt im Transitland und auf der Flucht, von Folter, Sklaverei, Leibeigenschaft und Zwangsprostitution. Die »Politik des Sterbenlassens«,10 also das bewusste Wegsehen, Vorenthalten von Hilfeleistungen oder simple Ausliefern an die widrige Witterung und die Naturgewalten, ist sowohl im Mittelmeer als auch entlang der Balkanroute die häufigste Form der Gewalterfahrung. Dazu kommen systematische Demütigung und Entmenschlichung, etwa wenn Geflüchtete an der serbisch-mazedonischen Grenze bis auf ihre Unterwäsche entkleidet oder mit Schäferhunden gejagt werden,11 bevor man sie völkerrechtswidrig über die Grenze zurückweist. Gleichzeitig verrechtlicht, legitimiert und zementiert die Externalisierung der europäischen Asylpolitik – etwa durch Abkommen mit Libyen, Tunesien oder der Türkei – menschenrechtswidrige Zustände in Drittstaaten.
Das ist die eigentliche Krise, der sich Europa gegenübersieht und die es nicht nur nicht beendet, sondern täglich weiter befeuert. Weiterhin erzeugen wir Europäer:innen wesentlich mehr Fluchtursachen – durch unsere Klima-, Handels- und Sicherheitspolitik – mit, als wir bekämpfen; weiterhin jedoch gelingt es uns, diese Zusammenhänge zur Gewissensberuhigung, aus Bequemlichkeit und als Legitimation für die eigene Lethargie zu ignorieren, kleinzureden und auszublenden. Die Krise sind dann nicht zunehmende Ungleichheit, globale Verteilungskämpfe und ein immer heißer werdender Planet, der die menschliche Zivilisation bald unmöglich machen wird, sondern ein paar Hundert Schutzsuchende, die vor den Folgen dessen, was wir in ihre Weltregionen ausgelagert haben, fliehen – und vor immer mehr und immer fester verschlossenen Toren stehen. Und die im schlimmsten, aber leider nicht seltenen Fall zu Verwundung und Tod führen.
Dass diese Krise, so weggeschoben und ausgeblendet sie aus unser aller Alltag auch sein mag, nicht ohne Folgen für das Innere des europäischen Kontinents bleiben konnte, ist mittlerweile evident. Im Aufstieg rechter, autoritärer und anti-demokratischer Kräfte quer durch Europa manifestiert sich die Gewöhnung der Bevölkerung an »neue Härte«, eine »starke Hand« und »Null Toleranz«; an Formen der Brutalisierung, Dehumanisierung und Entrechtlichung, die an den Grenzen begonnen haben, aber nicht dort enden.
2. INTEGRATION GESCHEITERT?
Es ist, wie die Erfahrung der letzten Jahre, aber auch neuere sozial- und neurowissenschaftliche Befunde zeigen, nicht damit getan, falsche Integrationserzählungen richtigzustellen oder ihnen mit dem Ruf nach »mehr Bildung!« entgegenzutreten. Westliche Gesellschaften sind (formal) so gebildet wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, und dennoch steigen autoritäre Tendenzen, rassistische Diskriminierung und populistische Hetze, und der Wunsch nach einem »starken Mann« an der Spitze. Das hat einen so banalen wie unanfechtbaren Grund: Fakten erreichen uns niemals dort, wo es Emotionen tun. Tatsächlich erschließen sich dem Menschen alle Formen des Wissens, sämtliche Zahlen und Statistiken, die man ihm anbietet, ausschließlich über Emotionen – und sei es »nur« durch grundlegendes Interesse am Neuen und Unbekannten.12 Die Emotion erst schürt dieses Interesse und wird zum Türöffner, ohne den jegliche neue Information, die auf uns einprasselt, gar keine Chance hat zu verfangen oder gar ein ehrliches Nach- und Umdenken herbeizuführen. Ohne dieses Interesse, und diese Erfahrung kennt jeder und jede Pädagog:in, ist Wissensvermittlung, Wertebildung und, noch viel gewichtiger, Meinungsumschwung unmöglich.
Dieses möchte ich dem/der Leser:in einschränkend mit auf den Weg geben, bevor ich mich an eine kritische Bestandsaufnahme des »Integration gescheitert«-Narrativs mache. Mein Ziel ist es nicht, zu negieren, dass eine höhere Diversität in westlichen Aufnahmeländern wie Deutschland und Österreich – darunter sei vor allem ethnische wie auch religiöse Diversität verstanden – Problemlagen schaffen oder verschärfen kann. Neue politische Fragestellungen entstehen (etwa »Wie geht ein sich lange Zeit als monolingual verstehendes Land mit einem zunehmenden Anteil an Kindern mit nicht deutscher Muttersprache in Grund- und Mittelschulen um?«), bestehende werden mitunter verschärft (etwa die in Österreich und Deutschland im internationalen Vergleich hohe Anzahl an Femiziden, worunter auch, wenn auch zu einem geringen Prozentsatz, sogenannte »Ehrenmorde« fallen).13 Das Konzept der »Superdiversität«14 beschreibt einerseits den Umstand, dass ein wachsender Anteil der in Deutschland und Österreich lebenden Menschen Migrationshintergrund hat (mittlerweile 26 Prozent bzw. 27 Prozent der Gesamtbevölkerung),15