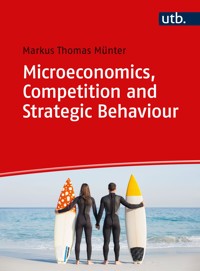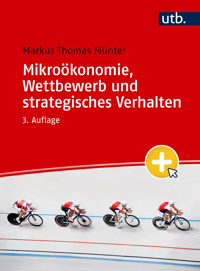
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie konkurrieren Unternehmen, wie entscheidet das Management, wie funktionieren Märkte? Mikroökonomie ist spannend. Markus Thomas Münter erklärt strategische Entscheidungen mit anwendungsorientierter mikroökonomischer Theorie. Empirische Daten, viele Praxisbeispiele und verhaltensökonomische Erkenntnisse helfen, Strategieentwicklung und digitale Geschäftsmodelle besser zu verstehen – damit beim Start ins Berufsleben direkt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dieses Buch zeigt, • wie Digitalisierung und Plattformen Märkte verändern, • warum disruptive Innovationen Unternehmen zerstören können, • weshalb Menschen begrenzt rational entscheiden und • wann Spieltheorie wirklich Wettbewerbsvorteile schafft. Die dritte Auflage wurde überarbeitet und erweitert, sie geht u. a. stärker auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein. Dieses Lehrbuch ist der ideale Einstieg in eine managementorientierte Volkswirtschaftslehre für Studierende der Wirtschaftswissenschaften sowie angrenzender Studiengänge. utb+: Zusätzlich zum Buch steht ein E-Learning Kurs mit rund 200 Single- und Multiple-Choice-Fragen zur Verfügung,um das Wissen zu festigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 4910
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. Markus Thomas Münter lehrt Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomie, an der htw saar.
Markus Thomas Münter
Mikroökonomie, Wettbewerbund strategisches Verhalten
Mit eLearning-Kurs
3., überarbeitete und erweiterte Auflage
Umschlagabbildung: © Clerkenwell ∙ iStock
Autorenfoto: © privat
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2021
1. Auflage 2018
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564562
© UVK Verlag 2025
‒ Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 4910
ISBN 978-3-8252-6456-7 (Print)
ISBN 978-3-8463-6456-7 (ePub)
Vorwort zur dritten Auflage
‚Mikroökonomie, Wettbewerb und strategisches Verhalten‘ wird sehr gut nachgefragt und an zahlreichen Hochschulen eingesetzt – das freut mich sehr, war doch der Ansatz in einem Mikroökonomie-Lehrbuch stärker Bezüge zu BWL-Themen und Managementmethoden herauszuarbeiten zumindest ein bisschen unkonventionell. Zielgruppe sind Studierende in den ersten Semestern betriebswirtschaftlicher Bachelor-Studiengänge, deren mögliche Entwicklungslinien das Management von Unternehmen oder ein Einstieg in die Managementberatung sind. Dieses Lehrbuch legt den Schwerpunkt auf relevante mikroökonomische Konzepte, die regelmäßig in der Praxis vorkommen, für strategische Entscheidungen genutzt werden oder das Verständnis von Märkten verbessern. Insbesondere sind zahlreiche Studien sowie Zahlen, Daten und Fakten integriert, um einen starken Realitäts- und Anwendungsbezug zu gewährleisten.
In der jetzt vorliegenden dritten Auflage sind einige unklare Formulierungen behoben und kleinere Ergänzungen zur besseren Verständlichkeit eingefügt – Danke meinen Studierenden für zahlreiche hilfreiche Hinweise. Durchwegs wurden die Bezüge zu Unternehmensstrategie gerade im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit stärker betont, zudem wurden Case Studies aktualisiert und zusätzliche Frage-Boxen zum Hintergrund und besseren Verständnis eingefügt. Größere Anpassungen und Ergänzungen betreffen:
Empirische Abschätzung der Marktgröße und Marktdynamik (Kapitel 2),
Strategische Gruppen und Mobilitätsbarrieren (Kapitel 2),
Auswirkungen von Unsicherheit auf menschliche Entscheidungen (Kapitel 3)
Capital-Asset-Pricing Model und Kapitalmarktbewertung (Kapitel 4),
Behavioral Strategy (Kapitel 4),
Ambidexterität und Absorptionsfähigkeit (Kapitel 4),
Einfluss der vierten industriellen Revolution auf Unternehmen (Kapitel 5),
Empirische Wachstumsraten von Unternehmen (Kapitel 5),
Totale Faktorproduktivität zur Messung von Innovation (Kapitel 6),
Treiber und (Miss-)Erfolgsfaktoren von M&A-Transaktionen (Kapitel 6),
Messung von Marktanteilsdynamik und Stabilität von Marktführerschaft (Kapitel 7),
Cap-and-Trade-Modell zur Reduktion von Klimaschäden (Kapitel 7),
Wettbewerbspolitik in digitalen Märkten (Kapitel 7),
Real-Time Bidding Auktionen im Marketing (Kapitel 8),
Generische Strategien vs. Stuck in the Middle (Kapitel 10).
Danke an Rainer Berger für die wiederum hervorragende und umsichtige verlegerische Betreuung und an Anna Trumm für das wiederholte Hinweisen auf Zahlendreher und verlorengegangene Ableitungen. Danke an meine Frau Cecile und meinen gefühlten Co-Autor-Kater Mr. Jimi Jimmy für mannigfaltige Ablenkung beim Schreiben und Inspiration beim Nachdenken über menschliches Verhalten irgendwo zwischen begrenzter Rationalität und als strategisch deklarierten Irrsinn.
Karlsruhe und Saarbrücken, im Frühjahr 2025
Markus Thomas Münter
Vorwort zur zweiten Auflage
Erfreulicherweise wurde die erste Auflage von ‚Mikroökonomie, Wettbewerb und strategisches Verhalten‘ sehr gut im Markt aufgenommen. In der hier vorliegenden zweiten Auflage wurden einige Tippfehler sowie unklare Formulierungen behoben und kleinere Ergänzungen zur besseren Verständlichkeit eingefügt – Danke meinen Studierenden für hilfreiche Hinweise.
Größere Anpassungen und Erweiterungen betreffen folgende Themen, die insbesondere aktuelle Fragen adressieren oder die Anwendung von mikroökonomischen Methoden in Management und Unternehmensberatung betreffen: In Kapitel 1 wurden die Vorteile von Märkten stärker herausgearbeitet und ein Blick auf Rationalität hinzugefügt, in Kapitel 2 wird in einer Case Study die Entwicklung der deutschen Musikindustrie entlang von Produktlebenszyklen gezeigt, in Kapitel 4 gibt es jetzt einen eigenen Abschnitt zu Unternehmensorganisation und Principal-Agent-Problemen sowie zu Unternehmensgründung, in Kapitel 7 ist das Unterkapitel zu Wettbewerbspolitik deutlich ausgeweitet und um Regulierung bei Marktversagen ergänzt, Kapitel 8 wurde um Auktionen sowie Dynamic und Personal Pricing erweitert, und in Kapitel 9 gibt es jetzt Beispiele zu gemischten Strategien. Ziel ist weiter, dass die mikroökonomischen Grundüberlegungen weiterhelfen, Dynamik in Märkten zu verstehen und da und dort vielleicht den Anstoß geben, einen tieferen und analytischeren Blick auf Unternehmensstrategie, Wettbewerb und Kundenverhalten zu entwickeln.
Mein besonderer Dank gilt Franziska Müller von der Verbraucherzentrale Brandenburg für die Daten zu Dynamic Pricing, Georg Sobbe vom Bundesverband Musikindustrie für die Daten zu Umsätzen in der deutschen Musikindustrie, Carolin Freude für das Stichwortverzeichnis sowie Rainer Berger für wiederum tolle verlegerische Unterstützung und Betreuung.
Meine Frau Cecile hat (womöglich aufgrund schwer beschreibbarer Fähigkeiten auf Basis ihres Studiums der Verlagsherstellung) nicht nur alle Tipp- und Formatierungsfehler entdeckt, sondern auch darauf hingewiesen, dass das Prisoners‘ Dilemma zwar erwähnt, aber nicht erklärt ist. Dafür, für alles andere, und für das geduldige Lächeln über diverse Kollateralentwicklungen meines Lebens mein unendlicher Dank.
Hamburg, Karlsruhe und Saarbrücken, im Frühjahr 2021
Markus Thomas Münter
Vorwort zur ersten Auflage
Klagen über realitätsferne Lehre, fehlende Anwendbarkeit der Methoden und das vermeintlich offensichtliche Versagen der Volkswirte und der Volkswirtschaftslehre im Zusammenhang mit der Finanz- und Schuldenkrise des vergangenen Jahrzehnts gehören fast zum guten Ton. Viele Studierende beklagen zudem einen hohen Abstraktionsgrad von Modellen, unrealistische Annahmen betreffend der Rationalität von Entscheidern und den übermäßigen Einsatz von Mathematik – oftmals wird dann gefordert, Lehrstühle oder Professuren für Volkswirtschaftslehre umzuwidmen in stärker anwendungsbezogene Themenbereiche.
Anwendungsorientierte Mikroökonomie, wie sie an internationalen Business Schools gelehrt wird, hat allerdings heute kaum noch etwas mit der manchmal auf angewandte Mathematik reduzierte Mikroökonomie der 1980er oder 1990er Jahre zu tun. Im Wesentlichen lassen sich die Veränderungen in drei Stoßrichtungen für erfolgreiche Lehre fassen:
Ein fundierter Abgleich von Empirie und Theorie,
Berücksichtigung von verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen und
anwendungsorientierte Methoden zur Strategieentwicklung für Unternehmen.
Dabei gleicht der immer schon überstrapazierte und entsprechend gescholtene Homo oeconomicus mittlerweile Schrödingers Katze: Kiste nicht öffnen, sonst könnte es sein, dass sie tot ist. Wir haben mittlerweile, auch durch Nobelpreise an Herbert Simon, Reinhard Selten, Daniel Kahneman oder Richard H. Thaler belohnt, einige robuste Erkenntnisse darüber, in welchen Situationen Menschen nahezu rational entscheiden, und wann und insbesondere warum sie davon abweichen. An vielen Hochschulen wird bereits heute eine anwendungsorientierte Mikroökonomie gelehrt, die in industrie- oder unternehmensspezifischen Fallstudien vor dem Hintergrund von Digitalisierung und globalem Wettbewerb zentrale empirische Beobachtungen gut erklären kann. Zudem liefert sie Handlungsanweisungen für Unternehmensstrategie und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. So betitelt der Economist diese Entwicklung schon 2012 mit „A Golden Age of Micro“ und zeigt, dass Amazon, Google, Facebook und eBay in ihren Strategieabteilungen führende akademische Mikroökonomen beschäftigen.
In diesem Kontext ist Mikroökonomie, Wettbewerb und strategisches Verhalten im Rahmen meiner Vorlesungen in Saarbrücken entstanden. Studierende haben keine Berührungsängste mit modellhafter Abstraktion, wenn die Herleitung aus ihrer wahrgenommenen Realität erfolgt, nachvollziehbar und direkt ist. Empirie, Verwendung tatsächlicher Unternehmensdaten und Fallstudien orientiert an aktuellen Entwicklungen schaffen hierfür eine tragfähige Grundlage – um diesen Punkt klar zu machen: Zweiseitige Märkte in digitalen Geschäftsmodellen sind wichtiger als ein vermeintliches Giffen-Gut irgendwann im 18. Jahrhundert irgendwo in Schottland, wenn Mikroökonomie bei Studierenden ein Fundament für spätere Entscheidungen in Unternehmen legen soll. Zur Daseinsberechtigung der Mikroökonomie in der Ausbildung von Betriebswirten an anwendungsorientierten Hochschulen reicht es nicht, eine abstrahierende Sicht auf ökonomische Zusammenhänge zu vermitteln oder lediglich die Grundlagen für betriebswirtschaftliche Fächer wie Marketing oder Controlling zu schaffen. Vielmehr muss in der Lehre auch aufgezeigt werden, welche mikroökonomischen Methoden in der Unternehmenspraxis wirklich angewendet werden. Versteht man diese Konzepte als allgemein anwendbare „Werkzeuge“, dann wird aus der oft gefürchteten und mutmaßlich realitätsfernen Mikroökonomie ein Schweizer Taschenmesser, welches Studierende – gerade beim Einstieg in Strategieabteilungen oder Managementberatungen – unmittelbar einsetzen können.
Dinge, die in diesem Buch stehen – und Dinge, die nicht in diesem Buch stehen
Zielgruppe dieses Buches sind Studierende in den ersten Semestern betriebswirtschaftlicher Bachelorstudiengänge, deren mögliche Entwicklungslinien das Management von Unternehmen oder ein Einstieg in die Managementberatung sind. Der Schwerpunkt dieses Lehrbuchs zielt auf die aus Managementperspektive relevanten mikroökonomischen Konzepte, die regelmäßig in der täglichen Praxis vorkommen und für strategische Entscheidungen genutzt werden – unter anderem Preisdiskriminierung, Economies of Scale, Spieltheorie, Umgang mit Unsicherheit, Eintrittsbarrieren oder Sunk Costs – oder zum Verständnis von Marktstrukturen, Innovationen und Wettbewerbsverhalten notwendig sind. Der Fokus liegt auf Konzepten, die starke Querverbindungen zu betriebswirtschaftlichen Fächern haben und in Masterstudiengängen weiterführend in den Bereichen Industrieökonomie, Managerial Economics oder Wettbewerbspolitik vertieft werden. Zudem kommt natürlich Mathematik zum Einsatz – eine der zentralen Fragen ‚im richtigen Leben‘ ist ja fast immer: Rechnet sich das?
Im Umkehrschluss bleiben viele Bereiche der Mikroökonomie außer Betracht, die mir in über 15 Jahren Unternehmensberatung und Management nie begegnet sind oder keinen engen Bezug zur Betriebswirtschaftslehre und Managemententscheidungen haben. Zudem werden wesentliche Themen – Marktversagen, öffentliche Güter, natürliche Ressourcen oder Arbeitsmarkt – ausgeklammert: In den meisten Curricula werden diese Inhalte in der Wirtschaftspolitik abgedeckt. Zudem werden Themen ausgespart, die ich vielleicht spannend finde, die aber bei Licht betrachtet in Breite und Tiefe nur für Studierende der Volkwirtschaftslehre auf dem Weg in eine wissenschaftliche Laufbahn wesentlich sind – im Anhang zu Kapitel 1 sind ausgezeichnete weiterführende Lehrbücher angeführt.
Danke
Ich danke meinen Studierenden – durch Diskussionen in den Vorlesungen, aber insbesondere im Rahmen von Abschlussarbeiten habe auch ich hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit gewinnen können. Fabiane Mihut-Albeck gebührt mein allergrößter Dank für ihre Unterstützung im Vorfeld und beim akribischen Korrekturlesen, Philipp Klenner für hilfreiche Hinweise zu Kapitel 4, Steffen Häfele vom Bundeskartellamt für hilfreiche Tipps zu Kapitel 7 und Rainer Berger für die hervorragende und umsichtige verlegerische Betreuung. Dieses Buch ist zu weiten Teilen an der LaTrobe University in Melbourne geschrieben – Alex Maritz & Anahita Amirsardari: Thanks mates, for making life and work so easy down under. Danke meinen Kolleginnen und Kollegen an der htw saar für die Möglichkeit, Wissenschaft zu betreiben.
Meiner Frau Cecile dafür, dass dieses Leben möglich ist.
Melbourne, Hamburg und Saarbrücken, im Juli 2018
Markus Thomas Münter
Inhalt
Vorwort zur dritten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
Abkürzungsverzeichnis
Verzeichnis mathematischer und ökonomischer Variablen
1Mikroökonomie, Wettbewerb und strategisches Verhalten
1.1Mikroökonomie zwischen Empirie, Theorie und Experimenten
1.2Märkte, Angebot und Nachfrage
1.3Preiselastizität und Grenzerlöse
1.4Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
2Kundenverhalten, Marktabgrenzung und Netzwerkeffekte
2.1Kundenverhalten und Nachfrageentscheidungen
2.2Marktabgrenzung und Produktkategorien
2.3Netzwerkeffekte und mehrseitige Märkte
2.4Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
3Entscheidungen bei Risiko und Behavioral Economics
3.1Entscheidungen bei Risiko und Unsicherheit
3.2Begrenzte Rationalität und Behavioral Economics
3.3Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
4Unternehmen, Wettbewerb und Innovationen
4.1Unternehmen, Unternehmensziele und Strategien
4.2Wettbewerbsvorteile, Marktstruktur und unternehmensspezifische Fähigkeiten
4.3Wettbewerb und Innovationen
4.4Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
5Unternehmensgröße, Technologie und Produktionsentscheidungen
5.1Produktionsfunktion und Technologie
5.2Kurzfristige Entscheidungen: Abnehmendes Grenzprodukt und Produktivität
5.3Langfristige Entscheidungen: Technischer Fortschritt und Skalenerträge
5.4Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
6Kosten, Restrukturierung und M&A
6.1Kostenfunktion, Entscheidungen und Wettbewerbsfähigkeit
6.2Kurzfristige Entscheidungen: Fixkosten und Grenzkosten
6.3Langfristige Entscheidungen: Anpassung der Kostenstruktur
6.4Kostenseitige Wettbewerbsvorteile und M&A
6.5Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
7Vollständige Konkurrenz, Monopol und Wettbewerbspolitik
7.1Vollständige Konkurrenz
7.2Ökonomische Wohlfahrt und Marktversagen
7.3Monopol und marktbeherrschende Unternehmen
7.4Wettbewerbsbeschränkungen, Wettbewerbspolitik und Wettbewerbsbehörden
7.5Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
8Preisstrategien und Preisdiskriminierung
8.1Formen und Voraussetzungen von Preisdiskriminierung
8.2Direkte Preisdiskriminierung und Marktsegmentierung
8.3Indirekte Preisdiskriminierung und zweiteilige Tarife
8.4Bundling
8.5Auktionen
8.6Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
9Strategische Entscheidungen mit Spieltheorie
9.1Nash-Gleichgewichte in simultanen Spielen
9.2Risikoaversion und gemischte Strategien
9.3Sequentielle Entscheidungen und Commitment
9.4Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
10Strategischer Wettbewerb im Oligopol
10.1Kapazitätsentscheidungen und Strategien beim Cournot-Wettbewerb
10.2Sequentielle Entscheidungen und Strategien bei Stackelberg-Wettbewerb
10.3Preisentscheidungen und Strategien bei Bertrand-Wettbewerb
10.4Strategischer Wettbewerb bei Produktdifferenzierung
10.5Relevanz für Unternehmensstrategien
10.6Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
Stichwort- und Unternehmensverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
AIA
| Artificial Intelligence Act (EU-Verordnung zu künstlicher Intelligenz)
B2B
| Business to Business (Geschäft mit Firmenkunden)
B2C
| Business to Consumer (Geschäft mit Privatkunden)
BPO
| Business Process Outsourcing (Fremdvergabe von Geschäftsprozessen)
bspw.
| beispielsweise
CAGR
| Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)
CAPM
| Capital-Asset-Pricing Model (Modell zur Wertpapierbewertung)
d.h.
| das heißt
DMA
| Digital Markets Act (EU-Verordnung zu digitalen Märkten)
DSA
| Digital Services Act (EU-Verordnung zu digitalen Dienstleistungen)
EBIT
| Earnings before Interest and Tax (operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern)
EU ETS
| EU Emissions Trading System (EU-Emissionshandelssystem)
F&E
| Forschung und Entwicklung
FTE
| Full Time Equivalents (Vollzeitarbeitskräfteäquivalent)
ggfs.
| gegebenenfalls
GuV
| Gewinn- und Verlustrechnung
GWB
| Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
KMU
| Kleine und mittlere Unternehmen
M&A
| Mergers and Acquisitions (Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen)
nEHS
| nationales Emissionshandelssystem
p.a.
| per annum (pro Jahr)
PEST
| politisch-rechtliche, ökonomische, soziale und technologische Unternehmensumwelt
PESTLE
| politische, ökonomische, soziale, technologische, rechtliche und ökologische Unternehmensumwelt
RoE
| Return on Equity (Eigenkapitalrentabilität)
ROIC
| Return on Invested Capital (Rentabilität des investierten Kapitals)
SCP
| Structure-Conduct-Performance (Marktstruktur-Unternehmensstrategie-Marktergebnis)
SIEC
| Significant Impediment to Effective Competition (wesentlicher Einfluss auf funktionierenden Wettbewerb)
SSNIP
| Small but Significant Non-Transitory Increase in Price (kleiner aber wesentlicher nicht-vorübergehender Preisanstieg)
SWOT
| Strength-Weaknesses and Opportunities-Threats Analysis (Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiken-Analyse)
TEUR
| Tausend Euro
TK
| Transaktionskosten
z.B.
| zum Beispiel
Verzeichnis mathematischer und ökonomischer Variablen
1/b
| Indikator für die Größe des Marktes
a
| maximale Zahlungsbereitschaft
A
| technologische Effizienz
AP
| Produktivität
ATC
| totale Durchschnittskosten
AVC
| variable Durchschnittskosten
b
| Steigung der Nachfragefunktion
coυ
| Kovarianz zweier Variablen
CS
| Konsumentenrente
d
| totales Differential
D
| Nachfrage
DWL
| Deadweight Loss (Wohlfahrtsverlust)
eTC
| Gesamtkostenelastizität
E
| Preiselastizität einer Marktseite bei Netzwerkeffekten
Em
| Emissionen
EK
| Eigenkapital
EU
| erwarteter Nutzen
EV
| Erwartungswert eines Ereignisses
FC
| Fixkosten
FK
| Fremdkapital
g
| Wachstumsrate eines Unternehmens
GRS
| Grenzrate der Substitution
GRT
| Grenzrate der technischen Substitution
I
| Einkommen
K
| (Gesamt-)Kapital, Kapitaleinsatz
L
| Arbeit, Anzahl der Mitarbeiter
Li
| Lerner-Index
MBE
| Grenznutzen aus Emissionen
MEC
| externe Grenzkosten von Emissionen
MC
| Grenzkosten
MCA
| Grenzvermeidungskosten von Emissionen
MES
| Minimum Efficient Size (Mindestbetriebsgröße)
MP
| Grenzprodukt
MR
| Grenzerlös
n
| Zahl der Unternehmen
p
| Preis
PS
| Produzentenrente
q
| Produktionsmenge oder Kapazität eines Unternehmens
qD
| nachgefragte Menge
qS
| angebotene Menge
Q
| Produktionsmenge oder Kapazität aller Unternehmen
r
| Kapitalmarktzins, Diskontierungszinssatz
rD
| Fremdkapitalzins
rf
| risikofreier Zins
rm
| erwartete Rendite eines Marktportfolios am Kapitalmarkt
rSH
| Eigenkapitalrenditeerwartung
R
| Erlöse (Umsatz)
R2
| Bestimmtheitsmaß
si
| Marktanteil von Unternehmen i
S
| Angebot
SC
| Sunk Costs
t
| Zeit
T
| Technologie, technologischer Pfad
TC
| Gesamtkosten
TFP
| totale Faktorproduktivität
u
| Nutzen
υ
| Wert in der Wertfunktion
V
| Unternehmenswert
VC
| variable Kosten
w
| Lohnsatz (Stundenlohn, Monats- oder Jahresgehalt)
–w/r
| Lohn-Zins-Verhältnis
W
| Vermögen
WR
| risikobehafteter Erwartungswert des Vermögens
WS
| sicherheitsäquivalentes Vermögen
WACC
| Weighted Average Cost of Capital (gewichtete Eigen- und Fremdkapitalkosten)
zi
| Zahlungsbereitschaft (Reservationspreise)
Z
| Lagrange-Funktion
Griechische Variablen
α
| partielle Produktionselastizität des Kapitals
β
| partielle Produktionselastizität der Arbeit
βC
| Beta-Faktor im Capital-Asset-Pricing Model
γ
| industriespezifischer Grad horizontaler Produktdifferenzierung
∂
| partielle Ableitung
Δ
| absolute Differenz
εI
| Einkommenselastizität der Nachfrage
εXY
| Kreuzpreiselastizität der Nachfrage
εp
| Preiselastizität der Nachfrage
θ
| Stärke des indirekten Netzwerkeffektes
λ
| Lagrange-Multiplikator
μ
| Grad der Verlustaversion
π
| Gewinn
σ2
| Varianz einer Verteilung
ω
| Grad der Risikoaversion
1Mikroökonomie, Wettbewerb und strategisches Verhalten
eLearning | Zu diesem Kapitel wird ein eLearning-Kurs angeboten. Folgen Sie einfach dem Link oder nutzen Sie den QR-Code.
https://narr.kwaest.io/s/1351
Unternehmerische Entscheidungen zu treffen, ist ein bisschen wie Kochen – es funktioniert irgendwie, auch wenn man es nicht kann, aber meist nicht sonderlich gut. Beim Kochen schaut man zunächst anderen zu, ab und an blickt man in ein Kochbuch, auf die Packung einer Tütensuppe oder in eine App – aber meistens nutzt man schlicht die Zutaten, die gerade in der Küche zu finden sind. Kochbücher sind keine wissenschaftlichen Lehrbücher. Kochanleitungen beschreiben, je nach Anspruchsniveau, das schrittweise Vorgehen, um eine vorgekochte Tomatensuppe zu erwärmen, oder vielleicht sogar etwas aufwendigere Speisen zuzubereiten (Kolmar 2017 und Barham 2001). Folgt man den Anweisungen auf der Rückseite der Tütensuppe oder im Kochbuch, hat man danach meist ein genießbares Essen auf dem Tisch – allerdings versteht man selten, weshalb. Und genauso, wie man irgendwie kochen muss, auch wenn man es nicht richtig kann, müssen Manager Entscheidungen treffen. Natürlich kann man sich auch Essen kommen lassen – Lieferheld, Deliveroo oder Delivery Hero sei dank – und Manager in Unternehmen können McKinsey & Company, Bain & Company oder BCG kommen lassen, aber auf Dauer ist das ein teurer Spaß.
Besser ist natürlich, man weiß, welche Wirkungen strategische Entscheidungen in Märkten haben – auf Kunden, auf Wettbewerber, auf das eigene Unternehmen. In diesem Sinne ist Mikroökonomie allerdings kein Kochbuch: Mikroökonomie versucht keine schrittweisen Anleitungen für unternehmerisches Handeln oder Entscheidungen zu liefern. Im Mittelpunkt steht, Ursachen für das beobachtbare Verhalten und die Entscheidungen von Menschen in ökonomischen Situationen zu erklären, um herauszuarbeiten, welche Auswirkungen sich für Märkte, Unternehmen und Wettbewerb ergeben. Dennoch liefern die Beobachtungen natürlich Orientierungspunkte für künftige Entscheidungen und die Einordnung von Wettbewerbssituationen insbesondere aus Managementperspektive.
Die mikroökonomische Perspektive ist mindestens dreigeteilt:
Entscheidungen von Kunden in unterschiedlichen Situationen und Rahmenbedingungen – bspw. beim Kauf eines Smartphones – beschreiben und erklären können.
Strategische Entscheidungen von Managern in Unternehmen – bspw. die Festlegung von Produktionskapazitäten oder Preisen für die nächste Smartphone-Generation – herleiten und begründen können.
Das Zusammenspiel der Entscheidungen, die Interaktion von Unternehmen und Kunden in Märkten und die Auswirkungen auf Preise, Mengen, Marktstrukturen oder Gewinne der Unternehmen – den Niedergang von Nokia und Research in Motion sowie den gleichzeitigen Erfolg von Samsung und Apple – nachvollziehen und quantifizieren können.
Mikroökonomie analysiert die Entscheidungen von Kunden und Unternehmen, deren Zusammenspiel und die Funktionsweise von Märkten. Die Notwendigkeit für Entscheidungen basiert immer auf Knappheit: Menschen müssen zwischen Alternativen wählen, weil nicht unbegrenzt Ressourcen, Geld oder Zeit verfügbar sind. Mikroökonomie kann für mindestens zwei Zielgruppen wichtige Unterstützung bieten: Einerseits für Unternehmen, die Strategien für unterschiedliche Wettbewerbssituationen entwickeln wollen, andererseits für staatliche Institutionen wie bspw. Wettbewerbsbehörden, deren Ziel ist, die Funktionsfähigkeit von Märkten zu verbessern. Makroökonomie dagegen betrachtet die gesamte Volkswirtschaft und versucht, Erklärungen für Arbeitslosigkeit, Inflation, Konjunkturzyklen und Wachstum zu geben.
Lernziele
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit
den Zielsetzungen von Mikroökonomie aus Managementperspektive,
dem Zusammenspiel von Theorie und Empirie zur Ableitung von ‚Stadtplänen für Märkte und Wettbewerb‘,
den grundlegenden Zusammenhängen von Angebot und Nachfrage sowie der Bestimmung eines Marktgleichgewichtes, und
der Preiselastizität der Nachfrage und Grenzerlöse als Messgrößen der Effekte von Preisänderungen auf die nachgefragte Menge und Umsätze.
1.1Mikroökonomie zwischen Empirie, Theorie und Experimenten
Weshalb befinden sich in vielen Städten der Welt die Filialen von Burger King und McDonald’s in unmittelbarer Nähe zueinander? Weshalb verkauft Microsoft die Produkte Word, Excel und PowerPoint einzeln, aber auch in einem Office Paket – und zu welchem Preis? Wie viele Mitarbeiter muss Osram entlassen, weil die EU-Kommission die Produktion konventioneller Glühbirnen untersagt hat? Wieso bietet die Deutsche Bahn eine Bahncard 50 an – und wie legt sie deren Preis optimal fest? Kann BMW durch strategisches Verhalten dem neuen Konkurrenten Tesla den Marktzutritt sperren? Was ist der Wert des 50:50-Jokers bei Wer wird Millionär? Mikroökonomie versucht, derartige Fragestellungen zu beantworten. In den folgenden Kapiteln werden die notwendigen Konzepte und Frameworks dazu entwickelt und angewendet.
Abbildung 1.1: Wasserflaschenpark.
Mikroökonomie analysiert Märkte und das Verhalten von Käufern und Verkäufern – man kann sich einige der grundlegenden Fragestellungen an folgendem Beispiel klar machen. An einem sehr heißen Feiertag, an dem alle Geschäfte geschlossen sind, befinden sich 20 Menschen in einem weitläufigen Park – die eine Hälfte besitzt je eine geschlossene 1 Liter-Wasserflasche (ohne Kohlensäure und absolut identischer Qualität und Temperatur) und ist in keiner Weise durstig, die andere Hälfte ist sehr durstig, besitzt aber keine Wasserflaschen. Die Situation lässt sich in etwa wie in Abbildung 1.1 beschreiben: Die zehn Besitzer der Wasserflaschen (dunkelgraue Figuren) wären im Prinzip bereit, ihre Wasserflaschen zu verkaufen, die zehn potenziellen Kunden (hellgraue Figuren) wären grundsätzlich bereit, dafür zu bezahlen. Allerdings unterscheiden sich die Preisvorstellungen der Verkäufer und die Zahlungsbereitschaft der Durstigen, zudem kennen weder Verkäufer noch Käufer die Preisvorstellungen und Zahlungsbereitschaft der jeweils anderen Marktseite im Wasserflaschenpark. Was wird nun passieren? Wie viele Flaschen werden verkauft, zu welchen Preisen? Wie finden sich potenzielle Verkäufer und Käufer? Wie kann ein Verkäufer den höchsten Preis erzielen, wie kann ein Käufer den niedrigsten Preis erzielen? Mögliche Antworten auf diese Frage in Kapitel 1.2.
Modelle, Stadtpläne und Mikroökonomie
Realität ist in ihrer Komplexität nicht beschreibbar, daher basiert Wissenschaft auf Abstraktion. Wissenschaft versucht, Regelmäßigkeiten der Realität zu identifizieren, zu erklären und – wo angebracht – nutzbar zu machen. Um diese Regelmäßigkeiten in ihrer komplexitätsreduzierten Form greifbar zu machen, werden Modelle verwendet.
Modelle können, neben einer vereinfachenden Abbildung der Wirklichkeit, der wahrgenommenen Realität insbesondere Entscheidbarkeit hinzufügen – das ist offensichtlich für jeden Stadtplan bis hin zu Google Maps. In diesem Sinne versorgt Mikroökonomie Manager mit Stadtplänen für Wettbewerb und Märkte: Mit empirisch belastbaren, wenngleich abstrahierend modellhaften Abbildungen wird Entscheidbarkeit hinzugefügt – und diese ist schließlich zentral, wenn Mikroökonomie als erklärend für Entscheidungen, die Manager in Unternehmen treffen, verstanden wird. In Analogie zu den Stadtplänen gilt aber auch: Kein Modell kann alle Aspekte der Realität gleichzeitig abdecken – so hat Google Maps unterschiedliche Sichten für Autofahrer (mit Verkehrs- und Stauinformationen), für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs (mit Abfahrtszeiten und Umsteigeverbindungen) oder für Touristen (mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten) – weil sonst der Blick für wesentliche Informationen verstellt wird. Modelle vereinfachen und abstrahieren immer, um die Realität handhabbar zu machen. Zudem werden Zusammenhänge und Elemente herausgestellt, die für Entscheidungen wesentlich erscheinen: So sind in Stadtplänen Hauptverkehrsstraßen in grün oder orange markiert, obwohl dies nicht der Realität entspricht, und in deutlich vergrößertem Maßstab eingezeichnet (Meyer 1996). In ähnlicher Weise stellen mikroökonomische Modelle unterschiedliche Aspekte – bspw. in Kapitel 3 Entscheidungen bei begrenzter Rationalität, in Kapitel 8 Preisstrategien oder in Kapitel 10 strategischen Wettbewerb – aus Perspektive der jeweiligen Entscheidungssituation besonders heraus.
Mikroökonomische Analysen basieren auf Regelmäßigkeiten in Entscheidungen und typischen Entwicklungen in Märkten. Um Regelmäßigkeiten wissenschaftlich zu identifizieren, werden zwei sich ergänzende wissenschaftstheoretische Perspektiven, wie in Abbildung 1.2 dargestellt, eingenommen: Deduktion und Induktion.
Deduktion bedeutet, dass aus einer Menge plausibler Annahmen durch logisches Schließen und Ableiten eine Theorie entwickelt wird. Diese kann durch Falsifikation – den Nachweis falscher Schlussfolgerung oder Verletzung logischer Regeln – widerlegt werden. Aus gegebenen Rahmenbedingungen und Überlegungen (einem Modell) können dann Hypothesen formuliert werden, d.h. aus allgemeinen theoretischen Überlegungen wird auf einen besonderen Fall geschlossen, der in der Realität erwartet wird. So hat Einstein 1918 theoretisch Gravitationswellen vorhergesagt, der Nachweis in der Realität ist erst 98 Jahre später gelungen (Einstein 1918 und Abbott et al. 2016).
Induktion geht genau den anderen Weg: Auf Basis von Empirie – der systematisch, aber ausschnittsweise beobachteten Realität – wird ein regelmäßiges Muster vermutet und abstrahierend sowie verdichtend auf ein allgemeines Modell geschlossen. Empirische Modelle können durch Beobachtung eines widersprüchlichen Einzelfalls falsifiziert werden, allerdings kann eine induktive Schlussfolgerung niemals verallgemeinert werden (Popper 1934). So ging man in Europa, auf Basis konsistenter empirischer Beobachtungen, sehr lange davon aus, dass alle Schwäne weiß sind – und entwickelte auch Erklärungen, warum es überhaupt nicht anders sein kann. 1697 hat dann der niederländische Seefahrer de Vlamingh in Australien erstmals schwarze Schwäne beobachtet – die ganze Theorie weißer Schwäne war falsch (Taleb 2007).
Abbildung 1.2: Empirie, Hypothesen und Theorie als Basis für Managemententscheidungen.
Im Zusammenspiel von Induktion und Deduktion werden dann Hypothesen möglich, die einen Abgleich von Modell (der theoretischen und abstrakten Vorstellung der Realität) und Fakten (der empirischen Beobachtung und Einordnung der Realität) ermöglichen (Blaug 1992 und Münter 1999). Entscheidungen von Managern sind immer Hypothesen auf Basis eines Modells, welches sich in der Realität bewähren muss – ohne ein Modell ist eine logische Entscheidung nicht möglich, da die bloße Wahrnehmung der Realität keine Entscheidbarkeit herbeiführt. So hilft es einem Manager relativ wenig, stundenlang eine Bilanz anzusehen, wenn er das Modell (doppelte Buchführung, Aktiva vs. Passiva, periodengerechte Abgrenzung und die zugehörigen Rechnungslegungsvorschriften) nicht kennt – ein Betrachten der Realität ohne Modell ermöglicht keine Schlussfolgerung und fundiert keine Entscheidung.
Fragen | Rationalität – warum heben Menschen 10-EUR-Scheine auf der Straße auf?
In den Wirtschaftswissenschaften – gleich ob BWL oder VWL – wird meist als Hypothese angenommen, dass sich Menschen rational verhalten oder rational entscheiden. Rationalität bedeutet, dass Menschen vernünftig denken und handeln, und dass dieses rationale Tun entsprechend der Präferenzen eines Menschen auf ein Ziel gerichtet ist. Rational ist eine Entscheidung oder ein Verhalten also dann, wenn eine Handlung nachvollziehbar und begründet auf ein Ziel orientiert ist, zunächst unabhängig der tatsächlichen Zielerreichung (Effektivität) oder des gewählten Mitteleinsatzes (Effizienz). Rationalität impliziert damit Freiheit zur Entscheidung und Auswahlmöglichkeiten.
Aus der Vielfalt philosophischer Erklärungen von Rationalität hat sich in den Wirtschaftswissenschaften ein Begriff entwickelt, der im Wesentlichen logisches, auf ein Ziel gerichtetes Handeln unter minimalem, also effizientem Mitteleinsatz, als rational bezeichnet. Damit ist klar, dass individuelle Rationalität – zumindest empirisch – eine große Vielfalt an Verhaltensmustern beinhaltet: weder haben alle Menschen die gleichen Ziele oder Präferenzen, noch sind die Begabungen oder die Fähigkeiten zu logischem Denken und Handeln aller Menschen gleich.
Die Annahme von Rationalität erlaubt allerdings, dass menschliches Verhalten in ökonomischen Situationen vorhersagbar wird: Menschen heben einen 10-EUR-Schein, der auf der Straße liegt, auf. Auf dieser Grundlage durch Anreize gesteuerter Handlungen können sowohl für Kunden wie auch für Manager Hypothesen über deren Entscheidungsverhalten in Märkten entwickelt werden, um dann im Zusammenspiel von Kundenverhalten und Unternehmensstrategie Vorhersagen für Preise oder Marktstrukturen abzuleiten. Oftmals wird gegen Rationalität eingewendet, dass Menschen lediglich ihren Gewohnheiten folgen oder in ihren Konsummustern andere Menschen imitieren oder beliebigen Trends folgen – all dies kann aber, je nach individueller Zielsetzung und individueller Befähigung zu Logik, durchaus vollständig rational sein (Smith 2003).
Der enge Rationalitätsbegriff ist aber nicht aufrechtzuerhalten, wenn psychologische, soziologische oder institutionenökonomische Aspekte des Verhaltens und der Entscheidungsfindung von Menschen im Rahmen empirischer Studien betrachtet werden (weiterführend Arthur 1994, DeMartino et al. 2006, Simon 1993 und Conlisk 1996). Menschen verhalten sich dann zwar weiterhin vorhersagbar – und nicht etwa erratisch oder rein zufällig – aber nur noch begrenzt rational. Damit wird die theoretische Vielfalt von Verhaltens- und Entscheidungsmustern nochmals ausgedehnt. Inkonsistenzen im Entscheidungsverhalten und damit begrenzte Rationalität werden umso deutlicher erkennbar, je komplexer die Entscheidungssituationen sind, je weniger ausgeprägt die Zielsetzungen menschlichen Handelns sind und je stärker Emotionen oder Wertvorstellungen eine Rolle spielen.
Daneben wirken sich häufig Unsicherheit und Risiko als auch dynamische, auf die fernere Zukunft gerichtete Erwartungen einschränkend auf die Rationalität von individuellem Verhalten oder Entscheidungen aus. Zudem spielen falsch verstandene Opportunitätskosten und Sunk Costs eine entscheidende Rolle bei kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen, die zu einem begrenzt rationalen Entscheidungsverhalten führen (weiterführend Kapitel 3 zu Behavioral Economics sowie Simon 1955 und Kahneman 2003).
Modelle, Daten, Ökonometrie und stilisierte Fakten
Aus mikroökonomischer Sicht sind Modelle theoriegeleitete Vorstellungen und Abbildungen der Realität, die empirisch fundiert sind. Modelle beschreiben dabei den Zusammenhang zwischen zwei oder mehr ökonomischen Variablen – bspw. dem Effekt von Werbeaufwand auf den Absatz eines Produktes. Empirische Daten der Entscheidungen – sei es von Kunden oder Managern – können aus Markt- und Wettbewerbsanalysen stammen. Zahlen, Daten und Fakten zu einzelnen Unternehmen aus der Unternehmensberichterstattung (Geschäftsberichte mit Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, insbesondere aber Lagebericht und Strategiepräsentationen) spiegeln immer Entscheidungen in Märkten wider. Wenn der Marktanteil von Villeroy & Boch in China ansteigt, dann ist das ein Abbild zahlreicher Entscheidungen von Kunden, des Managements von Villeroy & Boch sowie indirekt auch der Rückwirkungen der Entscheidungen der Wettbewerber von Villeroy & Boch, deren Marktanteile zurückgehen.
Um den Zusammenhang zwischen Werbeaufwand und Gewinn π eines Unternehmens systematisch zu analysieren, können bspw. Fakten aus der GuV oder Bilanz entnommen werden. Durch statistische Analysen und Methoden werden regelmäßige Muster in den Daten erkennbar, die dann zu modellhaften Erklärungen verdichtet werden, wie in Abbildung 1.3 skizziert.
Abbildung 1.3: Empirie und Theorie.
Dieser wechselseitige Abgleich von Daten und theoretischen Modellen wird als Ökonometrie bezeichnet – sie umfasst mathematische Datenanalyse und statistische Methoden, um theoretische Modelle anhand von Daten empirisch zu überprüfen, zu quantifizieren oder zu kalibrieren. In der Regel kommen hier verschiedene Formen von Regressionsanalysen auf Basis von Querschnittsdaten (einzelner oder vieler verschiedener Unternehmen einer oder mehrerer Industrien) oder Zeitreihendaten (Entwicklung bestimmter Größen im Zeitablauf) zum Einsatz und können mit Statistikprogrammen oder Excel durchgeführt werden (Kennedy 2008 sowie Davis und Pecar 2013).
Fragen | Lernen aus Daten – entscheiden künftig Maschinen?
Unternehmen setzen zum Erkennen von Mustern in Daten vielfältige statistische und mathematische Verfahren ein, um Entscheidungen vorzubereiten. Zahlreiche dieser Methoden und Verfahren analysieren Zusammenhänge in Daten, d.h. Korrelationen zwischen Variablen, die Varianz der Daten oder bedingte Wahrscheinlichkeiten wie in der Bayes‘-schen Statistik. Mit zunehmender Digitalisierung und Datenverfügbarkeit in Unternehmen finden hier zwei sich wechselseitig bedingende Entwicklungen statt: Big Data und künstliche Intelligenz werden regelmäßig von Unternehmen eingesetzt, um Entscheidungen zu verbessern.
Big Data – große und komplexe Datensätze aus sehr unterschiedlichen Quellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die schwach- oder unstrukturiert sind, und schnell oder sogar exponentiell anwachsen – ermöglicht weit bessere Analysen zur Entscheidungsvorbereitung, erfordert aber auch andere Analysemethoden. Eine Entwicklungsrichtung statistischer und mathematischer Algorithmen wird hier unter künstlicher Intelligenz zusammengefasst: Analyseverfahren, die selbständig aus Big Data lernen, mögliche Erklärungen entwickeln und Entscheidungsunterstützung bieten – oder ohne weiteren Eingriff eines Menschen eine Entscheidung treffen. Bereits in Anwendung finden sich auf Daten und Algorithmen basierte Lösungen zur automatisierten Preisbestimmung für Personal Pricing oder Dynamic Pricing (weiter dazu Kapitel 8).
Im Kern stehen bei der Anwendung von datengetriebener künstlicher Intelligenz die Prozesse Mustererkennung (‚Classification‘) und Vorhersage (‚Prediction‘), um auf Basis kausaler Erklärungen aus den Daten zunächst Entscheidungsoptionen und schließlich Entscheidungen abzuleiten (Pearl und Mackenzie 2018 sowie Spiegelhalter 2019). Mustererkennung in der Form von überwachtem oder tiefem Lernen zielt auf die Einordnung einer Entscheidungssituation. Vorhersage nutzt den vermuteten kausalen Zusammenhang, um aus den Daten die künftige Entwicklung abzuleiten. Big Data und künstliche Intelligenz als logisches Schlussfolgern sind damit lediglich neue Formen von Induktion und Deduktion – wenngleich in der Folge die Rollen von Menschen als Entscheidern im Zusammenspiel mit Daten und Algorithmen verändert werden, und damit auch der Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftswissenschaften (weiterführend Brynjolfsson et al. 2017, Loebbecke und Picot 2015, Mihet und Philippon 2019, Currie et al. 2020 sowie Acemoglu und Restrepo 2018).
Ob die Entwicklung unternehmerischer Entscheidungen ähnlich wie bei autonomem Fahren verlaufen wird – entlang einer fünfstufigen Klassifikation von assistiertem Entscheiden über geprüftes/überwachtes Entscheiden bis hin zu letztlich vollständig autonomen Entscheiden – ist in 2024 nicht abzusehen, aber unwahrscheinlich. Dagegen spricht einerseits die Komplexität gerade strategischer unternehmerischer Entscheidungen in nicht klar definierten Rahmenbedingungen (hier ist künstliche Intelligenz zumindest aktuell oft überfordert), andererseits aber insbesondere der Gestaltungswille von Menschen. Dagegen kann aber datengetriebene Entscheidungsunterstützung helfen, menschliche Entscheidungen auf Basis begrenzter Rationalität zumindest mit einer ‚anderen Entscheidungsoption‘ zu konfrontieren – und vielleicht zu besseren Entscheidungen beizutragen (Camerer 2019 und Kahr 2023 sowie Kapitel 3 zu Behavioral Economics).
Zahlreiche Studien (weiterführend Münter 2023) zeichnen aber die Entwicklungslinie vor – insbesondere das Zusammenspiel gut ausgebildeter und erfahrener Mitarbeiter mit Daten und Algorithmen, oft als Human-in-the-Loop bezeichnet, ermöglicht überlegene Lösungen: dies gilt für Ärzte in der Diagnostik, für Bankmitarbeiter bei der Kreditvergabe, und auch die Unternehmensberatung Bain hat angekündigt, die Projekte mit Klienten künftig durch die generative KI-Lösung ChatGPT unterstützen zu lassen (https://bain.com/vector-digital/partnerships-alliance-ecosystem/openai-alliance).
Die Rolle der künstlichen Intelligenz im Zusammenspiel mit Daten ist dabei Mustererkennung, Prognose sowie Entwicklung von Entscheidungsoptionen – der Mensch bringt dann gesunden Menschenverstand in Form von Urteilsvermögen, Erfahrung, Kreativität, sozialer Intelligenz, Empathie und Emotionen ein. Schließlich wird aber durch diese Arbeitsteilung in Form eines Supervised Learning der Algorithmus verbessert: er lernt aus der Auswahl, Bestätigung oder Korrektur durch den menschlichen Entscheider.
In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften werden Daten und Ergebnisse empirischer Studien in stilisierte Fakten verdichtet. Stilisierte Fakten beschreiben regelmäßig beobachtbare („typische“) und als wesentlich erachtete Grundzusammenhänge empirischer Studien, bspw. zwischen Werbeaufwand und Gewinn eines Unternehmens, und können als robuste empirische Regelmäßigkeiten dann Grundlage eines Modells sein. Das heute gängige Verständnis des Begriffs stilisierter Fakten geht auf Kaldor (1961) zurück:
„Any theory must necessarily be based on abstractions; but the type of abstraction chosen cannot be decided in vacuum: it must be appropriate to the characteristic features of the economic process as recorded by experience. Hence the theorist, in choosing a particular theoretical approach, ought to start off with a summary of the facts which he regards as relevant to his problem. Since facts, as recorded by statisticians, are always subject to numerous snags and qualifications, and for that reason are incapable of being accurately summarized, the theorist, in my view, should be free to start off with a ‘stylized’ view of the facts – i.e. concentrate on broad tendencies ignoring individual detail, and proceed on the ‘as if’ method, i.e. construct a hypothesis that could account for these ‘stylized’ facts, without necessarily committing himself on the historical accuracy, or sufficiency, of the facts or tendencies thus summarized.“ (Kaldor 1961, S. 177 f.).
Dabei ist zwangsläufig, dass immer auch den stilisierten Fakten widersprechende Beobachtungen aufzufinden sind: Wesentlich ist, sorgfältig zwischen Regelmäßigkeiten und Ausnahmen zu trennen. Ein theoretisches Modell beschreibt eine mögliche Erklärung einer regelmäßigen und als typisch erachteten empirischen Beobachtung.
Damit geht – im Gegensatz zu einer zufälligen Koinzidenz – eine Beschreibung einer Kausalitätsbeziehung einher, d.h. einer funktionalen Ursache-Wirkungs-Beziehung zur Erklärung eines Effektes. Im Rahmen eines Modells zu erklärende oder erklärbare Größen werden als endogene Variablen bezeichnet: In mikroökonomischen Modellen bspw. der Gewinn. Die zur Erklärung herangezogenen Größen sind exogene Variablen – bspw. die Marktstruktur oder die Wettbewerbsintensität in einer Industrie, können aber auch vom Unternehmen steuerbare Größen wie der Marketingaufwand oder die F&E-Strategie sein. Die funktionale Beziehung zwischen exogener und endogener Variable kann nur einen Teilaspekt einer Erklärung geben – zudem kann die Beziehung wechselseitig kausal sein. Sowohl endogene wie exogene Variablen können zudem von Größen außerhalb des Modells beeinflusst sein.
Experimente und Behavioral Economics
Entscheidungen lassen sich empirisch häufig nur ex post und indirekt – etwa über die Analyse getroffener Kaufentscheidungen oder umgesetzter Unternehmensstrategien – beobachten. Die indirekte Analyse von Entscheidungen auf Basis von Markt- und Wettbewerbsdaten hat mehrere Defizite, unter anderem Datenbeschaffung und -qualität, Vergleichbarkeit der Daten aus verschiedenen Industrien, Märkten, Regionen und Zeiträumen sowie die Auswahl und Spezifikation der richtigen ökonometrischen Methoden. Ein wesentlicher Nachteil ist aber, dass der Entscheidungsprozess nicht direkt beobachtbar ist: So sind zwar Folgen der Entscheidungen selbst, manifestiert in Marktanteilen oder Absatzzahlen von Smartphones, erkennbar, aber die eigentliche Entscheidung, die Rahmenbedingungen der Entscheidung oder die alternativ betrachteten Produkte sind nicht beobachtbar.
Vor diesem Hintergrund führen Mikroökonomen seit den 1980er Jahren verstärkt Experimente durch. Ziel ist, unter kontrollierten Laborbedingungen das Entscheidungsverhalten und insbesondere die Interaktion von Menschen in strategischen Entscheidungssituationen zu beobachten und zu analysieren. Ein starker Treiber für diese Experimente ist es, zu überprüfen, ob Menschen tatsächlich vollständig rational entscheiden und handeln, oder ob regelmäßige Abweichungen von vollständiger Rationalität beobachtet werden können: Tatsächlich haben die experimentell gewonnenen Erkenntnisse einen deutlichen Beitrag zur Entstehung von Behavioral Economics, der verhaltenswissenschaftlichen Analyse ökonomischer Entscheidungen, geleistet (weiterführend hierzu Kapitel 3). In den vergangenen Jahrzehnten wurden verstärkt Experimente durchgeführt, um individuelles Entscheidungsverhalten, dessen Einflussfaktoren und entstehende dynamische Interaktion zu untersuchen. Um die Robustheit der abgeleiteten Aussagen sicherzustellen, erweisen sich seit einiger Zeit standardisierte, computer- und simulationsgestützte Laborexperimente als wegweisend für die weitere Forschung.
Der Vorteil von ökonomischen Laborexperimenten ist, dass das Entscheidungsverhalten direkt, unter kontrollierten und veränderbaren Rahmenbedingungen (ähnlich den in Medizin und Psychologie verwendeten ‚Randomized Controlled Trials’) beobachtet werden kann. Somit kann eine einfache Prüfung der Konsistenz von Entscheidungen und Handlung, sowie des Ausschließens von alternativen Erklärungen stattfinden. Zudem können Erklärungen gefunden werden, die in abstrakten Daten (wie einer Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung) nicht erkennbar sind oder sich nicht einzelnen Entscheidungen zuordnen lassen. Mit Laborexperimenten sind aber eine Reihe von Nachteilen und Herausforderungen verbunden. Teilnehmer an einem Experiment sind sich natürlich über die Teilnahme bewusst. Damit rufen Laborsituationen bestimmte Verhaltensweisen hervor und unterdrücken andere: Es gibt Hinweise darauf, dass Teilnehmer sich den Erwartungen des Forschers oder gemäß der ‚üblichen Ergebnissen‘ eines Experiments verhalten wollen, zudem unterscheiden sich Laborsituationen in monetären und sozialen Nachwirkungen drastisch von Entscheidungen im richtigen Leben. Daneben werden zahlreiche Experimente, im Wesentlichen aus Kostengründen, mit Studierenden an Hochschulen durchgeführt, die eben gerade kein repräsentatives Abbild tatsächlicher Entscheider in realen Märkten sind. Jedoch bestätigen, wenngleich seltene, Tests mit Managern typische Ergebnisse der Experimente mit Studierenden (Kagel und Roth 2016 sowie Davis und Holt 1993).
Die Herausforderungen der Laborexperimente können in Teilen durch Feldexperimente gelöst werden – hier wird das Experiment, unbewusst für die Teilnehmer, in realen Umgebungen durchgeführt, bspw. mit tatsächlichen Kunden in Form unterschiedlicher Produktangebote oder Preise (sogenannte A/B-Tests) in ansonsten identischen Supermarktfilialen. Zudem werden diese Feldexperimente auch von Unternehmen, insbesondere online, durchgeführt – so zeigt bspw. der Versicherer CosmosDirekt potenziellen Kunden in Abhängigkeit der IP-Adresse unterschiedliche Produktpakete oder Produktanordnungen auf der Website, um das Entscheidungsverhalten der Kunden besser kennenzulernen (Levitt und List 2009, List und Reiley 2007 sowie Gneezy und List 2006).
1.2Märkte, Angebot und Nachfrage
Mikroökonomie beschäftigt sich mit der Funktionsweise von Märkten und den daraus entstehenden Marktergebnissen. Umgangssprachlich werden auf einem Markt Waren zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt. Um – auch für die nachfolgenden Kapitel – begriffliche Klarheit zu schaffen: Märkte sind Institutionen (Systeme, Regeln, Muster und Strukturen), in denen wiederkehrend Transaktionen zwischen Marktteilnehmern angestrebt oder durchgeführt werden. Im Einzelfall kann ein Markt räumlich, zeitlich oder inhaltlich eng definiert werden, bspw. als deutscher Automobilmarkt im Jahr 2018, auf dem Personenkraftwagen von Unternehmen verkauft und von Endkunden gekauft werden. Aber auch der automatisierte Handel zwischen Hochleistungscomputern über Rechenkapazität beschreibt einen Markt, ebenso wie der globale Handel von Emissionsrechten zwischen Unternehmen und Staaten.
Märkte als Institution
Märkte unterscheiden sich in ihren Systemen, Mustern und Strukturen in vielen Dimensionen – unter anderem nach
gehandelten Produkten und Dienstleistungen – bspw. der Aktienmarkt,
der Rolle und Anzahl der Marktteilnehmer – bspw. die mittelständischen Automobilzulieferer,
nach dem (Stand-)Ort – der Fischmarkt in Hamburg,
dem institutionellen Organisationsgrad – bspw. zugelassene Teilnehmer an einer Mobilfunklizenzauktion der Bundesnetzagentur,
dem Informationsgrad und dem Informationsaustausch der Marktteilnehmer – bspw. Verhandlungen im Rahmen einer M&A-Transaktion,
sowie der Art der Preis- und Mengenbestimmung – bspw. verbrauchsabhängige Datenpakete.
Die Funktionsweise von Märkten hat sich dabei evolutorisch über viele Jahrhunderte in den Leitplanken des jeweiligen Rechtssystems und vor dem Hintergrund technologischer Entwicklungen entwickelt und beeinflusst maßgeblich die Verhaltensweisen der Marktteilnehmer. In diesem Sinne funktioniert der Aktienmarkt selbstverständlich anders als eine M&A-Transaktion – obwohl in beiden Fällen Unternehmensanteile gehandelt und übertragen werden.
Zusammengefasst werden Systeme, Muster und Strukturen der Märkte als Institutionen bezeichnet: Institutionen beschreiben allgemein bekannte Verhaltensmuster und Regeln, die von Marktteilnehmern bei wiederkehrenden Transaktionen angewendet werden und das typischerweise beobachtbare Verhalten auf Märkten beschreiben und erklären helfen. Institutionen erstrecken sich von unverbindlichen Konventionen und allgemein anerkannten Spielregeln zwischen den Marktteilnehmern, die sich bewähren, bis hin zum Rechtssystem, welches insbesondere den Eigentumsbegriff, -rechte und -übertrag in Märkten festlegen. Zweck und Ziel von Institutionen ist dabei einerseits Unsicherheit in Märkten zu reduzieren, andererseits Handlungsmöglichkeiten so zu gestalten, dass Transaktionen überhaupt stattfinden können.
Institutionen kommt damit eine maßgebliche Rolle für die Funktionsfähigkeit sowie die Effizienz von Märkten zu und erklären gleichzeitig im internationalen Vergleich unterschiedliche Wachstumspfade von Volkswirtschaften – bspw. vor dem Hintergrund sehr unterschiedlich geprägter Eigentums- und Entscheidungssysteme in Kapitalismus, Kommunismus oder absolutistischen und diktatorischen Systemen (Voigt 2019 sowie Acemoglu und Robinson 2012). Werden Transaktionen nicht in allgemein zugänglichen Märkten ausgeführt, sondern innerhalb der Familie, auf Schwarzmärkten, innerhalb von Unternehmen oder durch den Staat, sind häufig fehlende oder nicht funktionierende Institutionen und zu hohe Transaktionskosten dafür verantwortlich.
Die Institutionen eines Marktes sowie insbesondere die Preis- und Mengenbestimmung können zahlreiche Ausprägungen annehmen – die Bandbreite reicht von spontanen Transaktionen, bei denen sich die Marktteilnehmer immer wieder neu auf die Art der Abwicklung der Transaktion verständigen und den Preis verhandeln, über Auktionen mit veränderlichen Preisen (wie bspw. bei der Versteigerung von Antiquitäten oder Werbeplätzen bei Google) bis hin zu regulierten Märkten, in denen der Staat oder der Betreiber des Marktes sowohl mögliche Transaktionen als auch Modelle und Vorgehensweise zur Preisfindung sowie Abwicklung der Transaktionen festlegt. Dies ist bspw. der Fall beim Handel von Wertpapieren. Der Betrieb des Marktes (die Börse) sowie die Teilnahme sind genehmigungs- und anmeldepflichtig, die Art der durchführbaren Geschäfte, die möglichen Produkte sowie die Art der Preisermittlung und Abwicklung einer Transaktion sind in Deutschland über das Börsen- und das Wertpapierhandelsgesetzt nahezu vollständig determiniert, zudem wird jede Transaktion von der Börsenaufsicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht überwacht.
Außerdem verändern sich Märkte teilweise drastisch im Zeitablauf getrieben durch Veränderungen der Präferenzen der Kunden, Innovationen und technologischen Neuerungen auf Seite der Unternehmen und Regulierung durch den Staat und veränderte Institutionen sowie durch Rückwirkungen aus Veränderungen in anderen Märkten.
Produktmärkte, Faktormärkte und Transaktionskosten
Eine erste hilfreiche und vereinfachende Strukturierung ist, die Marktteilnehmer als Käufer (die Nachfrageseite) und Verkäufer (die Angebotsseite) eines Produktes, einer Dienstleistung oder eines sonstigen Gutes (bspw. Rechte, Informationen, Daten oder Derivate auf originäre Produkte) zu klassifizieren. Wenn die Angebotsseite durch Unternehmen gegeben ist, werden diese in Summe als Industrie (bspw. Telekommunikationsindustrie, Pharmaindustrie oder Finanzdienstleistungsindustrie) bezeichnet. Übergeordnet sind Wirtschaftszweige (wie bspw. verarbeitendes Gewerbe, Bildung oder Baugewerbe), untergeordnet sind Produkte (bspw. auf Basis der SIC/ISIC-Klassifizierung als PKWs, Girokonten oder Smartphones). In Produktmärkten werden physische oder digitale Produkte zwischen Unternehmen (B2B) oder zwischen Unternehmen und Kunden (B2C) gehandelt, in Faktormärkten werden Arbeit und Kapital als Einsatzfaktoren für Produktion und Dienstleistung auf dem Arbeitsmarkt und dem Kapitalmarkt gehandelt.
Mit der Durchführung einer Transaktion auf einem Markt sind Kosten verbunden: Such- und Informationskosten der Marktteilnehmer, Provisionen, Dienstleistungen von Intermediären zur Anbahnung eines Vertragsabschlusses oder Abwicklung der Transaktion und die Nutzung des Marktes als solcher. Diese Kosten werden als Transaktionskosten bezeichnet. Da Transaktionskosten meist an den Übergang von Eigentumsrechten gebunden sind, führt ein verlässliches und allgemein akzeptiertes Rechtssystem zu einer Senkung von Transaktionskosten – umgekehrt erfordert ein schlechtes Rechtssystem jeweils umfangreiche Vertragsverhandlungen oder ggfs. Schmiergeldzahlungen und erhöht die Transaktionskosten. Wenn diese Transaktionskosten zu hoch sind, kommt eine Transaktion entweder nicht zustande, oder aber sie wird in einer anderen Institution – bspw. einem Unternehmen – abgebildet (Kapitel 4). Umgekehrt bedeuten Transaktionskosten gleich Null, dass alle Marktteilnehmer vollständige Information besitzen – die Suche nach besseren Angeboten oder die Verhandlung von Preisen wären dann unnötig.
Marktangebot, Marktnachfrage, Preise und Mengen
Eine zentrale mikroökonomische Fragestellung ist, wie sich in einem Markt durch das Zusammenspiel von Käufern und Verkäufern Preise und Mengen bilden. Die Analyse von Märkten im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage versucht – aus unterschiedlichen Blickwinkeln – herauszufinden, welche Anzahl an Transaktionen, mit welchen Mengen und zu welchen Preisen, zustande kommen und wie groß die Erlöse, also Preis multipliziert mit Menge, sind.
So wurden durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage 2016 in Deutschland 23,7 Mio. Smartphones zu einem durchschnittlichen Preis von 407 EUR verkauft (Statista 2017). Damit ergibt sich ein Erlös (gleichbedeutend mit Umsatz) im Gesamtmarkt von 9,65 Mrd. EUR. Um eine erste Erklärung für das Zustandekommen dieses Marktergebnisses zu verstehen, werden jetzt Nachfrageseite und Angebotsseite getrennt voneinander betrachtet.
In Abbildung 1.4 links ist die (hypothetische) Nachfrage nach Smartphones in Deutschland abgebildet, die bspw. über eine Kundenbefragung der Zahlungsbereitschaft („Wären Sie bereit, für 150 EUR ein Smartphone zu kaufen? Würden Sie es auch für 250 EUR kaufen?“) ermittelt werden kann. Die individuelle Zahlungsbereitschaft eines Kunden gibt an, welchen Preis dieser Kunde maximal für ein Smartphone einer bestimmten Qualität oder Marke zu zahlen bereit wäre. In Abbildung 1.4 rechts sind die individuellen Zahlungsbereitschaften durch eine – hier vereinfachend linear angenäherte – Linie als Nachfragekurve des gesamten Marktes verbunden. Nachfragekurven können allerdings, abhängig von den tatsächlichen Marktforschungsdaten, auch nahezu beliebige andere funktionale Formen annehmen. Für eine lineare Nachfragefunktion können durch die Schnittpunkte mit der Preis- und Mengenachse jetzt zwei wichtige Informationen ermittelt werden: (1) Kein Kunde ist bereit, mehr als 1.000 EUR für ein Smartphone zu bezahlen, und (2) 40 Mio. Kunden würden ein Smartphone zu einem Preis von 0 (also geschenkt) annehmen.
Abbildung 1.4: Zahlungsbereitschaft und Nachfragekurve für Smartphones.
Die Nachfragekurve verläuft anhand unterschiedlicher Zahlungsbereitschaften der Kunden fallend: Je höher der Preis, desto niedriger ist die Nachfrage nach einem Produkt. Aus diesen Informationen lässt sich eine – hier vereinfachend linear angenommene – Nachfragefunktion rekonstruieren. Eine (inverse) Nachfragefunktion beschreibt den wechselseitigen funktionalen Zusammenhang zwischen nachgefragter Menge qD (in Mio. Smartphones) in Abhängigkeit des Preises p (in EUR) bei sonst unveränderten Rahmenbedingungen, in diesem Beispiel als
a bezeichnet die maximale Zahlungsbereitschaft im Markt (hier 1000 EUR) und b gibt die Steigung der Nachfragefunktion an, die hier wegen beträgt. Mit jeder Preissenkung um 25 EUR steigt die nachgefragte Menge an Smartphones um 1 Mio. an. Umgekehrt kann man durch Division der maximalen Zahlungsbereitschaft mit der Steigung der Nachfragefunktion die maximale Nachfrage des Marktes als ermitteln, maximal 40 Mio. Stück. ist damit ein Indikator für die Größe der Nachfrage in einem Markt – je kleiner b ist, desto größer ist die maximale Nachfrage.
Determinanten der Zahlungsbereitschaft der Kunden sowie des Verlaufs und der Lage der Nachfragekurve in einem Markt sind neben dem Preis auch das Einkommen, die Preise anderer Produkte, das Verhalten anderer Kunden, die Qualität der Produkte und das Marketing der Unternehmen (weiterführend Kapitel 2 und Kapitel 3) – so steigt die Nachfrage nach Smartphones mit steigendem Einkommen, aber insbesondere mit günstigen Datentarifen. In Abbildung 1.5 ist skizziert, dass eine Veränderung der Zahlungsbereitschaft aller Kunden die Nachfragekurve parallel verschiebt, eine Veränderung der Größe des Marktes führt zu einer Drehung der Nachfragekurve. Der fallende Verlauf der Nachfragekurve hat zwei Ursachen, die auf Preisveränderungen beruhen: Den Substitutionseffekt und den Einkommenseffekt. Der Substitutionseffekt beschreibt, dass Kunden bei steigenden Preisen auf vergleichbare Produkte ausweichen, weil diese relativ günstiger sind – so weichen einige Kunden bei steigenden Preisen von Samsung Smartphones auf kostengünstigere Alternativen aus. Der Einkommenseffekt entsteht, weil bei konstantem Einkommen und gleichzeitig steigenden Preisen die Kaufkraft sinkt – Preissteigerungen bei Datentarifen führen dann dazu, dass bei gleichem Einkommen weniger Daten konsumiert werden können.
Abbildung 1.5: Veränderungen der Nachfragefunktion.
In gleicher Weise wie auf der Nachfrageseite kann man durch Befragung der Unternehmen oder Marktforschung deren individuelle Bereitschaft ermitteln, in Abhängigkeit eines erzielbaren Preises ein Smartphone anzubieten. Determinanten des Angebots sind neben dem erzielbaren Preis ganz wesentlich Technologie, Produktionskapazität und Kostensituation eines Unternehmen sowie die mit einem bestimmten Preis verbundene Gewinnerwartung, aber auch das Verhalten der Wettbewerber (vgl. weiterführend Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 10) – wenn die Kosten für die Herstellung von Touchscreens sinken, werden die meisten Smartphone-Hersteller ihre Produktion und das Angebot ausweiten, dagegen führen Produktionsausfälle bei Chiplieferanten zu einem Rückgang des Angebots.
In Abbildung 1.6 links ist das (hypothetische) Angebot verschiedener Unternehmen angegeben, zu einem bestimmten Preis Smartphones am Markt anzubieten. Die individuelle Bereitschaft der Unternehmen, Smartphones anzubieten, steigt, je höher der erzielbare Preis ist. In Abbildung 1.5 rechts sind die individuellen Angebote der Unternehmen mit einer Angebotskurve des gesamten Marktes verbunden. Die Angebotsfunktion beschreibt den funktionalen Zusammenhang zwischen angebotener Menge qS (wieder in Mio. Stück) in Abhängigkeit des Preises p bei sonst unveränderten Rahmenbedingungen. Diese lässt sich – anlog zur Nachfragefunktion – rekonstruieren und ergibt sich als
Ab einem erzielbaren Preis von 360 EUR werden Smartphones angeboten, mit jedem zusätzlichen Marktpotenzial von 1 Mio. Stück werden Unternehmen in den Markt eintreten, die Produktion ausweiten und ihre Preise um 2 EUR erhöhen.
Abbildung 1.6: Individuelles Angebot und Angebotskurve für Smartphones.
Marktgleichgewicht und Marktpreis
In einem stark vereinfachten Modell können nun Angebots- und Nachfragekurve zusammen betrachtet werden. Offensichtlich ergibt sich in Abbildung 1.7 links ein Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage, der als Marktgleichgewicht wechselseitig die Menge und den Preis bestimmt. Ein Marktgleichgewicht ist die einzige Preis-Mengen-Kombination, an dem die nachgefragte Menge qD exakt der angebotenen Menge qS entspricht. Durch den Schnittpunkt der beiden Kurven wird der Gleichgewichtspreis bestimmt, der die nachgefragte Menge und die angebotene Menge ausgleicht. Eine wesentliche Erkenntnis ist: Jeder Kunde, dessen Zahlungsbereitschaft größer oder gleich dem Gleichgewichtpreis ist, kann zu diesem Preis ein Smartphone kaufen – jedes Unternehmen, dass zu diesem Gleichgewichtspreis oder darunter bereit ist anzubieten, kann zu diesem Preis ein Smartphone verkaufen. Genau unter dieser Bedingung kommen Transaktionen zustande.
Durch Gleichsetzen der beiden Funktionen (1.1) und (1.2) mit
Abbildung 1.7: Marktgleichgewicht als Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve.
Ein einheitlicher Marktpreis und ein Marktgleichgewicht ist typisch und zu erwarten, wenn
die gehandelten Produkte absolut identisch sind, so dass keine Produktdifferenzierung vorliegt oder Kunden Präferenzen für einen bestimmten Verkäufer haben,
alle Marktteilnehmer über die gleichen vollständigen Informationen verfügen, also jeder Marktteilnehmer alle anderen Marktteilnehmer kennt und/oder über deren Zahlungsbereitschaft und Preisvorstellung Kenntnis hat,
Wettbewerb zwischen den Verkäufern herrscht, d.h. keine Absprachen über Preise oder anderweitige strategische Verhaltensweisen vorliegen,
beide Marktseiten zahlreiche Marktteilnehmer haben, so dass keiner der Marktteilnehmer durch sein Verhalten Preise oder Mengen beeinflussen oder sogar festlegen kann, und
eine Koordination auf den Gleichgewichtpreis möglich ist, d.h. Preise sind per se flexibel und die Transaktionskosten der Marktteilnehmer sind vernachlässigbar klein.
Wenn eine oder mehrere dieser Anforderungen nicht hinreichend erfüllt sind, kann es sein, dass unterschiedliche Marktpreise zu einem Zeitpunkt existieren. In den folgenden Kapiteln werden sukzessiv diese vereinfachenden Annahmen aufgehoben, um ein detailliertes Bild des Marktmechanismus, der Entscheidungen der Kunden und insbesondere der strategischen Entscheidungen der Unternehmen zu erhalten.
Ein Markt, für den die genannten Anforderungen allerdings recht gut erfüllt sind, ist der Aktienmarkt:
Eine Daimler-Aktie ist durch ihre ISIN DE0007100000 ein homogenes Produkt, die Preise an den verschiedenen Börsen sind bei Aktien sehr hoher Liquidität in jedem Zeitpunkt nahezu identisch, zudem spielt es für die Kunden keine Rolle, an welcher Börse oder über welchen Broker sie die Aktie kaufen.
Die Marktteilnehmer, d.h. Käufer und Verkäufer, können zu jedem Zeitpunkt das Orderbuch der jeweiligen Börsen einsehen – dort sind identisch zu einer Angebots- und einer Nachfragefunktion alle aktuell gebotenen Kauf- und Verkaufspreise und die jeweiligen Stückzahlen aufgelistet (www.onvista.de/aktien/orderbuch/Daimler-Aktie-DE0007100000 oder innerhalb der Deutschen Börsewww.boerse-frankfurt.de/aktien/orderbuch).
Alle Marktteilnehmer konkurrieren – jeder möchte für sich individuell den jeweils besten Verkaufs- oder Kaufpreis realisieren.
Beide Marktseiten bestehen aus vielen Tausend Marktteilnehmern und jeder Marktteilnehmer ist – relativ zur Größe des Marktes betrachtet – klein und kann den Aktienkurs (den Preis der Aktie) nicht maßgeblich beeinflussen.
Die Deutsche Börse (wie auch andere Börsenbetreiber) koordiniert Angebot und Nachfrage für jede Aktie zu jedem Zeitpunkt über Market Maker oder Designated Sponsors auf den Gleichgewichtspreis.
In der Folge schwanken allerdings die Aktienpreise sehr stark: Ein Marktgleichgewicht bedeutet nicht stabile oder starre Preise, sondern ein nahezu sofortiger Ausgleich von Angebot und Nachfrage durch Preisflexibilität führt zu ständiger Preisanpassung und schwankenden Preisen.
Marktmechanismus und Veränderungen eines Marktgleichgewichtes
Ob ein Marktgleichgewicht erreicht wird, hängt unter anderem davon ab, ob Abweichungen von einem Marktgleichgewicht im Zeitablauf durch Mengen- und Preisanpassungen korrigiert werden. In Abbildung 1.8 links liegt ein Preis p1 zufällig über dem Gleichgewichtspreis p0. In der Folge übersteigt bei diesem Preis p1 das Angebot der Unternehmen die Nachfrage der Kunden, so dass es zu einem Überschussangebot kommt – bspw. in Form zu viel produzierter Ware oder einem hohen Lagerbestand. Dieses Überschussangebot können die Unternehmen beseitigen, indem sie die Preise von p1 auf p0 senken. Damit steigt die nachgefragte Menge der Kunden an und das Marktergebnis bewegt sich in Richtung des Marktgleichgewichtes.
Abbildung 1.8: Überschussangebot und Überschussnachfrage.
Analog, in Abbildung 1.8 rechts dargestellt, folgt aus einem Preis p2 < p0 eine Überschussnachfrage. Die Unternehmen können nun die Preise erhöhen, in der Folge geht die nachgefragte Menge zurück und das Marktgleichgewicht wird wieder erreicht. Ohne Preisflexibilität und die ausgleichende Wirkung der Preise kann kein Marktgleichgewicht erreicht werden.
Abbildung 1.9: Verschiebung von Angebots- oder Nachfragefunktion und Anpassung des Marktgleichgewichtes.
In ähnlicher Weise wird ein neues Markgleichgewicht determiniert, wenn sich die Rahmenbedingungen im Markt ändern und sich die Angebots- und/oder Nachfragekurve verschieben. In Abbildung 1.9 links erhöhen die Unternehmen für jeden Preis ihre angebotene Menge, so dass sich die Angebotskurve nach rechts verschiebt. Der Grund hierfür könnten bspw. Kostensenkungen bei Zulieferern sein. In der Folge wird das höhere Angebot auch verkauft, allerdings müssen die Unternehmen die Preise reduzieren, um die höhere Produktionsmenge zu verkaufen. In Abbildung 1.9 rechts steigt die Nachfrage – bspw. aufgrund zunehmenden Einkommens. In der Folge verschiebt sich die Nachfragekurve nach rechts – die Unternehmen können jetzt mehr absetzen und zudem die Preise erhöhen. Wie stark diese Effekte sind, wird wesentlich durch den Verlauf und die Steigung der Nachfrage- und der Angebotskurve bestimmt und in Kapitel 1.3 erläutert.
Die Effekte der Anpassung an ein (neues) Marktgleichgewicht in Abbildung 1.8 und Abbildung 1.9 erfordern je nach Marktsituation, Informationsstand der Marktteilnehmer und Ausmaß der Anpassung natürlich Zeit und einen Lernprozess der Marktteilnehmer – man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Markt zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht ist, sondern man wird in der Regel dynamische Anpassungsprozesse beobachten.
Fragen | Warum funktionieren Märkte so gut, warum ist der Staat oft ein schlechter Unternehmer?
Um in einer Gesellschaft gute oder sogar bestmögliche ökonomische Lösungen zu erreichen, konkurrieren prinzipiell drei verschiedene Institutionen: der Markt, die Unternehmen und der Staat. Welche Institution die besten Lösungen effizient hervorbringt, kann nicht allgemein gesagt werden – es hängt davon ab, welches Problem zu lösen ist, welche Anreize im Fall der Problemlösung gegeben sind, und ob der Marktmechanismus funktioniert (Kapitel 7 zu möglichem Marktversagen). In zahlreichen Ländern entstehen gerade – aus Unzufriedenheit mit Lösungen, die Märkte hervorbringen – Forderungen, vermeintliche ‚kapitalistische Märkte‘ zugunsten von ‚mehr Staat‘ zurückzudrängen (weiterführend Fuest 2020 sowie Fuest und Grimm 2024), vor allem wenn es um Klimaerwärmung oder ungleiche Einkommensverteilung geht, aber auch bei Insolvenzen von Unternehmen, zur Lenkung von Investitionen oder Innovationen, oder zur Unterstützung von internationaler Wettbewerbsfähigkeit.
Grundlegend ist zunächst zu erkennen, dass Märkte selbst eine gesellschaftliche Innovation sind. Märkte erlauben ein Ausprobieren von neuen Produkten oder Geschäftsmodellen, in denen sich gute Ideen gegen schlechte Ideen durchsetzen und damit Anreize für Unternehmen oder Konsumenten haben, sich nach besten Lösungen umzusehen (von Hayek 1968 und 1975). Das funktioniert so gut, weil Unternehmen und Kunden eindeutige Zielfunktionen haben – Unternehmen wollen Gewinne erzielen, um Überlebensfähig zu sein, Kunden wollen ihren Präferenzen entsprechend konsumieren, um ihren Nutzen und ihre Zufriedenheit zu steigern. Deshalb setzen Unternehmen und Entrepreneure auch neue Ideen und Innovationen um: Sie versprechen sich davon Gewinne.
Beide Marktseiten haben also Anreize, nach besseren Lösungen zu suchen: Dieser dezentrale Such- und Koordinationsprozess ist der Kern der zuerst von Adam Smith (1776) beschriebenen unsichtbaren Hand, die Märkte koordiniert und in der Wirkung des Preismechanismus sichtbar wird. Märkte erzeugen Information, unter anderem in Form von Preisen. Wenn ein Kunde mit einem Verkäufer über einen Preis verhandelt, verdichten beide alle vorhandenen Informationen (Produktionskosten oder die Wettbewerbssituation auf Seite des Verkäufers, Zahlungsbereitschaft und alternative Produkte auf Seite des Kunden) in eine einzige Zahl – die dann alle relevanten Informationen in Form eines Preises enthält.
Hohe Preise zeigen Knappheit und mögliche Gewinne an, niedrige Preise zeigen fehlende Attraktivität der Lösung und kaum Gewinnmöglichkeiten an, und steuern so unsichtbar das Handeln von Unternehmen und Konsumenten in Märkten. Hohe Preise signalisieren für Unternehmen Anreize für Innovation oder schaffen neue Marktsegmente, niedrige Preise lenken indirekt Ressourcen (Ideen, Anstrengungen, Kapital und Arbeit) hin in effiziente Einsatzmöglichkeiten mit höherer Rentabilität. Die Suche der Kunden nach guten Lösungen wird auch an Supermarktkassen sichtbar: Die Wartezeit an allen Kassen ist in etwa gleich lang, weil alle Kunden nach der schnellsten Kasse Ausschau halten und damit im Wettbewerb ihr Verhalten optimieren – in der Folge sind alle Warteschlangen zu jedem Zeitpunkt fast gleich lang (Frank 2011). In ähnlicher Weise stehen alle Kunden an der ‚besten Eisdiele‘ an und signalisieren so anderen Kunden hohe Qualität oder bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.
In diesem Sinn schaffen Märkte regelmäßig spontane Ordnung in Situation, die ein zentraler Koordinator (wie bspw. der Staat) kaum überschauen oder steuern könnte (Sugden 1989 und Preda 2009). Märkte koordinieren also Transaktionen zwischen Unternehmen und Kunden und schaffen evolutorisch und dezentral die dazu notwendige Ordnung oder Struktur: Niemand erfindet einen Markt – ein Markt entsteht und organisiert sich von selbst, weil er für alle Marktteilnehmer vorteilhaft ist. Die Koordination im Markt erfolgt ohne zentrale Steuerung, vielmehr passen sich die Strukturen dezentral und dynamisch den Anforderungen der Marktteilnehmer an. Märkte, die eine große Menge an Informationen hervorbringen oder verarbeiten können, führen dann zu effizienten Lösungen und optimalen Transaktionen. Umgekehrt behindern Informationsasymmetrie und fehlende Informationen die Funktionsfähigkeit und Effizienz von Märkten. Geringe Informationsdichte, schlechte oder falsche Informationen können zu Spekulation und Blasenbildung in Märkten führen, oder einen Markt zusammenbrechen lassen.
Anders als Unternehmen und Kunden hat der Staat keine eindeutige ökonomische Zielfunktion: Die Steigerung des Gemeinwohls in der Gesamtheit einer Gesellschaft ist ein ungleich komplexeres Problem – es beinhaltet unter anderem Ziele der Gleichheit, der Verteilungsgerechtigkeit, der Freiheit und der Sicherheit – zumal die Wahl der Maßnahmen und Methoden zur Erreichung dieses Ziels der politischen Willensbildung unterliegen. Zudem kennt der Staat weder alle Produktionsmöglichkeiten (bspw. Technologien oder Ressourcen), noch die Präferenzen aller Konsumenten – es liegt somit ein umfangreiches Informationsdefizit vor, dass eine zentrale Planung ökonomischer Aktivitäten durch den Staat unmöglich macht. Dies wird ums so deutlicher sichtbar, wenn sich Präferenzen der Kunden oder technologische Möglichkeiten im Zeitablauf verändern. Der Staat unterliegt hier also einer ‚Anmaßung von Wissen‘ (von Hayek 1975) – und entscheidet in der Regel aufgrund von Eigeninteresse der Politiker, politischer Macht von Behörden oder durch gezielte Beeinflussung durch Lobbygruppen anders, als Unternehmen oder Kunden frei im Markt entscheiden würden – in der Regel schlechter.