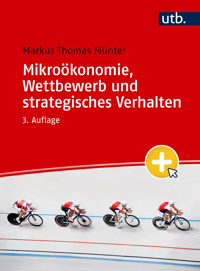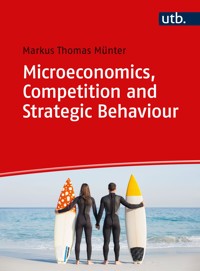Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wettbewerb richtig analysieren und überlegene Strategien entwickeln! Der immer rasantere Wettbewerb bestimmt Marktanteile und letztlich auch den Erfolg eines jeden Unternehmens. Doch wie wirkt sich dies auf die Strategie von Unternehmen aus? Markus Thomas Münter zeigt, wie sich Markstrukturen durch Wettbewerb konkret verändern und wie Unternehmen ihre spezifischen Fähigkeiten erfolgreich einsetzen können, um im Wettbewerb zu bestehen. Auf Besonderheiten digitaler Geschäftsmodelle geht er ein. Auch spieltheoretische Ansätze zieht er zur Erklärung heran. Ein spannender Einstieg für alle, die ökonomische Zusammenhänge in Management, Consulting und Studium schnell und anwendungsorientiert verstehen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Thomas Münter war 15 Jahre Unternehmensberater und im Management von Finanzdienstleistern. Seit 2014 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomie, an der htw saar.
Markus Thomas Münter
Wettbewerb und Unternehmensstrategie
für Management und Consulting
Umschlagabbildung: © merovingian | iStockphoto
Autorenbild: © privat
DOI: https://doi.org/10.24053/9783739881928
© UVK Verlag 2022
- ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorwort
Warum scheitern Unternehmen? Sie haben entweder keine Strategie – oder die Strategie ist schlecht. Ist es so einfach? Ja und nein. Natürlich gibt es neben der Strategie noch viele weitere Einflussfaktoren für den Erfolg und die Überlebensfähigkeit von Unternehmen, aber die richtige Strategie ist von diesen Einflussfaktoren mitbestimmt und kann dann auch beitragen, dass das eigene Unternehmen überlebt.
Ich habe, bevor ich an die Hochschule zurückgekommen bin, 15 Jahre lang – davon etwa die Hälfte als Unternehmensberater, die andere Hälfte als Manager – teils unfreiwillig Feldforschung betrieben und beobachtet, wie ‚Strategie gemacht‘ wird, im Wesentlichen für und in Banken und Finanzdienstleistern, aber auch in der Telekommunikationsindustrie, bei Versicherungen und Technologie-Plattformen. Einige der Strategien haben sehr gut funktioniert, andere überhaupt nicht. Ich habe natürlich nicht nur zugesehen, manchmal habe ich auch geholfen, Strategien zu entwickeln und umzusetzen – auch hier hat natürlich nicht alles funktioniert. Eines hatten aber zumindest alle ‚meine Strategien‘ gemeinsam – sie haben den Markt berücksichtigt, das Verhalten und die möglichen Reaktionen der Wettbewerber, und sie waren quantitativ hinterlegt.
Was sind die häufigsten Defekte von Strategien in Unternehmen? Aus meiner Sicht sind es zwei wesentliche Treiber, die oft – obwohl in sich widersprüchlich – zusammenwirken:
Monopolartiges Verhalten – Vorstände und Geschäftsführer und Entscheidungsgremien wie Management Boards denken und handeln, als wäre das Unternehmen ein Monopolist. Damit sind meist zwei Probleme verbunden: zum einen wird der Wettbewerb nicht berücksichtigt, zum anderen erliegt man nach Innen und Außen einer Gestaltungsillusion, bis hin zu einer Hybris von aktuellen Vorständen und Managern. Oft endet dann sowohl die Strategie wie auch der Vertrag des Managers, weil der Markt oder die Wettbewerber ‚überraschend‘ auch eine Rolle spielen. Zudem geht mit dem monopolartigen Verhalten, welches kaum Fokus und Energie auf den Markt verwendet, eine zu starke Innenorientierung einher – Unternehmen beschäftigen sich im Rahmen von übergroßen Meetings und Reorganisationen mit sich selbst, statt mit den Wettbewerbern.
Veränderungsresistenz – die Trägheit der Organisation und Pfadabhängigkeiten dominieren Entscheidungen. Damit geht zum einen ein Status Quo-Bias (‚haben wir schon immer so gemacht‘ versus ‚so wie Sie das vorschlagen, hat das noch nie funktioniert‘) einher, anderseits eine oft erstaunliche Energie, nicht zu entscheiden. In vielen Unternehmen werden zahlreiche strategische Optionen entwickelt, aber nicht umgesetzt. Gründe sind im Wesentlichen in der Governance der Unternehmen (‚das gehört nicht zu unserem Auftrag‘, ‚das müssen wir aber nochmal abstimmen‘ oder ‚das kriegen wir beim Aufsichtsrat nie durch‘) zu sehen und in falschen oder fehlenden wirklichen Anreizstrukturen für Entscheider versteckt. Zudem scheinen in vielen Unternehmen sehr viele Menschen erklären zu können, warum irgendwas gerade jetzt oder überhaupt nicht geht.
Strategie ist also nicht ‚Everybody’s Darling‘. Viele – auch erfolgreiche – Unternehmen vertrauen auf ihre gelebten Routinen oder unternehmerischen Mut, statt sich mit analytischem Herangehen neue Chancen zu erschließen. Insbesondere werden – der Politik nicht unähnlich – oft mit viel taktischem Bauchgefühl Trends und Mehrheitsmeinungen in der Organisation erspürt und aufgegriffen, um dann mit viel Konsens, aber konfliktfrei eine Strategie festzulegen, die insbesondere den Besitzstand wahrt und innerhalb der Organisation den Führungsprozess erleichtert. Viele Unternehmen scheitern aber, weil sich die Organisation selbst keine langfristige Strategie zutraut, da Strategie häufig Veränderung bedeutet und erfordert und über taktische und kurzfristige Initiativen hinausgeht.
Vor diesem Hintergrund ist dieses Buch entstanden. Erstens ist das Ziel, den Mehrwert von klarer quantitativer Wettbewerbsanalyse und dem Durchspielen strategischer Entscheidungen aufzuzeigen, zweitens sollen typische Muster von unzureichender Strategieentwicklung deutlich werden, drittens sollen Hinweise für den richtigen Einsatz im ‚richtigen Leben‘ eine Anwendbarkeit ermöglichen.
Hier sind aber zwei Sicherheitshinweise notwendig:
Strategie ist immer industrie- und unternehmensspezifisch, jede Industrie hat ihre eigene Logik und Pfadabhängigkeit, jedes Unternehmen besteht aus Menschen und hat seine eigene Identität und Kultur. Bspw. haben Telekommunikationsindustrie und Finanzdienstleistungsindustrie je ihre eigene Industrielogik und Wettbewerbsdynamik, genauso unterscheiden sich unternehmensspezifische Fähigkeiten und Strategien innerhalb der Finanzdienstleisterindustrie, bspw. von Deutscher Bank und Commerzbank. Mit anderen Worten: dieses Buch liefert keine kochbuchartigen Anweisungen für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie, die in jedem Unternehmen und in jeder Industrie gilt.
Eine der häufigsten Fragen in Unternehmen ist: ‚Rechnet sich das?‘ Damit ist klar, dass Strategie nicht auf Leadership oder den Geistesblitzen von Vorständen basiert, sondern auch eine quantitative Dimension hat – jedes (wenn jemand ein Gegenbeispiel kennt, bitte Info an mich) erfolgreiche kapitalmarktorientierte Unternehmen sichert strategische Entscheidungen über Business Cases ab, die im Wesentlichen dazu dienen, eine Strategie quantitativ abzubilden (und dann natürlich in die Planung und Budgetierung zu überführen). Zudem lässt sich Strategie nicht in PowerPoint und Templates entwickeln, sondern basiert – gerade die Zukunft betreffend – immer auf quantitativen Szenarien und Analysen.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer Ableitung von marktorientierten und unternehmensspezifischen Wettbewerbsvorteilen der Unternehmen und dem Zusammenspiel der Strategien im Wettbewerb; nicht im Mittelpunkt stehen dagegen die Implementierung von Strategien und deren Controlling innerhalb einer Organisation, ebenso wenig Change Management und Leadership. Gerade vor dem Hintergrund immer breiter und tiefer verfügbarer Daten (gerade auch über Märkte und Wettbewerber) werden an entsprechenden Stellen analytische und ökonometrische Verfahren zumindest skizziert.
Mein Dank gilt allen, die in den letzten zwanzig Jahren mit mir Unternehmensstrategien entwickelt und umgesetzt haben – ich habe viel von und mit Euch gelernt. Mein besonderer Dank gilt Georg Sobbe vom Bundesverband Musikindustrie für die Daten zu Umsätzen in der deutschen Musikindustrie, John Weche von der Monopolkommission für die Daten zur Rangstabilität der größten 100 Unternehmen in Deutschland, Jessica Dobry für das Stichwortverzeichnis sowie Rainer Berger für wiederum tolle verlegerische Unterstützung und Betreuung.
Saarbrücken und Karlsruhe, im Sommer 2022
Markus Thomas Münter
Inhalt
Vorwort
1Unternehmensstrategie und Wettbewerbsumfeld
Perspektiven auf Strategie
Evolutorisches Wettbewerbsverhalten und Behavioral Strategy
Unternehmensziele und Unternehmensorganisation
Unsicherheit als Rahmen für Wettbewerb und Strategie
Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
2Wettbewerbsvorteile und Unternehmensstrategie
Market-based View als Erklärung für Wettbewerbsvorteile
Resource-based View als Erklärung für Wettbewerbsvorteile
Wettbewerbsvorteile aus Differenzierung und Kostenführerschaft
Wettbewerbsvorteile in digitalen Geschäftsmodellen
Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
3Dynamik im Wettbewerb
Marktdynamik und Produktlebenszyklen
Wettbewerber, Industrielebenszyklen und Unternehmenswachstum
Marktstruktur und Wettbewerbsintensität
Zusammenfassung
Literaturtipps
4Strategische Entscheidungen mit Spieltheorie
Nash-Gleichgewichte in simultanen Spielen
Risikoaversion und gemischte Strategien
Sequentielle Entscheidungen und Commitment
Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
5Strategischer Wettbewerb im Oligopol
Kapazitätsentscheidungen und Strategien beim Cournot-Wettbewerb
Sequentielle Entscheidungen und Strategien bei Stackelberg-Wettbewerb
Preisentscheidungen und Strategien bei Bertrand-Wettbewerb
Relevanz für Unternehmensstrategien
Zusammenfassung
Literaturtipps
Kontrollfragen
Literatur
Stichwörter
1Unternehmensstrategie und Wettbewerbsumfeld
Apple stand 1997 kurz vor dem Bankrott. Im Herbst 1997 kehrte Steve Jobs als CEO zu dem von ihm 1976 gegründeten Unternehmen Apple zurück. Im ersten Jahr nach seiner Rückkehr hat Steve Jobs im Wesentlichen das Produktportfolio bereinigt und Kosten reduziert. Als er im Sommer 1998 nach der Strategie von Apple gefragt wird, antwortete er: ‚I am waiting for the next big thing‘ (Rumelt 2011a, S. 14). Auch die Commerzbank stand 1998 vor einer strategischen Neuausrichtung – statt wie die Deutsche Bank die Zukunft im internationalen Investmentbanking zu suchen und zu sehen, hat die Commerzbank den Weg zu einer europäischen Privat- und Geschäftskundenbank durch Übernahmen eingeschlagen: seit 2000 hat die Commerzbank in 2003 die BRE Bank in Polen übernommen, in 2004 Teile der Schmidt Bank gekauft, in 2005 die Eurohypo vollständig integriert, in 2007 Teile der Bank Forum in der Ukraine und in 2008 schließlich die Dresdner Bank übernommen.
Im Oktober 2001 brachte Apple den ersten iPod, im Februar 2007 das erste iPhone auf den Markt. Am 15. September 2008 – etwa zwei Wochen nach der Ankündigung der Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank – hat Lehman Brothers als Folge der US-Immobilien- und Subprime-Krise Insolvenz angemeldet. In der Folge haben sich zahlreiche Finanzdienstleister in existenzbedrohenden Krisen wiedergefunden. In Abbildung 1.1 sind die Aktienkursentwicklungen von Commerzbank und Apple für den Zeitraum von Januar 1997 bis November 2021 zu sehen – der Aktienkurs von Apple ist um 116.954,71% gestiegen, der Aktienkurs der zwischenzeitlich teilverstaatlichten Commerzbank ist um 94,21% gefallen. Ist also Abwarten eine bessere Strategie als M&A? Tatsächlich kann spieltheoretisch gezeigt werden, das Abwarten als Second Mover Advantage oftmals eine plausible Strategie sein kann (weiterführend Kapitel 4), und empirische Studien zeigen, dass M&A-Vorhaben häufig nicht den erwarteten Erfolg bringen (weiterführend Kapitel 2).
Abbildung 1.1: Aktienkursentwicklung Commerzbank AG und Apple Inc. von 1. Januar 1997 bis 24. November 2021 (bereinigt um Aktiensplits und Neuemissionen). Logarithmische Skala, Index zum 1. Januar 1997 gleich 100, eigene Berechnungen l Datenquelle comdirect.de.
Ist der Anstieg des Aktienkurses von Apple auf eine überlegene Strategie zurückzuführen, hat umgekehrt die Strategie der Commerzbank nicht funktioniert – oder war Apple nur im richtigen Markt unterwegs, und die Commerzbank im falschen? Der Erfolg einer Strategie und damit auch der Unternehmensgewinn wird von zahlreichen Einflüssen bestimmt: Wie verändern sich der Markt und die Erwartungen der Kunden, welche Strategien wählen die Wettbewerber, wie verändern sich das technologische oder rechtliche Umfeld, wie entwickelt sich die Konjunktur, wie verändern sich wirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen – und, nicht zuletzt natürlich, wie gut ist die eigene Strategie, passen die eigenen unternehmensspezifischen Fähigkeiten zu dieser Strategie und ist das Unternehmen in einem attraktiven Markt aktiv.
Fragen | Bringt denn Strategie überhaupt etwas?
Auf den ersten Blick scheint offensichtlich, dass natürlich Strategie für den Unternehmenserfolg entscheidend ist. Es könnte aber auch am Genie des Vorstands, an simplem Glück oder an einer unangreifbaren Marktposition liegen – so dass selbst eine schlechte oder nicht vorhandene Strategie keinen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. In zahlreichen empirischen Studien wurde versucht, diese Frage zu beantworten (weiterführend Bowman und Helfat 2001, Helfat und Martin 2015, Esho und Verhoef 2020 sowie die dort zitierten Studien und Kapitel 2) – was sind die wesentlichen Ergebnisse?
Tatsächlich kommen als zentrale Erfolgs- und Profitabilitätstreiber von Unternehmen zwei Ursachengruppen in Frage: Industriespezifische Effekte und unternehmensspezifische Fähigkeiten, und innerhalb dieser Fähigkeiten dann die Strategie eines Unternehmens (sogenannte ‚Corporate Effects‘) – und alle überlagert von Zufällen, Glück und Pech. Aus empirischer Perspektive wird dann versucht, die Varianz der Unternehmensgewinne durch diese Größen zu erklären, und insbesondere die über dem Mittelwert liegende Profitabilität einzelner Unternehmen auf eindeutige Ursachen zurückzuführen. Strategie eines Unternehmens erstreckt sich hier auf Management-Fähigkeiten, Leadership-Fähigkeiten (bspw. außergewöhnlich innovativer oder führungsstarker CEOs) sowie die strategischen Planungs- und Steuerungsprozesse eines Unternehmens. In vielen Studien wird identifiziert, dass Strategie (als Teil der dynamischen unternehmensspezifischen Fähigkeiten) einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet – allerdings ist der Anteil der Strategie am Erfolg mit zwischen 7% und bis zu 18% nicht dominant: wichtiger scheint in der (a) richtigen Industrie oder dem richtigen Markt aktiv zu sein und (b) die richtigen unternehmensspezifischen Fähigkeiten zu besitzen. Anderseits zeigt sich aber, dass (c) Strategie in einigen Industrien wichtiger und erfolgskritischer und (d) gerade in Transformationsphasen (konjunktureller Abschwung, technologische Veränderungen etc.) Strategie überlebensnotwendig werden kann.
Betrachtet man zudem die Untersuchungen zu tatsächlichem Entscheidungsverhalten in strategischen Situationen, dann wird klar: Strategie ist wichtiger als Leadership oder eine herausgestellte Führungspersönlichkeit (March 1994, Hannan und Freemann 1984, Miller und Cardinal 1994, Weber et al. 2001, Kahneman 2003 und Newark 2018). Gute und schlechte Manager profitieren in etwa gleich stark von Strategie, ohne Strategie entscheiden beide in etwa auf dem Niveau von Münzwürfen – was in Anbetracht von C-Level-Gehältern bei fehlender Strategie eine ernsthafte Alternative darstellt.
Strategie hat mindestens zwei Perspektiven. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive liegt der Schwerpunkt auf strategischem Management, d.h. im Kern auf der Umsetzung einer Strategie innerhalb einer Organisation – den Einsatz der richtigen Ressourcen, den Aufbau eines Zielsystems und der Gestaltung einer organisatorischen Struktur und geeigneter Prozesse, um den Unternehmenserfolg zu gewährleisten (Macharzina und Wolf 2018). Aus mikroökonomischer und industrieökonomischer Perspektive steht die Interaktion der Strategien im Wettbewerb mit anderen Unternehmen im Mittelpunkt – die Wahl der richtigen Strategien, ein Verständnis der Dynamik von Märkten und strategischem Verhalten der Wettbewerber sowie Veränderungen im Umfeld eines Unternehmens (Münter 2021). Strategie hat damit einmal eine Orientierung nach innen und strukturiert eine Organisation und richtet sie auf Ziele aus, zum anderen eine Orientierung nach außen und versucht die Überlebensfähigkeit der Organisation im Wettbewerb zu erhöhen. In gleicher Weise können Unternehmensstrategien entlang dieser zwei Dimensionen scheitern – entweder gelingt intern die Umsetzung nicht, oder die Strategie scheitert im Wettbewerb.
In einer Studie von McKinsey mit 1.139 Entscheidern aus verschiedenen Industrien zeigt sich, dass erfolgreiche Strategien zahlreiche interne wie auch externe Erfolgsfaktoren aufweisen – in erster Linie klar formulierte und verankerte Ziele, eine gute Datenbasis der Entscheidung, integrative Share- und Stakeholder-Beteiligung, präzise Abschätzung der Marktdynamik sowie die explizite Berücksichtigung des Wettbewerberverhaltens (Dye et al. 2009).
Ziel und Aufbau dieses Buches
Ziel dieses Buches ist es, die mikroökonomischen Grundlagen für erfolgreiche Unternehmensstrategien aufzuzeigen. Schwerpunkte sind die Dynamik der Strategien im Markt und die Ableitung von Wettbewerbsvorteilen aus Marktstruktur und unternehmensspezifischen Fähigkeiten als Treiber von Unternehmenserfolg und Profitabilität.
In Kapitel 1 liegt der Schwerpunkt auf grundlegenden Fragen zu Existenz und Wirksamkeit von Unternehmensstrategie, geeigneten Unternehmenszielen im Spannungsfeld von Shareholder- und Stakeholder-Interessen sowie begrenzter Rationalität, sowie auf den externen Einflussfaktoren auf den Unternehmenserfolg. Wettbewerbsvorteile in Kapitel 2 können aus Market-based View und Resource-based View erklärt werden, daneben stehen Produktdifferenzierung, Kostenführerschaft und Netzwerkeffekt als wesentliche Treiber für die Profitabilität von Unternehmen. In Kapitel 3 stehen empirisch beobachtbare Muster im dynamischen Wettbewerb im Mittelpunkt: Verschiebung von Markt- und Industriegrenzen, Produkt- und Industrielebenszyklen, Unternehmenswachstum und Marktanteilsdynamik sowie horizontale Konzentration und Wettbewerbsintensität. Kapitel 4 zeigt wesentliche Konzepte der Spieltheorie auf, um Aktionen und Reaktionen der Wettbewerber zu antizipieren und besser damit umgehen zu können: dominante Strategien, beste Antworten oder Committment – aber insbesondere auch den Umgang mit begrenzt rationalen Wettbewerbern, die Vorteilhaftigkeit zufälliger Entscheidungen oder wann First-Mover-Strategien funktionieren. Im abschließenden Kapitel 5 werden Modelle zu Wettbewerb im Oligopol entwickelt und auf typische strategische Herausforderungen wie Markteintritte, Kapazitätsaufbau, Preiswettbewerb oder den Aufbau von Produktdifferenzierung angewendet.
Überblick | Dieses Kapitel beschäftigt sich mit
Strategie aus betriebswirtschaftlicher und mikroökonomischer Perspektive,
Wettbewerb zwischen Evolution und Strategie,
begrenzt rationalen Entscheidungen und Behavioral Strategy, sowie
Rahmenbedingungen strategischer Entscheidungen aufgrund der Unternehmensorganisation (Corporate Governance) und Unternehmensumwelt.
Perspektiven auf Strategie
„What is strategy and how do you know if you have one?“ (Markides 2004, S. 5). Die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich schwierig. In zahlreichen Studien hat sich gezeigt, dass Unternehmen und Führungskräfte oft keine Unternehmensstrategie verfolgen oder diese nicht präzise und konsistent benennen können (Rukstad und Collis 2008, Leinwand und Mainardi 2016 sowie Newark 2018). Vor diesem Hintergrund ist zunächst hilfreich, den Begriff der Unternehmensstrategie zu definieren und dann mit der tatsächlichen beobachteten Strategie oder Verhaltensweise eines Unternehmens im Wettbewerb zu vergleichen.
Strategie kann allgemein (Büchler 2014, Johnson et al. 2017, Grant 2018 oder Pidun 2019 zu alternativen und ergänzenden Definitionen) beschrieben werden als
die langfristige Ausrichtung eines Unternehmens und die Leitplanken aller Entscheidungen und Stoßrichtung aller Aktivitäten,
unter Berücksichtigung der Marktstruktur und möglicher Strategien aller Wettbewerber,
um Wettbewerbsvorteile auf Basis und durch Gestaltung der unternehmensspezifischen Fähigkeiten in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld auszunutzen oder zu realisieren,
mit dem übergeordneten Ziel, robuste Profitabilität und die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern.
Strategie stellt in diesem Sinn immer eine auf die Zukunft gerichtete Hypothese dar, die sich in künftiger Entwicklung als richtig oder falsch herausstellt (Porter 1996, Rumelt und Lamb 1997 sowie Rumelt 2011b) – allerdings nicht sofort, sondern entsprechend des langfristigen Charakters von Strategie erst nach drei bis fünf Jahren. Eine McKinsey-Umfrage von 2009 unter 2.207 Entscheidern hat ergeben, dass nur 28% die Qualität der strategischen Entscheidungen in ihren Unternehmen als gut oder sehr gut ansehen. 60% antworteten, dass schlechte Entscheidungen genauso häufig vorkommen wie gute Entscheidungen – die restlichen 12% gaben an, dass gute Entscheidungen selten getroffen werden (Dye et al. 2009 sowie Lovallo und Sibony 2010).
Die Ausprägungen von Unternehmensstrategien kann zunächst in drei (nicht überschneidungsfreie) Dimensionen gegliedert werden:
Als generische Strategien werden Kostenführerschaft und Produktdifferenzierung bezeichnet – beide können, wenn sie kostenlos umsetzbar sind, immer die Profitabilität steigern. Bei Kostenführerschaft steigt die Preis-Kosten-Marge bei gleichbleibendem Preis, bei Produktdifferenzierung wird ein USP (Unique Selling Proposition, d.h. ein Alleinstellungsmerkmal) für einzelne Marktsegmente aufgebaut, der Preiserhöhungen ermöglicht. Generell gilt aber: Weder Kostenführerschaft noch Produktdifferenzierung sind ohne zusätzliche Kosten umsetzbar – bspw. sind Investitionen in Effizienzsteigerung (Prozessinnovationen) oder Marketing notwendig (weiterführend Kapitel 2).
Wettbewerbsstrategien analysieren die strategische Interaktion von Wettbewerbern in Märkten, bspw. Kapazitätswettbewerb, Preiskämpfe oder First-Mover-Strategien. Die Analyse erfolgt über spieltheoretische Modelle, die über das Zusammenspiel der Strategien eine Bewertung der Wirksamkeit einzelner Strategien und des zu erwartenden Marktergebnisses (Effekte auf Unternehmensgröße, Preisniveau, Gewinne etc.) ermöglichen. Herausforderung ist hier, das strategische Verhalten und Reaktionen der Wettbewerber richtig zu antizipieren und in die eigene strategische Entscheidung einfließen zu lassen (weiterführend Kapitel 4 und Kapitel 5).
Innovationen im Sinne Schumpeters (1911 und 1942) als Durchsetzung neuer Kombinationen ermöglichen eine Veränderung des Wettbewerbsprozesses, bspw. weg vom Verkauf von zehn Songs auf einer CD hin zu einem (werbefinanzierten oder bezahlten) Abonnement für Musik-Streaming, oder die Etablierung einer Plattform wie Amazon Marketplaces unter Einbindung der Wettbewerber. Ein Teil der Strategien der Unternehmen ist damit nicht gegen Konkurrenten gerichtet, sondern auf eine Veränderung der Marktstrukturen und der Logik des Wettbewerbsprozesses – bis hin zu Disruption bestehender Märkte, bestehender Kundenbeziehungen und bestehender Unternehmen durch neue Geschäftsmodelle. Ob derartige Wettbewerbswirkungen von Innovationen ausgehen können, hängt einerseits von technologischen Möglichkeiten und andererseits vom Verhalten etablierter Unternehmen ab (weiterführend Münter 2021a und 2021b).
Überlagert werden diese drei Ausprägungen von Unternehmensstrategie natürlich von Trends, Moden und Strategie-Buzzwords – so zeigt eine Studie von BCG mehr als 300 Strategie-Frameworks im Zeitraum von 1950 bis 2014, die teilweise nur eine kurze Lebensdauer hatten (Reeves et al. 2015, weiterführend Ghemawat 2003 und Freedman 2013). Unabhängig davon bleibt Unternehmensstrategie auf diesen Ebenen natürlich abstrakt – zur Ableitung einer tatsächlichen unternehmensspezifischen Strategie ist dann ein Abgleich mit der Unternehmenskultur, den Werten und Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie den Erwartungen der Shareholder und Stakeholder notwendig. Allerdings ergibt sich aus der Strategie-Definition oben und den drei Ausprägungen von Unternehmensstrategie eine sehr einfache und strukturierte Checkliste beim Einstieg in die Diskussion mit Vorständen oder Geschäftsführern zur Existenz und Plausibilität der tatsächlichen Unternehmensstrategie. Oft zeigt sich hier, dass entweder keine Strategie formuliert ist oder dass die vorhandene Strategie aufgrund von verändertem Marktumfeld oder Wettbewerberverhalten nicht mehr plausibel ist – ein guter Startpunkt für Unternehmensberatungen, um ein Proposal für ein Strategie-Projekt zu entwickeln.
Strategie kann auf unterschiedlichen Ebenen verortet sein:
Als Unternehmensstrategie (Corporate Strategy) umfasst sie den vollständigen Aktionsradius eines Unternehmens, d.h. hier werden Geschäftsmodelle, Geschäftsbereiche, Produktportfolio, globale Standorte und Vertriebsregionen, grundlegende Finanzierungsstruktur und Organisationsstruktur sowie M&A-Aktivitäten und strategische Allianzen festgelegt. Wesentlich ist hier auch die Zuteilung von Ressourcen (Mitarbeiter, Budgets, Eigenkapital, Investitionen, Produkte oder Geschäftsmodelle) innerhalb des Unternehmens, zudem setzen auf dieser Ebene alle strategischen Controlling-Prozesse zur Steuerung von übergeordneten KPIs wie Unternehmenswert oder Aktienkurs, Eigenkapitalrentabilität oder Cash Flow an. Hier ist wesentlich, das Unternehmen selbst als Portfolio zu verstehen – entsprechend können durch Zukäufe oder Verkäufe das Portfolio verändert und der Unternehmenswert beeinflusst werden (weiterführend Pidun 2019 und Kapitel 2 zu M&A).
Als Geschäftsstrategie (Business Strategy / Business Unit Strategy) werden Stoßrichtungen zur Zielerreichung für einen bestimmten Produktmarkt oder eine bestimmte Zielgruppe festgelegt, bspw. auch als kundenzentrierte Strategie. Hier werden Entscheidungen zu Unternehmensgröße und Produktionsmenge, Leistungsmerkmalen der Produkte und Marktbearbeitung, Innovationen und Technologie oder Preisen getroffen. Zentral ist hier, die Wettbewerbsvorteile gegenüber Wettbewerbern zu entwickeln und strategiekonform einzusetzen. Das Controlling einer Geschäftsstrategie erfolgt meist über Gewinnziele eines Geschäftsbereichs, die Verantwortung für eine Gewinn- und Verlustrechnung eines Managementteams oder über die Zuordnung von Zielen auf die übergeordneten Konzernziele.
Als funktionale Strategie (Functional Strategies) werden Unternehmens- oder Geschäftsstrategie übersetzt in Funktionalbereiche eines Unternehmens, bspw. in eine Marketingstrategie oder eine IT-Strategie. Die Existenz und die Bedeutung der funktionalen Strategie ist mitbestimmt durch die Organisationsstruktur: In einer Spartenorganisation ist in jedem Geschäfts-/Produktfeld eine Marketing- oder IT-Abteilung zugeordnet, entsprechend dominiert die Geschäftsstrategie; in einer Matrix-Organisation haben Marketing- und IT-Abteilung übergreifende Verantwortung und Ressourcen, so dass hier ggfs. die funktionale Strategie die Geschäftsstrategie dominiert. Problematisch an funktionalen Strategien ist oft, dass statt einer Ergebnisverantwortung entweder Erlös- oder Kostenziele verankert sind und mögliche zusätzliche Ziele (‚innovative IT-Landschaft‘, ‚werthaltige Neukunden‘, ‚bessere Sichtbarkeit im Markt‘ etc.) häufig schwach quantifizier- und operationalisierbar sind.
Strategie ist damit in hierarchische und funktionale Dimensionen zerlegbar. Diese Klassifizierung scheint auf den ersten Blick zwar plausibel, aber sie definiert nicht per se, welche Strategie logisch führend ist. So kann sich die Unternehmensstrategie als hochaggregiertes Abbild der Geschäftsstrategien ergeben, genauso könnte die Unternehmensstrategie die Ziele für die Geschäftsstrategie vorgeben. In gleicher Weise kann auch die Unternehmensstrategie die IT-Strategie vorgeben, aber gerade im Kontext von digitaler Transformation, Big Data und künstlicher Intelligenz können wesentliche strategische Impulse der IT-Strategie die Unternehmensstrategie bestimmen – weltweit haben viele Unternehmen hier neue Vorstandsbereiche eines Chief Digital Officers geschaffen, der als Querschnittsfunktion die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben soll (Péladeau und Acker 2019). Gerade in größeren Unternehmen und Konzernen mit mehreren Tochtergesellschaften führen die unterschiedlichen strategischen Ebenen immer wieder zu Ressourcenkonflikten und Inkonsistenzen in der tatsächlichen Strategie (Radner 1992).
Zudem verlaufen die Grenzen zwischen Unternehmensstrategie und Geschäftsstrategie fließend, so dass Strategie hier im Weiteren als Synonym für die langfristige Ausrichtung eines Unternehmens im Wettbewerb verstanden, gleich ob dadurch in enger Definition das Portfolio des Unternehmens verändert wird oder ob eine langfristige Kapazitätsentscheidung getroffen wird (weiterführend Chen und Miller 2012).
Strategie innerhalb des Unternehmens und strategisches Management
Strategie, sowohl in wissenschaftlicher Analyse als auch im Rahmen der Strategieentwicklung im Unternehmen, beschäftigt sich mit der Frage, ob eine Strategie existiert und ob diese Strategie plausibel ist – anwendungsorientiert setzt strategisches Management dann eine solche Unternehmensstrategie um. Wie aber wird Strategie in Organisationen kommuniziert, gelebt und erlebt? Tatsächlich hat Strategie zwar häufig den Anspruch, innerhalb einer Organisation allgemeingültig und anwendbar im Tagesgeschäft zu sein, aber oft stehen gelebte Routinen, Interessen einzelner Unternehmensbereiche oder schlichte Kommunikationsprobleme im Weg.
Vor diesem Hintergrund können Strategie und ihre Evolution, wie von Johnson et al. (2017) vorgeschlagen, empirisch innerhalb von Organisationen entlang von vier sich überlappenden und ergänzenden Mustern gegriffen und beobachtet werden, die entsprechende Implikationen für Strategieentwicklung und -umsetzung haben (weiterführend Whittington 1996, Barnett und Burgelman 1996, Kirsch et al. 2009, Levinthal 2011 sowie Buchanan und Huczynski 2017):
Strategie ist rational und logisch: Strategie ist hier ein objektiver, logischer und weitgehend gestaltbar-willkürlicher Prozess, so dass im Wesentlichen analytische und klassifizierende Management-Techniken zum Einsatz kommen, um eine Strategie abzuleiten. Diese Sichtweise geht auf mathematisch-analytische Ansätze aus den Bereichen Management Science und Operations Research zurück. Strategieentwicklung ist damit ein rationaler und zielgerichteter Prozess und kann gerade in komplexen Organisationen und dynamischen Wettbewerbsumfeldern helfen, Diskussionen zu Zielen und Vorgehensweisen zu vereinfachen und zu strukturieren. In dieser Sicht sind objektive Daten unstrittig: so werden bspw. Kundenzahlen sowohl als Ist-Zahl wie auch als Ziel im Unternehmen allgemein und gleichartig verstanden und verwendet. Damit wird erreicht, dass Strategie erklärbar wird, bspw. gegenüber Stakeholdern oder dem Kapitalmarkt, aber auch für Mitarbeiter und damit Leitplanken für Entscheidungen schafft.
Strategie ist pfadabhängig: Strategie ist hier von Historie, Entwicklungen und Entscheidungen der Vergangenheit, Strukturen der Organisation, Routinen und Wahrnehmung der Mitarbeiter geprägt. Eine Pfadabhängigkeit schränkt mögliche künftige Strategien aufgrund der bisher erfolgten Entscheidungen und Investitionen ein oder macht einen Wechsel zeitaufwendig oder kostspielig – künftige Entscheidungen sind also nicht unabhängig vom Status quo und bisherigen Entscheidungen. Strategien werden inkrementell weiterentwickelt und basieren auf subjektiven Annahmen über die Gegenwart und Zukunft und werden durch organisationsinterne Verhandlungen und Diskussion im Unternehmen manifestiert. In dieser Sicht sind schon Daten, bspw. betreffend der Kundenzahl strittig – so ‚erklären‘ Bereiche im Unternehmen die Zahlen jeweils unterschiedlich und arbeiten zudem an Zielen, die nicht deckungsgleich oder konsistent sind. Strategieentwicklung ist damit stark von Personen und deren Verhaltensmustern bestimmt. Strategie ist damit weniger objektiv und nachvollziehbar, zudem steht die Steigerung des Unternehmenserfolgs nicht zwingend als Ziel (siehe auch Kapitel 1). Veränderungen der Unternehmensumwelt müssen hier oft erst mit Routinen und Unternehmenskultur abgeglichen werden, bevor strategische Reaktionen möglich sind.
Strategie ist zukunftsoffen: Strategie ist evolutorisch, d.h. Strategieentwicklung erfolgt in Teilen zufällig und durch externe Impulse getrieben, kann aber Innovationen schaffen. Wesentlich ist in dieser Sichtweise, dass Strategie und Unternehmensentwicklung nicht nur von innen kommen – zentrale Impulse stammen von außen und werden durch Kunden, Wettbewerber oder Stakeholder bedingt. Mitarbeiter und Führungskräfte akzeptieren hier Unsicherheit der Zukunft und das Unternehmen passt sich strategisch dynamischen Rahmenbedingungen an – bspw. bei rechtlichen oder regulatorischen Veränderungen, technologischen Innovationen oder gesellschaftlichen Veränderungen. Diversität in der Organisation kann dann die Resilienz des Unternehmens erhöhen, gerade bei technologischen oder marktseitigen Veränderungen.
Strategie ist Kommunikation: Strategie wird im Wesentlichen durch Sprache, Kommunikation und Zuschreibung von Bedeutung („Erklärungen“) beobachtbar und gelebt. Damit ist jede Strategie subjektive Abbildung der vermuteten Realität der Manager, und die strategische Agenda ist durch Sprache und Kommunikation beeinflussbar und formbar. Strategie wird hier zu einem politischen Prozess, d.h. Ziele treten gegen Vorgehensweisen und Grundüberzeugungen an, ohne dass die Erfolgskriterien eindeutig definiert sind: so kann bspw. die anstehende Vertragsverlängerung eines Vorstands die ‚strategische Agenda‘ des Unternehmens dominieren, da hier schnelle und vorzeigbare Erfolge gegenüber langfristigen Gewinnzielen bevorzugt werden. In dieser Sichtweise kommt einzelnen Managern große Macht zu: Sie können gerade in Bereichs-Silos oder Tochterunternehmen großer und komplexer Organisationen eine Deutungshoheit der Ziele und strategischen Ausrichtung übernehmen, und so die eigentliche Strategie verändern oder sogar deren Umsetzung blockieren.
Strategie in Unternehmen pendelt damit zwischen ‚wir haben einen klaren Plan‘ und ‚organisierter Anarchie‘ (Cohen et al. 1972). Natürlich unterscheiden sich diese Muster von Unternehmen zu Unternehmen in Abhängigkeit der Unternehmensgröße und Eigentümerstruktur, der strategischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen sowie insbes. handelnden Menschen in der Organisation. Um Strategie erfolgreich umzusetzen ist entweder eine hinreichende Kongruenz dieser vier Dimensionen erforderlich (die Strategie ist logisch hergeleitet, berücksichtigt Pfadabhängigkeiten, adaptiert Umweltveränderungen und wird konsistent erklärt), oder eine der Dimensionen ist eindeutig führend. Widersprechen sich diese vier Dimensionen stark, dann ist entweder hoher Koordinations- und Transformationsaufwand notwendig, oder aber die Strategie wird nicht erfolgreich oder effektiv umgesetzt. In der unternehmerischen Praxis werden entsprechend selbst zunächst klar formulierte Strategien im Zeitablauf diffus – sie verlieren ihren Fokus, situative Herausforderungen im Tagesgeschäft verändern und dominieren Sicht- und Herangehensweisen, neue Mitarbeiter oder neue Kunden bringen neue Impulse ein. Damit geht einher, dass die Erlös- und Kostenentwicklung nicht mit der ursprünglichen strategischen Planung zusammenpasst und schließlich Gewinnziele nicht erreicht werden.
Auch aus diesem Grund finden in Unternehmen (meist jährlich im Rahmen der Jahresplanung im Herbst, weiterführend Kapitel 3) Strategie-Reviews statt. Hier werden zum einen der Erfolg der aktuellen Strategie bewertet, insbesondere aber die Prämissen der Strategie überprüft und ggfs. angepasst sowie die tatsächlich gewählten strategischen Maßnahmen auf Strategiekonformität analysiert. Gleiches geschieht typischerweise bei signifikanten Wechseln in Vorstand oder Geschäftsführung. In der Folge von Strategie-Reviews oder Vorstandswechseln steht häufig ein ‚Change-Program‘ mit neuer strategischer Ausrichtung, einer organisatorischen Neuaufstellung und damit wieder einer präziseren strategischen (Re-)Fokussierung auf Ziele und strategiekonforme Maßnahmen (Kelly und Amburgey 1991).
Fragen | Warum braucht ein Unternehmen einen Unternehmensberater?
Wie werden in Unternehmen wirklich Entscheidungen über die Strategie getroffen? Formal ist in der Unternehmensverfassung (sei es in der Geschäftsordnung der Geschäftsführung oder des Vorstands, über das Aktienrecht und das Handelsgesetzbuch oder entsprechend unternehmensintern vereinbarter Prozesse) meist das oberste Entscheidungsgremium in Abstimmung mit den Anteilseignern verantwortlich, bspw. der Vorstand im Austausch mit, aber auch unter Kontrolle vom Aufsichtsrat.
Tatsächlich findet aber in großen Unternehmen mindestens die Analyse möglicher Strategien, oft auch die Vorauswahl, im Zusammenspiel mit Unternehmensberatern statt. Unternehmensberatungen mit einem Schwerpunkt auf Unternehmensstrategie (bspw. Bain, McKinsey oder Boston Consulting Group) haben dabei oft die Aufgabe, auf Basis einer Markt- oder Wettbewerbsanalyse vorhandene strategische Optionen zu plausibilisieren und zu vergleichen, neue Optionen zu entwickeln sowie bei der Implementierung zu unterstützen.
Unternehmensberatungen – insbesondere strategische Managementberatungen – haben durch die Entwicklung und Gestaltung, manchmal auch nur Legitimierung, von Ideen und das Anstoßen von Veränderungen das Management und damit die Unternehmen massiv verändert. Unternehmensberatung und Management sind in vielen Unternehmen in Symbiose, zudem wechseln viele Unternehmensberater nach einigen Jahren zu ihren Klienten (Sturdy 2011). Unternehmensberatungen kommt dabei aber noch eine völlig andere Bedeutung zu: sie haben wesentlich zur Etablierung der anwendungsorientierten Methoden des strategischen Managements beigetragen (Hungenberg 2000, Wright et al. 2012 und Pidun 2019). Diverse Matrix-Modelle (zur Zuordnung von Strategien entsprechend zweidimensionaler Kriterien), die Benchmarking-Ansätze (zum Vergleich von Wettbewerbern), Portfolioanalysen (zur Ermittlung von Risiko- und Ergebnis-Gewichten von Geschäftsfeldern oder Produkten) oder Lebenszyklusmodelle (wie Produktlebenszyklus, Industrielebenszyklus oder Technologiezyklus) bis hin zu SWOT-Analyse und Five-Forces-Modell stammen alle aus wissenschaftlicher Forschung – ohne die Anwendung durch Unternehmensberatungen wären sie womöglich niemals im richtigen Leben angekommen.
Zahlreiche der so entwickelten Tools und Methoden sind über Projekte, insbes. aber über ehemalige Unternehmensberater, in den Unternehmen angekommen und mittlerweile im täglichen Einsatz – oftmals reduziert auf falsch verstandene Templates oder Frameworks, die dann bei fehlerhafter Anwendung und einem Scheitern der Strategie wieder zu einem neuen Auftrag für eine Unternehmensberatung führen. Wichtiger ist dagegen, die Logik der Industrie, die zentralen strategischen Herausforderungen und Implikationen zu erkennen, Unsicherheit als zentrales Merkmal strategischer Entscheidungsprobleme zu verstehen, und quantitative Verfahren wie Kostenkurven oder Spieltheorie anzuwenden (Levinthal 2011 sowie Birshan und Kar 2012).
Evolutorisches Wettbewerbsverhalten und Behavioral Strategy
Wie verhalten sich Unternehmen im Wettbewerb? Wie wählen Unternehmen Strategien aus, sind die gewählten Strategien optimal, welche Strategien treffen im Wettbewerb aufeinander? In der wissenschaftlichen Diskussion haben sich drei – natürlich nicht widerspruchsfreie und ergänzende – Perspektiven auf Zielsetzungen und Strategien von Unternehmen herausgebildet (Alchian und Demsetz 1972, Nelson und Winter 1982, Rumelt et al. 1991, Hart 1995 und Münter 1999): eine (1) industrieökonomische Perspektive, eine (2) evolutorische Perspektive und eine (3) Corporate Governance Perspektive.
Abbildung 1.2: Drei Perspektiven auf beobachtbare Unternehmensstrategien.
Industrieökonomische Perspektive auf Wettbewerbsverhalten
In Theorie und Praxis dominiert die industrieökonomische Perspektive, die auch Grundlage für strategisches Management ist. Unternehmensziel ist hier, den Gewinn (kurzfristig) und den Unternehmenswert (langfristig) zu steigern oder zu maximieren. Der Fokus der empirischen und theoretischen Untersuchungen im Rahmen von Industrieökonomie und strategischem Management liegt auf der Ableitung oder Begründung optimaler Entscheidungen, um Orientierungspunkte und Leitplanken für Unternehmensentwicklung und Strategieauswahl zu geben. Strategien werden rational abgeleitet und zielen auf Gewinnmaximierung und Unternehmenswertsteigerung. Rationalität wird hier nicht notwendigerweise als Voraussetzung gesehen, vielmehr kann Rationalität im Zeitablauf und durch Lernen entstehen.
Wenn sich alle Unternehmen so verhalten, werden entsprechend im Wettbewerb rationale und optimale Strategien der Unternehmen aufeinandertreffen. Damit ist auch das Wettbewerbsergebnis vorbestimmt: Im Rahmen von bspw. spieltheoretischen Untersuchungen können Marktanteile ermittelt, die Wirkung von Marketingstrategien abgeschätzt oder optimale Preismodelle innerhalb einer Industrie abgeleitet werden. Damit diese Analysen allerdings zutreffen, müssen alle Marktteilnehmer rational entscheiden und sich wechselseitig über die Abhängigkeit ihrer Entscheidungen von den Entscheidungen anderer bewusst sein.
Zudem müssen alle für die Entscheidungen notwendigen Informationen (entweder als datenbasierte Fakten, als Ergebnis von Markt- und Wettbewerbsanalysen, oder als Wahrscheinlichkeitsverteilung möglicher Ereignisse) vorliegen (siehe weiterführend Kapitel 3 und Kapitel 4). Unterstellt wird dabei, dass jedes Unternehmen das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgt, über Kenntnis und Voraussicht bezüglich der Umweltbedingungen sowie der Möglichkeiten und Strategien der Konkurrenten heute und in der Zukunft verfügt und in der Lage ist, diese Informationen ‚gewinnmaximierend‘ zu verarbeiten – wie dies geschieht, bleibt in der oft kritisierten ‚Black Box‘ des strategischen Managements verborgen.
Evolutorische Perspektive auf Wettbewerbsverhalten
Offensichtlich vereinfacht diese Sicht- und Vorgehensweise zu stark – Unternehmen verfügen weder über vollständige Information oder perfekte Voraussicht, noch sind Unternehmen in der Lage, diese Informationen optimal zu verarbeiten. Vor diesem Hintergrund hat sich eine zweite Sicht – die verhaltenswissenschaftliche und evolutorische Perspektive auf Strategie – entwickelt (Cyert und March 1963, Simon 1972, Nelson und Winter 1982, Barnett und Burgelman 1996 sowie aus Perspektive der Unternehmensführung Kirsch et al. 2009).
Ähnlich der Evolutionstheorie von Darwin (1859) sind Strategien und Zielsetzungen hier wesentlich durch Selektion und Adaption bestimmt: Unternehmen versuchen in dynamischen Wettbewerbssituationen mit unvollständiger Information durch ein Experimentieren mit möglichen Strategien ihre Überlebensfähigkeit sicherzustellen. Wesentlich ist, erfolgreiche Strategien beizubehalten und weiterzuentwickeln, nicht-erfolgreiche Strategien werden aussortiert. Zudem sind Unternehmen hier nicht ‚optimierende Black Boxes‘, sondern komplexe, sozioökonomische Organisationen, innerhalb derer unterschiedliche und auch widersprüchliche Zielsetzungen (bspw. zwischen Managern oder als Silo-Denken zwischen Abteilungen, aber auch im Konflikt zwischen Gewinnerzielung und CSR-Interessen) existieren. Der Fokus der empirischen und theoretischen Analysen liegt auf tatsächlich beobachtetem Verhalten: Manager agieren begrenzt rational und betreiben Satisficing, Entscheidungen basieren pfadabhängig auf bisherigen Entscheidungen, innerhalb des Unternehmens wird kontrovers über Zielsetzungen verhandelt oder gestritten. Strategie basiert dann auf Routinen und wird von Zufällen beeinflusst, ist aber nicht eindeutig auf die Maximierung von Unternehmenszielen gerichtet (vgl. dazu auch das auf Zufällen basierende Gibrat-Modell in Kapitel 3).
Evolutorische Verhaltensweisen bringen keine optimalen Strategien hervor. Zwar wird das Verhalten der Unternehmen oft interpretiert, 'als ob' sie den Gewinn maximieren (Friedman 1953) – es würde dann auf kurze Sicht also keine Rolle spielen, ob alle Unternehmen tatsächlich den Gewinn maximieren, denn langfristig bleiben nur solche Verhaltensweisen und Unternehmen überlebensfähig, die tatsächlich optimale Strategien anwenden. Wenn diese auf Darwins Theorie der natürlichen Selektion basierende Argumentation jedoch empirisch richtig sein soll, dann muss ex ante eine optimale Verhaltensweise bekannt sein – die Idee der natürlichen Selektion impliziert im Umkehrschluss nicht, dass überlebende Verhaltensweisen oder Strategien optimal sind (Blume und Easley 1992 und 2002, Heiner 1989 sowie Güth und Peleg 1997).
Zusammengenommen ist infrage zu stellen, ob Unternehmen tatsächlich die Zielsetzung verfolgen, den Gewinn zu maximieren (oder andere Größen wie Marktanteil des Unternehmens oder den Status quo und das Gehalt der Manager) und ob ihnen dies generell möglich ist, insbesondere ob alle notwendigen Informationen vorliegen und diese auch für optimale Entscheidungen verwendet werden. In der Regel wird man in Industrien über die Unternehmen hinweg eine Vielfalt an Strategien beobachten können, die zumindest kurzfristig evolutorisch koexistieren, ohne jeweils gewinnmaximierend zu sein (Jovanovic 1982, Malerba und Orsenigo 1996 sowie Münter 1999). Die Wettbewerbsintensität bestimmt dann darüber, ob und wie schnell nicht optimale Strategien aussortiert werden:
„If one thinks within the frame of evolutionary theory, it is nonsense to presume that a firm can calculate an actual ‘best’ strategy. […] There are certain characteristics of a firm's strategy, and of its associated structure, that management can have confidence will enhance the chances that it will develop the capabilities it needs to succeed. […] there is a lot of room in between, where a firm (or its management) simply has to lay its bets knowing that it does not know how they will turn out. Thus diversity of firms is just what one would expect under evolutionary theory. It is virtually inevitable that firms will choose somewhat different strategies […]. Inevitably firms will pursue somewhat different paths. Some will prove profitable, given what other firms are doing and the way markets evolve, others not. Firms that systematically lose money will have to change their strategy and structure and develop new core capabilities, or operate the ones they have more effectively, or drop out of the contest.” (Nelson 1991, S. 69).
In empirischen Studien wird regelmäßig nicht nur Vielfalt der Strategien beobachtet: Tatsächlich zeigt sich sowohl über Unternehmen einer Industrie hinweg, als auch innerhalb großer Unternehmen über unterschiedliche Geschäftsbereiche hinweg große Heterogenität an Unternehmensstrategien, an Management-Methoden oder an Effizienz, die sich deutlich in Produktivitätsunterschiede und unterschiedliche Profitabilität niederschlagen (Hatten und Schendel 1977, Hambrick et al. 1996, Jensen und McGuckin 1997 sowie Bloom et al. 2019): Trotz der Möglichkeit von Benchmarking, Adaption und Imitation sind Unternehmen innerhalb einer Industrie – egal wie eng sie gefasst wird – zu jedem Zeitpunkt unterschiedlich. Zudem ist diese Unterschiedlichkeit persistent – sie geht im Zeitablauf nicht verloren und reduziert sich auch nicht signifikant (Malerba und Orsenigo 1996).
Beabsichtige vs. emergente Strategien
In ähnlicher Weise hat die empirische Forschung zu strategischem Management verglichen, ob beobachtete Strategien der Unternehmen tatsächlich den vorher, bspw. auf Hauptversammlungen oder Kapitalmarkttagen, angekündigten Strategien entsprechen. Zwei Extrempunkte von Entwicklungslinien von Strategien, natürlich mit allen Zwischenstufen, sind möglich (Mintzberg und Waters 1985 sowie Mirabeau und Maguire 2014):
Beabsichtige Strategien: Die beobachteten Strategien entsprechen implementierten und tatsächlich beabsichtigten Strategien (‚Deliberate Strategies‘) zu einem hohen Grad, d.h. die gewählte Strategie wurde intern im Unternehmen und extern im Markt konsistent umgesetzt – unabhängig der Frage, ob die Strategie auch erfolgreich ist.
Emergente Strategien: Beobachtete Entscheidungen, Unternehmensentwicklung und strategische Maßnahmen entstehen im Wesentlichen ohne oder entgegen grundlegenden strategischen Entscheidungen – vielmehr bilden sie sich im Zeitablauf aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Impulse heraus (‚Emergent Strategies‘) und werden im Markt umgesetzt.
Emergente Strategien können aus folgenden Gründen entstehen:
entweder hat intern in der Organisation die Implementierung oder extern die Umsetzung im Markt nicht funktioniert,
die beabsichtige Strategie hat sich im Zeitablauf, gerade aufgrund der Dynamik von Markt- und Wettbewerbsumwelt und damit notwendig gewordenen Entscheidungen, in eine emergente Strategie transformiert,
oder aber das Management des Unternehmens hat bewusst für eine emergente Strategie entschieden.
Umsetzung und Implementierung können an Widerständen und Trägheit in der Organisation (weiterführend Hannan und Freeman 1984 sowie Kelly und Amburgey 1991) oder schlicht aufgrund von unzureichenden Management-Fähigkeiten scheitern. Der dritte Fall emergenter Strategien kann entstehen, wenn aufgrund hoher Unsicherheit im Markt oder betreffend neuer Technologien, aber auch bei empfundener Unmöglichkeit der Formulierung oder Festlegung einer Strategie bewusst akzeptiert wird, dass sich Strategie im Zeitablauf durch eine inkrementelle und iterative Abfolge sich ergänzender und verdichtender Entscheidungen herausbildet. So hat sowohl die Staats- und Finanzschuldenkrise ab 2007 wie auch die Corona-Pandemie seit 2019 bei Vorständen und Aufsichtsräten zur Formulierung ‚wir fahren auf Sicht‘ geführt, da wesentliche Prämissen der strategischen Planung nicht mehr valide waren, zudem auch das Verhalten der Wettbewerber nicht mehr präzise vorhersagbar war.
Gerade in großen Unternehmen bleibt Strategie auf Unternehmensebene oft unvollständig in dem Sinn, dass nicht alle künftigen Entscheidungen auf darunterliegenden Ebenen absehbar oder vorbestimmbar sind (Levinthal 2011). Zum anderen wird gewollt oder ungewollt akzeptiert, dass Manager Freiheitgrade im Tagesgeschäft ausnutzen und unvollständige Steuerungs- und Überwachungssysteme ohnehin nie abschließend die Umsetzung einer übergeordneten Strategie gewährleisten können. Damit ist aber auch eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit und Innovation möglich – bis hin zu einer auf emergenten Strategien basierenden lernenden Organisation, die sich ohne enge strategische Leitplanken evolutorisch weiterentwickelt (Gavetti et al. 2012, Levinthal und March 1993 sowie Miles et al. 1978). Anderseits können sich emergente Strategien auch in das von Lindblom (1959) als ‚Durchwursteln‘ bezeichnete Muster entwickeln: Aufgrund fehlender oder nicht hinreichend klarer Strategie entscheiden Manager situativ und inkrementell nur das nächste oder drängendste Problem, aber insbesondere immer in Reaktion auf andere Entscheidungen oder auf geänderte Rahmenbedingungen, sowie als Abstimmungs- und Verhandlungsprozess in Entscheidungsgremien.
Behavioral Strategy
Entscheidungen von Menschen, egal ob als Kunden oder Manager, werden oft als vollständig rational auf Basis von Präferenzen, auf Ziele ausgerichtet, ohne jegliche Emotionen oder Wahrnehmungsverzerrung beschrieben. Tatsächlich werden zahlreiche Entscheidungen aber nicht vollständig rational getroffen – vielmehr weichen sie signifikant und in systematischen Mustern von maximierendem oder optimalem Verhalten ab. Diese Entscheidungen werden im Rahmen von Behavioral Economics analysiert und Erklärungen basieren insbesondere auf psychologischen und verhaltenswissenschaftlichen Experimenten und empirischen Beobachtungen (Kahneman 2003 und 2011, Della Vigna 2009, Camerer et al. 2011 und Thaler 2015).
Eine Neigung zu schnellem Denken (und vorschnellen Entscheidungen) schränkt Menschen im Prozess der Informationswahrnehmung, der Informationsverarbeitung und in der eigentlichen Entscheidung ein. In der Folge werden zahlreiche Entscheidungen begrenzt rational getroffen (Simon 1955 und 1957, March und Simon 1958 sowie March 1994):
Unvollständige Erfassung der Situation – zahlreiche Entscheidungssituationen sind komplex, und die möglichen Strategien und deren Wechselwirkungen mit denkbaren Zielen nicht vollständig beschreibbar,
unvollständige Information – zahlreiche Entscheidungssituationen weisen eine Mischung aus Unsicherheit, Risiko und absolut fehlender Information auf,
kognitive Beschränkungen – Menschen besitzen eingeschränkte intellektuelle Fähigkeiten und sind beschränkt oder verzerrt in Wahrnehmung, Lernen, Erinnern und planvollem Vorgehen, und
zeitliche Limitierung in der Entscheidungsfindung – viele strategische Entscheidungen, gerade auch in Unternehmen, können aufgrund begrenzter Zeit nicht vollständig durchdacht werden.
Menschen (Entscheider als Kunden oder Manager) erkennen durchaus die Begrenztheit ihrer Rationalität – vor diesem Hintergrund werden nur wenige Alternativen geprüft und die Entscheidungsfindung wird anhand von Heuristiken vorgenommen. Zudem tritt neben das Ziel der Maximierung von Nutzen oder Gewinn die Suche nach Gutgenug-Lösungen (Satisficing), die dann erreicht sind, wenn ein bestimmtes Anspruchs- oder Zufriedenheitsniveau, eine Höhe des geplanten Gewinns oder eine Wahrung des Status quo erreicht sind. Dieses Verhalten ist in gleicher Weise bei Managern, bei der Suche nach einem Job, beim täglichen Weg an die Hochschule und bei der Wahl des Lebenspartners zu beobachten.
Grundlegend neue Entscheidungen werden nur getroffen, wenn eine deutliche Abweichung vom Anspruchsniveau festgestellt wird, ansonsten dominieren Routinen und Heuristiken, die bisherige Entscheidungen fortschreiben oder inkrementell auf Basis lokaler Suche adaptiv weiterentwickeln, und so den Status quo festigen oder sichern (Lindblom 1959 sowie Levinthal und March 1993). Eine Gut-genug-Lösung kann durchaus konsistent mit maximierendem Verhalten sein: Satisficing kann auch entstehen, wenn in Anbetracht aller Opportunitätskosten einer Alternative, Suchkosten nach besseren Alternativen und insbesondere zeitlichen Beschränkungen entschieden wird – also Maximierung mit zahlreichen Nebenbedingungen.
Die Überlegungen von Behavioral Economics – im Wesentlichen fundiert aus beobachteten Konsumentenentscheidungen – haben mittlerweile in Behavioral Strategy ihr Spiegelbild in Unternehmen und für Entscheidungen von Managern gefunden. Einige der empirisch regelmäßig beobachteten Entscheidungsverzerrungen werden nachfolgend beschrieben. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass diese Muster sich wechselseitig verstärken können und so den Grad begrenzter Rationalität erhöhen und die Qualität strategischer Entscheidungen beschränken (weiterführend Lovallo und Sibony 2010, Powell et al. 2011, Das 2014, Levinthal 2011, Gavetti 2012 sowie Gavetti et al 2012 sowie Garbuio et al. 2014):
Confirmation Bias (Bestätigungsverzerrung oder selektive Wahrnehmung) – Informationen werden so ausgewählt und interpretiert, dass eigene Überzeugungen und Annahmen bestätigt, erklärt und verstärkt werden. Im Gegenzug werden unpassende Informationen ausgeblendet oder unterdrückt (kognitive Dissonanz), so dass entlang Routinen an bisherigen Entscheidungen oder Strategien festgehalten wird und Pfadabhängigkeiten begründet sind. Dies ist häufig bei Marktforschung und Wettbewerbsanalyse zu beobachten: Marktforschung wird häufig verwendet, um bestehende Annahmen zu bestätigen und ggfs. Mitarbeiter und Manager von eigenen Annahmen zu überzeugen. Auch rein stochastischen Ereignissen wird Bedeutung zugeschrieben, so dass Manager – je nach Blickwinkel – bestätigende oder widerlegende Informationen in zufällige Muster hineininterpretieren. Die Qualität einer Entscheidung kann dagegen verbessert werden, indem bewusst nach widerlegenden Informationen gesucht wird (Nickerson 1998).
Endowment Effect (Besitzstandseffekt) – Der Endowment-Effekt ist in zahlreichen Experimenten, unter anderem mit Kaffeetassen, nachgewiesen. Er beschreibt, dass die Wertschätzung von Gegenständen davon beeinflusst wird, ob eine Person den Gegenstand aktuell besitzt oder nicht, so dass die Zahlungsbereitschaft beeinflusst wird (Knetsch 1989, Kahneman et al. 1990 und 1991). Allerdings unterliegen auch Unternehmen und Manager dem Endowment-Effekt: Manager halten zu lange an bestehenden Strategien und Geschäftsfeldern fest, diese werden zudem systematisch höher bewertet als nicht-vorhandene Geschäftsfelder oder alternative Strategien. Dadurch werden Zu- oder Verkäufe von Geschäftsbereichen dadurch verlangsamt oder verhindert, der Wechsel auf eine neue Strategie erfolgt zeitverzögert oder lethargisch. In der Konsequenz sind Unternehmen systematisch ineffizient aufgrund des Festhaltens an falschen Strategien, Produkten oder Geschäftsfeldern, zudem werden auf dieser Basis Strategien, Planungen oder Budgets der Vorjahre ‚fortgeschrieben‘, ebenso werden die Fähigkeiten des eigenen Unternehmens (der eigenen Mitarbeiter, der eigenen Technologie etc.) systematisch überschätzt und überbewertet.
Action Bias