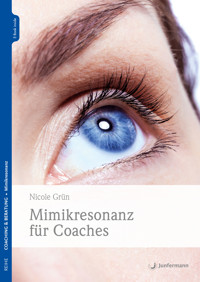
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mimikresonanz: Navigator durch eine gelingende Coachingsitzung Der Erfolg eines Coachings hängt maßgeblich von der Beziehung zwischen Coach und Coachee ab. Wie gelingt es aber, eine angemessene Beziehung zum Coachee aufzubauen? Sowohl Selbst-Empathie als auch Empathie sind hierbei ausschlaggebende Faktoren. Dafür bietet Mimikresonanz – also die Emotionserkennung über die Mimik – alltagstaugliche Werkzeuge und sorgt dafür, dass das Coaching effektiver wird und auch das eigene Emotionsmanagement des Coachs kommt dabei nicht zu kurz kommt. Mimikresonanz fungiert als Navigator durch eine gelingende Coachingsitzung und befähigt Coaches nicht nur dazu, ihre Klienten noch besser zu begleiten, sondern auch selbst leistungsfähig zu bleiben. Nicole Grün erläutert in ihrem Buch, wie Mimikresonanz die alltägliche Praxis des Coachings verbessern kann. Das Buch antwortet u.a. auf diese Fragen: - Was ist eigentlich Coaching? - Was verbirgt sich hinter der therapeutischen Allianz? - Wie erkenne ich als Coach die 12 Primäremotionen? - Empathie: Wie wirkt sich das auf den Coachee aus? - Impathie: Was macht das mit mir als Coach? - Wie gelingt Emotionsmanagement im Coaching?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nicole GrünMimikresonanz für Coaches
Über dieses Buch
Emotionen im Coaching besser erkennen
Der Erfolg eines Coachings hängt maßgeblich von der Beziehung zwischen Coach und Coachee ab. Wie gelingt es aber, eine angemessene Beziehung zum Coachee aufzubauen? Dafür bietet Mimikresonanz – die Emotionserkennung über die Mimik – alltagstaugliche Werkzeuge, die dafür sorgen, dass Sie als Coach sich zielgenau auf die Coachees abstimmen können. Mimikresonanz ist Ihr Navigator durch eine gelingende Coachingsitzung und befähigt Sie nicht nur dazu, Ihre Klienten noch besser zu begleiten, sondern auch selbst leistungsfähig zu bleiben. Nicole Grün erläutert anschaulich, wie Mimikresonanz die alltägliche Praxis des Coachings effektiver macht. Das Buch antwortet u. a. auf diese Fragen:
Wie erkenne ich als Coach die 12 Primäremotionen? Wie verbessert das Erkennen von Emotionen die Beziehung zum Coachee? Wie wirkt sich Empathie auf Coachee und Coach aus? Was trägt Mimikresonanz zu einer gelungenen Coachingsitzung bei? Wie gelingt Emotionsmanagement im Coaching?Nicole Grün arbeitet als Coach mit Praxis in Reutlingen und ist spezialisiert auf die Weiterbildung von Coaches in den Bereichen Emotionserkennung und Emotionsmanagement. Als Mimikresonanz-Trainerin navigiert sie sicher durch die Welt der Emotionen und weiß, dass Emotionscoaching wirkt. http://www.nicolegruen.de
Copyright: © Junfermann Verlag, Paderborn 2020
Coverfoto: © BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Fotos: Sonya Martin
Illustrationen: Claudia Esser & Nicole Grün
Icons: Agentur Meilenstein, Timo Banaszak
Covergestaltung / Reihenentwurf: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Satz, Layout & Digitalisierung: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsjahr dieser E-Book-Ausgabe: 2020
ISBN der Printausgabe: 978-3-95571-947-0
ISBN dieses E-Books: 978-3-7495-0081-9 (EPUB), 978-3-7495-0083-3 (PDF), 978-3-7495-0082-6 (MOBI).
1. Einleitung
Ist Coach einfach nur ein Beruf, den jeder ausführen kann, der schon mal jemandem in einer herausfordernden Lebenssituation einen Tipp gegeben hat, oder ist es eher eine Berufung, die sehr viel Grundlagenwissen, Methodensicherheit und Empathie benötigt?
Und was ist mit der Selbstfürsorge? Wie kann ein Coach dafür Sorge tragen, dass das eigene psychische Wohlergehen Bestand hat?
Als Coach zu arbeiten bedeutet nicht nur, eine Methode zu beherrschen oder sich in andere einfühlen zu können. Es bedeutet auch, selbst stabil zu sein, um die Gespräche mit den Klienten führen zu können, denn man wird automatisch zur Projektionsfläche, und dann muss man professionell reagieren und sich abgrenzen können. Jedoch ist die Abgrenzung diffizil, denn sie darf nicht dazu führen, dass die Beziehung zum Gegenüber gefährdet wird. Ob ein Coaching nämlich Wirkung zeigt oder nicht, liegt zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz daran, wie gut und stabil diese Beziehung ist.
Warum entscheiden sich Menschen für ein Coaching und was verstehen wir überhaupt unter Coaching? Gibt es Situationen, in denen sich die Grenzen dieses Ansatzes zeigen? Und wie sollte ein professionell arbeitender Coach damit umgehen? Welche methodischen Ansätze sind wirksam, vielleicht sogar wirksamer als andere, und was genau hat die Emotionserkennung über die Mimik durch Mimikresonanz damit zu tun?
Welche Vorteile hat ein Coach davon, wenn er sich damit beschäftigt, die Spuren der Mimik nicht nur zu sehen, sondern auch zu verstehen?
Diese Fragen und viele andere beantwortet dieses Buch, aber beginnen wir mit einer Geschichte. Meiner Geschichte.
Ich bin seit der Jahrtausendwende Coach und habe mich kontinuierlich weitergebildet, damit ich für meine Klienten einen prall gefüllten Werkzeugkoffer zur Verfügung habe, um situativ angemessen agieren zu können.
1.1 Persönliche Motivation, etwas anders zu machen
Folgende Situation ergab sich vor einigen Jahren: Ein Unternehmen meldet sich und sucht einen Coach für eine Führungskraft. Besagte männliche Führungskraft vergreift sich oft im Ton, sowohl dem Chef als auch den Mitarbeitern gegenüber. Da er direkt an die Geschäftsführung berichtet, ist der Vorgesetzte irritiert und besorgt über das Verhalten, das ihm da begegnet. Es findet also ein Erstgespräch statt, bei dem sowohl der Geschäftsführer als auch die Personalerin anwesend sind.
Ich als Coach bin sozusagen auf dem Prüfstand.
Dann wird der zukünftige Klient hinzugebeten. Er ist informiert und willens, die Chance in der professionellen Begleitung zu sehen und sich zu entwickeln. Am Ende dürfen wir auch kurz unter vier Augen sprechen, um uns etwas näher zu beschnuppern. Wir besprechen die Parameter des Coachings, die Rolle des Coaches, die Rolle des Klienten und die Rolle des Auftraggebers. So weit, so gut. In vielen größeren Unternehmen verlaufen Coachingvergaben nach diesem Muster.
Die erste Sitzung folgt dann einige Wochen später und die Arbeit beginnt, sowohl für mich als Coach als auch für den Coachee. Im weiteren Verlauf werden Termine verschoben, da aktuelle Situationen im Unternehmen den Einsatz der Fachkraft am Arbeitsplatz verlangen, und ich fange häufig wieder bei null an.
Wir erarbeiten einige hilfreiche Aspekte auf der Verhaltensebene, die sich wirklich einprägen und Veränderung auch im Außen bemerkbar machen. Der Geschäftsführer bemerkt dies auch und äußert sich positiv. Ich bin empathisch und aufmerksam, und doch entgeht mir während der ersten vier Sitzungen scheinbar etwas Wichtiges, denn bei unserem fünften Treffen offenbart mir mein Coachee, dass er kündigen und das Unternehmen verlassen wird.
Das Coaching hat ihm über vieles die Augen geöffnet und er möchte so nicht mehr arbeiten. Er merkt, dass ihm das guttut, was wir erarbeitet haben, doch sorgt das Umfeld im Unternehmen für ständige Provokationen und er muss extrem viel Kraft aufwenden, um nicht wieder in sein altes Muster zurückzufallen. Das möchte er zukünftig einfach nicht mehr.
Ich bin tatsächlich ein wenig geschockt, denn es war ja weder meine Aufgabe noch mein Ziel, den Klienten dahin zu coachen. Habe ich wirklich etwas übersehen? Gab es Zeichen, bei denen ich hätte aufmerksam werden müssen? Was hätte ich anders gemacht, wenn ich die Tendenz eher wahrgenommen hätte? Hätte ich etwas anders gemacht?
Für den Klienten habe ich das Beste getan, aber aus Sicht des Auftraggebers ist das Problem ja nicht wirklich kleiner geworden: Bis dato gab es eine gute Fachkraft, die menschlich aneckte. Nun muss ein neuer Mitarbeiter gesucht werden!
Zumindest bin ich als Coach seitdem in diesem Unternehmen „verbrannte Erde“, denn ich sollte den Mitarbeiter ja „reparieren“ und nicht zum Kündigen bringen.
Der Verlauf eines Coachings ist kein zementierter Prozess, und doch gibt es gewisse Vorgehensweisen, um herauszufinden, wo genau das Problem liegt, das sich im Außen als Verhalten offenbart. Nach diesem Verfahren agieren viele Coaches: Wir suchen nach dem Grund für das Symptom, also dem sogenannten cause, und durchlaufen dabei eine Reihe an Schritten, die je nach Coachingansatz auf der Verhaltensebene starten und bis zur Sinngebung gehen (können).
Fundierte Coachingausbildungen lehren die einzelnen Prozessschritte, sei es beim NLP, emTrace oder anderen Ansätzen. Ich coache seit fast 20 Jahren und habe mir sowohl Methodenkompetenz angeeignet als auch Rollenverständnis und Lebenserfahrung.
Das beschriebene Coaching jedoch wurde für mich zu einer Art Mahnmal. Ich war mir sicher, dass es Zeichen gegeben haben musste, denn mein Klient war offen zu mir und erzählte mir viele sehr persönliche Gegebenheiten. Die gemeinsame Arbeit basierte auf einem Vertrauensverhältnis.
Ich war unzufrieden mit mir und dem Ergebnis, obwohl ich auch heute noch sage, dass es nicht meine Aufgabe war, einen Reisenden aufzuhalten. Aber es blieb ein Gefühl zurück, das mich zu einer Suchenden werden ließ.
1.2 Ein Klärungsversuch
„Coaching ist die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs- / Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen / Organisationen. Zielsetzung von Coaching ist die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen.
Als ergebnis- und lösungsorientierte Beratungsform dient Coaching der Steigerung und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit. Als ein auf individuelle Bedürfnisse abgestimmter Beratungsprozess unterstützt ein Coaching die Verbesserung der beruflichen Situation und das Gestalten von Rollen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Durch die Optimierung der menschlichen Potenziale soll die wertschöpfende und zukunftsgerichtete Entwicklung des Unternehmens / der Organisation gefördert werden.
Inhaltlich ist Coaching eine Kombination aus individueller Unterstützung zur Bewältigung verschiedener Anliegen und persönlicher Beratung.
In einer solchen Beratung wird der Klient angeregt, eigene Lösungen zu entwickeln.
Der Coach ermöglicht das Erkennen von Problemursachen und dient daher zur Identifikation und Lösung der zum Problem führenden Prozesse. Der Klient lernt so im Idealfall, seine Probleme eigenständig zu lösen, sein Verhalten / seine Einstellungen weiterzuentwickeln und effektive Ergebnisse zu erreichen.
Ein grundsätzliches Merkmal des professionellen Coachings ist die Förderung der Selbstreflexion und -wahrnehmung und die selbstgesteuerte Erweiterung bzw. Verbesserung der Möglichkeiten des Klienten bzgl. Wahrnehmung, Erleben und Verhalten.“
So definiert der Deutsche Bundesverband Coaching e.V. auf seiner Website Coaching. Andere definieren es sehr ähnlich lautend und fügen noch hinzu, dass Freiwilligkeit ein wichtiger Aspekt ist und sich Coaching im Unterschied zu Therapie an gesunde Menschen richtet. Was unterm Strich bedeutet, dass auch gewisse Grundkenntnisse über die Erkennungsmerkmale psychischer Erkrankungen vonnöten sind, denn nur dann ist eine Abgrenzung von gesund und krank möglich. Ich hatte das große Glück, dass vier Tage Neurosen- und Psychosenlehre Teil meiner Coachingausbildung waren. Aus meiner Sicht ist dies eine extrem wichtige Grundlage für die Arbeit mit Menschen, denn man muss als Coach wissen, wann ein Coaching die richtige Wahl ist und wann eine therapeutische Begleitung sicherer ist. Man muss also die Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten nicht nur kennen, sondern auch erkennen!
1.3 Was im Coaching möglich ist – Abgrenzung zu Psychotherapie und Heilpraxis
Die Diplom-Psychologin und Mimikresonanz-Trainerin Tanja Lange schreibt hierzu:
„Häufig kommt die Frage auf, was im Coaching möglich ist und wo die Grenzen zwischen Coaching und Psychotherapie bzw. Heilpraxis verlaufen.
Es sei angemerkt, dass die Grenzen zwischen Coaching und Psychotherapie bzw. Heilpraxis häufig verschwimmen. Im Coaching kommen viele Interventionen aus psychotherapeutischen Schulen zur Anwendung. Und dennoch gibt es einige klare Grenzen zu beachten:
Coaching richtet sich prinzipiell an psychisch gesunde Menschen. Gegenstand von Psychotherapie sind behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen. Die Behandlung sowie auch die Diagnosestellung psychischer Erkrankungen dürfen folglich nur mit Heilerlaubnis (Zulassung als Psychologischer Psychotherapeut, Ärztlicher Psychotherapeut oder Heilpraktiker für Psychotherapie bei Erwachsenen sowie als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut bei Kindern und Jugendlichen) durchgeführt werden.
§ 1 Abs. 3 Satz 1 und 2 PsychThG besagen:
(3) Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine somatische Abklärung herbeizuführen.
In der ICD-10 (International Classification of Diseases) der WHO (Weltgesundheitsorganisation) sind alle Krankheiten verzeichnet. Das Kapitel V (F) beinhaltet psychische und Verhaltensstörungen. Folgende Erkrankungen dürfen beispielsweise nicht gecoacht werden: Depressionen, Angststörungen, Phobien, Psychosen, Essstörungen, Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente), Traumata, Somatisierungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen.
Klienten, die ins Coaching kommen und bei denen ein Arzt, Psychologe, Psychotherapeut oder Heilpraktiker für Psychotherapie eine oder mehrere F-Diagnose(n) nach ICD-10 gestellt hat, dürfen zumindest in Bezug auf die psychische(n) Erkrankung(en) nicht behandelt werden. Die Klärung dieser Frage sollte also unbedingt Teil der Auftragsklärung im Coaching sein.
§ 1 Abs. 3 Satz 3 PsychThG besagt:
Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben.
Hierbei handelt es sich um Ausnahmen von der Erlaubnispflicht. So dürfen beispielsweise folgende Themen Gegenstand von Coaching sein: Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement, Selbstmarketing, Prävention von Burn-Out und Bore-Out, allgemeine Stressbewältigung und Entspannungstechniken, mentales Training, allgemeine Lebensberatung, Beratung im beruflichen Kontext, Konfliktmanagement, Lernschwächen, Unterstützung in akuten Krisen (z. B. Sorgen nach Trennungen, Trauerbewältigung, Arbeitsplatzkonflikte oder -verlust).
Im Coaching braucht es natürlich – wie in der Psychotherapie – eine tragfähige und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Klient (therapeutische Allianz). Ein weiteres gemeinsames Ziel von Coaching und Psychotherapie ist die Verhaltenserweiterung bzw. die Verhaltensflexibilisierung beim Klienten bzw. Patienten.
Die inhaltliche Arbeit findet im Unterschied zur Psychotherapie im Coaching meist mit geringerer emotionaler Tiefe statt, d. h. es wird nicht tiefergehend in der Vergangenheit und der Biographie geforscht. Es geht nicht um die Auseinandersetzung mit der Psyche in tieferen Ebenen, sondern um aktuelle Probleme und Themen.
Coaching ist weder Vergangenheitsbewältigung noch Ursachenforschung, sondern bezieht sich auf die Handlungsebene im Hier und Jetzt. Wer sozusagen Ursachenforschung betreibt und die gesamte Lebensgeschichte betrachtet, um dem Klienten zur Gesundung zu verhelfen und das psychische Funktionsniveau wiederherzustellen, betreibt Heilkunde bzw. Psychotherapie und darf dies als Coach nicht.
Coaching benötigt also einen gesunden Klienten und zielt damit gerade auf die vorhandenen Selbstregulierungs- und Selbststeuerungsfähigkeiten ab, auf eine intakte und reife Persönlichkeitsstruktur. Coaching ist demnach Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützt den Klienten, selbst auf Lösungen hin zur von ihm gewünschten Veränderung zu kommen. Ein Coaching bedingt sozusagen, dass die Lösungen in dem Menschen liegt und er fähig ist, diese zu finden.
Was aber bedeutet eine intakte, gesunde Persönlichkeitsstruktur? Menschen mit gesunder Persönlichkeitsstruktur haben in ihrer frühen Entwicklung durch die Interaktion mit ihren Bezugspersonen verschiedene strukturelle Fähigkeiten ausgebildet. Sie haben beispielsweise gelernt, ihre Impulse zu steuern und vorgegebene Normen zu berücksichtigen. Sie haben gelernt, ihren Selbstwert sowie das Nähe-Distanz-Verhältnis in Beziehungen angemessen zu regulieren. Sie haben auch gelernt, Körpererleben mit Emotionen zu verknüpfen und dadurch ein lebendiges Körperselbst zu erfahren. Sie haben die Fähigkeit zur Selbst-Objekt-Differenzierung erworben, d. h. die Fähigkeit, zwischen sich selbst und anderen unterscheiden zu können. Sie haben die Fähigkeit zur Empathie erworben und die Fähigkeit zum Verständnis fremder Gefühle. Sie haben die Fähigkeit zum Erleben von psychischer, sozialer und sexueller Identität ausgebildet und die Fähigkeit zur Loslösung von Objekten, zum Beispiel beim Abschied oder im Trauerprozess.
Umgekehrt können folgende Wahrnehmungen Hinweise auf strukturelle Schwächen liefern:
Die reflexive Selbstwahrnehmung ist nicht möglich.
Der Klient äußert, er wisse nicht, wer er sei, und kann innere Vorgänge nicht schildern.
Eigene Emotionen können nicht differenziert wahrgenommen werden und nicht gezielt zur Verhaltenssteuerung eingesetzt werden.
Ein Klient zeigt zu unterschiedlichen Zeiten und Situationen völlig verschiedene Seiten und wechselnde soziale Rollen, es gibt keine differenzierte Identität.
Der Klient hat Schwierigkeiten, zwischen sich selbst und einer anderen Person zu unterscheiden, z. B. werden eigene Gefühle einem anderen zugeschrieben.
Andere Menschen werden in Extremen erlebt („schwarz oder weiß“, gut oder böse).
Es gibt selbst- und fremddestruktive Handlungen.
Das Bild von anderen ist weitgehend durch eigene Projektionen bestimmt.
Große Kränkbarkeit, die als vernichtend erlebt wird, und unrealistische Größenvorstellungen, einhergehend mit Rückzug, sind feststellbar.
Angenehme Emotionen fehlen weitgehend und unangenehme drängen in den Vordergrund.
Subjektive Fantasien und Realitätserleben sind schwer zu trennen.
Man redet aneinander vorbei, es gibt kein Wir-Gefühl.
Der Klient zeigt einen betont sachlichen und distanzierten Umgang, verbunden mit generalisierenden Aussagen.
Der Klient zeigt wenig Mitgefühl und kein Verständnis dafür, dass das Gegenüber eine eigene Geschichte hat und persönliche Stärken und Schwächen.
Dem Klienten fehlt die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen.
Beziehungen erscheinen funktionalisiert.
Trennungen werden scheinbar emotionslos hingenommen oder können massive Reaktionen auslösen.
Psychische Störungen können bei strukturellen Schwächen, aber auch bei Menschen mit intakter und reifer Persönlichkeitsstruktur entstehen.
Woran erkenne ich psychische Störungen?
Nachfolgend werden beispielhaft einige Merkmale genannt, die auf akute psychische Störungen, Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen hinweisen können. Die genauen Diagnosekriterien sind in der ICD-10, Kapitel V (F23, F3, F4) zu finden.
Akute vorübergehende psychotische Störungen
Wahngedanken (z. B. Verfolgungswahn, Eifersuchtswahn, Beziehungswahn)
Halluzinationen (Stimmen hören, Geruchs- und Geschmackshalluzinationen, körperliche Halluzinationen)
unverständliche oder zerfahrene Sprache
Ratlosigkeit
illusionäre Verkennungen, Verkennungen von Personen und Orten
deutliche Steigerung oder Verminderung der Bewegungsaktivität
reduzierte emotionale Schwingungsfähigkeit, inadäquate Emotionen
akuter Beginn und nicht länger als einen bzw. drei Monate
Depressionen
mindestens zwei Wochen lang
deutlich depressive Stimmung die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag, unbeeinflussbar von den Umständen
Interessen- oder Freudeverlust
verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit
Verlust von Selbstwertgefühl
unangemessene Schuldgefühle
Suizidgedanken oder suizidales Verhalten
Denk- und Konzentrationsstörungen, Unentschlossenheit
Schlafstörungen
Angststörungen
deutlich anhaltende Furcht vor Menschenmengen, öffentlichen Plätzen, alleinigen oder weiten Reisen
wiederholte spontan und unbegründet auftretende Panikattacken
vorherrschende Anspannung, Besorgnis, Befürchtungen in Bezug auf alltägliche Ereignisse und Probleme
körperliche und psychische Symptome wie Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern, Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Unruhegefühle, Schwindel, Gefühle von Unwirklichkeit, Angst vor Kontrollverlust, verrückt zu werden oder zu sterben, anhaltende Reizbarkeit, übertriebene Schreckreaktionen
Vermeidungsverhalten
Posttraumatische Belastungsstörungen
anhaltende, aufdringliche Erinnerungen, Wiedererleben, Träume der Belastung (Flashbacks)
innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen
Vermeidungsverhalten
Erinnerungslücken in Bezug auf die Belastung
anhaltende Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Hypervigilanz, erhöhte Schreckhaftigkeit
Einschränkungen des psychischen Funktionsniveaus auf Seiten des Patienten machen es in der Psychotherapie hin und wieder notwendig, dass der Therapeut vorübergehend einen Teil der Verantwortung für den Patienten übernehmen muss. Das bedingt, dass der Therapeut Experte ist, der dem Patienten in Erfahrung und Wissen voraus ist, und so auch vorübergehende Abhängigkeiten entstehen können. Im Coaching ist es wichtig, zu Beginn die Eigenverantwortung des Klienten zu klären und Abhängigkeiten vorzubeugen. Als Coach bin ich nur für den Prozess zuständig, ich brauche nicht unbedingt therapeutisches Experten- oder Fachwissen.
Gleichzeitig ist wichtig, für sich selbst als Coach zu reflektieren, ob man den Auftrag des Klienten annehmen und verantworten kann und möchte – aus ethischen, moralischen und persönlichen Gründen und inwiefern der Auftrag mit den eigenen Werten übereinstimmt. Ebenso wichtig ist es, sich zu fragen, ob man für das Anliegen des Klienten angemessen ausgebildet ist. Es ist also nicht nur eine gesetzliche, sondern auch eine Frage der inneren Haltung, ob ich einen Auftrag annehme, ihn ablehne und / oder dem Klienten empfehle, sich an entsprechend ausgebildete Experten zu wenden.
Literatur: ICD-10; Rudolf, Gerd (2013): Strukturbezogene Psychotherapie.“
2. Coaching – Hilfe zur Selbsthilfe
Ein Coach ermöglicht die Hilfe zur Selbsthilfe und steuert den Prozess, der zum Ziel führt. Er selbst ist kein Lösungsanbieter. Akzeptanz, Vertrauen und Diskretion sind wichtige Grundpfeiler in der Zusammenarbeit zwischen Klienten und Coach.
Es geht für den Coach nicht darum, schnelles Geld mit menschlichen Befindlichkeiten zu erwirtschaften, sondern so gezielt und effektiv wie möglich und auftragsgebunden auf den verschiedenen Ebenen des Verhaltens, der Fähigkeiten, der Talente, des Wissens, des Glaubens, der Wertvorstellungen, der Persönlichkeit, der soziologischen Rollen und Systemzugehörigkeiten, der Sinnfindung mit der anvertrauten Person zu arbeiten.
Wir Coaches sollten daher über eine solide Ausbildung als Grundlage für unser Arbeiten verfügen, denn das sind wir den Klienten schuldig. Auch wenn das Coaching wie in meinem in der Einleitung geschilderten Beispiel trotz allem immer wieder zu unerwarteten Ergebnissen führen kann.
Sich nach einem Prozess, der einen unzufrieden zurücklässt, auf die Suche nach den Ursachen zu begeben bringt Experten oft in Kontakt mit eigenen Mustern und fordert dazu heraus, die eigene Medizin zu kosten: Fragen zu stellen und zu beantworten, Denkmuster zu durchbrechen, Motive zu ergründen, Zielsetzungen neu zu definieren und sich vielleicht sogar selbst coachen zu lassen.
Diese Suche kann deutlich machen, dass in der Zusammenarbeit mit Menschen unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt, das Problem und den Prozess einerseits nötig sind und andererseits aber auch die Dynamik des Ablaufs beeinflussen.
Coaching ist wie eine Art Tanz: ein Contemporary, bei dem die Schrittfolge im Bewegungsablauf entsteht und auf dem Vertrauen basiert, dass derjenige, der führt, weiß, was er tut. Es geht um das Hineinspüren und das Gefühl für den Rhythmus. Wenn sich beide Protagonisten darauf einlassen, entsteht Resonanz. Aber das Ganze funktioniert nur dann, wenn der Führende weiß, was er tut, und der Folgende darauf vertrauen kann.
2.1 Erstkontakt – die tragfähige Grundlage
Alles beginnt mit dem Kennenlernen, denn hier wird der Grundstein für die Zusammenarbeit gelegt. Nicht nur fachliche Kompetenz und der Bezug zum Klientenumfeld, also die Erfahrung, die der Coach mitbringt, um mit dem Klienten an dessen Problem zu arbeiten, sondern auch Sympathie spielt eine erhebliche Rolle. Sympathie bedeutet hier nicht, dass man sich gleich vorstellt, beste Freunde werden zu können, sondern sie ist vielmehr das Fundament des Vertrauens. Kann man sich „riechen“? Auch das ist metaphorisch zu sehen, denn nicht immer besteht die Möglichkeit, ein Erstgespräch wirklich von Angesicht zu Angesicht durchzuführen. Manchmal lernt man sich während eines Telefonats kennen oder während einer Videokonferenz. In meinem Erfahrungsumfeld ist das Kennenlerngespräch immer kostenfrei, denn es ist sowohl für den Coach als auch für den Coachee ein wichtiger Gradmesser: Beide müssen miteinander „können“!
Es geht also bei diesem Gespräch nicht nur um die Auftragsklärung, sondern auch um eine erste Klärung auf der Beziehungsebene. Beide beteiligte Parteien haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie miteinander arbeiten wollen und können. Wenn es für eine Seite nicht passt, sollte die gemeinsame Arbeit gar nicht erst begonnen werden. Ich habe beides erfahren – also sowohl, dass sich ein Coachee einen anderen Coach aussuchen möchte, als auch, dass ich als Coach nicht mit dem Coachee arbeiten möchte.
Wenn man eine solche Entscheidung bereits gleich nach dem ersten kurzen Kennenlernen treffen muss, kann sie sich natürlich auch als Fehler herausstellen, doch zumeist war ja subjektiv irgendeine Art von „Störung“ vorhanden, die das Miteinander erschwert hat oder hätte.
Zum wichtigsten Handwerkszeug eines Coaches gehört es, Fragen stellen zu können, und am besten sind es gute Fragen! Fragen, die das Problem einkreisen und die Motivation des Gegenübers herausfiltern.
Tipps für gute Fragen gibt es im Anhang.
2.2 Rahmenbedingungen – das Drum und Dran
Ebenso können beim Erstgespräch die Rahmenbedingungen geklärt werden:
Wie soll gearbeitet werden (online oder offline)?
In welchen Abständen wird gearbeitet?
Wer hat welche Aufgaben (eventuelle Hausaufgaben für den Klienten etc.)?
Wie lange dauert eine Sitzung? (Hier führen viele Wege nach Rom: In einer Therapie dauern Sitzungen meist 50 Minuten, im Coaching meist eine Stunde. Es können aber auch 90 Minuten oder mehr sein. Das vereinbaren Coach und Coachee miteinander. Wichtig ist nur die Transparenz.)
Gibt es
Add-ons
(Videomitschnitte, wenn man online arbeitet, Protokolle oder Ähnliches)?
Auch Methodentransparenz kann wichtig sein. Wurde man wegen einer bestimmten Methode oder Art des Coachings konsultiert oder rein wegen des Fachgebiets? Hier sollte unbedingt Einigkeit zwischen den beiden Parteien bestehen, damit die Zusammenarbeit gelingen kann.
Ich bevorzuge Kennenlerngespräche, bei denen ich mein Gegenüber sehen kann, also per Videokonferenz (das ist heutzutage unproblematisch möglich über Anbieter wie Skype, Zoom oder auch Apple mit Facetime) oder am liebsten persönlich. Das hat für mich vor allem den Vorteil, die Person schon gleich kalibrieren zu können: Also zu sehen, wie sich der Körper verhält, welche Sprachmuster es gibt und wie intoniert wird. Welche Wörter benutzt das Gegenüber und wie werden diese durch Körpersprache begleitet? So erhalte ich schon eine ganze Menge Informationen, bevor es überhaupt um Inhalte des Coachings geht, und kann bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in Resonanz gehen.
2.3 Mimikresonanz – die Methode
Schon beim ersten Gespräch bietet sich die Möglichkeit, Kenntnisse der Emotionserkennung über die Mimik einzusetzen. Kann man bei den Aspekten, die der zukünftige Klient berichtet, schon etwas im Gesicht entdecken? Wir benötigen einen emotional aufgeladenen Moment, um eine rasche muskuläre Bewegung in Form einer Mikroexpression sehen zu können. Wenn der Klient seine Motivation für ein Coaching erläutert, kann genau das bereits hier auftreten und Sie als Coach erhalten eine Idee von Ihrem Gegenüber und dem Problemzustand – ein hilfreicher Wissensvorsprung, der nicht nur dazu führen kann, dass sich der Gesprächspartner schon von Beginn an verstanden fühlt, sondern der letztlich auch zur tatsächlichen Auftragsvergabe beitragen kann.
Resonanz ist ein sehr wichtiger Part in der Mimikresonanz-Methode, die aus drei Schritten und dem damit verbundenen Fachwissen besteht:
Mimikscouting: Die Fähigkeit, die Zeichen der mimischen Muskulatur wahrzunehmen.
Mimikcode: Das Wissen, welche mimisch-muskuläre Bewegung zu welcher Emotion gehört.
Resonanztraining: Wahrnehmung und Wissen mit den passenden Worten in den Kommunikationsprozess einzufügen.
Mimikscouting bedeutet, sich auf die Spuren der Mimik zu begeben und damit eben auch genau hinzuschauen: dem Gesprächspartner ins Gesicht zu schauen und das so locker wie möglich, ohne durch starres Anstarren gleich einen psychopathischen Eindruck zu hinterlassen .





























