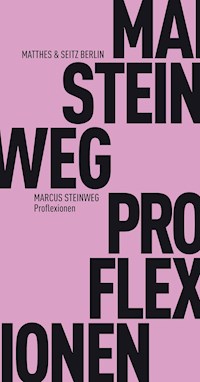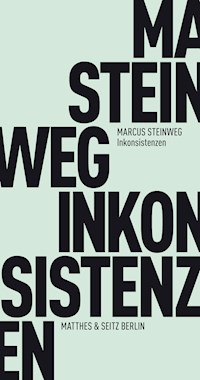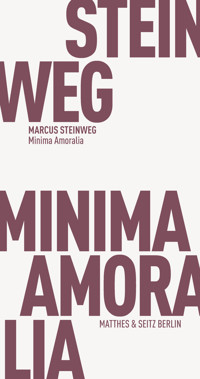
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Titel des Buchs verweist auf Theodor W. Adornos Minima Moralia. Nicht um ihm zu widersprechen, sondern um daran zu erinnern, dass Denken auch für Adorno nur als Konflikt mit dem Bestehenden zu haben ist, mit dem Zeitgeist, der Tradition, der Gesellschaft. Wahrhaft moralisches Denken fällt amoralisch aus. Es arrangiert sich nicht opportunistisch mit den ökonomisch wie ideologisch kontrollierten Verhältnissen und Zwängen, sondern befragt sie, zeigt ihre Gelenktheit auf, sowie die Tatsache, dass niemand ungelenkt, also frei, existiert. Die Notizen, die dieses Buch versammelt, handeln von Gespenstern, saurer Milch, Hans Blumenberg, verweigerter Schläfrigkeit, nichtheroischem Schreiben, aber auch von Heraklit, Sprachlust, vergesslichem Wasser, der Materialität der Sprache und dem Regenbogen, dem sich jedes Denken, das aufs Äußerste geht, anvertraut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MINIMA AMORALIA
Fröhliche Wissenschaft 248
Marcus Steinweg
MINIMA AMORALIA
INHALT
1. Traumgespinste
2. Gespensterlärm
3. Gewisse Leben
4. Theatrales Denken
5. Identitätskomödie
6. So gut wie Beckett
7. Begriffsdramatik
8. Grenzgänger
9. Ballistik
10. Chaos / Physis
11. Konsistenzlüge
12. Nichts Rätselhaftes
13. Nichtselbst
14. Geisterreich der Fantasie
15. Entsubjektivierung
16. Glaube
17. Notiz zu Kierkegaard
18. Pfeil
19. Wachsen
20. Nur einen Sommer
21. (Un)Gerettete Zukunft
22. Kitzel
23. Index
24. Fantasie
25. Versuchung
26. Spinne
27. Freiheit in actu
28. Hyptnotisch
29. Sehen des Unsichtbaren
30. Beides in einem
31. Traurige Metamorphose
32. Mit und ohne Blumenberg
33. Metaphorologie
34. Notiz zu Nietzsche
35. Trost
36. Denkspiel
37. So viele Gespenster
38. Vitalismus
39. Harmlosigkeitsmanagement
40. Saure Milch
41. Notiz zu Handke
42. Selbstexposition
43. Zeitgenossen
44. Irreversibel
45. Nicht heroisches Schreiben
46. Füße
47. Verweigerte Schläfrigkeit
48. Feuerbach
49. Denkbar präzise
50. Ins Unbekannte
51. Notiz zu Friedrich Schlegel
52. Ohne
53. Atemlose Produktion
54. Notschrei
55. Universalität
56. Linie / Kurve / Bahn
57. Notiz zu Günther Anders
58. Liebe oder Profit
59. Notiz zur Grausamkeit
60. Ein spezifischer Kartesianismus
61. Topologie
62. Schrei
63. Ich
64. Wechselspiel
65. Streben
66. Verrücktes Subjekt
67. Diät
68. Gezeigtes Gefängnis
69. Jenseits des Zugriffs
70. Dringlichkeit
71. Genuss
72. Engagierte Neutralität
73. Notiz zu Heraklit
74. Selbstverfehlung
75. Problematischer Kredit
76. Längst im Abseits
77. Ikarisches Denken
78. Vokabelskepsis
79. Sprachlust
80. Im Labyrinth der Sprache
81. Apologeten des Nichtdenkens
82. Thanatophilosophie
83. Versuch
84. Identität
85. Sumpf
86. Entwirklichung
87. Horizont
88. Spur
89. Ambivalenz der Aufklärung
90. Indefinit
91. Suche
92. Selbstbetrug
93. Stelzen
94. Übersetzt in Farbe
95. Vergessliches Wasser
96. Syntagmen
97. Nüchternes Funkeln
98. Maschine
99. Rennen
100. Wahrheitsberührung
101. Am helllichten Tag
102. Blindflug
103. Regenbogen
104. Materialität der Sprache
105. Loch im Sein
106. Filmemachen
107. Komische Vergeblichkeit
108. Seiltänzer
109. Seinskasino
110. Fallen
111. Ego morior
112. Hommage
113. Lesen
114. Heiliges Chaos
115. Gegenstandslos
116. Hurrikan
117. Nicht fertig mit Nietzsche
118. Liebesdynamik
119. Selbstbezichtigungsnarzissmus
120. Sinn
121. Verhexung
122. Vulkan
123. Entselbstung
124. Notiz zu Louise Bourgeois
125. Don’t cry – think!
126. Noch einmal zu Barthes
127. Notiz zu Cixous
128. Müde
129. Unverzichtbare Überstürzung
130. Horizont 2
131. Anfang
132. Das Unaufhörliche
133. Nebel
134. Konvergenz mit dem Nichts
135. Larvensubjekt
136. Sonne
137. Jetzt
138. Wahrheit
139. Wohnen
140. Ohnmacht
141. Vorhölle
142. Notiz zur Freiheit
143. Inkompatibel
144. Hysterie
145. Ewiges Opfer
146. Abstraktes Denken
147. Fehl der Sprache
148. Hellsichtigkeit
149. Keine Gegenwart
150. Gespenstisches Selbstverhältnis
151. Brücke
152. Notiz zu Karl Kraus
153. Kostümliebe
154. Ewiger Winter
155. Stilist
156. Im Dunkeln
157. Jetzt oder nie
158. Instabile Gegenwart
159. Metaphysik der Jugend
160. Materialismus der Freiheit
161. Hieroglyphen
162. Nachtwächter
163. Noch einmal zu Susan Sontag
164. Monströse Normalität
165. Berstende Kraft
166. Sexualität
167. Notiz zu Heidegger
168. Schlamassel
169. Was Agnes Martin weiß
170. Fröstelnder Narzissmus
171. Notiz zu Adnan
172. Sperrung
173. Gnade
174. Karikatur
175. Intensität
176. Objekt / Subjekt
177. Glut
178. Strindberg
179. Zerrissener Traum
180. Langer Weg
181. Emphase
182. Fragen
183. Phantasmen
184. Transzendenz & Immanenz
185. Leere
186. Was macht der DJ?
Anmerkungen
TRAUMGESPINSTE
Versuchte man, das Charisma einer Person zu ermitteln, käme man nicht ohne Metaphysik aus. Was Bertolt Brecht an Walter Benjamin moniert, mit dem ihn eine unwahrscheinliche Freundschaft verband, war dessen Festhalten am metaphysischen oder mystischen Moment. Benjamin blieb zeit seines Lebens Metaphysiker. So metaphysikkritisch sein Denken auch ausfiel, so sehr blieb es den Anteilen am Phänomen zugewandt, die sich der Greifbarkeit entziehen. Nie war er in Versuchung, sich einem platten Positivismus anzuschließen. Sein Dinguniversum ist belebt. Es ist durchgeistigt, weil lauter Geister es bevölkern. Mit Kafka teilt er die Liebe zu Gespenstern. Allerdings zeugen die Gespenster nicht von positiver Transzendenz. Sie wohnen in den Dingen und zwischen ihnen. Und manchmal ergreifen sie vom menschlichen Subjekt Besitz, um es selbst als Gespenst erscheinen zu lassen. An ihnen ist etwas Fremdes, das sich weder verstehen noch bestreiten lässt. Georges Didi-Huberman spricht in seinem Buch zu Sandro Botticellis Venus den Entzugscharakter von dessen Bildpersonal an.1 Wie bereits Aby Warburg bemerkt, sind die dargestellten Figuren, ob Jünglinge oder Mädchen, eigenartig abwesend. Sie sind da, ohne da zu sein, wie Gespenster. Ihre Präsenz ist zugleich Absenz. Was man ihre Gegenwart nennen kann, bleibt von einer Art Widerständigkeit bestimmt, als kehrten sie sich von uns ab. Man könnte sogar meinen, dass sie sich von sich selbst distanzieren, wie Traumgespinste, die im Moment ihres Erscheinens schon im Verschwinden begriffen sind. Didi-Huberman erkennt in dieser Präsenz-Absenz-Dialektik die gespenstische Bilddialektik schlechthin. Bilder entziehen sich als solche im Modus ihrer Vergegenwärtigung. Sie schleichen sich ins Vergessen, bevor man sie, immer unzureichend, erinnern kann. Vielleicht ist es das, was Benjamin mit der Aura im Blick hat: dieses primordiale Vergessen dessen, was nie gegenwärtig war, und die Erinnerung an es wie an etwas apriorisch Verlorenes, dem keine Trauer entsprechen kann.
GESPENSTERLÄRM
Nachdem er in einem Brief vom Januar 1914 Bertrand Russell von seiner »schrecklichen Angst« und »Depression« berichtet hat, räumt Wittgenstein ein, nie gewusst zu haben, »was es heißt, sich nur noch einen Schritt vom Wahnsinn [getrennt] zu fühlen.« Bis es schließlich doch zum Gefühl der Besserung seines Zustands kommt. »Erst seit zwei Tagen kann ich wieder die Stimme der Vernunft durch den Lärm der Gespenster hören und habe wieder angefangen zu arbeiten.«2 Wie Kafka fühlt sich Wittgenstein von Gespenstern umfangen. Es sind die Dämonen des Wahnsinns, die an ihm zerren. Ihn weht der kalte Atem der Psychose an. Mit ihrem Eintreten würde sein Denken sich aufzulösen beginnen. Er ist Logiker, er glaubt an die Kraft des Verstands und verfügt über eine ungewöhnlich hohe Intelligenz. Etwas zugespitzt kann man sagen, dass seine Intelligenz seine Intelligenz bedroht. Hinzu kommt der Eindruck, nicht mit sich im Reinen zu sein. »Wie kann ich Logiker sein, wenn ich noch nicht Mensch bin!«3, heißt es in einem anderen Brief an Russell um Weihnachten 1913. Bis in die Tagebuchaufzeichnungen der 1930er-Jahre festigt sich das Gefühl, an der Grenze zum Wahnsinn zu operieren. Wichtig ist, alles dafür zu tun, diese Grenze nicht fahrlässig zu überschreiten. Die gesamte Philosophie Wittgensteins liegt hier: in diesem Appell, der zunächst an ihn selbst ergeht, die Grenze zum Unaussprechlichen anzuerkennen, sich ihr zu nähern, aber sie keinesfalls zu übertreten. Daher Wittgensteins Imperativ, stehen zu bleiben, wo andere weitergehen. Erstens, weil er nicht dem sinnwidrigen Gequassel derer erliegen will, die es tun, zweitens, weil er weiß, dass in der Zone des Nichtsinns der Wahnsinn auf ihn wartet. Sein Denken resistiert sowohl dem Nichtsinn wie dem Wahnsinn. Es ist widerständig, geradezu militant in diesem Sinn.
THEATRALES DENKEN
Es gibt eine Theatralik des Denkens, die zwischen den auf seiner Bühne befindlichen Agenten nicht eindeutig zu unterscheiden erlaubt. Das sokratische Theater gewisser platonischer Dialoge lässt Sokrates bald als Wissenden, bald als Unwissenden, oft als Fragenden auftreten. Nicht immer weiß man, an wen die Fragen, die er stellt, gerichtet sind. An seine Gesprächspartner, an eine ferne Zukunft, an ihn selbst? Bei Nietzsche stößt man auf ein inszeniertes Maskenspiel, das sich in die Tiefe des Chaos bohrt, das er als dionysischen Ungrund konzipiert. Und auch Foucault und Deleuze sind theateraffine Denker, die sich dem Maskenspiel hingeben, schließlich bewegt sich alles, was sie sagen, an der Grenze zum Schein oder zur ontologischen Inkonsistenz, die weitere Namen des Chaos sind. Und Lacan? Seine exzentrischen Lehrauftritte fallen komödiantisch aus. Der ungeheure Ernst und die messerscharfe Intelligenz seiner Überlegungen kippen leicht ins Komische. Auf dem Grund des Komischen allerdings wartet oder persistiert das Reale, von dem er sagt, dass man es sich nicht einverleiben kann. Was möglich ist: es aus der Distanz des Bühnensubjekts herbeizuwinken, es also als das zu markieren, dem man sich nicht ungeschützt nähern soll. Die Bühne ist der Schutzraum, in dem verhandelt wird, was nur indirekt angesprochen werden kann, damit es, um es mit einer Formulierung Rilkes zu sagen, »gelassen verschmäht, uns zu zerstören.«6
IDENTITÄTSKOMÖDIE
Will man die Wahrheit eines Denkens ausmachen, genügt es, herauszufinden, in welchen Spiegel es sich verirrt. Wo sucht es sich, wo glaubt es sich zu erkennen, in welchem Identitätsspektakel bildet es sich ein, auf sich zu treffen, auf ein Selbst, das es selbst wäre, kein Gespenst also und mehr als ein Abbild? Die narzisstische Fantasie, im Draußen auf sich zu stoßen, dass da irgendwo entschieden wäre, wer man sei, generiert eine Ontologiekomödie, der sich jeder Identitarismus unterwirft, während er tragische Züge anzunehmen beginnt. Plötzlich ist alles grotesk und man findet sich in einer Geisterbahn wieder, aus der es kein Entrinnen gibt. Es ist ein Spiegelkabinett ohne Ausgang, das jedes Identitätsdenken hervorbringt. Was es sich unter sich vorstellt, hat den Charakter einer ewigen Versuchung angenommen. Das Begehren erstickt am Begehren seiner selbst (oder dessen, was der Spiegel ihm zu versprechen scheint).
SO GUT WIE BECKETT
Man kann nicht aufhören zu schreiben, weil mit allem, was geschrieben wurde, noch nichts gesagt ist. Oder nichts als nichts, weshalb alles zu sagen bleibt und Schreiben und Denken nicht aufhören. Das weiß Derrida so gut wie Beckett.
GRENZGÄNGER
Nie fiele es Susan Sontag ein, das Lob der Morbidität anzustimmen. Ihre Intelligenz verbietet ihr noch das der Gesundheit, da sie weiß, dass es zwingend reaktionär ausfällt. Deshalb kann sie schreiben, dass »Schriftsteller wie Kierkegaard, Nietzsche, Dostojewski, Kafka, Baudelaire – und Simone Weil – gegenwärtig [1963] gerade deshalb bei uns im Ansehen [stehen], weil ihre Werke eine Atmosphäre des Ungesunden umgibt. Gerade in diesem Ungesunden liegt ihre Gesundheit und ihre Überzeugungskraft.«9 Was Sontag hier sagt, darf weder dem Kult der Gesundheit noch seinem Gegenteil zugeschlagen werden. Es unterminiert ihre Kultivierung wie ihre Gegensätzlichkeit. Dass die Gesundheit der Genannten im Ungesunden liegt, heißt, dass sie Grenzgänger sind. Sie assimilieren sich nicht dem Bestehenden, sondern widersetzen sich ihm. Mit fiebriger oder anorektischer Entschiedenheit gehen sie gegen die Imperative ihrer Zeit vor, seien sie kultureller, religiöser, sozialer, politischer, medizinischer oder ökonomischer Natur. Sontag erkennt die Überzeugungskraft ihrer Helden in deren Weigerung, Helden zu sein. Obwohl sie sie »Kulturheroen« nennt, insistiert sie auf ihnen als Protagonisten eines künstlerischen Extremismus, der sie der Verausgabung sowie faktischem Leid aussetzt. Natürlich ist ihr die Gefahr pathetischer Leidensstilisierung bewusst. Nur hindert sie dieses Bewusstsein nicht daran, in ihnen Grenzfiguren im bürgerlichen Sozialtheater zu sehen, die dessen Beliebigkeit unter Preisgabe ihrer Gesundheit demonstrieren. Es sind Autoren von »ätzender Originalität«, sagt sie. Ihre Nachahmer fallen hinters von ihnen Verworfene zurück. »Es gibt Leben, die einen exemplarischen Charakter haben, und solche, die ihn nicht haben; es gibt solche, die uns zur Nachahmung einladen, und solche, die wir mit einer Mischung aus Abscheu, Mitleid und Ehrfurcht aus der Distanz betrachten. Hier liegt, grob gesprochen, der Unterschied zwischen dem Helden und dem Heiligen (wenn man diesen Begriff im ästhetischen statt im religiösen Sinne gebrauchen darf).« Als herausragendes Beispiel eines solchen »Heiligenleben[s]« nennt Sontag dasjenige von Simone Weil, die in den Hungerwahn getriebene Anorektikerin, deren Denken sich am Limit seiner Möglichkeiten überschlug, ohne der Versuchung des Irrationalismus zu verfallen, ohne den geringsten Kompromiss mit der Doxa und ihrer Gesundheitsreligion einzugehen, ohne der Lüge aufzusitzen, dass das Leben umsonst sei, solange man sich endlichen Autoritäten beugt.
BALLISTIK
Dass es Denken nur als sich selbst denkendes Denken gibt, wissen wir spätestens seit Descartes. Das heißt nicht, dass es sich in der Bemühung um Gewissheit auf den Zweifel verlässt. Es muss noch den Zweifel bezweifeln, wie Wittgenstein weiß. Ein unendlich verlängerter Zweifel wäre keiner. Vor allem wird der Zweifel vom Unbezweifelten getragen oder flankiert. Ein wenig Glaube gehört noch zur rigorosesten Skepsis. Man muss sich klarmachen, dass der Glaube auf dem Zweifel ruht. Das gilt nicht nur für den religiösen Glauben; aber wer will entscheiden, ob es einen nicht-religiösen gibt? Glauben heißt bereits an der Verlässlichkeit des Glaubens zweifeln und Zweifeln heißt ahnen, dass es ohne Glauben nicht geht. Das Denken erstreckt sich in sein Jenseits. Es katapultiert sich ins Ungewisse. Bevor es dies tut, prüft es seine Mittel und die Wahrscheinlichkeit seiner Flugbahn. Es gibt es nicht, ohne eine gewisse Ballistik. Das aber heißt, dass es sich noch im selbstbewussten Flug seiner Schwerfälligkeit versichert. Grenzen überschreitet nur, wer seine Grenzen kennt.
KONSISTENZLÜGE
Dem Selbstverlust beizuwohnen, als ginge er einen nichts an, ist Grunderfahrung des Subjekts, sofern es sich ins Nichts seiner Subjektivität versenkt, das heißt, mit Hegel gesprochen, in die präsubjektive Substanz. Es ist das Meer der vorgeistigen Materie, in die das Bewusstsein zurücktaucht, um sich der Gefahr auszusetzen, endgültig mit ihm zu verschwimmen. Was Sigmund Freud mit dem ozeanischen Gefühl assoziiert, ist Ausdruck dieser Regression. Es gibt sie auch als Progression, immer dann, wenn das Subjekt seinen Grund als Abgrund erfährt, um aus dieser Erfahrung ernüchtert, erneuert, erleuchtet hervorzugehen. Man sollte diese Erfahrung nicht als Esoterik abtun. Sie ist Erfahrung aller, die eine Erfahrung machen, um ihr Selbst an ein Licht zu verlieren, das ihre Nacht zum Leuchten bringt. »Erfahrung«, schreibt Peter Sloterdijk, »ist, was eine Wendung des Subjekts gegen sich selbst bewirkt und die vernichtende Befreiung von einer Vormeinung mit sich bringt.«14 Sie verstört und redefiniert die Ökonomie des Subjekts. Es weiß nun, auch ohne Freud gelesen zu haben, nicht bei sich zu Hause zu sein. Plötzlich begreift es sich als sein Draußen. Denken heißt jetzt, der Fremdheit mittels einer Sprache zu entsprechen, deren Gebrauch das Selbst verrät. Die Erfahrung erweist sich als Verrat, der das Subjekt zum Schauplatz seines Entgleitens macht. Und dennoch handelt es sich erst dann um eine Erfahrung, wenn sie luzide, kompromisslos, mutig ausfällt. Es gibt Menschen, die es schaffen, sich an ihrer Leere sattzusehen. Ihnen gelingt, mit der Lüge ihrer Konsistenz zu brechen, weil sie es riskieren, ohne sie zu existieren.
NICHTS RÄTSELHAFTES
Bewusstsein als Droge. Es gibt Hellsichtigkeit, die einen taumeln lässt. Wie schützt man sich vor ihr? Indem man in den Rausch flüchtet, während sie selbst einen Rausch darstellt? Es gibt das Wissen, ums bewusstseinserweiternde Wissen. Es wirkt wie eine Droge, die das Bewusstsein derart zuspitzt, dass es sich der Ohnmacht nähert oder dem Wahn. Sollten Halluzinationen wie Psychosen Strukturen sein, die das Subjekt der angsteinflößenden Wahrheit nähern, dass es keine Geheimnisse, keinerlei Dunkelheit, nichts Rätselhaftes gibt?
GEISTERREICH DER FANTASIE
Obwohl sich das Objekt des Begehrens leicht benennen lässt, ist mit dieser Benennung fast nichts über das Begehren gesagt. Hinterm Objekt, von ihm unsichtbar gemacht, persistiert, wofür es einsteht. Immer ist es Substitut dessen, was es nicht zum Verschwinden bringen kann. Indem sich das Begehren aufs Objekt richtet, öffnet es sich dem, was an ihm mehr als dieses Objekt ist. Es eröffnet den Raum der Objektlosigkeit. Man kann auch vom Geheimnis einer Dingwelt sprechen, die das Geisterreich der Fantasie ist. In ihm ist nichts greif- oder besitzbar, weshalb die Objekte als Stellvertreter der Dinge fungieren. Indem sie es tun, reißen sie das Subjekt der Begierde in die Objektwelt zurück, die die Welt vorläufiger Befriedigung oder relativer Satisfaktion genannt werden kann. Vorläufig und relativ deshalb, weil das Begehren über sie hinausschießt, um sich der Erfahrung des Unverfügbaren zu exponieren.
ENTSUBJEKTIVIERUNG
Im Meskalinrausch glaubt Henri Michaux sich der »Mathematik des Weltgeheimnisses«15 zu nähern. Seine Drogenprotokolle überzeugen schon deshalb, weil sie keinerlei Obskurantismus implizieren. Im Gegenteil: Sie klären auf! Worüber? Über das, was man die Metaphysik des Körpers und seiner überschwänglichen Zustände nennen könnte, über die Maßlosigkeit, die ein Gefühl der Überfülle freisetzt, während sie das Subjekt einer Entsubjektivierungserfahrung aussetzt, die es zu gesteigerter Genauigkeit der Wahrnehmung zwingt, damit ihm nichts vom Nichts, das mit der Überfülle in eins fällt, entgehen möge, um sich schließlich beim Verlust seiner Sinne durch die Intensivierung ihrer Leistung als nahezu unbeteiligter Zeuge zuzusehen.
GLAUBE
Simone Weil verbindet mit Kierkegaard das Wissen, dass jedes Wissen an den Glauben grenzt. Es muss sich ausreizen, bis es kaum noch wissen kann, ob es nicht längst glaubt. Hierin liegen sein Hyperbolismus und seine Gefahr. Kierkegaard assoziiert den Glauben mit dem Absurden. Er transzendiert den Verstand und verschafft ihm durch diese Transzendenz Gültigkeit. Der Glaube ersetzt den Verstand nicht, er bestärkt ihn, indem er ihn an seine Grenze und über sie hinausführt. Natürlich handelt es sich nicht um den Glauben an eine personale Instanz. Der Glaube, notiert Kierkegaard im Tagebuch, ist, »was die Griechen den göttlichen Wahnwitz nannten.«16 Er richtet sich auf die Leere aus, die Gott heißt. Wer aber sein Sein an der Leere misst, muss wahnsinnig sein. Es ist dieses Wahnsinnigwerden des endlichen Subjekts, das dem Unendlichen, das Glaube heißt, in seinem Leben Gültigkeit verschafft.
NOTIZ ZU KIERKEGAARD
Kierkegaard hat den (abstrakten) Begriff mit der (konkreten) Existenz kurzgeschlossen. Man könne »einen Begriff ohne die Erkenntnis haben, aber nicht die Erkenntnis ohne den Begriff«, heißt es in der Mitschrift einer Vorlesung Schellings zur Philosophie der Offenbarung vom Wintersemester 1841/42.17 So sehr Kierkegaard eher Schriftsteller als Philosoph genannt werden kann (was Heidegger tatsächlich abschätzig tat, während er massiv von ihm beeinflusst blieb), so sehr stimmt das Gegenteil. Das existenzielle Denken fällt bei ihm als Begriffsdenken aus. Die Begriffe sind, wie in Hegels Phänomenologie des Geistes, existenziell temperiert. Sie bersten vor Vitalität und Unruhe, was nicht heißt, dass sie nicht streng im Sinne der von Kierkegaard praktizierten Vitalitäts- und Unruhedialektik sind.18 All dies findet in den Berliner Tagebüchern in Auseinandersetzung mit dem späten Schelling statt, einem Denken, das seine ursprüngliche Leidenschaft – zumindest sieht es Kierkegaard so – verloren hat. Die Diagnose lässt sich aufs Heute übertragen. Seine Zeit sei »so erbärmlich, weil sie keine Leidenschaften hat.«19