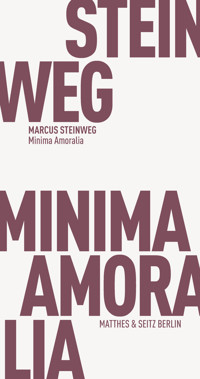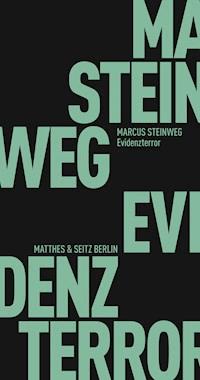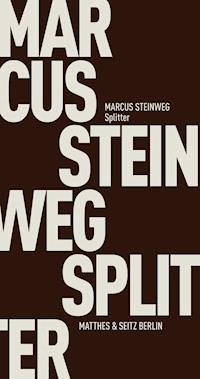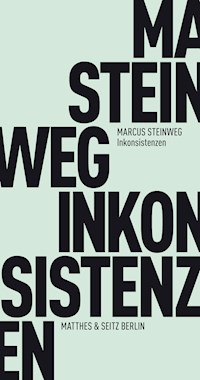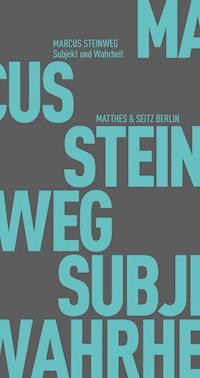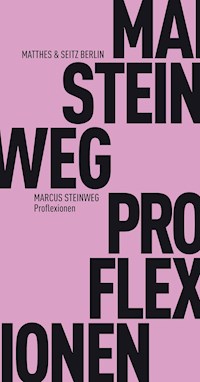
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fröhliche Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach Inkonsistenzen, Evidenzterror, Splitter und Subjekt und Wahrheit setzt der Philosoph Marcus Steinweg mit den Proflexionen sein eigensinniges Denken fort und nimmt den Leser mit auf den Weg. In prägnanten und hochverdichteten Kurztexten, Denkbildern, Bemerkungen und Miniaturen zu Autoren wie Simone Weil, Georg Trakl, Fernando Pessoa, Etel Adnan, Peter Handke, Franz Kafka, Jean-Luc Nancy oder Ludwig Wittgenstein kristallisiert sich seine unabschließbare Arbeit an den Antinomien des Denkens. Motive wie ›Manhattan‹, ›Kindheit‹, ›Gespenster‹, ›Liebestheologie‹, ›Diätetik‹, ›Schnee‹, ›Professorenphilosophie‹, ›Märchenstunde‹, ›Freundschaft‹ dienen ihm nicht als Reflexionsgrund, sondern als Anlass zu Proflexionen: Affirmationen nicht des Bestehenden, sondern seiner Inkonsistenz. Immer geht es Steinweg darum, Denken als Vorwärtsdynamik statt als Rückversicherung zu praktizieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Steinweg
PROFLEXIONEN
INHALT
1. Kritzeln
2. Immanenzdichtung
3. Notiz zu Handke
4. Schreiben
5. Ausweglos
6. Notiz zu Pessoa
7. Exzesse der Hellsichtigkeit
8. Träumen
9. Qui suis-je?
10. Überflug
11. Schwimmen
12. Sekunde
13. Gier
14. Lesen
15. Schaukel
16. Problem
17. Notiz zu Wittgenstein
18. Schwelle
19. Hunger
20. Selbstverausgabung
21. Schwarz
22. Unterwegs
23. Ungerettet
24. Spiel
25. Notiz zu Musil
26. Denkraum
27. Aporien
28. Hotelzimmer
29. Indifferenz
30. Traurig
31. Notiz zu Robert Walser
32. Null
33. Brennpunkt
34. Schulden
35. Ein Kartesianer des Dunklen
36. Feuer
37. Kunstwerk
38. Angst
39. Notiz zu Kierkegaard
40. Stein
41. Strumpf
42. Brief
43. Gewährenlassen
44. Wüste
45. Wasser
46. Unbestimmtheitsgleichung
47. Absolution
48. Existenz
49. Beatitudo
50. Notiz zu Jaspers
51. Versuchung
52. Geiz
53. Puppen
54. Notiz zu Cavell
55. Kafka an Felice
56. D.
57. Sprachmüll
58. Tränen
59. Frau
60. Märchenstunde
61. Komplexe Realität
62. Notiz zu John Berger
63. Lektion
64. Autofahren mit Lacan
65. Perlen
66. Notiz zu Genet
67. Unterschied
68. Manhattan
69. Schwert
70. Appell
71. Kaninchen
72. Gras
73. Glückliche Tiere
74. Ozean
75. Müdigkeit
76. Notiz zu Adorno
77. Wille
78. Come on!
79. Geschwister
80. Begriff
81. Sieben Tropfen Glück
82. Kreativität
83. Antigone
84. Linie
85. Neues Licht
86. Notiz zu Ingeborg Bachmann
87. Ressentiment
88. Nacht
89. Crazy
90. Journal
91. Liebe
92. Fucked up
93. Ja
94. Notiz zu einer Notiz
95. Was kann Literatur?
96. Schmerz
97. Ergriffen
98. Notiz zu Trakl
99. Grotesk
100. Form
101. Sentimentalität
102. Subjekt
103. Notiz zu Heiner Müller
104. Dichter
105. Bühne
106. Nein
107. Manchmal
108. Gespensterphilosophen
109. Ermutigung
110. Linien, Löcher, Knoten
111. Beten
112. Schraube
113. Nichtidentität
114. Tiere
115. Notiz zu Nancy
116. Postkarte
117. Paraphrase
118. Schreiben
119. Leid der Transparenz
120. Gewöhnung
121. Unterschied
122. Rettung
123. Professorenphilosophie
124. Mutter
125. Notiz zu Kafka
126. Ideologiekritik
127. Daedalus ohne Ikarus
128. Inexistenz
129. Mond
130. Baustelle
131. Notiz zu Hegel
132. Komik
133. Lob des Losers
134. Differenzidiotie
135. Freundschaft
136. Diätetik
137. Vor der Tür
138. Insel
139. Pretty?
140. Erschöpft
141. Dummheit
142. Scheu
143. Aussichtslos
144. S. W.
145. Glück
146. Trottel
147. Haargenau
148. Es kostet mehr, als es kostet
149. Liebestheologie
150. Idiot
151. Lawine
152. Nackt bei offenem Fenster
153. Summen
154. Diätetik 2
155. Molotowcocktail
156. Boden
157. Analyse
158. Kind
159. Streuner
160. Notiz zu Zwetajewa
161. Faszination
163. Vereinigung
164. Kritizismus
165. Traum
166. Magie
Anmerkungen
KRITZELN
IMMANENZDICHTUNG
In seinem Fragment zu Friederike Mayröcker sagt Handke vom Lesen, dass es ein »Mitbuchstabieren, Entdecken, Welt- und Selbsterforschen sei.«2 Statt in ihm ein Entschlüsseln auszumachen, Hermeneutik, plündernde Exegese, definiert Handke es als ein Begleiten, Sichüberraschenlassen, erwartungsloses Herausfinden. Lesen heißt Mitlesen. Das Lesen assistiert dem gelesenen Text, ohne ihn zu maßregeln. Es gibt ihm Zeit und Raum. Der Text selbst ist ein Raum-Zeit-Gebilde, eine »Konstruktion«3, die sich als solche ausstellt. Er verstellt sich nicht zum πνεῦμα, zum flüsternden Spiritus, Geist oder Lufthauch. Es reicht nicht aus zu sagen, dass Dichtung Fiktion sei und lüge. Wenn sie etwas taugt, dann ist sie wahr im Sinne einer Wahrheitskonstruktion, die ganz in diese Welt gehört. Vielleicht lässt sich von Immanenzdichtung sprechen. Ihre Transzendenzpunkte sind »Wortspalt[e]«4. Durch sie strömt ein Gespensteratem, der das Bekannte und Erklärte ebenso auseinander- wie zusammenhält. Das Mitbuchstabieren, von dem Handke spricht, impliziert die Bereitschaft, sich auf die Risse im Textgewebe einzulassen. Ein Text ist kein geschlossenes Gefüge. Er darf nicht verfugt sein, wie Handke einmal, Heidegger kritisierend, sagt: »Die dichte Fügung. Da ist alles richtig – und nichts.«5 Der Text besteht aus Löchern, durch die Luft geht, die ihrer Metaphorisierung widersteht. Nur Idioten machen aus ihr einen Götteratem. Dabei liegt die Leistung der Dichtung darin, die Ritzen im Text nicht zu schließen. Fürs Gedicht sind sie unverzichtbar. Ihr Geltenlassen betrifft das Lesen wie das Schreiben. Von Mayröcker sagt Handke, dass sie »die einzige deutschsprachige Dichterin« sei, »die weint. Und sie weint sachlich, mit den Sachen, den Dingen, den Menschen – in sachlicher Liebe.«6 Im Vorbeigehen gelingt ihm dabei eine Definition der Liebe: Sie muss sachlich sein, noch wenn sie zu Tränen führt. Sie ist Mitgehen mit dem Geliebten, nicht in ein Außerhalb, sondern in alternativloser Immanenz.
NOTIZ ZU HANDKE
Handke sagt, es ginge darum, dem »Aufsteigen der Leere«7 beizuwohnen. Im Schreiben tut sie sich auf. Es öffnen sich Zwischenräume. Der Raum der Bedeutungen und Sprachen erweist sich als rissig. In die Risse schlüpft das Subjekt. »Diese Momente, wo die Leere sich auftut, das sind Dauermomente, mit denen man – wie man in der Umgangssprache sagt – etwas anfangen kann.«8 Mit ihnen fängt der Schreibmoment an. In der Erfahrung gesteigerter Insignifikanz. Schreibend entzieht sich der Schreibende der Autorität der Rhetoriken und Zeichen. Er verlängert die Sprache in ihr Jenseits, lässt sie mit sich brechen, reibt sie gegen sich auf. Nicht indem er ihr Außenelemente einträgt, sondern indem er sie mit dem ihr inhärenten Außen vernäht. Erst in den Zwischenräumen der Sprache ist Sprache möglich, die sich der Wiederholung des Bekannten entzieht. Wie Rilke und Heidegger spricht Handke vom Offenen, das die Leere ist oder der Zwischenraum. Giorgio Agamben schreibt von der Notwendigkeit, sich dem »Mysterium«, auf dessen Kontaktverlust wir mit Sprache reagieren, nicht zu entziehen. Das Mysterium, das er, im Verweis auf Gershom Scholem, mit dem Feuer konnotiert, muss kein theologisches sein.9 Als Index seiner ontologischen Inkonsistenz ist es Bruch des Bekannten mit sich selbst, weshalb angesichts des Mysteriums »die künstlerische Schöpfung nur zu einer Karikatur werden«10 kann. Dass sich inmitten der Sprache Leere auftut, heißt, dass die Sprache über die Fähigkeit verfügt, inmitten der Immanenz aus sich herauszutreten. Statt um die Reaktivierung religiöser Transzendenz geht es um Resistenz gegenüber dem Immanentismus des Kausalen und Historischen, der seine Brüche ignoriert. Dies nennt Handke Erzählen ohne Dramaturgie und Plot. Daher die Nähe zu Cézanne.11 Es ist ein Realisieren. Eine Verdopplung des Bestehenden, um es aus sich heraus ins Element des Textes oder der Farbe zu überführen. Statt Übersetzungsarbeit zu sein, erschafft es neue Realität inmitten der bestehenden. Dies ist die schöpferische Dimension der Kunst: ohne aus dem Bestehenden herauszutreten, es in etwas Neues zu verwandeln, das von ihm zeugt. Erst im Austritt aus der Geschichte tritt das Subjekt in sie ein. Die Dialektik von Mysterium und Historie erweist sich als komplex. Ein Name der Anerkennung dieser Komplexität, die sich sämtlichen Erlösungsversprechen sperrt, ist Literatur. Ein anderer Philosophie.
SCHREIBEN
Mit Kafka und Handke – vielleicht mit allen Schriftstellern und Dichtern – stellt sich Marguerite Duras die Frage, was Schreiben sei. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass zum Écrire Selbstentmächtigung gehört. Hier liegt seine Souveränität. Nicht im Gelingen, nicht in Könnerschaft, sondern in der Bereitschaft, sich im Schreibprozess verloren zu gehen. Schreiben bedeutet, sich auf diese Verlorenheit einzulassen. Schreibend umzirkelt Duras das Loch im Herzen der Realität.
AUSWEGLOS
Fernando Pessoa spricht vom »inneren Schlaf«12, Duras vom »inneren Schatten«13. Es geht ums Nichts, ums Außen und um die Leere ohne Trost. Zuletzt ist eine Traurigkeit gemeint, die jedes Wort zerreißt. Jeder Satz ist von ihr heimgesucht, noch die Syntax wird von ihr zerstört. Zerstörung, die vom Leben handelt, vom Verlust, den es darstellt, vom Vergehen ohne Sinn. Nichts kann Pessoa vor diesem Schlaf retten, der noch die äußerste Wachheit kontrolliert. Im Traum zerfallen alle Konsistenzen. Liebe und Freundschaft erweisen sich als Chimären. Selbst die Gespenster sind nicht mehr gespenstisch. Sie sind Phantome, von denen der Träumende sich Exil erhofft, und dieser Hoffnung wird entsprochen, indem ihm jeder Ausweg genommen wird, das erträumte Jenseits, die Transzendenz: »ich will nicht einmal vor irgendetwas entfliehen.«14
NOTIZ ZU PESSOA
EXZESSE DER HELLSICHTIGKEIT
Rationalismus impliziert Leidenschaft. Die Ratio kommt nicht in Gang, ohne von einem Außen berührt zu werden, das sie mit Passionen infiziert. Der Impuls, zu denken, elektrisiert das Subjekt, treibt es aus sich heraus, lässt es erzittern. Kein Denken ohne Ergriffenheit, Dringlichkeit und Not. Denkend riskiert der Denkende, aus seinen Gewissheiten zu fallen. Er bewegt sich im Medium des Ungewissen, seine Evidenzen zerbröseln, was bekannt schien, erweist sich als unbekannt. Zum Wagnis des Denkens gehört der Verlust des Bodens, auf dem es sich bewegt. Dafür muss man sich begeistern lassen, enthusiasmieren.19 Enthusiastisch sei, wer »im göttlichen Element ergriffen«20 sei, schreibt Jean-Luc Nancy. Im Enthusiasmus steckt das Göttliche (θεĩῖν). Kein Enthusiamus ohne Gott. Es gibt andere Lesarten. Heute sprechen wir von Begeisterung. Auch hier: der spiritus als Geist, Hauch und Atem. Immer bedeutet, enthusiastisch zu sein, im Element des Rätselhaften von ihm angegangen zu werden. Im Berührtsein vom Unberührbaren, was einer Erschütterung des Selbst gleichkommt, einem Schütteln und Wanken, liegt die Bedingung der Möglichkeit kritischer Kompetenz. Der Enthusiasmus führt das Subjekt an die Grenze des Wissbaren. Kritisch ist die Begeisterung nicht als Fanatismus, sondern als Dynamik der Selbstentäußerung im fremden Element. Zur Begeisterung gehört die Bereitschaft, sich aufs Nicht-Entschlüsselte einzulassen. Dabei handelt es sich nicht um bloßes Sichverlieren. Begeistert ist, wer durch Begeisterung neue Wege für sich erschließt. Nie kann es darum gehen, entweder für die Kritik und gegen die Begeisterung oder umgekehrt zu votieren. Es geht um Kritik, wie Handke einmal sagt, als »Form der Begeisterung«.21 Der Enthusiasmus schleudert das Subjekt über seine Evidenzen hinaus. Im Überschwang öffnet es sich für Neues, d. h. fürs Namen- und Gesichtslose seiner Welt. Der Geist des Begeisterten rührt an die Unvertrautheitszone des Vertrautheitsuniversums, das seine Wirklichkeit ist. Das macht ihn nicht zum Realitätsflüchtling. Nur wer sich begeistern lässt, hat eine Chance, sich mit dem Wirklichen in dessen Unwirklichkeit zu konfrontieren. 22 Wer denkt, es sei wirklich im Sinne substanzialer Konsistenz, verfehlt es. Noch der aufgeklärteste Blick auf die Realitäten muss ihrer Inkonsistenz Rechnung tragen. Autoren wie Robert Walser und Franz Kafka und mit ihnen Walter Benjamin sind Immanenzgespenstern nachgegangen. Ihr Schreiben reicht ins Phantomatische noch der beständigsten Realität. Es muss sich von den ephemeren Evidenzen entfernen, um sich auf die ihnen konstitutive Inevidenz einzulassen. Die Begeisterung trägt Züge der Blindheit, doch handelt es sich um eine Blindheit, die sehend ist. Es gibt Exzesse der Hellsichtigkeit. Sie drängen das Subjekt ins Außen, wo es seine Kategorien zur Welt- und Selbsterfassung einbüßt. Letztlich geht es darum, zu träumen, um sich dem Inkonsistenzmoment von Realität zu stellen, ihrer Arbitrarität. Im Traum, schreibt Robert Walser, sei alles »zugleich wahr und unnatürlich«.23
TRÄUMEN
Bei Theodor W. Adorno beobachtet Jacques Derrida ein Schwanken zwischen dem Nein des Philosophen und dem Ja des Künstlers, zwischen Kritik und Affirmation, Transparenz und Intransparenz, Evidenz und Inevidenz, Verstehen und Nichtverstehen, Licht und Dunkelheit.24 Adorno ist Kantianer und Nietzscheaner gleichermaßen. Er ist Hegelianer, sofern wir in Hegel die Kompossibilität von Kant und Nietzsche, Aufklärung und sich selbst aufklärende Aufklärung, realisiert sehen. Das kritische Projekt, das die Philosophie immer sein wollte, muss sich mit seinen Grenzen befassen, um kritisch zu sein. Der Traum von der Aufklärung ist unbestreitbar ein Traum. Im Aufklärungsdenken persistiert der Wunsch gelingender Aufklärung wie die Fiktion realer Selbstdurchsichtigkeit, die das Subjekt autonom erscheinen lässt, während es ganz in Heteronomie getaucht bleibt.25 Deshalb muss es träumen! Nicht um sich über seine Fremdbestimmtheit hinwegzutäuschen, sondern um sich mit ihr als solcher zu konfrontieren. Der Wahnsinn der Vernunft – ihre einzige Chance – liegt in ihrem Hyperbolismus.26 Das Subjekt verfügt – trotz faktischer Gefangenschaft in der objektiven Welt oder gerade wegen ihr – über die Fähigkeit durchzudrehen. Im Durchdrehen artikuliert sich seine Kraft. Zu ihm gehört Widerstand gegenüber seinen Determinanten. Die Weigerung, sich mit seinem objektiven Sein zu versöhnen, macht es zum politischen Tier. Die Kapazität, sich von sich zu lösen, um sich aufs Unbestimmte hin zu überschreiten, indem es sich weigert, mit dem Träumen aufzuhören. Träume sind nicht Träumereien. Adorno schrieb seine auf. Sie sind als Traumprotokolle erschienen. Er wusste, dass zum Denken das Träumen gehört – wie Derrida.
QUI SUIS-JE ?
»Wer bin ich?« – Die Frage eröffnet André Bretons Roman Nadja (1928). Sie ist Symptom einer kaum zu entwirrenden Verwirrung, indem sie auf den Verlust des Selbst, seiner Vertrautheit und Familiarität, antwortet. Es gibt keine Frage, die keine Antwort implizierte. Der Fragende antwortet auf die schmerzhaft empfundene Auflösung seiner Identität. Er kann nicht vor sich verbergen, dem Zufall entsprungen zu sein. Sein Sein hat weder Bedeutung noch Sinn. Immer sind es die anderen, die ihm ein Selbst zuteilen, in dem er sich nicht wiedererkennt. »L’enfer, c’est les autres« – Jean-Paul Sartres Satz aus Huis clos (1944) assoziiert den Anderen mit Ablehnung und Ausschluss, die er durch Blicke, Beobachtung und Abschätzung exerziert. Der Raum der Intersubjektivität ist Raum reziproker Tortur. Es gibt keinen Blick, der vorurteilsfrei wäre. Mit dem Eintritt in die symbolische Ordnung, die die Sphäre unausgesetzter Wertung ist, schnatternder Selbstvergewisserung, sinnversessener Hermeneutik, verliert das Subjekt, was es nie hatte: seine Identität. Es wird zum Möglichkeitstier, dessen Existenz sich aufs Wählen gegebener Optionen, statt unmöglicher Chancen, beschränkt. Das Unmögliche ist das Unwählbare. Im Raum der Erwartungen, Hoffnungen und Imperative der Anderen zu existieren, heißt, es als Kastrat zu tun. Lacan wusste, dass der Preis der Sprache unendlich hoch ist. Wir sprechen, weil wir nicht wissen, wer wir sind. In der symbolischen Zone bewegt sich das Subjekt am Limes abwesender Subjektivität. Es hat weder Natur noch Wesen. An ihm zerrt das Nichts durch die Enttäuschung der Anderen. Als hätte es je eine Chance gehabt, Vorstellungen zu entsprechen, die nicht seine eigenen sind. Das Eigene gibt es nicht, gewiss. Dass es so ist, tröstet nicht über den Zwang hinweg, fremdbestimmte Entität zu sein. Das Selbst ist eine unbekannte Ziffer. Im Raum der Anderen ist es Gespenst und Chiffre. Sie sehen es kaum, denn sie sehen nur, was sie sich zu sehen erlauben, also nahezu nichts. Im Gespenstersein liegt Hoffnung auf ein Leben jenseits der Sichtbarkeit. Unsichtbar werden, sein Sein aufs ihm inhärente Nichts zu verlängern, kann Ausdruck äußerster Auflehnung sein. Das Subjekt verkriecht sich in faktischer Inexistenz. Es verkrümelt sich ins Nirgendwo. Doch dieses Nirgendwo ist nicht Irgendwo. Es ist der Schauplatz geballter Absenz im Herzen des Präsenzsystems, das wir Wirklichkeit nennen. Die Anderen sprechen von Lüge und Täuschung. Ihr Vokabular ist dem Sagbaren verpflichtet. Das Unsagbare kommt ihnen unheimlich vor und wird zur Illusion erklärt. Dabei ist das Subjekt, das als Gespenst mit Gespenstern verkehrt, realer als die es exkludierende Realität. Breton verknüpft die »Rolle« des »Gespenstes« mit der Notwendigkeit, anders als der, den die Anderen in mir sehen, zu sein:
»Meine Vorstellung von ›Gespenst‹, mit allem, was darin an Konventionellem steckt im Hinblick auf seine äußere Erscheinung wie seine blinde Unterwerfung unter bestimmte zufällige Bedingungen der Stunde und des Orts, hat für mich vor allem Bedeutung als endliches Bild einer Qual, die ewig sein kann. Möglich, daß mein Leben nur ein Bild dieser Art ist und ich dazu verdammt bin, rückwärts zu gehen, im Glauben, ich würde forschend voranschreiten; dazu verdammt, erkennen zu wollen, was ich eigentlich wiedererkennen müßte, einen schwachen Teil dessen in Erfahrung zu bringen, was ich vergessen habe. Diese Sicht auf mich selbst erscheint mir nur insofern falsch, als sie mich mir selbst voraussetzt und eine abgeschlossene Figur meines Denkens, das keinen Grund hat, mit der Zeit Kompromisse zu schließen, willkürlich auf eine Ebene des Vorher verlegt, und insofern als sie zugleich eine Vorstellung von nicht wiedergutzumachendem Verlust, von Strafe oder Fall beinhaltet, deren mangelnde moralische Begründung meiner Ansicht nach außer Frage steht.«27
Das Subjekt ist nicht abgeschlossen. Es ruht auf keinerlei stabilem Grund. Eher reicht es ins Unbestimmte einer unvordenklichen Vergangenheit zurück. Indem es sich ins Gewesene bohrt, verliert es an Identität. Was seine Erinnerung ihm an Wirklichkeit erschließt, erweist sich als Schleier, der weder Anfang noch Ende kennt. An diesem Stoff webt es weiter, ohne ahnen zu können, ob es ihm gelingen wird, sich mit ihm zu vernähen. Warum sollte es nicht genügen, Gespenst unter Gespenstern zu sein – in der »Gesellschaft der Ungeheuer«, die Henri Michaux, dessen erste Veröffentlichung den Titel »Qui je fus / Wer ich war« trug, als Existenzgrund der Menschen evoziert?28 Sollte der Mensch der Unheimliche sein oder, nach Heideggers Sophokles-Deutung, das Unheimlichste (δεινότατον), dann vielleicht deshalb, weil er, um zu existieren, kaum auf seine Existenz angewiesen ist. »Wer bin ich?« Die Frage enthält nicht das mindeste Rätsel. Die ihr adäquate Antwort liegt auf der Hand: Als Gespenst unter anderen bin ich Gespenst meiner selbst.