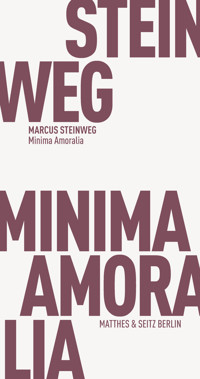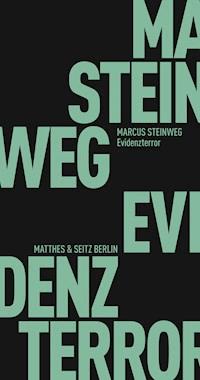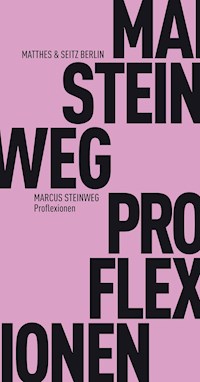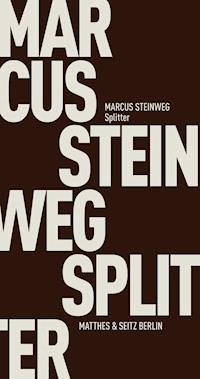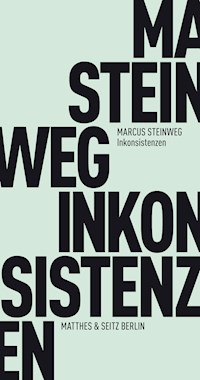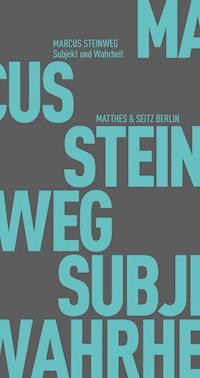
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fröhliche Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Marcus Steinwegs neues Buch kreist um zwei Grundbegriffe der philosophischen Tradition: Subjekt und Wahrheit. In über 300 Bemerkungen zu ›Positivismusfalle‹, ›Aktive Indifferenz‹, ›Kopflos denken‹, ›Karate (空手)‹, ›Wittgensteins Herz‹, ›Lieblingstier‹, ›Politidiotie‹, ›Chinesische Romantik‹, ›Gespensterliebe‹ oder ›Zoologische Irritation‹ geht es ebenso um die kritische Infragestellung dieser Kategorien wie um die Insistenz auf ihrer Unverzichtbarkeit. Immer hält sich Steinwegs Denken im Spannungsfeld von Konsistenz und Inkonsistenz, Vertrautheit und Unvertrautheit, Immanenz und Transzendenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Steinweg
Subjekt und Wahrheit
»Entschuldige nichts, verwische nichts,sieh & sag, wie es wirklich ist– aber Du musst das sehen,was ein neues Licht auf die Tatsachen wirft.«Ludwig Wittgenstein
INHALT
1. Papagei
2. Schlinge
3. Hegel & Kafka
4. Seltsam
5. Peitsche
6. Uhr
7. Ungeheuer
8. Xeniteia
9. Löwe
10. Spiegel
11. Kunst
12. Traum und Zeit
13. Emergenz
14. Wunde
15. Zwiefache Angst
16. Notiz zu Baudelaire
17. Reise
18. Mantel
19. Maske
20. Streunen
21. Was jeder weiß
22. Notiz zu Foucault
23. Problematischer Kredit
24. Beschwichtigung
25. Scham
26. Ironie
27. Notiz aus Warschau
28. Weigerung
29. Geheimnis
30. Notiz zu Etel Adnan
31. Opposition
32. Spaziergang
33. Überraschung
34. Abgrund
35. »Liebe mich!«
36. Baltimore am frühen Morgen
37. Unerlöst
38. Fantasie
39. Karate ()
40. Melancholie
41. Substitutionslogik
42. Bellende Hunde
43. Sex oder Kino
44. Panik
45. Bloch mit Lacan
46. Notiz aus Paris
47. Lücke
48. Berührung des Unberührbaren
49. Tatsachenesoterik
50. Ohne Gespenster
51. Schmerz
52. Barfuß
53. Bummeln
54. Wolken
55. Kontingenzoffenheit
56. Mut
57. Intensitäten
58. Aufbruch
59. Kafka ohne Bataille
60. Desperado
61. Wette
62. Netz
63. Komplexe Wirklichkeiten
64. Märchen
65. Verlangen
66. Notiz zu Nancy
67. Atheismus
68. Notizen
69. Gott ist tot
70. Deleuze war Spinozist genug, …
71. Falsche Gegensätze
72. Plätschern
73. Fehler
74. Ex negativo
75. Notiz zu Karl Kraus
76. Liebe
77. Kindheit
78. Angsthasen
79. Schiefe Welt
80. How it is
81. Notiz zu Michaux
82. Sucht
83. Lektion
84. Tricky
85. Zwist
86. Kopf
87. Lust
88. Dämon
89. Traum
90. Kometen
91. Haut
92. Notiz zu Kafka
93. Milch
94. Denken
95. Romantic Shit
96. Kette
97. Notiz zu Deleuze
98. Der Knilch
99. Ja-Sagen
100. Pedanterie
101. Gespensterliebe
102. Schnori
103. Aufmerksamkeit
104. Athletik
105. Notiz zu Valéry
106. T-Shirt
107. Paradies
108. Schlüssel
109. Harmlos
110. Paraphrase
111. Nichts
112. Riss
113. Tabu
114. Einsatz
115. Unruhedialektik
116. Humor
117. Lesen
118. Parallelismus
119. Certitudo
120. Existenz
121. Null
122. Mittendrin
123. Romantisch?
124. Notiz zu Nietzsche
125. Gezischel
126. Gesetz der Liebe
127. Schiedsrichter
128. Labyrinth
129. Pferd
130. Interpretation
131. Opium
132. Nichtsnutz Odradek
133. Tänzer
134. Spinne
135. Notiz zu Lacan
136. Definition
137. Fieber
138. Eine Art Irrsinn
139. Ermutigung
140. Notiz zu Kant
141. Synopse
142. Intervention
143. Rasur
144. Romantik
145. Schein
146. Selbsteinmauerung
147. More Geometrico
148. Hier
149. Écrire
150. Collage
151. Loch
152. Wittgensteins Herz
153. Drehtür
154. Verdacht
155. Notiz zu Kojève
156. Traum 2
157. Wildes Denken
158. Liebeslüge
159. Impotenz
160. Notiz zu Cioran
161. Ontologische Faulheit
162. Katze
163. Poetische Präzision
164. Nähe
165. Eye to Eye
166. Apologie
167. Ununterscheidbarkeit
168. Mythen
169. Vergebliche Tränen
170. Erfahrung
171. Skandal
172. Geheimnis
173. Mehr ist nicht drin
174. Schreckbild
175. Vertrauen
176. Nach dem Tod Gottes
177. Kreuzung
178. Privileg
179. Mutter
180. Positivismusfalle
181. Immanenztheater
182. Essenzialismus
183. Zähne
184. Appell
185. Apriori
186. Notiz zu Adorno
187. Tanz der Begriffe
188. Walser mit Wittgenstein
189. Traurige Tiere
190. Souveränität
191. Konsistenztraum
192. Kathedralik
193. Chinesische Romantik
194. Hysterie
195. Straucheln
196. Stern
197. Deleuze mit Derrida
198. Stay here
199. Inkongruenz
200. Einfach
201. Sexualtheologie
202. Daneben
203. Wirkliche Wirklichkeit
204. Angst?
205. Intelligenzmangel
206. Kopflos
207. Drift
208. Je ne supporte pas la stupidité
209. Nichts?
210. Sekundarismus
211. Autoritätsgläubig
212. Kompromiss
213. Selbstverkennung
214. Punkt
215. Lösung
216. Komplexität
217. Kalt
218. Gespenster
219. Sätze
220. Tanz
221. Aktive Indifferenz
222. Vektor
223. Mimikry
224. Schnurren
225. Liturgie
226. Notiz aus Malta
227. Clare et distincte
228. Selbstverkleinerung
229. Faszination
230. Notiz zum Körper
231. Kafka mit Bataille
232. Kinder
233. Alchemie
234. Kleine Insektenkunde
235. Notiz zu Susan Sontag
236. Chance
237. Gespensterliebe 2
238. Witz
239. Konstruktion
240. Ekel
241. Fäden
242. Umgekehrt
243. Heiterkeit
244. Kuss
245. Notiz zu Derrida
246. Wittgenstein
247. Befremdung
248. Neue Welt
249. Notiz zu Alexander Kluge
250. Traumwesen
251. Lüge
252. Dumm?
253. Riss
254. Überwindung
255. Folie
256. Alles klar?
257. Notiz zu Barthes
258. Sensibilismus
259. Schriftsteller
260. Angst
261. Taschenlampe
Anmerkungen
PAPAGEI
»Ohne Vergessen ist man nur Papagei«1, schreibt Valéry, als wolle er Nietzsches These vom aktiven Vergessen bekräftigen, die die Kraft des Denkens statt in der Erinnerung in ihrem Versagen erblickt. Statt wie ein Papagei zu sein, der Gehörtes wiederholt, impliziert Denken die Bereitschaft zu vergessen, was man weiß. Nicht um in den Irrationalismus zu gehen, sondern um sich der Autorität des Gewussten zu entziehen. Denken erschöpft sich nicht im Wissen. Denken heißt, der Wissensautorität sein Vertrauen zu entziehen. Weder beugt es sich der δόξα noch der ἐπιστήμη. Wer beim Denken nicht bereit ist, den Kopf zu verlieren, denkt überhaupt nicht.
SCHLINGE
»Die Wahrheit«, schreibt Kierkegaard in seinen Tagebüchern, »ist eine Schlinge: Du kannst sie nicht haben, ohne daß du gefangen wirst; du kannst die Wahrheit nicht derart haben, daß du sie fängst, sondern nur derart, daß sie dich fängt.«2 Nichts anderes sagt Hegel übers absolute Wissen. Du kannst es nicht haben, weil es dich längst hat. Deshalb jagst du ihm hinterher – als Beute.
HEGEL & KAFKA
Beide setzen das Subjekt ins Verhältnis zum Absoluten, das bei Freud das Unbewusste und bei Lacan das Reale heißt. Beide kommen zu dem Schluss, dass es keinen Zugang zu ihm gibt, weil es kein Entkommen vor ihm gibt. Dass mir der Zugang zu ihm verwehrt bleibt, hat den Grund, dass es mir immer schon zugänglich ist. Die Linie zu ihm ist längst überschritten. Wollte ich sie nochmals überschreiten, verlöre ich mich mit ihm, weshalb eben diese Überschreitung unmöglich ist.
SELTSAM
Robert Walsers Prosa ist von seltsamen Gestalten bevölkert. Sie gehören der Welt an, indem sie sich ihr entziehen. Es sind Resistenzfiguren, die sich der Gesellschaft durch unmerkliche Gesten verweigern. Sie sind ganz von dieser Welt. Doch sind sie es auf eine seltsam-verstörende Art. Man könnte sie Immanenzfiguren nennen, insofern sie den Übergang zur Transzendenz verschließen, indem sie die Immanenzzone durchlöchern, um ihre Inkonsistenz zu demonstrieren. Rätselwesen, die inmitten transzendenzloser Immanenz deren Brüchigkeit indizieren. So werden sie zu Protagonisten einer noch unerschlossenen Welt. Eine dieser Figuren wird als »Doktor« beschrieben, nicht weil es sich um einen Doktor handelt, sondern weil sie »eine Art Doktorhut« auf dem Kopf hat. Seltsam am »Doktor« ist seine Entrücktheit in ein immanentes Jenseits. Er tritt inmitten der Menschen als einer auf, der ihnen nur diskret angehört. Der »Doktor« ist nicht verrückt, er verbleibt im Bereich des Greifbaren, wenn auch in Gestalt der Ungreifbarkeit selbst. Er trägt, schreibt Walser, »eine unzweideutige Verachtung gegenüber seiner Umgebung zur Schau«.3 Ihm gelingt es nicht den Abstand zu verbergen, der ihn von den anderen trennt. Walser beschreibt ihn als von Gedanken durchschossen, die ihm Realitäten öffnen, die der gesunde Menschenverstand als Gespinste beschreibt. Er ist nicht nur vom Rest der Menschheit abgeschnitten, es scheint, als leide er noch an einer unüberwindbaren Distanz zu sich selbst. Ein Subjekt ohne Wesen, wie ohne Absichten. Von Musils Mann ohne Eigenschaften, über Duras und Deleuze bis hin zu Agamben, findet sich der Gedanke eines Subjekts ohne Subjektivität. Walsers »Doktor« ist nur ein Beispiel dieser leeren Allgemeinheit: »Was dieser Mann sein eigen nannte, betrachtete er als etwas, dessen er auch schon Grund hatte, überdrüssig zu sein. Nur was er ersehnte, vermochte er zu achten, und nur was er erstrebte, schien er zu besitzen.«4 Walter Benjamin hat von Walsers Figuren gesagt, dass sie aus der Nacht kommen. Er vergaß hinzuzufügen, dass sie in sie zurücksinken, von Augenblick zu Augenblick. Und dieses Sinken wird ihr Leben gewesen sein.
PEITSCHE
Über den Selbstausbeutungskapitalismus schreiben heute alle. Zu seiner Zeit war Kafka der Einzige: »Das Tier entwendet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst, um Herr zu werden, und weiß nicht, daß das nur eine Phantasie ist, erzeugt durch einen neuen Knoten im Peitschenriemen des Herrn.«5
UHR
Das Subjekt zu denken – das seinen Tod nicht nur überlebt hat, sondern andauernd überlebt: seinen Tod wie seine Auferstehung – bedeutet der Wahrheit einer Torsion zu entsprechen, die es gegen sich selbst dreht wie eine gegen den Uhrzeigersinn laufende Uhr. Die Zeit des Subjekts – die seine Lebensspanne umfasst – verläuft nicht vom Vergangenen ins Künftige. Das Subjekt ist längst tot, in Gestalt eines lebenden Toten, der nicht aufhört, sich aus seiner Zukunft heimzusuchen, um als verrücktspielende Uhr, mit Zeigern wie Fingern, an seinem Ursprung zu kitzeln, der mit seinem Tod koinzidiert.
UNGEHEUER
Der Kampf mit dem Dämon erweist sich als Kampf mit sich selbst. Die Psychoanalyse kennt diesen Konflikt. Im Denken ist es der Kampf gegen »das schändliche Ungeheuer des Dogmatismus«6, wie Barthes es nennt. Das Dogma, das sind wir. Der Dämon ist in uns. Es sind nicht ausschließlich die Anderen, die irren. Dies ist die fundamentale Lektion der sokratischen Lehre. Wir müssen gegen uns selbst kämpfen, um zu verstehen, wer wir sind.7 Wichtig ist zu verstehen, dass das innere Ungeheuer keine Macht darstellt, sondern ein Außen, das in mir wohnt, ohne mir anzugehören. Barthes weiß, dass der Kampf mit dem Dogmatismus nicht gewonnen werden kann. Er hat unendlich viele Leben. Einmal geschlagen, setzt er sein Unwesen unter anderem Namen fort. Es gibt kein Jenseits des Dogmatismus, keinerlei letzte Wahrheit. Aber es gibt die Möglichkeit, sich nicht damit abzufinden, dass es so ist. Das Ungeheuer verschwindet nicht, doch es hat Schwächen. Ab und zu verliert es an Einfluss. Das sind die Momente, in denen das Denken sich von seinen Gespenstern befreit, in dem es sie als solche markiert.
XENITEIA
LÖWE
Einmal beschreibt Robert Walser den abessinischen Löwen im Zoologischen Garten Berlins. Sein Blick richtet sich auf Erscheinung wie Verhalten des Tiers. Er erkennt in ihm einen Schauspieler, dessen Inszenierung vor Publikum kontrolliert und dramatisch ausfällt, einen Tragiker, den nichts aus der Fassung bringt. Er bewahrt Ruhe noch dann, wenn er sich dem Drama seiner Sterblichkeit öffnet. Walser skizziert ihn als würdevolles und wildes Tier. Darin liegt seine Schauspielkunst: In der Gleichzeitigkeit von Anmut und Gefährlichkeit: »Er ist sein eigener Dichter und sein eigener Spieler.«9 Man muss an das heraklitische Kind denken, den Archonten des Weltspiels, in dem Heidegger, Axelos und Deleuze das Prinzip gekrönter Anarchie erblicken. Das Schicksal der Welt liegt in seinen Händen. Das Kind paart Unschuld mit Unberechenbarkeit. Wie der Löwe Walsers, der – als »eingesperrtes Tier« – Souveränität angesichts faktischer Gefangenschaft exerziert, ist das Kind Allegorie gefesselter Kontingenz. Walser spricht vom »Götterblick« des Löwen. Er erkennt in ihm Erhabenheit und Schrecken, Milde und Zorn. Rilkes Panther verwandt, blickt er durch Käfigstäbe in die Welt, um »im Gefangenenzimmer hin und her« zu gehen: »Immer hin und her. Hin und her. Stundenlang. Welch eine Szene! Hin und her, und der mächtige Schweif peitscht den Boden.« Welch eine Szene also? Unser aller Szene, die wir gefangen sind im Käfig – statt nackter Triebe, unserer Welt. Die Szene des in seinem Gefängnis schauspielernden Löwen exemplifiziert die Realität sämtlicher Subjekte, deren Lebensform ihr Leben verneint. Dem Löwen gelingt es, das Drama seiner Existenz mit majestätischer Noblesse zu bestehen.
SPIEGEL
Der Spiegel zeigt die Leere, die er verbirgt.
KUNST
Weder allein die der Welt zugekehrte noch die ihr abgewandte Seite sind das Spannende am Kunstwerk, sondern die Spannung, die es zu zerreißen droht, indem es mit gleicher Aufmerksamkeit in beide Richtungen blickt. Was ihm nicht gelingt!
TRAUM UND ZEIT
Eintrag aus Adornos Traumprotokollen vom 10. September 1954: »Ich träumte, ich hätte an einer theologischen Diskussion teilgenommen, auch Tillich war dabei. Ein Redner entfaltete den Unterschied von Equibrium und Equilibrium. Jenes sei das innere, dieses das äußere Gleichgewicht. Die Anstrengung, ihm zu beweisen, daß es Equibrium nicht gebe, war so groß, daß ich darüber erwachte.«10 Ist der zu führende Beweis, dass es weder das Wort Equibrium noch das von ihm bezeichnete Gleichgewicht gibt, deshalb so anstrengend, weil er den Traum intakter Träume erschüttert und den Träumenden seinem Traum entreißt? Wohin? In ein Außen des Traums, das zwar Gleichgewichtsverhältnisse, aber nur äußerliche kennt? Alles weist darauf hin, dass der Traum vom inneren Gleichgewicht Traum jener bleibt, die sich aus dem Außen ins imaginäre Innen verziehen. So gesehen gehörte der Traum einer Innerlichkeitsmetaphysik an, deren Konsistenz sich Ignoranz verdankt. Träumend negiert der Träumende den Kontakt zum Traumaußen, das ihn mit asymmetrischen Verhältnissen quält. Der Traum vom inneren Gleichgewicht ist der Traum errungener Stabilität. Traum aller, die das Ungleichgewicht der äußeren Welt als Bedrohung statt als Ermöglichungsgrund realen Werdens erfahren. Man muss an Kants Unterscheidung zwischen den Anschauungsformen von Raum und Zeit denken. Während der Raum diejenige des äußeren Sinns genannt wird, ist die Zeit die des inneren wie des äußeren Sinns.11 Kants Privilegierung der Zeit gegenüber dem Raum hat im Denken Derridas und Foucaults (wie bereits der Psychoanalyse samt ihrer Insistenz auf Exteriorität) eine Korrektur zugunsten des Raums gefunden. Als Denken der Verräumlichung (espacement) oder des Außen (dehors) operieren diese Denker gegen das Primat von Traum und Zeit. So wie es kein Gleichgewicht zwischen Innen und Außen gibt, sowenig ist das Innerlichkeitsphantasma aufrechtzuerhalten, das der Traum ausgeglichener Gewichtsverhältnisse oder gelungener Autoaffektion darstellt. Was Adorno seinem Traum entreißt, ist das Wissen um dessen Unmöglichkeit.
EMERGENZ
Weiß man, dass die Funktion des Subjekts in der Geschichte, statt in der Stellvertretung Gottes, der unersetzbar bleibt, darin besteht, ihm aus der Patsche zu helfen, indem es ihm dessen Inexistenz im Namen seiner monströsen Freiheit verzeiht?
WUNDE
»Die Welt, die große Wunde Gottes«12, notiert Friedrich Hebbel 1843 in sein Tagebuch. Dabei verhält es sich doch umgekehrt!
ZWIEFACHE ANGST
Wenn der Rausch die »Angst vor dem Vakuum«13 ist, wie Heiner Müller behauptet, dann ist Religion Angst vor dem Vakuum wie Angst vor dem Rausch.
NOTIZ ZU BAUDELAIRE
»Selbst wenn Gott nicht existierte«, schreibt Baudelaire, »wäre dennoch die Religion heilig und göttlich. Gott ist das einzige Wesen, das um zu herrschen nicht einmal zu existieren brauchte.«14 Was er nicht sagt: Damit es Religion geben kann und das Göttliche, darf Gott nicht existieren. Wer an Gott glaubt, bekennt sich zu dessen Inexistenz. Dies doppelte Bekenntnis – an ihn zu glauben, wie daran, dass er nicht existiert – gehört zum Wesen der christlichen Religion, weshalb (neben Bloch und anderen) Lacan und Nancy es atheistisch nennen.15
REISE
Warum sollte sich das Denken nicht verbiegen, verrenken und zerreißen, warum denkt man, es ginge ohne Akrobatik oder Athletik, die das Cogito zersplittern, um es, nach gelungener Operation, neu zusammenzusetzen, mit veränderten Gliedmaßen, einem Kopf, der nicht der eigene sein muss, Füßen, die den Kontakt zum Boden aufgegeben haben, Beinen, die es dem Unbekannten zutreiben, Händen, die ins Leere greifen, Augen, die nichts sehen, Ohren, die alles hören, ohne zu verstehen, einer Nase, die eine unbestimmte Fährte aufnimmt, einem Mund, der sich zum Schrei öffnet, einem Herzen, das seine Arbeit wie zum Spiel fortsetzt, ohne Gewissheit darüber zu erlangen, wohin die Reise geht?
MANTEL
Nancy weiß, dass zum Wissen noch dann Glauben gehört, wenn es sich im Schatten der Inexistenz Gottes hält. Das »unvermeidliche Zittern des Denkens«16 zeugt, indem es den Tod Gottes bezeugt, von der Unruhe eines Subjekts, das in der Abwesenheit eines Konsistenzgaranten existiert. Ein zitterndes Subjekt also: zitternd und lachend – um Kafka zu paraphrasieren – vor Mut. Weder seine Herkunft noch seine Zukunft sind gewiss. Lose bewegt es sich im Raum seiner brüchigen Gegenwart, um in der löchrigen Immanenz, die sein Leben ist, seine Existenz auszumachen. Denken heißt, diesem Zittern nachzugeben, es angesichts der Inkonsistenz aller Realitäten zuzulassen, die es wohlig ummanteln, um es vergessen zu lassen, dass der Mantel Löcher hat und kaum existiert. Man muss an Nikolaj Gogols Erzählung Der Mantel (1842) denken. Ab einem gewissen Moment ist der Mantel dermaßen zerschlissen, dass es keine Stelle mehr an ihm gibt, an der sich Flicken befestigen ließen. Ein neuer Mantel muss her. Vielleicht heißt dies nicht nur, dass wir schlecht geschützt gegen das uns anwehende Außen sind, sondern auch, dass jedes Subjekt selbst solch ein Mantel ist, dessen Substanz ein Loch darstellt, an das kaum noch eine Akzidenz zu heften ist.
MASKE
Die Wahrheit maskiert sich als Wahrheit.
STREUNEN
Von Walter Benjamins Flaneur unterscheidet sich Robert Walsers Spaziergänger nicht dadurch, dass er sich in der Natur anstatt in der Stadt herumtreibt. Seine Passagen sind die zwischen Kultur und Natur. Er taumelt in der Ununterscheidbarkeitszone beider Ordnungen. Auf dem »irrenden Planeten«17 Erde bewegt er sich als Irrender. Wie »ein besserer Strolch, feinerer Vagabund, Tagedieb, Zeitverschwender oder Landstreicher«18 spaziert er auf der Trennlinie zwischen Natur und Kultur. »Federn, Bänder, künstliche Blumen und Früchte auf den netten, drolligen Hüten waren für mich fast ebenso anziehend wie die anheimelnde Natur selber«19, sagt er, um über die Eitelkeit der Menschen zu lachen. Der Dichter als Streuner, dem sich die Inkonsistenz der sozialen Welt erschließt, ohne dass sie ihn in Verzweiflung stürzt. Zu lustig ist die Komödie, die in jedem ihrer Akte Vanitas inszeniert. Nichts ist von Bestand. Die einzige Gewissheit ist die ums Ungewisse. Alles, was wichtig zu sein scheint, ist in den Nebel seiner Inkonsistenz getaucht. Hier streunt der Spazierende in ungebremster Heiterkeit. Alle ihm widerfahrenden Ereignisse werden mit Genauigkeit registriert. Walsers Spaziergänger blickt mit an Indifferenz grenzender Neugierde in die Welt. Einmal trifft er auf den Riesen Tomzack. Mit ihm begegnet ihm die Wahrheit des Menschen, der an der Schwelle der Moderne die Unmöglichkeit ihrer Affirmation wie ihrer Verwerfung erfährt: »Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft waren ihm eine wesenlose Wüste, und das Leben schien zu gering, zu eng für ihn zu sein. Für ihn existierte keinerlei Bedeutung; doch bedeutete wieder er selbst für niemand irgend etwas. Aus seinen Augen brach ein Glanz von Unterwelten- und Überwelten-Gram hervor, und ein unbeschreiblicher Schmerz sprach aus jeder seiner müden, schlaffen Bewegungen. Nicht tot, doch auch nicht lebendig, nicht alt und auch nicht jung war er. Hunderttausend Jahre alt schien er mir zu sein, und ferner schien mir, daß er ewig leben müsse, um ewig nicht lebendig zu sein. Jeden Augenblick starb er und vermochte dennoch nicht zu sterben.« In Gestalt des Untoten bedrängt den Spaziergänger die Einsicht ins Unheimliche seiner Situation. Um seine Heiterkeit angesichts des Ungeheuers nicht einzubüßen, muss er weiterziehen, im Wissen darum, dass sein Spaziergang einer Flucht zu gleichen beginnt. Wovor fliehen und wohin? – Walsers Spaziergänger flieht die Irre in die Irre. Schreiben im Horizont des toten Gottes bedeutet: seine Inexistenz in ihren äußersten Winkeln durchstöbern, um an den Peripherien der Bedeutungen neuen Sinn auszumachen, ihn zu erfinden, wo ihn die Vanitas erschlägt und kein Leben mehr möglich ist. Sich dem Glück öffnen, ohne Garantien, ohne Sicherheit, ohne Teleologie zu sein. Walsers Spaziergänger schweift im Unruheraum Realität. Statt Ausdruck dümmlicher Verklärung der Verhältnisse ist seine Heiterkeit Indiz unverwüstlicher Zuversicht angesichts der wachsenden Wüste, die Nietzsche Nihilismus nennt. Mit Walser erreicht das Evangelium vom toten Gott eine nächste Stufe der Heiterkeit. Nur der nüchterne Mensch wird ihre Indifferenz – die Albert Camus und Marguerite Duras evozieren – als Glück erfahren. Es handelt sich ums Glück, gottloser Mensch zu sein, oder um das, was Deleuze und Žižek die »Würde des Atheismus«20 nennen.
WAS JEDER WEISS
Es ist die Sprache, die am Sprechen hindert, nicht ihr Verlust.
NOTIZ ZU FOUCAULT
Der »menschliche Körper ist der Hauptakteur aller Utopien«, konstatiert Foucault. Immer sucht er Anschluss an sein Jenseits. Er grenzt an sein Außen, sucht Kontakt zu ihm, überreizt und überfordert sich. Als sei er auf der Suche nach einem unmöglichen Ort. Niemals begnügt er sich mit sich, zu keinem Zeitpunkt ist er inerte Masse. Noch wenn er sich den vegetativen Erfordernissen überlässt, kratzt er an seiner Oberfläche: »Der Körper ist auch ein großer utopischer Akteur, wenn es um Maskieren, Schminken und Tätowieren geht. Wer sich maskiert, schminkt oder tätowiert, erlangt damit nicht, wie man meinen könnte, einen anderen Körper, nur schöner, reicher geschmückt und leichter wiederzuerkennen. Tätowieren, Schminken und Maskieren sind zweifellos etwas ganz anderes. Dadurch tritt der Körper in Kommunikation mit geheimen Mächten und unsichtbaren Kräften. Maske, Tätowierung und Schminke legen auf dem Körper eine Sprache nieder, eine rätselhafte, verschlüsselte, geheime, heilige Sprache, die auf ebendiesen Körper die Gewalt Gottes, die stumme Macht des Heiligen oder heftiges Begehren herabrufen. Maske, Tätowierung und Schminke versetzen den Körper in einen anderen Raum, an einen anderen Ort, der nicht direkt zu dieser Welt gehört. Sie machen den Körper zu einem Teil des imaginären Raumes, der mit der Welt der Götter oder mit der Welt der Anderen kommuniziert.«21 Immer bereit, ein Außen zu empfangen, winkt der maskierte, tätowierte, geschminkte Körper es herbei, um sich nicht als Gefängnis zu bewohnen, und weil er weiß, dass das Außerhalb des Gefängnisses längst in ihm ist. Die Kraft des Imaginären muss ihn nicht in die narzisstische Verkennung reißen. Solange der Körper sich nicht dem immanenten Außen verschließt, ist er vor der Versuchung zur Selbsteinschließung gefeit. Es ist das narzisstische Subjekt, das sich dem Kontakt mit dem Außen verweigert, um sich in sein Selbstbild einzuschließen, was ihm übrigens nie gelingt.22 Statt im Maskieren, Tätowieren und Schminken Indizien eines Narzissmus’ auszumachen, müssen wir in ihnen Techniken der Narzissmusresistenz erkennen. Es geht um Kommunikation mit einem Außen, das die Dimension des Heiligen und Göttlichen umfasst. Kommunikation, die im Hier-und-Jetzt der Immanenz geschieht, als Herbeirufung dessen, was längst da ist, statt einer religiösen Transzendenz anzugehören. Der Körper ist transzendenzoffen, insofern es sich um immanente Transzendenz handelt. Ihre Atome sind von dieser Welt. Die Utopie markiert keine Unmöglichkeit. Sie ist in die Immanenz des Lebens eingelassen, weshalb die Kommunikation mit dem Außen Kommunikation mit sich ist, mit den rätselhaften Anteilen korporaler Existenz.
PROBLEMATISCHER KREDIT
Man darf den Narzissmus nicht als Eigensinn, Egozentrik, Eitelkeit oder in sich verrannte Selbstliebe verkennen. Im ihm drückt sich Aggression auf alles aus, was die narzisstische Imago trübt, das (imaginäre) Ichideal, kurz: auf die Welt (symbolische Ordnung). Dennoch hat Barthes recht, das Imaginäre seinem pejorativen Status zu entreißen. Die »Affirmation des Imaginären«23 koinzidiert nicht mit der des Narzissmus. Als Apologie der Einbildungskraft – das heißt eben auch einer gewissen Weltferne – resistiert sie den Realitätsvorstellungen, deren prekäre Konsistenz sich einem Tatsachenimperialismus verdankt, der sich bei genauem Hinsehen als phantasmatisch erweist.24 Ein Minimum an kritischer Anleihe beim Bekämpften ist Bedingung der Möglichkeit seiner Bekämpfung. Barthes wusste das – mit oder ohne Lacan!25
BESCHWICHTIGUNG
Kafka gesteht Milena, er wolle sie »auch von der Seite der Eifersucht« fassen, von allen Seiten. Sie solle sich keine Sorgen machen. Seine Liebe umfasse noch die Irritation, die die »ungesunden Träume des Alleinseins«26 freisetzt. Dabei gelingt ihm eine Definition der Liebe, die Treue mit Untreue interagieren lässt: Vertrauen in ihre Unerschütterlichkeit als Panik um ihren Verlust.
SCHAM
IRONIE
Es gibt Ironie nur als Bedauern der Ohnmacht, die um sich weiß. Oft ist sie Anerkennung der Verhältnisse, die ihr missfallen. Dieser Art könnte die »zarte Ironie« gewesen sein, die Adorno Benjamin attestierte und jenem »trotz des seltsam Objektivierten, Unberührbaren der Gestalt, ebenso im privaten Umgang den außerordentlichen Reiz verlieh.«32 Man muss sie sich als Emanzipation von jugendlicher Arroganz (die es auch bei Benjamin gab) vorstellen, als Austritt aus der Sphäre des Besserwissens dank gesteigerten Wissens ums Nichtwissen, das es grundiert. Das Denken verlässt den kindlichen Erkenntnisfuror, um Erwachsenenspiele zu spielen, die es einem Wissen ohne Moral zuführen.
NOTIZ AUS WARSCHAU
Dass das Subjekt mit seiner Welt verschraubt ist, heißt nicht, dass es ihr bruchlos angehört. Subjekt zu sein, bedeutet, sich von den Kräften zu emanzipieren, die es am Boden halten, um es in seiner Identität zu neutralisieren. Zu ihm gehört Widerstand allem gegenüber, was ihm Selbstkompromittierung verwehrt. Wenn sein Subjektstatus mit einer gewissen Freiheit koinzidiert, dann deshalb, weil es Freiheit als Möglichkeit zur Selbstablösung begreift. Subjekt ist, wer sich die Freiheit nimmt, es nicht zu sein.
WEIGERUNG
Es gibt Tiere, die sich weigern, menschlich zu sein. Das sind die Menschen.
GEHEIMNIS
»Was Benjamin sagte und schrieb, klang, als käme es aus dem Geheimnis«33, steht bei Adorno. Das Geheimnis, aus dem Benjamin schreibt, ist der Welt immanent. Nie geht es um raunend Mysteriöses. So wie der »Rätselcharakter«34