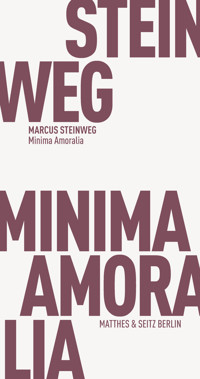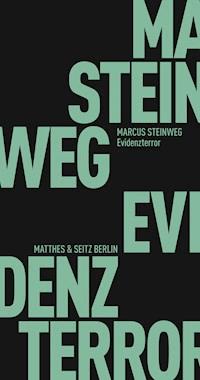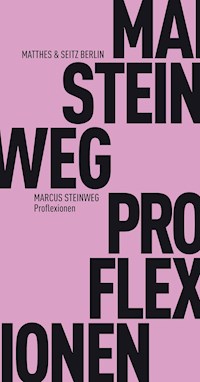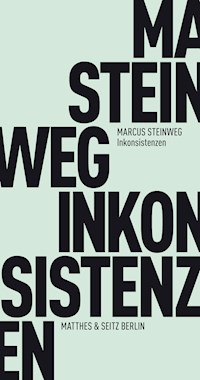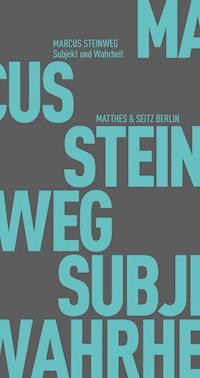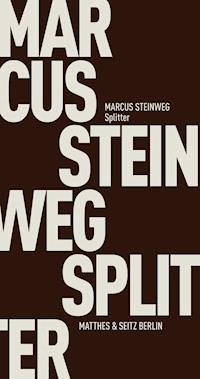
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fröhliche Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Splitter können unter die Haut fahren, Schmerzen und Entzündungen provozieren. Sie sind Bruchstücke einer Totalität, deren Integrität illusorisch bleibt. In Splittern zu denken, heißt eine Welt zu denken, deren Intaktheit bezweifelt werden kann. Nur muss sich dieser Zweifel nicht als Enttäuschung ausdrücken. Steinwegs Reflexionen spiegeln eine in ihrer Zersplitterung ebenso inkonsistente wie offene, nicht restlos determinierte Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Steinweg
Splitter
»Rücksichtnahme schmerzt michmehr als Wahrheit.«Franz Kafka
INHALT
1. Blick
2. Eis
3. Chaos
4. Stigma
5. Dürrenmatt
6. Form
7. Trotz
8. Notiz zu Hegel
9. Messer
10. Arschloch
11. Schaf
12. Idiotenberuhigung
13. Korrektur
14. Notiz aus New York
15. Müller mit Lacan
16. Wüste
17. Erfolg
18. Bloch
19. Frankenstein
20. Narkotika
21. Politische Kunst
22. Kein Widerspruch
23. Canetti
24. Regression
25. Mögliche Unmöglichkeit
26. Lider
27. Noch einmal für Deleuze
28. Resistenz
29. Vor dem Gesetz
30. Notiz zu Benjamin
31. Grund
32. Schwäche
33. Amor fati
34. Lupenrein
35. Verzicht
36. Kultur
37. Antwort
38. Wertlos?
39. Abgeklärt
40. Atempause
41. Haut
42. Routine
43. Mutter
44. Glück
45. Symbiose
46. Nuanciertes Leben
47. Bitterer Kaffee
48. Zauberei
49. Notiz zu Adorno
50. Glamour
51. Gefällig
52. Trauriges Denken
53. Links
54. Aporetischer Narzissmus
55. Flüstern
56. Kunst
57. Eine mächtige Mythologie
58. Erlösung
59. Klarheit
60. Gegengewalt
61. Sexualität bei Kafka
62. Skalpell
63. Phantasma
64. Unruhepraxis
65. Notiz zu Luhmann
66. Houellebecq
67. Kompossibilität
68. Fundstück
69. Ontologie für Angsthasen
70. Solide
71. Notiz zur Philosophie
72. Unterschied
73. Fressen
74. Wunder
75. Gewissen
76. Sonne
77. Infantilismus
78. Welt
79. Unübersehbar
80. Narzissmus
81. L.W.
82. Tod
83. Analer Geiz
84. Schatten
85. Irritation
86. Notiz zu Barthes
87. Typisch Kafka
88. Spiegel
89. Zoo
90. Sturz
91. Exkreszenz
92. Zumutung
93. Sucht
94. Obskurantismus
95. Feststellung
96. Mondän
97. Müdigkeit
98. Aporie der Resistenz
99. Immanenzterror
100. Pirouette
101. Humor
102. S.W.
103. Abgrund
104. Malevolentis
105. Ohne Wahrheit
106. Kultur
107. Perfektion
108. Selbstkompromittierung
109. Aktuelle Doxa
110. Finesse
111. Derrida
112. Leid
113. Jasagen
114. Ruhestörung
115. Hegel
116. Realitätssampling
117. Begriff
118. Gleis
119. Doppelte Kränkung
120. Glück?
121. Weiterdenken
122. Haus
123. Medaille
124. Brief
125. Aposteriorische Liebe
126. Pech gehabt
127. Riss
128. Exzess
129. Hass
130. Traum
131. Wunden & Narben
132. Falsche Opposition
133. Fragwürdig
134. Skandal
135. Erholung
136. Jenseits
137. Kontingenz
138. Frage
139. Hysterie
140. Gift
141. Liebe
142. Träumen mit Benjamin
143. Meinung
144. Warhol
145. Ausweg
146. Intelligenz
147. Familie
148. Akademismus
149. Unisono
150. Kind-Werden
151. Linke Hand
152. Ereignis
153. Schneewanderung
154. Zeuge
155. Mager
156. Geometrien der Angst
157. Inkonsistenz
158. Verstrickung
159. Wie die Uhren von Dalì
160. Mut
161. Drehbuch
162. Sterbewesen
163. Theater
164. Löcher
165. Kitzel des Denkens
166. Konvention
167. Nicht-Denken
168. Ohrfeige
169. Salamander
170. Bett
171. Wahrheit
172. Bejahung
173. Schlechte Unendlichkeit
174. Kafkas Welt
175. Gefahr
176. Aufhebung
177. »Ich liebe Dich«
178. Linksnietzscheanismus
179. Verzweiflung
180. Blut
181. Einladung
182. Neutrum
183. Kritisch
184. Triftigkeit
185. Ohn/Macht
186. Notiz zu Fanon
187. Unfähig
188. Improvisation
189. Wittgenstein
190. Hermeneutik
191. Aktueller Herrensignifikant
192. Opportunismus
193. Zugrundegehen
194. Inexistenz
195. Kinder & Tiere
196. Dialog
197. Notiz zu Heidegger
198. Heiner Müller
199. Alltagspathologie
200. Nietzsche mit Hegel
201. Vernunftdialektik
202. Schreiben
203. Übertreibung
204. Nichts
205. Hegels Radiergummi
206. Ellipse
207. Wagner ohne Wagner
208. Wasser
209. Interferenz
210. Körpersprache
211. Crazy?
212. Überkomplexität
213. Notiz zu John Heartfield
214. Selbstverständlichkeit
215. Kraft
216. Kommentargesellschaft
217. Sprache der Liebe
218. Dekonstruktion light
219. Kafka an Felice
220. Zwei Modelle
221. Dialektik
222. Beleidigtheit
223. Tränen
224. Archäologie
225. Phrase
226. Nietzsche mal anders
227. Zweifel
228. Selbstentsicherung
229. Vulgarität
230. Melancholie
231. Nähe
232. Kränkung
233. Deklaration
234. Chinesisches Subjekt
235. Innocentia
236. Von Wolken und Brüsten
237. Romantische Tierliebe
238. Schlüssel
239. Schönheitsoperationen
240. Gähnen
241. Unschärferelation
242. Genealogie
243. Brutalität
244. Doppelte Unmöglichkeit
245. Kalligrafie
246. Illusionär?
247. Notiz aus Tel Aviv
248. Imagination
249. Nasser Hund
250. Gesetz
251. Noch einmal zu Wittgenstein
252. Subjekt
253. Linkssein
254. Suspension
255. Creatio ex nihilo
256. Ellipse 2
257. Abweisung
258. Notiz zu Foucault
259. Sex & Liebe
260. Was ist Gegenwart?
261. Kopf
262. Finanzmetaphysik
263. Zauber
264. Tod
265. Schreiben 2
266. Fatum
267. Liebeskultur
268. Noch einmal für Duras
269. Vom Fliegen und Lieben
270. Älterwerden
271. Adorno gegen Lukács
272. Begriffsartistik
273. Kafka mit Müller
274. Blick 2
275. Tür
276. Anthropomorphismus
277. Verletzt
278. Windelweich
279. Leben
280. Notiz zu Stifter
281. Truisms
282. Inkompatibilität
283. Diskretion
284. Schluckauf
285. Allianz
286. Notiz zu Lévinas
287. Traumkredite
288. Spinnt der?
289. Mimikry
290. Notiz zu Artaud
291. Enttäuschung
292. Selbstverrätselung
293. Grenze
294. Autodestruktion
295. Noch einmal zu Adorno
296. Gespenster
297. Infinitesimalkontakt
298. Sinnliches Denken
299. Problem
300. Immanente Transzendenz
301. Canetti mit Wittgenstein
302. Einzige Alternative zu Gott
Anmerkungen
BLICK
Man könnte meinen, der Blick, den Kafka aus dem Fenster hinaus auf die Landschaft wirft, hätte die Leere zum Gegenstand. Das stimmt nicht. Im leeren Blick zeigt sich die Überfülle der eingerichteten Welt. Was sich ihm erschließt, ist nicht der Mangel an Bedeutung, sondern ihr Übermaß. Ihm enthüllt sich die Inkonsistenz der Realität. Das Subjekt grenzt an ihre Heterogenität und Kontingenz. Der Blick ist voller Sinn und Bedeutung. Die Ernüchterung, die er provoziert, liegt darin, auf keinerlei Leere zu stoßen. Sollte sich mit ihm eine Hoffnung verbinden, wäre es die auf Bedeutungslosigkeit.
EIS
Das Subjekt gleitet über der Leere wie auf dünnem Eis.
CHAOS
STIGMA
Schlimmer als der Tod ist der Fall des Lebenden aus dem Leben. Fortan setzt er seine Existenz als lebender Toter fort. Kafka nennt es den »Verlust des Gleichschrittes mit der Welt«. Er bedeutet, dass, wer unter dem Stigma des Verlusts lebt, »die Welt zerschlagen hat und, unfähig sie wieder lebend aufzurichten, durch ihre Trümmer gejagt wird.«5 Hier gibt es kaum Hoffnung. Es sei denn, der Tod wird zum Versprechen, das die Erlösung von einer nicht endenwollenden Agonie in Aussicht stellt.6 Wir müssen uns Gespenster als glücklose Menschen vorstellen. Sie durchstreifen ihr Leben als Gestorbene. Aus dem Leben zu stürzen, ist ein Ereignis, dessen Drastik kaum überschätzt werden kann. Der Verlust des Gleichschrittes mit der Welt ist Verlust des Lebens wie der es beflügelnden Lebendigkeit. Tot ohne tot zu sein, heißt im Horizont faktischer Inexistenz zu persistieren. Überall schreibt Kafka von den Konditionen eines Lebens, das sich fortsetzt, nachdem es sich verloren hat. Kafka ist der Dichter dieser Verlorenheit. Sein Schreiben öffnet das Leben auf seine Wahrheit, die keinerlei positives Jenseits indiziert. Es erzählt die Geschichte des seine Rückseite bewohnenden Lebens. Dabei handelt es sich um ein Leben, das inmitten der Immanenz mit ihr bricht, um sich im Bruch mit ihr den letzten Funken Hoffnung zu nehmen.
DÜRRENMATT
Es sei unmöglich, »daß ein Kunstwerk aus der Wirklichkeit fällt«7, bemerkt Dürrenmatt und hätte hinzufügen können: Entscheidend ist, wie es in sie einfällt!
FORM
»Kunst hat soviel Chance wie die Form, und nicht mehr.«8 – Der Satz aus der Ästhetischen Theorie (1970) provoziert Unverständnis. Man denkt den Primat der Form durch irgendeinen Inhalt (die soziopolitische, außerästhetische Realität) ersetzt zu haben. Wie immer, wenn das Halbdenken über das Denken triumphiert, erschöpft es sich in Substitutionslogik. Man ersetzt den (angeblichen) Primat der Form durch den des Inhalts und merkt nicht, dass man der Komplexität ihrer Interdependenz ausweicht. So fällt man hinter Adorno zurück. Was er zu denken gibt, ist ein Formbegriff, der, ganz von der Gesellschaft durchdrungen, auf Resistenz ihr gegenüber beruht. Der Realität zu resistieren, indem man ihr volles Gewicht auf sich nimmt: Darauf zielt Adornos ästhetische Theorie!
TROTZ
Der Sturz ins Chaos ist reale Möglichkeit. Wittgenstein fürchtet ihn in Gestalt des Wahnsinns. Die Psychose liquidiert das Denken, indem sie seine Realitäten auflöst. Die Erfahrung ihrer ontologischen Inkonsistenz kommt dem Kontakt mit Lacans Realem gleich. Es gibt hier keinerlei Raum für Romantik. Mit diesem Kontakt tritt das Subjekt in ein Außen, von dem es längst heimgesucht ist. Kafka verbindet mit Wittgenstein das Abschreiten der Chaosgrenzen. Alles liegt daran, der Inkonsistenz mit Minimalkonsistenz zu trotzen. Eben dieser Trotz heißt Denken oder Literatur.
NOTIZ ZU HEGEL
Hegel nicht gelesen zu haben, schützt nicht davor, Hegelianer zu sein.
MESSER
Kafkas berühmtester Satz zur Liebe steht im Brief an Milena vom 14. September 1920: »Liebe ist, daß du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.«9 Man muss nicht Kafka sein, um zu wissen, dass zu ihr Gewalt gehört. Die Liebe zerreißt das System der Erwartungen, die das romantische Liebesdispositiv darstellt (»Man hat anderes erwartet, und meist mehr als das«10). Sie zerreißt das liebende Subjekt einerseits, die Romantik der Zerrissenheit andererseits. Sie ist Zerreißung des Ideologems der Zerreißung, das den Liebenden als Zerrissenen konzipiert. Die Erfahrung der Liebe ist Erfahrung ihrer Unmöglichkeit. Sie existiert nur kontaminiert von narzisstischen Affekten, die ihr Sehnsuchtsvokabeln schlechter Unendlichkeit diktieren. Die Liebe soll unendlich sein, das heißt sie muss scheitern. Angeblich ist sie nicht von dieser Welt. Kafka wirft einen nüchternen Blick auf die romantische Selbstverklärung. Er erwartet von Milena, mit ihrer Liebeserwartung zu brechen, indem er von ihr verlangt, das Messer zu sein, das ihm dazu dient, sich von seinen Erwartungen zu befreien. Man könnte meinen, das sei pathetisch und übertrieben. Doch Kafka schreibt, dass alles Übertreibung sei, »nur die Sehnsucht ist wahr, die kann man nicht übertreiben.« Folgt also auch er dem Sehnsuchtsdispositiv der Romantik des kalten Herzens? Im Gegenteil. Kafka wendet dieses Dispositiv gegen es selbst, indem er der Sehnsucht eine geradezu materielle, mindestens aber körperliche Realität verleiht. Nichts ist hier übertrieben. Die Sehnsucht der Liebenden ist von großer Nüchternheit und Konsistenz. Sie impliziert Widerstand gegenüber dem Realismus der Enttäuschten wie gegenüber sämtlichen Idealismen der Verklärung. Sie schreibt sich keinem dieser Register ein. Vielmehr ist es diese Resistenz, die ihr einen Unendlichkeitsvektor einträgt. Statt um temporale Extension geht es um punktuelle Intensität. Wenn es so etwas wie Unendlichkeit in der Liebe gibt, dann ist sie von dieser Welt.
ARSCHLOCH
»Je n’ai pas cherché à plaire / Ich habe nicht versucht, zu gefallen«11 – ist das Mindeste, was Guy Debord von sich sagen konnte. Im Spiegel des Spektakels ungünstig zu erscheinen, entspricht der Erwartung des Autors von La société du spectacle (1967). Debord wusste, dass das Spektakel ihn entstellt, indem es von ihm erwartet, er erwarte, in ihm gut auszusehen. Es gehört zur Spektakellogik, unnötige Erwartungen zu wecken. Debord ist zu klug, um diesen Mechanismus nicht zu durchschauen. Hat er eine Lösung? Es gibt keine. Der Spiegel, der noch im aktuellen Kapitalismus als eben dieser selbst persistiert, versucht jedes Subjekt an sein Bild zu ketten, um es in seinen Narzissmus einzuschließen und zu narkotisieren. Das Alkoholikergenie Debord blieb wachsam. Er hatte keine Lust, an einem Anästhetisierungsprogramm teilzunehmen, das den Opportunismus derer nährt, die er »bescheidene Funktionäre« nennt, die »sich immer und überall verpflichtet glaubten, die dürftigsten Imperative der Augenblicksmoden« zu respektieren. Debord wollte lieber ein Arschloch als ein Opportunist sein. Das macht ihn unentbehrlich und aktuell.
SCHAF
Der Tagebucheintrag vom 19. November 1913 bringt es auf den Punkt: »Ich bin wirklich wie ein verlorenes Schaf in der Nacht und im Gebirge oder wie ein Schaf, das diesem Schaf nachläuft.«12 Das dem verlorenen Schaf nachlaufende Schaf ist doppelt verloren. Drückt es nicht Kafkas allgemeine Problematik aus? Das Problem seiner Figuren liegt nicht darin, zur Ungewissheit verurteilt zu sein. Ihnen ist noch die Gewissheit der Ungewissheit genommen. Nicht einmal ihr Scheitern ist gewiss.
IDIOTENBERUHIGUNG
Nichts verunsichert die Idioten mehr als Indifferenz gegenüber Erfolg, während sie ihre Hoffnungen auf Erfolgsversprechen bauen, die, indem sie sich erfüllen, ihre Inkonsistenz demonstrieren. Wer bekommt, worauf er hoffte, erhält nichts. Erfolg ist nichts als Erfolg. Zur Idiotenberuhigung bliebe zu sagen: Das hättet ihr früher wissen können! Das war bekannt!
KORREKTUR
Kunst lässt sich nicht korrigieren.
NOTIZ AUS NEW YORK
JFK Airport. – So sehr Martin Kippenberger gute Gründe hatte, ein Happy End of Franz Kafka’s ›Amerika‹ zu imaginieren, so unerbittlich wird das US-amerikanische Selbstbild von seiner narzisstischen Imago und dem sie dominierenden »Hurra-Optimismus« (so nennt es Adorno) dementiert. Die Alloverpräsenz von Dunkin’ Donuts, Starbucks Coffee und Burger King zwingt noch den leisesten Anspruch auf Singularität ins Kostüm neoliberaler Egalität. Der Individualismus – der als kapitalistische Religion auftritt – ist nur als Uniformismus und Konsensualismus zu haben. Der amerikanische Traum kulminiert im einlösbaren Versprechen egalitären Konsums. Eine Coca-Cola ist eine Coca-Cola, sagt Andy Warhol.13 Für den Präsidenten und Liz Taylor wie für jedermann.
MÜLLER MIT LACAN
Heiner Müller sagt, dass ihn Normalität nicht interessiere, obwohl er ihren Apologeten Enzensberger verstehe. »Mich interessiert sie nicht, weil Theater nicht normal ist, und da mich Theater am meisten interessiert, interessiert mich Normalität nicht. Theater lebt von Extremen, nicht von Normalität.«14 Das ist schlüssig, unterschlägt aber den wesentlichen Punkt. Die Extreme sind das Normale. Normalität ist extrem! Lacan wusste das. Er unterscheidet die Realität (Normalität) vom Realen (Extrem), um sie wechselseitig miteinander zu identifizieren.
WÜSTE
Badiou sagt, dass Nietzsche mit seinem Schreiben in die Wüste des Nihilismus gegangen sei.15 Seine »Heiligkeit« liege darin, sich in die »absolute Einsamkeit«16 begeben zu haben, an deren Ausgang ihn der Wahnsinn empfängt. Jedes Denken, das sich von den dominanten Gewissheiten entfernt, um in der Welt eine andere Welt zu öffnen, jedes Denken also, das mit den Realitäten bricht, um noch die Falle des Realismus genannten Idealismus zu umgehen, ist ein Denken der Wüste. Wüstendenken, das sich der Orientierungslosigkeit aussetzt. Denken ohne Erlösung und ohne Reserve. Umherirrendes Denken, dem nichts als seine Schwebe bleibt. Gleiten über dem Abgrund ontologischer Inkonsistenz. Ist es noch Philosophie? Ist es Antiphilosophie? Warum nicht weiterhin Philosophie sagen, solange wir unter diesem Begriff, statt akademische Prudenz, das Experiment eines Denkens begreifen, dessen Begriffe Instrumente zur Öffnung aufs Unbestimmte darstellen. Offen sind diese Begriffe, weil sie sich den Luxus finalen Wissens versagen, da sie noch ihrer Kontingenz Rechnung tragen. Begriffe wie Waffen. Doch es sind Waffen, die das Subjekt gegen sich selbst richten muss. Wo das Denken der Wüste den Nihilismus zu überwinden trachtet, bestätigt es das Nichts im Herzen der Realität. Es nimmt seinen Ausgang von ihm, um zu ihm zurückzukehren. Es geht durch die Wüste, um ihre Endlosigkeit zu erspüren. So öffnet es sich ihrer Inkommensurabilität. Diese Öffnung hat uns Nietzsche hinterlassen. Sein Erbe ist diese Unendlichkeit. Das Unendliche inmitten des Endlichen, das Loch im Sein. Wüste, Chaos oder Abgrund – immer handelt es sich um das gebrochene Konsistenzversprechen der großen Narrative, seien sie mythischer, religiöser, metaphysischer oder wissenschaftlicher Natur.
ERFOLG
Solange er ausbleibt, hofft man auf ihn. Tritt er ein, nimmt er einem die letzte Hoffnung. Nichts ist so deprimierend wie Erfolg.
BLOCH
Weder »Fatalist des Guten noch des Schlechten« zu sein, schreibt Ernst Bloch, bedeutet zu wissen, dass die Welt »Kraut und Rüben, Gutes und Schlechtes, Nacht und Licht, Mord und Geburt durcheinander«17 ist. Nicht Hölle, nicht Paradies – nichts als diese Welt. Was nicht heißt, dass sie zwingend ist, wie sie ist, sondern nur, dass sie so ist. So viel Realismus sollte sein – denkt Bloch!
FRANKENSTEIN
Kant hat das Monster einer sich überschreitenden Vernunft geschaffen. Ist Kant der Frankenstein der Philosophie?
NARKOTIKA
So sehr sich das denkende Subjekt einer gewissen Unruhe anvertraut, so sehr zielt es auf beruhigende Ergebnisse. Es gehört zum Komfort des Denkens, sich dessen Unbequemlichkeit nur momentweise zuzumuten. Der Alltag gehört den Stereotypen, sie sind die Narkotika der gewöhnlichen Einstellung. Husserl hatte recht zu sagen, dass das Denken mit dem Verlassen der »natürlichen Einstellung« beginnt.18 Denken heißt, sich gegen die doxologischen Anästhetika immunisieren.
POLITISCHE KUNST
»Natürlich kann man ein Pferd vor ein Taxi spannen oder ein Taxi vor ein Pferd. In beiden Fällen ist das nicht effektiv. Aber genau das wird meistens getan mit politischer Kunst: ein Pferd wird vor ein Auto gespannt. Und dann sind die Leute überrascht, wenn es nicht richtig fährt. Außerdem lebt das Pferd dabei nicht lange.« (Heiner Müller19)
KEIN WIDERSPRUCH
Beliebte Ideologie: Gutes-Gewissen-Haben durch Schlechtes-Gewissen-Haben.
CANETTI
Canetti nennt Kafka einen Experten der Macht. Dabei tut Kafka alles dafür, das Expertentum zu demontieren. Kafkas Expertentum ist Ohnmacht angesichts der sich ins Unsichtbare verziehenden Macht.
REGRESSION
Es gibt weder ein progressives Gewissen noch ein progressives Ressentiment. Gewissen und Ressentiment sind immer regressiv. In Abwandlung der Formel Kants zur Aufklärung ließe sich sagen: Denken ist der Austritt des Menschen aus der Regressionsgemeinschaft.
MÖGLICHE UNMÖGLICHKEIT
LIDER
Man kann die Müdigkeit als Décadence-Erscheinung lesen, wie Benjamin es mit Baudelaire in Bezug auf den Jugendstil und die Morbidität des Fin de Siècle tut. In ihr exemplifiziert sich der Niedergang in Gestalt sich senkender Lider. Man kann sie zugleich als Aufstand interpretieren, als Rebellion gegenüber dem Tatsachenlicht, das die Dinge in falsche Evidenzen hüllt.
NOCH EINMAL FÜR DELEUZE
Michel Tournier hat es in Bezug auf Deleuze in Erinnerung gerufen: Die Philosophie kennt ihre eigene Strenge, die der Laxheit des Nicht-Denkens opponiert. Was für ein Irrtum, in ihr die vage Tatsachenverweigerung verirrter Realitätsflüchtlinge zu sehen. Philosophen entziehen sich den Tatsachen, indem sie ihr Verhältnis zu ihnen intensivieren! Intensität ist, wie man seit Différence et Répétition