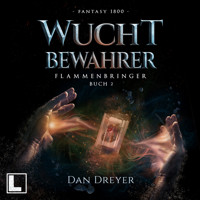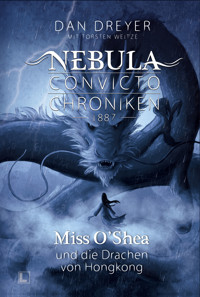Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Torsten Weitze
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Nebula Chroniken: 1887 Buch 1 »Miss O'Shea und der Löwe von Boston« »Was wissen Sie über Werwesen, Miss O'Shea?« Boston im Winter 1887. Eine klirrend kalte Nacht. Ein grausiger Mord um drei Uhr früh. Ein eisiger Morgen. Ein ganz normaler Arbeitstag für Caoimhe ›Kiwa‹ O'Shea, die junge Fotografin des Bostoner Police Departments. Doch dieser Tatort und dieses Verbrechen sind anders als alles, was Miss O'Shea bislang vor die Linse bekommen hat: Das Opfer wurde furchtbar entstellt, als wäre es von einem wilden Tier gerissen worden! Mitten in der Stadt! Wie ist das möglich? Und warum entlädt eine Kutsche zwei merkwürdige Pinkerton Agenten, die die Ermittlung an sich reißen? Die Suche nach dem Täter führt Kiwa vom modernsten Polizeipräsidium der Ostküste durch sämtliche Stadtteile Bostons und geradewegs hinaus aus der Welt, die sie bisher für die einzig mögliche gehalten hatte – und mitten hinein in eine, die es überhaupt nicht geben dürfte … Die Nebula Convicto. »Sind sie bereit für den Schritt hinter den Spiegel, Miss O'Shea?«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nebula Convicto Chroniken: 1887
Miss O'Shea und der Löwe von Boston
von
Dan Dreyer
Unter Mitwirkung von
Torsten Weitze
Autor: Dan Dreyer
Unter Mitwirkung von Torsten Weitze
Ackerstraße 127 • 40233 Düsseldorf • Germany
NEBULA CONVICTO CHRONIKEN: 1887
»Miss O’Shea und der Löwe von Boston«
© Dan Dreyer, Düsseldorf 2023, 1. Auflage
(NC01EB_V02– Nummer für internen Gebrauch)
Szenario: Torsten Weitze & Dan Dreyer
Lektorat & Korrektorat 1: Rainer Knietzsch
Lektorat & Korrektorat 2: Meike Bogmaier
Umschlaggestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG
Cover-Illustration: © Mi Ha | Guter Punkt, München
unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus
Satz: Dan Dreyer mit Alegreya Free
Karte: Map of Boston, 1887 by Sampson, Murdock & Co.
No copyright restrictions. Public domain.
•••
Das Werk, einschließlich seiner Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische
oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Vorwort
›NEBULA CONVICTO CHRONIKEN: 1887‹
Zum Schauplatz:
Das Gilded Age in den USA – das ›Vergoldete Zeitalter‹ – war eine Ära, die sich ungefähr von 1877 bis 1900 erstreckte und zwischen der Zeit der Reconstruction und der Progressive Era angesiedelt war. Es war eine Zeit des raschen Wirtschaftswachstums, des technologischen Fortschritts und der Industrialisierung.
Zwei Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten war Amerika ein Land in schwindelerregendem Wandel: Der sogenannte ›Wilde Westen‹ steuerte auf sein Ende zu. Parallel fanden die letzten Indianerkriege in den Great Plains, den Rockys und runter bis Mexiko statt. Goldfunde und anhaltende Siedlerbewegungen zogen unzählige Menschen gen Westen. Millionen europäischer Einwanderer ließen die Bevölkerung explodieren. Dabei klaffte eine gewaltige Schere zwischen Arm und Reich. Einigen wenigen Millionären standen Heerscharen von Arbeitern gegenüber, die ein hartes Leben führten.
Das Boston von 1887 stellte sich als Schmelztiegel all dieser Einflüsse dar.
Der reiche Handelshafen entwickelte sich in den Jahren zwischen Unabhängigkeit, Bürgerkrieg und Gilded Age zu einer Metropole, die ihr Stadtgebiet durch Landgewinnung verdreifachte. Hügel waren abgetragen und Landfläche aufgeschüttet worden.
Der Zustrom von Immigranten erreichte durch die ›Große Hungersnot‹ in Irland zwischen 1845 und 1849, eine Hochphase und viele Iren zog es an die Ostküste Nordamerikas. Sie waren die zahlreichste ethnische Gruppe in der Stadt und teilten sie sich mit anderen Einwanderern aus allen Nationen Europas, mit Chinesen und Afrikanern, vorwiegend ehemalige, befreite Sklaven und deren Nachfahren.
Boston verfügte zu dieser Zeit über eine der modernsten Polizeiorganisationen der Welt. Einige waren der Meinung, dass lediglich die ›Metropolitan Police of London‹ dem ›Boston Police Department‹ das Wasser reichen konnte, wenn es um Mannstärke, Strafverfolgung, Ermittlung und Datenerfassung ging. Das Aufgabengebiet des Bostoner Polizisten reichte vom Beseitigen von Tierkadavern, über die Unruheniederlegung in den Stadtvierteln bis zur Fahndung nach Straftätern.
Im 19. Jahrhundert gegründete innovative Institutionen wie die ›Harvard University‹, das ›Massachusetts Institut of Technology‹ (kurz MIT) und das ›Massachusetts General Hospital‹ beeindrucken bis heute.
Neben den Tummelplätzen der Eliten – wie Ballsälen, Opern- und Theaterhäusern – gab es auch soziale Ungerechtigkeit und damit echte Ghettos, in denen Hunger und Kriminalität allgegenwärtig waren.
In New York machte der Journalist und Fotograf, Jacob A. Riis, von sich reden, als er die dortigen Elendsviertel (die mit denen in Boston durchaus vergleichbar waren) mit seiner Feldkamera ablichtete und seine Fotos in New Yorker Zeitungen abgebildet wurden. Seine Aufnahmen sind bis heute eindrucksvoll und beeindruckend bedrückend.
In diese Welt entlasse ich also ›meine‹ Quadriga und meine Miss O’Shea.
Dabei verquirle ich sie nur zu gerne mit der, die Torsten Weitze in seinen ›Nebula Convicto‹-Romanen geschaffen hat. Er stand mir mit wachsamen Lore-Hüter-Augen zur Seite, warf die ein oder andere Ergänzung und Inspiration ein, schenkte mir sein Vertrauen und ließ mich sonst einfach von der Leine.
Daher auch an dieser Stelle mein großer Dank an Torsten, der mir die Tore zu seinem Nebula-Abenteuerspielplatz ohne Wenn und Aber geöffnet hat!
Ich hoffe, Ihr, liebe Leserinnen und Leser, habt genauso viel Spaß hinter dem Schleier wie ich.
Und jetzt: Vorhang auf! Hier kommt das verschneite Boston im Winter 1887 …
Ein Mord um drei Uhr früh
Boston, West End, Charles Street, Ecke Fruit Street, Samstag, 12. November 1887, 03:15 Uhr
Die Schneeflocke trudelte durch die mondlose schwarze Nacht.
Neben, über und unter ihr folgten Abermillionen weitere, um die weiße Decke zu verdichten, die auf der Hafenstadt lag. In der Luft über dem Charles River wurden sie emporgewirbelt, verschwanden für einen Moment in den tiefhängenden Wolken, die sie Richtung Ufer trugen. Die Schneeflocke nahm Wassertröpfchen um Wassertröpfchen auf. Sie hefteten sich an, gefroren, bildeten filigrane Strukturen und machten die Schneeflocke schwerer und breiter. Wie ein Blatt im Frühling segelte sie auf den Winden, die vom Fluss an Land brandeten, und sackte tiefer und tiefer. Sie verfehlte die Dachkante des wuchtigen Hauptgebäudes des ›Charles Street Jails‹, taumelte zwischen den gebogenen Eisenspitzen auf dem Grat der Gefängnismauer hindurch und wurde über die finstere Straße geweht, die nur von einigen wenigen Straßenlaternen erhellt wurde. Das heiße Blech der gasbetriebenen Funzeln ließ zahlreiche Flocken verdunsten. Doch sie verfehlte das Lampengehäuse, geriet in einen Strudel warmer Luft und landete auf dem zuckenden Augenlid eines Mannes, der nah am Fuß des Pfahls auf dem gefrorenen Kopfsteinpflaster lag und das Schneetreiben mit schmerzverzerrtem Gesicht beobachtete. Aus einer klaffenden Wunde in seinem Bauch gluckerte Blut hervor und bildete eine warme, dampfende Pfütze unter ihm.
Der Mann umklammerte seine geöffnete Bauchdecke mit krampfenden, blutig glitschigen Fingern. Schnaufend sah er an sich herab und an den eigenen Atemwolken vorbei. Obwohl er seine Beine nicht mehr bewegen konnte und die Pein ihm beinahe die Sinne raubte, bemerkte er den Kontrast zwischen schwarzer Nacht und dem Lichtkegel, in dem er lag. Langsam hob er eine zitternde Hand und führte sie vor seine schwindende Sicht. Weißer Schnee, dunkelbraune Haut, die helleren Handflächen, rotes Blut. Seine Muskeln streikten. Schlaff plumpste der Arm herab.
»Warum beendest du es nicht?«, brachte er heiser hervor.
In der Dunkelheit jenseits des Kegels aus Laternenlicht erschienen zwei gelbe Augen mit stecknadelkopfgroßen schwarzen Pupillen.
»Ich habe es bereits beendet«, grollte eine tiefe Stimme, die nur entfernt an eine menschliche erinnerte.
Die Bestie löste sich aus der Hocke, in der sie verharrt hatte, und trat etwas näher an den Rand zwischen Dunkelheit und Licht. Der Schnee knirschte unter den Pfoten ihrer Hinterläufe.
»Ja?« Der Mann hustete blubbernd.Tränen stiegen ihm in die Augen. Er legte den Kopf in den Nacken, grub ihn tiefer in den Schnee und holte keuchend Luft. Schmerzwellen schüttelten ihn. Die Eiseskälte des Bodens spürte er nicht. Weitere Schneeflocken landeten in seinem Gesicht, ließen seine Lider flattern, sprenkelten den grauen Vollbart. Fiebrige Hitze kroch von seinen Finger- und Zehenspitzen über seine Glieder bis in die Brust. Schwach hob er den Kopf und starrte in die Finsternis.
Unter den gelben Augen blitzten lange Fänge auf. »Ich höre deinen Herzschlag und rieche deinen versiegenden Atem«, sagte die Bestie. »Es ist gleich so weit.«
»Ach so …« der Mann legte seinen Kopf wieder auf den Boden neben dem Pfahl. Heute interessierte es ihn nicht, dass eben dort die Straßenhunde ihr Revier markierten. Der Schnee war frisch und roch so sauber, wie nur frischer Schnee riechen konnte. Er schien die Nacht, die Stadt und den Bordstein gereinigt zu haben. »Bist du noch da?«, fragte der Mann.
»Ja«, raunte es aus der Dunkelheit.
»Warum hast du es getan?« Er brachte die Worte schleppend und lallend hervor.
Wieder knirschte Schnee. Eine haarige Pranke setzte innerhalb des Lichtkegels auf. Schwarze, sichelförmige Klauen. Schwarze Haut, wo sie nicht von sandfarbenem Fell bedeckt oder blutverschmiert war.
»Es wurde mir aufgetragen«, knurrte die Bestie.
Der Mann konnte ein leises Kichern nicht unterdrücken, also kicherte er, bis ihm der Schmerz das Grinsen von den spröden Lippen pflückte.
»Du gehorchst Befehlen?«, fragte er mit schwächer werdender Stimme.
»Ja.«
»So etwas … liegt dir sonst nicht.«
Die Bestie knurrte. Es klang eher unwirsch als zornig. »Ich kann mich nicht dagegen wehren.«
Ein Hustenreiz peitschte den Mann und Klumpen seines Blutes flogen aus seinem Rachen, landeten auf dem Haufen, der sein Unterbauch gewesen war.
»Sorge dich nicht«, grollte die Bestie. »Es ist gleich vorbei.«
Mit letzter Kraft versuchte der Mann abzuwinken. Doch es wurde nur ein kurzes Zucken im Handgelenk. »Ich … sorge mich … um dich.«
Eine zweite Pranke erschien im Licht. War das Fell auf den Unterarmen noch hell und kurz, wurde es ab den Ellbogen länger und dunkler. Oberkörper, Buckel und Schädel blieben in der Finsternis, doch der wuchtige Umriss des Monsters zeichnete sich gegen die Beleuchtung des Gefängnisses ab.
Die Bestie schmatzte, leckte sich über die Klauen der Rechten. »Hm …«, machte sie. »Hättest du dem Wort nachgegeben, nichts von dem hier wäre geschehen.«
Wie gern hätte der Mann erneut gekichert. Wenn da nicht die dunklen Schlieren gewesen wären, die sich von den Rändern seines Sichtfeldes im Takt des schwindenden Pulses zur Mitte aufmachten. Er hustete und ließ den aufsteigenden Blutschwall aus seinem Mundwinkel rinnen.
»Einen Sterbenden … zu belügen ist eine Sünde, … alter Freund. Sei … wenigstens ehrlich … zu dir selbst.«
Dieses Mal erntete er wahrlich unwirsches Schnaufen mit einem Hauch von Verachtung.
»Lass jetzt los!«, grollte die Bestie.
Er ließ los.
Schlitternde Miss O’Shea
Boston, West End, Fruit Street, Samstag, 12. November 1887, 08:25 Uhr
Die Sonne quälte sich wie ein müder alter Mann über das Wasser der Massachusetts Bay und mühte sich vergebens, den Dunst eines verhangenen Morgens über Boston aufzulösen.
Auch Miss Caoimhe O’Shea, die alle nur ›Kiwa‹ nannten, mühte sich redlich. Allerdings nicht wie ein alter Mann, sondern wie die junge Frau, die sie war. Die Tochter irischer Einwanderer war in einen Wintermantel gekleidet, der für ihre zierliche Gestalt viel zu groß anmutete. Ihre haselnussfarbenen Locken steckten unter einem langen Wollschal, den sie sich mehrfach um Kopf, Nacken und Hals gewickelt hatte. Der Berg aus Textilien gestaltete es nicht leichter, das hölzerne, dreibeinige Stativ unter dem einen und die zu einer schmucken Mahagoni-Box zusammengefaltete Feldkamera ›Lucidograph No. 3‹ – ihr ganzer Stolz! – unter dem anderen Arm über die glattgefrorenen Bürgersteige zu bugsieren. Der kompakte Apparat, von der Firma Blair Camera Co. in Boston produziert, war ein wahres Schmuckstück neuster technischer Errungenschaften! Das Gehäuse konnte zu einer Kiste von der Größe einer Hutschachtel zusammengeklappt werden. Fotoplatten und Linsen waren sodann im Innern verstaut. Der Apparat war in Windeseile einsatzbereit. Es erforderte nur wenige Handgriffe, ihn aufzuklappen und auf das Dreibein zu montieren.
So man denn wohlbehalten den Einsatzort erreichte, was Kiwa derzeit fragwürdig erschien …
Die glatten Sohlen ihrer ausgelatschten Stiefel, die sie mit gefaltetem Zeitungspapier gegen die Kälte ausstaffiert hatte, flutschten und rutschten durch die Schneewehen, die sich knöchelhoch am Rinnstein aufgetürmt hatten und von dort über den Gehweg verweht wurden. Vor ihrem inneren Auge sah sie sich schon ausgleiten. Vermutlich würde sie sich ein Auge am Gewinde des Stativs ausstechen und sich die Vorderzähne an der harten Kante des Holzkastens der Kamera ausschlagen – die mit Sicherheit zu Bruch ginge …
Das wütende Schnauben des Chief-Constable des Police-Departments mischte sich zu den Bildern in ihrem Kopf: »Siebenundzwanzig Dollar, Miss O’Shea! Und da sind Linsen, Bildplatten und Plattenhalter noch nicht eingerechnet!«
Sie schüttelte den Kopf, um die tiefe Stimme zu verdrängen.
Durch Ehrgeiz und Fleiß hatte sie diese Anstellung im Boston Police Department errungen – und durch Ehrgeiz und Fleiß würde sie auch dieses Schneetreiben bewältigen! Wer konnte sie schon aufhalten, hm? Mit Stolz durfte sie von sich behaupten, ein Teil der 12% der Frauen in Nordamerika zu sein, die nicht als Arbeiterinnen, Stenographinnen, Saloondamen oder Verkäuferinnen tätig waren!
»Ha!«, machte sie und hüpfte wagemutig über einen weißen Buckel auf dem Bürgersteig. Bei ihrer Landung flutschte ein Absatz unter ihr weg, und beinahe wäre sie in einem unfreiwilligen Spagat gelandet. In letzter Sekunde rettete sie sich, indem sie ihre Schulter an der Backsteinmauer zu ihrer Linken abstützte und den Fuß in der Kante zwischen Gehweg und Wand verkantete. Die Kamera verrutschte bedenklich und drohte, zu Boden zu purzeln.
Siebenundzwanzig Dollar!
Sie entschied sich, das Dreibein fahren zu lassen, um den kostbaren Fotoapparat zu retten. Dumpf prallte das Stativ in den Schnee.
Erleichtert atmete sie aus und lehnte sich an die Mauer. Die Kamera in beiden Händen, die in wollenen Handschuhen ohne Fingerkuppen steckten. Das glatte Holz des Gehäuses fühlte sich wunderbar an. Es war schließlich intakt – und ihre Finanzen somit auch. Ihr Job brachte ihr 12 Dollar die Woche ein – was schon recht ordentlich war für eine junge Einwandererin aus Irland, von denen es in Boston Tausende gab. Niemand hatte auf sie gewartet, als sie vor fünf Jahren und mit zweiundzwanzig Lenzen den ersten Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt hatte.
Den geliebten Posten der Polizei-Fotografin hatte sie sich nach drei Jahren als Revier-Stenotypistin erkämpft und er sollte ihre Eintrittskarte in den Journalismus werden – so sie denn ihr Rüstzeug unversehrt zum Tatort befördern konnte.
Was weiterhin fraglich blieb, wie sie nach einer kurzen Abstoßbewegung aus der Sicherheit der Backsteinwand feststellen musste. Kaum hatte sie sich mit den Schultern vom Stein abgedrückt, als sie ihren Stand auch schon wieder schwinden spürte.
»Soll ich dir helfen?«
Kiwa zuckte zusammen und presste sich den Fotoapparat an die Brust, bevor sie ihr Schreckgespenst begrüßte.
»Hi, Ellis«, sagte sie. Ihr Herz puckerte durch die Lagen ihrer Winterkleidung und trommelte gegen das Holzgehäuse der Kamera.
Constable Kay-Ellis Cadogan. Ihr edler Retter in der Not. Ein schlanker Mann Mitte dreißig, anderthalb Köpfe größer als sie, mit dunkelbraunem Haar unter seinem Polizistenhelm, stahlblauen, wachen Augen, einer markanten Nase und dünnem Schnäuzer, der in einen Dreitagebart überging. Bei den Schichten, die die Ordnungskräfte Bostons ableisteten, war es ihm wohl nicht möglich, sich so regelmäßig zu rasieren, wie es die Statuten verlangten.
Verschmitzt grinsend trat der Polizist näher an sie heran. Er bückte sich, sammelte das Stativ vom Boden und bot ihr galant einen Arm zum Unterhaken an.
»Es ist gleich da vorne«, sagte er. »Nicht mehr weit.«
Dankbar hakte sie sich ein und gemeinsam setzten sie ihren Weg fort. Dass dabei warme Röte in ihre Wangen schoss, war ein angenehmer Nebeneffekt gegen die Kälte des Morgens. Ellis’ zäher Oberarmmuskel fühlte sich aber auch gut an. Trotz der dicken Schicht aus Wollfilzmantel und Uniform.
»Vorsicht!«, sagte der Polizist leise. »Die Nacht war bitterkalt. Der Boden ist glatt.«
»Was du nicht sagst!« Sie rümpfte die Nase, schlitterte einen halben Schritt und fing sich.
Ellis stützte sie und lachte.
Unsicher wackelnd manövrierten sie sich im Gespann um die Ecke der Gefängnismauer, die den Blick auf den Tatort bislang verbaut hatte. Fünfundzwanzig Schritte Entfernung, Bodennebel und einige weiße Verwehungen ließen sie nur ein paar Uniformierte erahnen.
»Weißt du schon, was passiert ist?«, fragte sie.
»Wir wissen noch nichts Genaues. Eigentlich war ich auf dem Weg zu den umliegenden Wohngebäuden, bis ich dich aufgelesen habe.« Ellis ließ beide Augenbrauen zucken. Bei jedem anderen Mann hätte es anzüglich gewirkt. Doch der Polizist hatte ein dermaßen offenes, ehrliches Gesicht, dass es eher wie der Ulk eines großen Bruders wirkte. Mit dem Anflug eines schelmischen Grinsens kniff sie ihm in den Oberarm.
Ungerührt fuhr Ellis fort: »Der Tote ist ein Schwarzer. Dürfte Ende sechzig sein. Der Kleidung nach gehörte er zur Mittelschicht. Vielleicht ein Hausangestellter bei reichen Leuten, vielleicht Unternehmer. Ich hoffte, jemanden in der Nachbarschaft aufzutun, der ihn kennt. Es ist recht unwahrscheinlich, dass er nicht in der Nähe wohnt. Bei dem Sauwetter wird er kaum aus einem anderen Stadtteil hierhergekommen sein.«
Mit einem Kopfnicken deutete sie auf die Backsteinmauer. »Habt ihr schon im Knast gefragt?«
»Oggy ist gerade beim Direktor.«
Auf ihrem Weg schreckten sie eine hagere Straßenkatze auf, die sie anfauchte und sogleich quer über die Straße davon eilte. Das Tier hatte zwischen ein paar schiefen Transportkisten nach Nahrung oder Wärme gesucht. Kiwa zuckte zusammen und Ellis fasste ihren Arm etwas fester, um sie auf den Beinen zu halten. Der Tatort lag nur noch einige rutschige Schritte vor ihnen. Offensichtlich war der Tote am Fuß einer Straßenlaterne zusammengebrochen. Zwei Polizisten umstanden den Leichnam. Ihre langen Mäntel wurden vom Wind aufgebläht. Sie stützten ihre zylinderförmigen Helme mit den halbrunden Kronen gegen eine stramme Brise, die vom Fluss herüberwehte.
»Hatte der Tote eine Aktentasche dabei?«, fragte sie, während sie einige Schritte näher heranschlitterten.
»Warum fragst du?«
»Na ja …« Sie nickte wieder zum Gefängnis. »Möglicherweise war er ein Anwalt, der beruflich hier zu tun hatte. So nah am Knast. Dazu die Kleidung, die du erwähnt hast.«
Als Ellis auflachte, entblößte er sein strahlend weißes Gebiss. »Detective O’Shea zieht bereits erste Schlüsse?«, feixte er und erntete einen weiteren Kniff. »Ein Anwalt wird wohl kaum mitten in der Nacht seine Klienten besuchen«, sagte er immer noch lächelnd. »Der Doc vermutet, er ist gerade mal seit ein paar Stunden tot. Gut, er ist steifgefroren, was die Einschätzung nicht leichter macht – selbst für einen medizinbewanderten Kauz wie Doc Meiers – doch er täuscht sich eher selten bei solchen Dingen.«
»Hm …«
Vor der Traube aus Polizisten löste Ellis ihre Verbindung und stellte den Dreifuß auf. Sie wäre gerne noch mit ihm zum Fluss geschlendert, der um diese Jahreszeit wahrlich ein spektakuläres Naturschauspiel bot, wenn sich Eisplatten am Fuß der West Boston Bridge auftürmten.
Aber gut … Leider konnte sie den Ruf der Arbeit nicht ignorieren.
Mit klammen Fingern befestigte sie die Kamera auf der Halterung.
Einer der Beamten schob seinen Helm Richtung Nacken und drückte den Rücken durch. »Miss O’Shea. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ausgeschlafen?«
Nichts anderes war von Constable Fletcher Dunn zu erwarten, wusste sie. Der breitgebaute Schotte war nie verlegen, wenn es darum ging weiblichen Kollegen auf die Nerven zu gehen – oder saudumme Andeutungen in seine stets anmaßenden Kommentare zu streuen.
Kiwa blies die Backen auf und gab sich Mühe, den Kerl zu ignorieren.
Wieder sprang ihr Ausrutsch-Retter hilfreich ein.
»Halt den Rand, Fletch«, sagte Ellis. »Bist selbst erst seit zehn Minuten hier.«
Constable Dunn vergrub seine Fäuste in den Manteltaschen und zuckte mit den Schultern, um den Kragen höher zu schieben. »Hätten auch im Frühling kommen können«, brummte er. »Dann wär der steife Negro vielleicht aufgetaut.«
»Bei Gott, Fletch!«, mischte sich der zweite Polizist ein. »Der Mann ist tot! Kannst du nicht ein Mal dein Schandmaul halten?« Rüde drängte er den anderen aus dem Weg und reichte Kiwa die behandschuhte Hand.
»Guten Morgen, Miss O’Shea«, sagte er.
»Morgen, Owen.« Sie griff die Hand und sah ihre eigene in der Pranke des Mannes verschwinden. Lieutenant Constable Owen MacLeòid war ein Hüne und entsprach in vielerlei Hinsicht dem Klischee eines Highlanders. Sie hatte keine Mühe, sich den Polizisten anstatt in Uniform in einem Kilt um die Hüfte und einem Claymore in der Faust vorzustellen. Blau bemaltes Gesicht und eine Horde gerüsteter Briten. Kriegsschrei und mitten rein!
MacLeòid ließ ihre Hand unversehrt fahren und wischte sich Schneeflocken aus seinem roten Backenbart, der in einen prächtigen Schnäuzer mündete. Mit der anderen zeigte er auf den Leichnam. »Machen Sie doch bitte ein paar Aufnahmen, ja? Sobald Sie die im Kasten haben, befreien wir den Toten gänzlich vom Schnee, damit Sie weitere Bilder schießen können.« Er legte ihr eine Pranke auf die Schulter. »Zucken Sie nicht zusammen, Kleines. Es ist kein schöner Anblick, das kann ich Ihnen sagen.«
»Geht klar«, sagte sie.
Einem Brocken wie Owen das gönnerhafte ›Kleines‹ nachzusehen, fiel ihr nicht schwer. Der Hüne hätte alles und jeden so nennen können und wäre kein Lügner. Abgesehen davon war er in Ordnung und respektierte sie und ihre Arbeit.
Der Polizist drehte sich auf dem Absatz um und vollführte einige scheuchende Armbewegungen. »Dann macht mal Platz, Jungs.«
Kiwa hob den Blick zum verhangenen Himmel. Es würden nicht die besten Fotos werden, so viel war klar. Doch mit dem T-förmigen Lampenstab und Magnesiumpulver für die Erzeugung von Blitzlicht beschwert, hätte sie den Tatort nie ohne ausgerenkte Hüfte oder Genickbruch erreicht.
Sie richtete das Objektiv auf den Leichnam und betätigte den Auslöser.
»Da ist Oggy«, sagte Ellis und entfernte sich, um dem Kollegen entgegenzugehen. »Und?«, rief er.
Officer Frank ›Oggy‹ Ogilvie winkte ab, bevor er die Traube der Polizisten erreicht hatte. »Nee. Den kennt da keiner. Müssen wir wohl doch die Nachbarschaft abklappern.«
»Na herrlich«, kommentierte Fletcher Dunn missmutig. »Da werden die Bim…«
Owens flache Hand klatschte in den Nacken des Schotten, dessen Helm ihm über die Augen rutschte. »Lass es!«, grollte der Hüne. »Es ist schon schwer genug für uns, die Kooperation der West Enders zu bekommen.«
»Ja, aber …«, setzte Fletcher an. Ein warnender Zeigefinger unter der Nase ließ ihn schlucken.
»Kein Aber, Mann! Vor dreißig Jahren wärst du mit deinem Drecksmaul vielleicht noch durchgekommen!«
»Mit weißer Kapuze in Tennessee«, warf Oggy hilfreich ein.
»Ja, genau.« Owen zeigte auf den rundlichen Constable, der im Gefängnis den Direktor gesprochen hatte. »In Tennessee. Aber das hier ist Boston, Mann! Der Schmelztiegel schlechthin. Also wirf deine widerlichen Vorurteile in den Charles River. Sonst lass ich dich einhundertmal Abolitionismus aufschreiben, klar? «
»Oder du verpisst dich nach Durness«, murmelte Oggy, womit er dem Kollegen einen Aufenthalt im nördlichsten Norden der dort dünn besiedelten Highlands vorschlug.
»Selbst da geht er den Leuten auf die Eier«, sagte Ellis kopfschüttelnd.
Nachdem Kiwa einige Bilder im Kasten hatte, machten sich die Polizisten daran, den Leichnam vom Schnee zu befreien. Mit jedem Zentimeter, den sie freilegten, stieg ihr die Magensäure höher in den Rachen.
»Der arme Mann!«, flüsterte sie.
»Echt, schöne Scheiße«, brummte Oggy.
Ellis, der über dem Toten kniete, lüpfte mit spitzen Fingern die blutgetränkte Weste. Die gefrorenen Maschen knirschten. »Wie kann jemand so etwas anrichten?«, fragte er in die Runde.
»Mit Wut?« Owen schob den Helm in den Nacken und fuhr sich mit flacher Hand über die Stirn.
»Ich meinte eher: womit«, sagte Ellis.
Kiwa schluckte. »Gab es eine Meldung zu einem entflohenen Tier aus dem zoologischen Garten?«
Fletcher schnaufte abfällig.
»Wir haben nichts dergleichen gehört«, sagte Owen und hob drohend die Hand in Richtung des abfälligen Schnaufers.
»Kann schon hinkommen …« Ellis richtete sich auf. »Seht mal: Es sieht wirklich so aus, als hätte dort ein Raubtier seine Klauen versenkt. Ein Säbelhieb war es jedenfalls nicht.«
»Wo ist eigentlich der Doc?«, fragte Oggy und reckte den Hals.
Fletcher zeigte über die Schulter. »Ist im Bau. Hat was von Aufwärmen gesagt.«
Ratlos standen die Polizisten um den verstümmelten Leichnam, während Kiwa weitere Aufnahmen machte.
Ratternde Kutschenräder, klappernde Pferdehufe und das Klingeln von Zaumzeug näherten sich hinter ihnen.
Owen deutete auf den Gefängnisbau. »Fletch, hol mal den Doc. Er sollte sich das noch einmal ansehen, bevor der Coroner es aufsammelt.«
»Is’ nich’ die Kadaverpritsche«, kommentierte Fletcher Dunn.
»Nicht?« Kiwa drehte sich um.
Es war in der Tat nicht die Kutsche der Gerichtsmedizin, sondern ein ziviler Zweispänner mit geschlossener Kabine. Gezogen wurde sie von zwei kraftstrotzenden Pferden, die sich in entspanntem Trab über die schneeverkrustete Straße näherten und den schwarz lackierten Wagen auf hohen Rädern zogen. Auf dem Bock saß eine nicht zu erkennende Gestalt, in einen Kokon aus Filzwolle verpackt. Lediglich behandschuhte Hände ragten aus den Stoffbahnen und hielten Zügel und Peitsche.
»Hattest du nicht die Straße gesperrt?«, erkundigte sich Owen bei Officer Ogilvie, der umgehend eifrig nickte und »Doch, sicher« sagte.
Das Gefährt stoppte auf der Fahrbahn.
Die Tür der Kabine schwang auf. Zwei Männer stiegen aus.
Beide trugen lange, hellbraune Kamelhaarmäntel, tailliert nach europäischer Mode. Beide waren schlank und hochgewachsen. Schwarze Melonen saßen auf ihren Köpfen. Schwarze, polierte Stiefel ragten aus schwarzen Hosenbeinen. Die gesamte Garderobe der Neuankömmlinge wirkte edel und ziemlich kostspielig.
Der vordere Mann lüpfte seine Kopfbedeckung zum Gruß und setzte das Ende eines glänzenden Gehstocks in den Schnee. Der hintere Mann grüßte nicht. Er zeigte auch sonst keine Regung. Hinter den Gläsern einer runden, schwarz getönten Brille blieb sein Ausdruck verborgen.
Oggy machte einen Schritt nach vorn und deutete die Straße hinunter, in die Richtung, aus der die Kutsche gekommen war. »Hört mal, Leute«, sagte er, »habt ihr nicht gesehen, dass da ne Barriere steht? Ihr habt hier nichts zu suchen.«
Der vordere Mann setzte die Melone wieder auf seinen blonden Kopf und lächelte. Dann pflückte er eine silberne Marke aus der Innentasche seines Mantels und hielt sie in die Höhe.
»Mister Pinkerton sieht dies womöglich anders«, sagte er heiter mit glockenheller, jungenhafter Stimme, die einen Hauch von britischem Akzent innehatte.
Pinkertons im Schnee
Charles Street, Ecke Fruit Street, Samstag, 10:52 Uhr
Kiwas Augenbrauen verschwanden unter dem gewickelten Schal und wären wahrscheinlich bis zum Himmel aufgestiegen, wenn der Mann sie nicht warm angelächelt und gezwinkert hätte.
Was zum Henker hatten denn Pinkertons in Boston zu suchen?
Während des Krieges waren die Frauen und Männer der ›Pinkerton National Detective Agency‹ an der Bildung des militärischen Geheimdienstes beteiligt gewesen. Vor sechzehn Jahren hatte die Agency sogar ein Mordkomplott gegen den damaligen Präsidenten Abraham Lincoln aufgedeckt und verhindert. Sie war berüchtigt, bei Ermittlungen gegen kriminelle Subjekte wenig zimperlich vorzugehen. In jeder größeren Stadt gab es Niederlassungen. Eisenbahngesellschaften sicherten sich die Dienste der privaten Agentur, um ihre Linien vor Überfällen zu schützen. Mittlerweile waren die Agenten aber eher dadurch aufgefallen, im Auftrag industrieller Unternehmen Gewerkschaften in Schach zu halten und Streiks zu brechen, wobei nicht selten Schädelknochen brachen.
Aus welchem Grund sollten sie sich für einen Toten in Boston interessieren?
»Einen schönen guten Morgen die Herren …«, sagte der Blonde. Unbekümmert ließ er einen Blick durch die Runde schweifen, dann wandte er sich zu Kiwa und verbeugte sich. »Ma’am.«
Der zweite Mann und der Kutscher führten einen stummen Dialog, der den anwesenden Polizisten entging. Kiwa bemerkte ihn und sah zum Fahrer auf. Langes schwarzes Haar ergoss sich über einen Kragen aus Bärenfell und rahmte ein wettergegerbtes, aber eindrucksvoll kantiges Gesicht, mit bernsteinfarbenen Augen unter energischen Augenbrauen, das zu einem jungen, wahrlich attraktiven Native American gehörte. Der Kutscher nickte ihr zu und schwang sich vom Bock.
Fletcher drohten die Augen aus dem Schädel zu kullern. Er zeigte auf den Mann. »Seit wann dürfen denn Rothäu…«
Owens flache Hand unterband auch diesen Ausbruch.
»Schnauze, Fletch«, flüsterte Oggy.
Der Mann, der der Kabine zuerst entstiegen war, musterte die Runde und hielt sodann Constable Owen MacLeòid seine ausgestreckte Hand entgegen, die in einem passgenauen Lederhandschuh steckte.
»Sie haben hier das Kommando?«
Owen schüttelte die dargebotene Hand und nickte.
»Fein!« Der Mann strahlte. »Ich darf mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Morgan Worthington. Bundesagent der Pinkerton National Detective Agency.« Er wedelte noch einmal mit der silbernen Plakette, bevor er sie im Mantel verschwinden ließ.
»Owen MacLeòid, Lieutenant Constable«, erwiderte der Hüne.
»Fein!« Mister Worthington klatschte vom Leder gedämpft in die Hände, dann präsentierte er die Rechte den anwesenden Polizisten und schüttelte reihum zum Gruße, wobei er Kiwas klamme Finger etwas länger umfasste. Lang genug, dass sie Ellis’ wachsamen Schatten hinter sich spürte.
»Und Sie müssen die wackere Caoimhe O’Shea sein!«, stellte Worthington freudig fest.
Kiwa schüttelte irritiert den Kopf. Der Mann sprach eindeutig mit englischem Akzent und es war ihm gelungen, ihren irisch-gälischen Namen perfekt betont auszusprechen. Er klang nämlich tatsächlich wie ›Kiwa‹ – oder besser ›Quiwhah‹, und damit genau so, wie der Brite ihn aufgesagt hatte.
»Ich sehe, Sie machen Ihrem Namen alle Ehre!«, fuhr der Mann fort. »Bedeutet er doch ›die Schöne, die Anmutige‹ in der Zunge Ihrer Ahnen, so ich mich nicht irre!«
Kiwa stupfte sich selbst an die Brust. »Woher wissen Sie, wie ich heiße?«
Worthington legte eine verschwörerische Miene auf und zwinkerte ihr zu. »Mir ist Ihre Arbeit aufgefallen, als ich Ihre Werke im Rathaus sah.«
Ihre Augenbrauen setzten die angefangene Reise gen Himmel fort.
»Wie? Was? Wie?«, stammelte sie. Es war ihr völlig unbegreiflich, wie der Mann von den Ergebnissen ihrer nächtlichen Exkursionen erfahren haben sollte, geschweige denn besagte Ergebnisse zu Gesicht bekommen hatte. Bislang hatte sie nur einem engen Kreis von Freunden und Bekannten davon erzählt, dass sie gelegentlich durch die heruntergekommen Stadtteile pirschte und Fotos von den Ärmsten der Armen schoss. Sie hatte einige ausgewählte Abzüge an den Bürgermeister der Stadt geschickt, in der Hoffnung, die Stadtoberen auf die Missstände aufmerksam zu machen.
»Wahrhaft eindrucksvolle Aufnahmen!«, sagte Worthington. Dann wandte er sich wieder den Polizisten zu. »Wenn es den Herrschaften genehm erscheint, ließe ich meinen werten Kollegen nun die Leiche untersuchen.«
Der Hagere mit der verdunkelten Brille schob sich neben Worthington und zog sämtliche Blicke auf sich. Er war ein großer Mann, dessen athletische Figur selbst unter dem langen Mantel nicht verborgen blieb. Sein breites Gesicht zierte ein dünner Schnauzbart herrschender Mode.
Owen räusperte sich. »Haben Sie denn die nötigen Befug…«, setzte er an.
Schon raschelte ein Kuvert, das ihm Worthington unter die Nase hielt.
»Aber sicher! Frisch aus dem Rathaus, mein Bester. Dazu ein Schrieb von den U. S. Marshals, dem Justizministerium und meinem werten Arbeitgeber, der derzeit im frostigen Chicago weilt. Sehen Sie nur hinein!«
Ergeben langte Owen nach dem Umschlag. Kiwa bemerkte, dass nicht nur ihre Augenbrauen mittlerweile durch die Wolken entschwunden waren. Die Polizisten glotzten allesamt völlig verblüfft aus ihren Uniformen.
Worthington tätschelte Owens dicke Schulter. »Nur keine Befangenheit, Lieutenant Constable! Es ist Ihr Tatort, keine Frage! Wir werfen einen schnellen Blick, und dann können sie ungetrübt fortfahren. Wir müssen lediglich überprüfen, ob es sich um eine lokale Angelegenheit handelt oder ob wir auf Bundesebene zu ermitteln haben.«
Der Bebrillte tat einen Schritt in die Mitte und damit näher an den Toten heran.
»Geben Sie mir ein wenig Raum, bitte?«, bat er mit wohltönender Baritonstimme, die keinerlei Zweifel daran ließ, dass der Sprecher das Fragezeichen lediglich aus Höflichkeit ans Ende seiner Bitte gepackt hatte.
•••
»Kommen Sie zurecht?«, erkundigte sich Agent Worthington bei seinem Partner, der seit Minuten über dem Toten hockte und eine Hand flach auf der zerfetzten Brust abgelegt hatte.
»Ja«, murmelte der Hagere. »Hab schon mal mehr Blut gesehen.«
»Gut, gut, gut.« Worthington hob beschwichtigend die Hände und sandte ein Lächeln in die Runde der versammelten Polizisten.
»Was’n das für ne Untersuchung?«, grummelte Fletcher Dunn.
»Psst!«, zischte der Hagere. Fletcher presste die Lippen aufeinander und verdrehte die Augen.
Ob der Hagere seine Augen geschlossen hatte oder nicht, war für Kiwa unter den dunklen Gläsern nicht zu erkennen. Aber aufgrund der konzentrierten Körperhaltung stellte sie sich vor, dass er dies tat. Nur warum? Zu welchem Zweck?
Irgendwann schien der Hagere genug … ja, was denn? Gesehen zu haben? Gehört? Gespürt? Bis auf die flache Hand auf der Brust war weiter nichts geschehen. Doch nun beugte er sich zum auf dem Boden liegenden Arm des Toten und legte seine Finger über dessen Faust. Der Hagere drückte zu. Es knackte. Die Polizisten zuckten zusammen. Es knackte noch einmal und klang verdächtig nach brechenden Knochen. Dann öffnete sich die Faust der Leiche.
Worthington ging neben seinem Partner in die Hocke und musterte den Inhalt der Hand, der den Constables bisher verborgen geblieben war. Kiwa beugte sich vor, um an den Rücken der Knienden vorbeizusehen und ebenfalls einen Blick zu erhaschen.
»Ein Bär?«, murmelte Worthington.
Der Hagere schüttelte sacht den Kopf und nahm den Gegenstand auf, der sich als handflächengroße schwarze Klaue herausstellte.
Nach allem, was Kiwa über die Fauna ihrer neuen Heimat wusste, hätte es sich durchaus um die Kralle eines Grizzlys handeln können. Doch wie hätte es dazu kommen sollen, dass ein riesiger Braunbär den armen Mann mitten in Boston zerfetzte, ohne dass ein Aufschrei im gesamten Stadtgebiet erscholl?
So ein Grizzly war schließlich nicht leicht zu übersehen.
»Hast du genug?«, fragte Worthington.
Der Hagere nickte. Als er sich aufrichtete, steckte er die Klaue in eine Manteltasche.
»Äh …«, machte Owen. »Handelt es sich dabei nicht um ein Beweismittel? Ist es eventuell sogar die Tatwaffe? Die können Sie nicht so einfach …«
Der Agent trat ihm lächelnd entgegen und klopfte auf die Brusttasche von Owens Uniform, in der der zuvor übergebene Umschlag steckte. »Frisch aus dem Rathaus, mein Bester, und so weiter. Sehen Sie nur nach!« Er zwinkerte und verbeugte sich. Die Krone seiner Melone touchierte Owens schlaff hängenden Unterkiefer nur knapp.
»Wohlan, Kameraden!«, rief Worthington. Mit einem letzten Nicken in Kiwas Richtung langte er nach dem silbernen Griff der Kutschenkabine.
Die Polizisten sahen sich ratlos an.
Beinahe wäre Kiwa der längere Blickkontakt zwischen Ellis und Worthington entgangen. Die Sache mit dem stummen Dialog schien sich zu wiederholen.
Sie runzelte die Stirn.
Dann wandte sich Ellis ab. »Alles klar, Leute«, sagte er in neutralem Tonfall. »Sobald die Agents abgezogen sind, legen wir fest, wer wo die Nachbarschaft abklappert. Wir brauchen immer noch einen Namen.«
Worthington räusperte sich und Ellis sah ihn über die Schulter an.
»Jebediah Washington«, sagte der Agent. »Vormals Jeb de la Vacherie, wohnhaft in der Barton Street. Gern geschehen.« Dann bestieg er die Kutsche.
Kopfschüttelnd folgte ihm der Hagere mit der dunklen Brille.
Bevor der Kutscher mit der Zunge schnalzte, um sein Gefährt ins Rollen zu bringen, vernahm Kiwa einen letzten Gesprächsfetzen aus dem Inneren des Wagens.
»Was denn?«, zischte Agent Worthington.
»Vergiss es«, raunte der Hagere.
Dann übertönten die auf dem gefrorenen Kopfsteinpflaster ratternden Eisenbänder und die pochenden Hufe den Dialog.
Sie sah der Kutsche und ihren irritierend selbstsicheren Passagieren hinterher, bis Owen die Situation auflöste.
»Ellis, Oggy, ihr übernehmt die unmittelbare Nachbarschaft. Fletch, du holst den Doc. Ich warte mit Miss O’Shea, bis der Coroner eintrifft.«
Officer Dunn trat missmutig in den Schnee. »Warum kann ich nicht die Befragungen vornehmen?«, murrte er.
Owen hob eine Augenbraue und sah den Kollegen an, als hätte er etwas ziemlich Dummes gesagt.
An seiner statt antwortete Oggy: »Weil das hier das West End ist und du Fletcher Dunn bist, der seine Rassistenschnauze nicht halten kann.«
»Noch Fragen?«, brummte Owen.
Ohne ein weiteres Wort drehte sich Fletcher ab und stapfte zum Gefängnistor.
»Komm, Oggy«, sagte Ellis. »Du die rechte, ich die linke Seite.«
Er zwinkerte Kiwa zu und dann marschierten die beiden Polizisten von dannen.
Ihre Schritte waren noch nicht hinter Kiwa verklungen, da räusperte sich Owen. Sie betrachtete den Ausschnitt durch die Glasplatte auf der Rückseite der Kamera, justierte das Objektiv auf den zerfetzten Mann am Boden, hob eine Augenbraue und sagte: »Ja?«
Owen räusperte sich ein zweites Mal.
Am Gehäuse der Kamera vorbei sah sie zu dem bulligen Schotten. »Nun sag schon!«
»Weißt du, Kleines …«
»Jaaahh?«
Owen zertrat einige Flocken zwischen seinen Stiefeln und kratzte sich am Hinterkopf. Kiwa richtete sich auf, stemmte die Fäuste in die Hüfte. Endlich rückte der Polizist mit dem Thema heraus, das ihm offenbar auf den Lippen lag.
»Ich habe mich gefragt, wann du Ellis mal zu einem Tanz bittest …«
»Wie bitte?« Ein halbseitiges Lächeln stahl sich auf ihr halb gefrorenes Gesicht.
»Na ja … dass er was für dich empfindet, geht sogar dem tumbsten Paddy auf. Sogar Oggy hat es mitbekommen. Und das will was heißen.«
Sie hob einen Zeigefinger und zeigte auf sich selbst. »Sollte dann nicht er mich fragen?«
Owen schnaufte und winkte ab. »Ellis?! Ach komm! Du bist die Einzige, zu der er mal nicht kurzangebunden oder gar grimmig ist. Wie lange kennt ihr euch schon? Zwei Jahre? Drei? Er scheint dich zu mögen, taut regelrecht auf in deiner Gegenwart. Es geht mich ja nichts an, aber bei meiner Dee und mir standen die Zeichen nicht schlechter. Sind jetzt auch schon zwölf Jahre …«
»Owen?«, unterbrach sie.
»Hm?«
Sie wackelte mit dem Zeigefinger. »Du hast schon recht.«
»Ja? Oh, das freut mich abe…«
»Es geht dich nichts an.« Lächelnd senkte sie den Blick wieder vor die Scheibe der Feldkamera.
Mit einem hörbaren Rauschen von Leder und Wolle stieß Owen seine Hände tief in die Manteltaschen.
»Oh, da kommt der Doc!«, rief er – und Kiwa war sich ziemlich sicher, einen Hauch Erleichterung wahrgenommen zu haben.
•••
Doc Meyers stupfte seine Melone Richtung Nacken und blies die Backen auf.
»Könnt schon ein Grizzly gewesen sein, Owen«, sagte er und deutete auf Brust und Bauchdecke der Leiche. »Man sieht’s recht deutlich. Da und da. Als wäre der arme Mann durch einen Prankenhieb verletzt worden.« Er schüttelte traurig den Kopf. »Dürfte gedauert haben. Er war nicht sofort tot.« Der Blick des Arztes wanderte vom Leichnam in die Höhe. »Die da waren es jedenfalls nicht«, sagte er und zeigte auf ein Paar Straßenkatzen, die trotz der frostigen Witterung auf dem Grat einer Mauer hockten und zu ihnen herübersahen. »Warten wohl auf ihr Frühstück, was?« Meyers kicherte.
Officer MacLeòid wedelte einige Schneeflocken vom Gesicht des Toten. »Täusche ich mich oder lächelt er? Sollte er nicht schmerzverzerrt aussehen, Doc?«
Der Arzt zuckte mit den Schultern. »Wer weiß schon, was einem Sterbenden durchs Hirn geht, hm? Vielleicht war er einfach nur erleichtert, als es zu Ende ging.«
Owen richtete sich auf und stampfte mit den Stiefeln. Mit zusammengekniffenen Augen starrte er die breite Charles-Street Richtung Zentrum hinab. »Na endlich«, sagte er. »Der Coroner.«
Doc Meyers legte sich eine flache Hand vor die Stirn, um seine Augen gegen das Schneetreiben abzuschirmen, das in den letzten Minuten wieder zugenommen hatte. »Ah, das ist gut. Dorothy wird sich den Toten noch einmal anschauen, sobald er aufgetaut ist. Möglicherweise wissen wir dann mehr.«
Kiwa folgte den Blicken der Männer und landete bei einem von einem einzelnen Pferd gezogenen Pritschenwagen, auf dessen Bock zwei vermummte Personen saßen. Selbst auf die Entfernung war die wuchtige Gestalt der Gerichtsmedizinerin Dorothy McCarthy zu erkennen. Im Vergleich zu ihr wirkte der spindeldürre Fahrer wie ein kleines Kind.
Owen knuffte Doc Meyers in die Seite. »Warum fährt sie nur immer mit raus?«
Kiwa kannte die Antwort des Arztes. Der kommende kurze Dialog war eine Art ›Running Gag‹ zwischen den beiden.
»Sie weiß einfach, dass es schneller geht, wenn sie mit anpackt«, kam es auch prompt. MacLeòid wandte sich an Kiwa. »Sind Sie so weit, meine Liebe? Haben Sie alles im Kasten?« In Anwesenheit des Arztes blieb Owens Ansprache förmlich.
Sie nickte und löste die Kamera vom Stativ.
»Ich nehm Sie gerne ein Stück mit«, bot Meyers an. »Mein Hanson steht auf dem Gefängnishof.«
»Danke, Doc!«, sagte sie erleichtert. Die Aussicht, den Weg ins Präsidium in Meyers Einspänner zurückzulegen, erschien ihr deutlich angenehmer, als zu Fuß durch Schnee und Eis zu schlittern. Sowohl ausgerenkte Hüfte als auch Genickbruch blieben ihr so erspart.
Meyers nahm das Stativ entgegen und bot ihr seinen Arm zum Einhaken an. »Dann mal los! Sehen wir zu, dass wir aus der Kälte kommen!«
Sie winkte Owen zum Abschied, der mit einem Kopfnicken antwortete.
Vorsichtig, und in einer Art ›Trippel-Rutsch-Schritt‹ machte sie sich auf den Weg zum Tor des Gefängnisses, wobei sie das Einhaken in Meyers’ Ellbogenbeuge vermied. Der Doc war ein feiner Kerl, doch bereits im fortgeschrittenen Alter. Wenn sie fiel, fiele sie lieber allein, als die Verantwortung für die körperliche Unversehrtheit des Arztes zu übernehmen.
Boston P. D.
Boston Police Department Headquarter, 37 Pemberton Square, Samstag, 12:55 Uhr
Zu Kiwas Freude war die Eingangshalle des Präsidiums angenehm beheizt, und auch wenn die Luft abgestanden und dumpf schmeckte, tat es ihr gut, ihre klammen Hände am bollernden Ofen aufzutauen. Vor dem großen Tresen, hinter dem Beamte bereitstanden, um den Anliegen der Bürger zu lauschen, saßen ein gutes Dutzend in Winterkleidung gepackte Personen auf langen Bänken und genossen die Wärme ebenfalls. Während strammer Winterwochen stand das Präsidium den Armen geöffnet, die sich kein Feuerholz oder Kohle leisten konnten. Einige übernachteten sogar in den Hafträumen, wenn deren Belegung dies zuließ. Für die untersten Bevölkerungsschichten war es mitunter die Rettung vor dem Erfrierungstod.
Das Präsidium war erst vor einigen Jahren am Pemberton Square erbaut worden. Eine Stadt von der Größe Bostons brauchte einen mächtigen Polizeiapparat, der den Büros in der Stadthalle irgendwann entwachsen war.
Das Boston P. D. war nach Londoner Vorbild entstanden und galt als eine der modernsten und besten Polizeiorganisationen der Welt. Soweit Kiwa informiert war, war eben dies der Grund, weshalb es überhaupt so etwas wie eine Tatort-Fotografin im Boston P. D. gab. Selbst New York hing noch hinterher, was diese überaus fortschrittliche Entwicklung anging. Kiwa hatte ihr Glück kaum fassen können, als sie die Zusage erhalten hatte, im neusten Amtsgebäude der Vereinigten Staaten arbeiten zu dürfen.
Dass ihre Dunkelkammer im Keller, in einem Flügel abseits der Hafträume, zu finden war, störte sie nicht. Der Wechsel von Außeneinsatz zu einsamer Bildentwicklungsarbeit machte sogar einen beachtlichen Anteil des Reizes ihrer Tätigkeit aus, die lediglich zwei Personen trüben konnten: Fletcher Dunn und Chief-Constable Herrington – ihr direkter Vorgesetzter.
Bei Fletcher gestaltete sich die Sache recht simpel: ›Arschloch‹ denken und ignorieren. Ihr Boss Bud Herrington machte es ihr nicht so einfach. Er war ein wirklich netter Kerl, der immer fair blieb, obwohl er für seine strenge Hand von sämtlichen Polizisten gefürchtet war. Leider konnte man es sich nicht aussuchen, mit welcher Facette des Chiefs man es zu tun bekam.
»KIWA!«, hallte die Stimme eines jungen Beamten vom Tresen durch die Vorhalle. Sie zuckte zusammen und sah auf.
Hinter der Barriere aus Messingstäben, die die Büros vor den Bürgern im Empfangsbereich abschirmten, winkte der Mann. »Du sollst zum Chief!«
Oh, oh, dachte sie. Ihren nächsten Einsatz hätte sie auch von den Jungs im Foyer erhalten können. Dass Herrington sie zu sich riefen ließ, war nicht das beste Zeichen.
Doch sie wusste ja, was kommen würde …
Ihre nächtlichen Exkursionen waren nur allzu häufig Auslöser für Ermahnung gewesen.
»Komme!«, rief sie zurück. Sie bückte sich und nahm den geliebten Lucidographen und das verhasste Stativ auf, bevor sie sich den Weg durch die Leute bahnte.
Als sie den Tresen erreichte, öffnete der Officer den Durchgang.
»Bereit für nen Abriss?«, flüsterte er grinsend.
Kiwa bugsierte das sperrige Dreibein bedrohlich nah an seiner Nase vorbei. »Du mich auch«, wisperte sie.
»Viel Glück mit dem Alten!« Hilfsbereit nahm er ihr Stativ und Kamera ab, um ihre Ausrüstung zu einer Kommode im hinteren Bereich zu bringen, die neben den Stufen zum Keller stand.
»Danke, Connor.« Sie wandte sich in die andere Richtung, stapfte an einigen Schreibtischen vorbei, hinter denen Polizisten saßen und Schreibkram erledigten. Nicht wenige sahen ihr mitfühlend nach.
Niemand wurde gern zu Chief Herrington zitiert.
Die Marmorfliesen unter ihren Sohlen waren nass und rutschig. Zahllose Beamtenstiefel hatten Schneematsch mit hineingetragen, und wie es aussah, kam Otis, der Hausmeister, mit dem Wischen nicht hinterher.
Der Alte stemmte seinen Mopp auf den Boden und umklammerte den Griff mit beiden Händen, als sie zwischen ihm und Putzeimer auf das Büro des Chiefs zuhielt.
»Viel Glück, Miss O’Shea«, wisperte er und zwinkerte ihr aufmunternd zu. Vor der Tür lag ein Putzlappen bereit, an dem sie ihre Absätze abrieb, um das Parkett im Innern nicht zu verschmutzen.
»Danke, Otis.« Sie nickte wacker und langte nach der goldenen Klinke.
Noch bevor sie die Schwelle mit beiden Füßen übertreten konnte, empfingen sie gestrenge Worte.
»Kommen Sie schon! Kommen Sie schon!«, grollte Herrington barsch und wedelte sie mit ungeduldiger Hand heran.
Kiwa schloss die Tür hinter sich und trat näher an den gigantischen Schreibtisch, der den Raum trotz seiner amtlichen Ausmaße beherrschte. Unterwegs wickelte sie den Schal vom Kopf und schüttelte ihr Haar aus. Vor einem der Stühle, auf denen Besuchern ein Sitz angeboten wurde, blieb sie stehen. Herrington bot ihr keinen an.
Zwischen dem Rand seiner runden Brille und den wuchernden grauen Augenbrauen musterte er sie streng. Dann blies er die Backen auf und schnaufte verdrossen.
»Was gibt es, Chief?«, fragte sie.
Herrington betrachtete sie stumm, legte die Hände im Nacken zusammen, lehnte sich gegen die hohe Lehne seines Ledersessels und ließ sie schmoren.
Kiwa warf einen Blick zum lodernden Kaminfeuer und öffnete die Knopfreihe ihres Wintermantels. Mit einer Hand am Revers wedelte sie sich Luft vor die Brust.
Der Chief beugte sich wieder vor und stützte seine Ellbogen auf die Tischplatte. Mit dem Zeigefinger schob er die Brille höher auf seine Knollennase, die ihm in Ausübung seiner Pflicht mehrfach gebrochen worden war, wie sie wusste.
»Fletcher Dunn«, sagte er mit seiner markant heiseren Stimme.
Die Beamten unter seinem Kommando munkelten, ihm wären die Stimmbänder beim Befehle brüllen während der Straßenkämpfe in South Boston gerissen und seitdem spräche er so heiser. Kiwa vermutete eher, dass es mit der gespielten Härte zusammenhing, für die der Chief so berüchtigt war.
Sie hob eine Augenbraue und einen Mundwinkel und starrte keck zurück, ohne etwas zu sagen.
Herrington lehnte sich wieder an, ließ seine Pranken flach vor sich auf dem Tisch liegen. »Warum, Miss O’Shea?«, fragte er.
»Warum was?«
Erneut blies er die Backen auf und ließ den Atem lautstark entweichen. »Warum geben Sie ihm ständig Angriffsfläche?«
Nun hob sie beide Augenbrauen, schwieg aber immer noch.
Mit matter Geste wedelte Herrington in der Luft. »Sie waren heute Morgen zu spät?«
Kiwa schnaufte. »Bei dem Wetter ist jeder zu spät«, sagte sie. »Und Fletch hat nichts Besseres zu tun, als mich bei Ihnen anzuschwärzen? Für zehn Minuten?«
Der Chief rieb sich über die Halbglatze und winkte ab. »Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich Sie ob Ihres Zuspätkommens gerügt habe, ja?«
»Wenn Sie meinen.«
Er beugte sich wieder vor. »Sie wissen doch, dass er nur auf so etwas wartet.«
Kiwa nickte.
»Wenn Sie also das nächste Mal nach West End gerufen werden, beeilen Sie sich.«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Sagen Sie noch mal was?«
»Ja, gern«, sagte sie. »Werde den Winter bei Gelegenheit bitten, etwas weniger zu schneien, damit Fletch mich nicht bei Ihnen anschwärzen kann, Chief.«
Herrington konnte ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken. »Ich weiß ebenso gut wie Sie, dass Fletch mitunter ein elender Hundsfott ist. Das können Sie mir glauben.«
»Aber?« Kiwa stemmte die Hände in die Seite.
»Aber er ist eben auch ein verdammt guter Cop.«
»Ist er das?«
Herrington richtete einen Zeigefinger auf sie. »Übertreiben Sie es nicht, Miss O’Shea!«, grollte er. »Seien Sie das nächste Mal pünktlich, dann brauche ich mich nicht um dermaßen kindische Beschwerden zu kümmern. Klar?«
Sie nickte ergeben, warf einen Daumen über die Schulter und deutete auf die Tür. »Darf ich dann? Ich muss die Tatortbilder entwickeln. Doc Meiers meinte, die sollte sich ein Experte vom zoologischen Garten noch einmal anschauen.«
Herrington wedelte wieder mit der Pranke. »Ja, ja. Gehen Sie schon.«
Sie wandte sich um.
»Moment!«
Sie hielt inne und hob in Erwartung dessen, was nun käme, den Blick zur hohen Decke.
»Ich ziehe Ihnen auch diese Woche wieder vier Dollar ab, Miss O’Shea.«
»Ja, sicher«, erwiderte sie leise.
»Acht Bilder!«, tönte die heisere Stimme des Chiefs. »Auf Kosten des Departments!«
Sie drehte sich zu ihm um.
»Warum kaufen Sie nicht selbst Papier und Platten, wenn Sie schon unsere Ausrüstung benutzen, hm?«, brummte Herrington.
Kiwa hob beschwichtigend beide Hände. »Ach Chief, Sie wissen doch, dass die Einkaufskonditionen des Departments besser sind, als die, die ich bekäme.«
Er schüttelte den mahnenden Zeigefinger. »Die nur so gut sind, weil Sie das Material verheizen und wir ständig nachkaufen müssen! Mister Blair grüßt mich schon persönlich, wenn er mich sieht.«
»Das tut mir leid«, sagte Kiwa kleinlaut, gleichwohl breit grinsend.
Herrington grinste zurück. »Ja, ja, ja. Sie kleine Irin sind ein rechter Kobold! Selbst wenn ich wollte, könnte ich Ihnen nicht böse sein, verdammt. Jetzt gehen Sie!«
»Danke, Chief!« Sie wendete auf den Absätzen.
»Nehmen Sie das da mit!«, schob er nach.
Ihr Blick fiel auf eine längliche Kiste aus dünnem Holz, die neben der Tür an der Wand lehnte. In kunstvollen Buchstaben waren die Worte ›Blair Camera Company‹ auf einer Seite aufgebracht.
Strahlend wirbelte sie herum.
»Ja!«, kam ihr der Chief zuvor. »Das ist Ihr verdammter ›Featherweight Tripod‹! Feinstes Kirschbaumholz, poliert. Faltbar und mit Griff! Messingauflage für Ihre verdammte Kamera. Ganze vier Dollar unserer werten Steuerzahler! Kam zusammen mit Chemikalien und Transportkoffer. Der restliche Kram steht allerdings schon unten. Nur das Beste für unseren Revierkobold, was?«
»Danke, Chief!«, rief sie strahlend und war kurz versucht, quer über den Schreibtisch um seinen dicken Hals zu springen.
»Gehen Sie jetzt!«
Beschwingt schnappte sie sich die Kiste und konnte es kaum erwarten, sie auszupacken. Nur zu gern hätte sie das sperrige Standard-Dreibein dem Flammentod zugeführt. Doch wie hatte Herrington gesagt? ›Sie verheizen unser Material‹.
Also gut. Sie würde es tief in der Zeugkammer verstauen, die elende Plackerei damit vergessen, und sich von nun an mit dem viel leichteren und praktischeren ›Federgewicht‹ beschäftigen können!
Boston P. D. HQ, Keller, Dunkelkammer, Samstag, 15:50 Uhr
Im diffusen roten Licht der ›Ruby Lantern‹ schob Kiwa das Papier in der chemischen Flüssigkeit ein wenig hin und her. Auf dem Tisch neben ihr lagen die frischbestückten Plattenhalter, von denen sie ein Dutzend präpariert hatte, um neue Bilder schießen zu können.
Das Foto entwickelte sich langsam in seinem Bad. Das rote Licht tünchte die Details der feuchten Aufnahme in grausige Kontraste. Die Verletzungen des Toten wirkten beinahe lebensecht – in diesem Fall treffenderweise ›todesecht‹. Ein Schauder lief ihr über den Rücken, obwohl es in der Dunkelkammer angenehm warm war.
Sie fischte das Bild mit der Holzzange aus dem Becken und hielt es vor sich. Mit der anderen Hand hob sie ein Vergrößerungsglas vor ein Auge und musterte die fotografierte Wunde, bis saurer Speichel ihre Wangeninnenseite hinunterlief. Dann tunkte sie das Blatt ins Fixierbad, um das Verbrechen als Foto zu bannen.
Es klopfte.
»Nicht!«, rief sie schnell. In den Becken neben ihr lagen noch zwei weitere Bilder, die auf keinen Fall einem hellen Licht ausgesetzt werden durften.
»Schon gut«, tönte Ellis’ Stimme durch das Holz der Tür.
»Nicht reinkommen!« Im Augenwinkel bemerkte sie den Türriegel, den sie vor lauter Arbeitseifer nicht vorgelegt hatte.
»Ja, ja. Hab ich verstanden. Ich komm nicht rein.« Sie hörte ihn leise lachen. »Oder vielleicht doch?« Die Tür wurde gerüttelt, blieb aber verschlossen.
»ELLIS!« Kiwa hob ein Bein auf Hüfthohe und trat vor den Riegel, der krachend einschnappte.
Er lachte lauter. »Alles gut! Ich mach doch nur Quatsch. Wie lange brauchst du noch?«
Sie atmete erleichtert aus und schmunzelte, als ihr pochendes Herz wieder in geregelten Bahnen pumpte. »Zehn, fünfzehn Minuten.«
»Alles klar. Ich warte oben.«
»Warum?«
»Du sollst mitkommen. An der Passagier-Station Nashua Street gab es einen Zwischenfall.«
»Worum geht es?«, fragte sie, während sie das entwickelte Foto zum Trocknen mit Klammern an einer Leine befestigte.
»Jemand hat sich vor den Drei-Uhr-Zug geworfen.«
»Oh nein!« Kiwa stöhnte gequält.
»Allerdings«, sagte Ellis. »Ist nicht viel übrig. Die Ärzte vom Hospital haben sich nicht mal beeilt, dahin zu kommen. Aber der Zug steht und kann erst weiterfahren, wenn wir da waren.«
Kiwa war bereits dabei, die belichteten Platten in der Aufbewahrungskiste in schwarzem Samt zu verstauen. Dort würden sie auf Entwicklung warten, bis sie wieder zurück wäre.
»Du könntest natürlich auch etwas Marmelade auf Fotopapier verstreichen«, säuselte Ellis durch die Türritze. »Kirsche wäre gut. Säh bestimmt genauso aus wie das Bild. Nur in Farbe.«
Sie schlug mit flacher Hand gegen die Tür und stellte sich vor, wie er auf seiner Seite erschrocken zurückzuckte. »Du bist eklig, Ellis! Lass das!«
»Na, komm. Bringen wir es hinter uns. Heute Abend begleite ich dich wieder.«
Lächelnd öffnete sie die Tür.
»Wo geht’s denn diesmal hin?«, fragte er.
»Downtown«, antwortete Kiwa. »Ich möchte ein paar Aufnahmen bei den Fleischpackern machen.«
Ellis kratzte sich über sein markantes Kinn. »Das sind die, die so überaus großzügig für ihre rückenbiegende Arbeit bezahlt werden, hm?«
»So überaus gar nicht.«
Er rieb die behandschuhten Hände aneinander und grinste gekünstelt. »Na, sehr fein! Dann habe ich also ein Date mit Miss O’Shea am Hobbs Wharf bei Eis und Schnee, mitten in der Nacht, zwischen gefrorenen Rinderhälften. Es könnte schöner nicht sein!«
»Du musst nicht …«, setzte sie an.
»Ja, ja. Nun gib mir schon das vermaledeite Dreibein!«
Strahlend hielt sie ihm das unterarmlange Paket unter die Nase. »Du meinst dieses hier? Bekomme ich schon getragen. Danke!«
Teehaus und Suppenküche
Beacon Hill, 12 Pinckney Street, Samstag, 20:20 Uhr
›Madame Gladys’ Tea and Coffee House‹ war eine Institution auf der Grenze der beiden Stadtteile West End und Beacon Hill. Sowohl die mehrheitlich schwarze Bevölkerung des einen Viertels, als auch die mehrheitlich weiße Bevölkerung des anderen, wusste Gladys’ Angebote von heißen Getränken und süßen Törtchen zu schätzen. Wer nicht für leibliches Wohl die warme Stube mit den gekachelten Wänden betrat, der kam für ›Gladys’ Gossip‹, denn sie wusste einfach alles über jeden und war nur zu gern bereit darüber zu sprechen. Getreu ihres Kredos ›Wenn du nichts Gutes über jemanden zu sagen hast, sag gar nichts‹, pflegte sie allerdings nur positive Bewandtnisse in den Mittelpunkt eines Gespräches zu setzen, was ihr das Vertrauen ihrer Nachbarn sicherte und erhielt.
Gladys Groover wurde von den Anwohnern liebevoll ›Nana‹ genannt und war so etwas wie das inoffizielle Maskottchen des Viertels. Kiwa hatte nie zuvor eine gütigere Person kennengelernt als die überaus ausladende schwarze Frau mit dem gewaltigen Busen, der Nickelbrille und den grauen Löckchen, und gestattete sich hin und wieder den Luxus eines Besuches.
Mit spitzen Lippen blies sie in die dampfende Tasse Tee in ihren Händen. Das Getränk war frisch und heiß, aber niemals heiß genug, um die Eiseskälte in ihren Knochen und ihrem Hirn zu tauen. Der frostige Morgen hatte mit Aufnahmen einer grausigen Bauchwunde begonnen. Nachmittags war sie mit Ellis am Bahnhof in West End gewesen, um die Überreste eines Mannes zu fotografieren, der vom Bahnsteig vor den einfahrenden Drei-Uhr-Zug gefallen und von diesem gute zwölf Schritt über die Gleise geschleift worden war. Ihr Begleiter hatte mögliche Zeugen befragt, doch niemand hatte gesehen, was geschehen war und wie der Mann überhaupt vom Steig hatte fallen können. Während der Polizist Bahnpersonal befragte, um bestenfalls die Identität des Toten herauszufinden, hatte sie Fotos vom Gepäck gemacht, das sich im Gleisbett verteilt hatte. Durch die Linsen der Kamera hatte sie das ›Tagebuch von Marty J. Wittman‹ unter Hosen und Hemden entdeckt. Der New Yorker war vermutlich auf dem Weg nach Hause gewesen – würde dort aber niemals ankommen. Zumindest wusste Ellis nun, wen der Zug überrollt hatte.
Im Anschluss durfte sie den restlichen Tag in der Dunkelkammer zubringen, um Bilder von Innereien und Gliedmaßen zu entwickeln, die unter dem roten Licht auf nassem Fotopapier wahrlich grauenvoll anzusehen waren.
Alles in allem kein besonders erhebender Arbeitstag.
Sie lehnte sich im bequemen Sessel zurück, legte den Kopf zur Seite, nippte am Tee und sah durch die mit Eisblumen verzierte Scheibe nach draußen.
Es schneite wieder. Der Wind, der vom Charles River aus in die Pinckney Street blies, wirbelte die Flocken in dichten Wolken auf, trieb sie durch die Lichtkegel der Straßenlaternen und ließ sie wellenförmige Verwehungen auf dem Kopfstein bilden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte sich eine lange Schlange von vermummten Menschen gebildet. Schweigsam standen sie hintereinander, stampften auf und bliesen, in dem sinnlosen Unterfangen, sie zu wärmen, in die Hände. Sie alle harrten vor der Suppenküche der ›Church of Advent‹ aus, die an jedem zweiten Abend eine Armenspeisung durchführte. Kiwa wusste, dass der Seiteneingang der Kirche annähernd einhundert Meter weiter die Brimmer Street hinab lag. Demzufolge dürften an die zweihundert Personen dort in dieser Warteschlange stehen und im Schneegestöber bibbern. Und es war erst Abend. Die Nacht versprach noch frostiger zu werden.
Eine Straßenkatze eilte quer über die Fahrbahn, wich einem Einspänner aus und verschwand zwischen den Wartenden in einer Gasse. Kiwa sah dem Tierchen hinterher, das sich sicherlich ebenso nach wohliger Wärme sehnte wie die Kolonne der hungrigen Menschen.
»Sag mal, Gladys … das werden immer mehr«, murmelte sie nachdenklich. »Oder täusche ich mich?«
Die Betreiberin des Teehauses unterbrach ihr geschäftiges Werkeln hinter ihrer Theke.
»Ja, das stimmt.« Ihre Stimme klang traurig. Sie polierte ein silbernes Kännchen und folgte Kiwas Blick nach draußen. »Der Winter ist hart. Es gibt kaum Arbeit auf den Farmen vor der Stadt. Seit Wochen kann ich zusehen, wie die Schlange länger wird.«
»Hm?« Irritiert sah Kiwa auf. Sie hatte von den Katzen gesprochen, doch Gladys sprach nun offensichtlich von den Leuten auf der Straße.
Die Wirtin stellte die Kanne beiseite und pflückte einen dampfenden Teekessel mithilfe eines dicken Lappens vom Herd. »Magst du noch einen Schuss Heißes?«, fragte sie. Kiwa nickte und hielt ihr die Tasse hin. Gladys schob ihren mächtigen Körper durch den Laden, wankte ihr entgegen und sprach weiter. »Auf dem Land ist alles fest gefroren, Kindchen. Der Warentransport läuft nur noch über die Eisenbahn. Daher produzieren die Fabriken weniger Ware. Viele sind arbeitslos geworden. Nach dem Krieg wandelte sich so einiges zum Besten, doch noch mehr muss sich wandeln, bevor es für alle besser wird. Bei uns Schwarzen in West End sieht man so etwas immer zuerst. Aber ich denke, dass es bei den Iren in South nicht anders aussieht. Sei froh, dass du eine Anstellung hast.«
Sie schenkte Kiwa einen Schwall heißes Wasser in die Tasse und betrachtete sorgenvoll die zitternden Menschen.
»Danke, Nana«, murmelte Kiwa und nippte am Tee, der nun wässrig, aber herrlich heiß war. »Meinst du, ich kann ein paar Bilder machen?«, fragte sie nach einer Weile stillen Beobachtens.
Gladys lächelte gütig und sah sie über den Rand der silbernen Brille an.
»Frag sie doch freundlich, Kindchen. Es hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass du deine Abzüge ins Rathaus schickst. Ich denke, sie werden ihren Stolz für die gute Sache schlucken können. Ist ja eh niemand zu erkennen unter den ganzen Mänteln, Mützen und Hüten.«
»Das mache ich«, sagte Kiwa. In Gedanken sortierte sie den Teil ihrer Fotoausrüstung, die sie aus dem Revier für die nächtliche Exkursion mit Ellis mitgenommen hatte.
Drei bis vier Aufnahmen würde sie anfertigen können – und hätte immer noch genug Platten und Blitz für ihren Besuch am Hobbs Wharf.
»Trink aber erstmal deinen Tee aus, Liebes«, sagte Gladys. »Draußen wird dir die Nase noch früh genug abfrieren.«
Beacon Hill, Brimmer Street, Samstag, 20:35 Uhr
Der Schnee knirschte und knarzte unter ihren Absätzen, als sie sich mit vorsichtigem Schritt ihrer Behausung näherte. Mit Freude stellte sie fest, dass das neue Federgewichtstativ seinem Namen alle Ehre machte, so wie sie laut Agent Worthington dem ihren Ehre machte. Es gelang ihr in der Tat, annähernd anmutig den Weg über die Verwehungen zu finden, ohne zu taumeln oder hinzufallen.
Parallel zum Spalier der Wartenden lief sie die Brimmer Street entlang. In einiger Entfernung zeichnete sich der Kirchturm gegen den dunklen Abendhimmel ab. Das Gotteshaus aus rotem Backstein markierte die unsichtbare Grenze zwischen dem ärmeren und dem wohlhabenden Teil von Beacon Hill. Lebten auf der einen Seite die armen Bürger, hatte sich auf der anderen die intellektuelle Elite – die sogenannten ›Boston Brahmins‹ – eingerichtet. Diese Gesellschaftsschicht wurde von Professoren, Doktoren, Anwälten und Unternehmern gebildet, die es sich leisten konnten, in schmucken dreistöckigen Stadthäusern mit kurzen Treppenaufgängen zu logieren.
Ein Arzt und Schriftsteller hatte den Begriff ›Brahmanen-Kaste‹ geprägt und so die Oberschicht Bostons mit der Priesterkaste innerhalb des hinduistischen Kastensystems verglichen. Mittlerweile bezeichnete man mit diesem Wort die alten wohlhabenden Familien Neuenglands britisch-protestantischer Herkunft, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung der amerikanischen Institutionen und Kultur ausübten.
Und Kiwa wohnte bei einer solchen Familie unterm Dach.
Von Boston Brahmins wurde erwartet, dass sie die englische Zurückhaltung in Kleidung, Benehmen und Auftreten beibehielten, die Künste pflegten und Wohltätigkeitsorganisationen wie Krankenhäuser und Colleges unterstützten. Vermutlich war einer oder eine aus dieser Klasse für die Speisen verantwortlich, die der schwarze Gemeindepfarrer gerade mit großer Kelle unter das weniger glückbeseelte Volk brachte.
Der Geistliche steckte in einem dicken Mantel mit Fellkragen und trug eine zylinderförmige Fellmütze auf dem Kopf. Er schenkte Eintopf aus, und obwohl Kiwa seine Worte nicht verstand, konnte sie an den Körperhaltungen der Menschen ablesen, dass er neben warmer Kost auch warme Aufmunterung spendete.
Unterstützt wurde er von einigen Mitgliedern seiner Gemeinde. Frauen und Männer brachten Geschirr aus Blech und Holz herbei, betrieben die Feuerstelle, über der der Eintopf in großem Kessel köchelte oder verteilten gestrickte Schals und Fäustlinge unter denen, die sie nicht hatten.
Kiwa blieb stehen.
Wie würde es dem Bürgermeister wohl gefallen, wenn sie ihm mit den nächsten Bildern auch eines von einem echten Helden brächte? Einem Mann, der anpackte, der wirklich etwas für die Bedürftigen tat und nicht in beheizten Marmorsälen Empfänge abhielt?